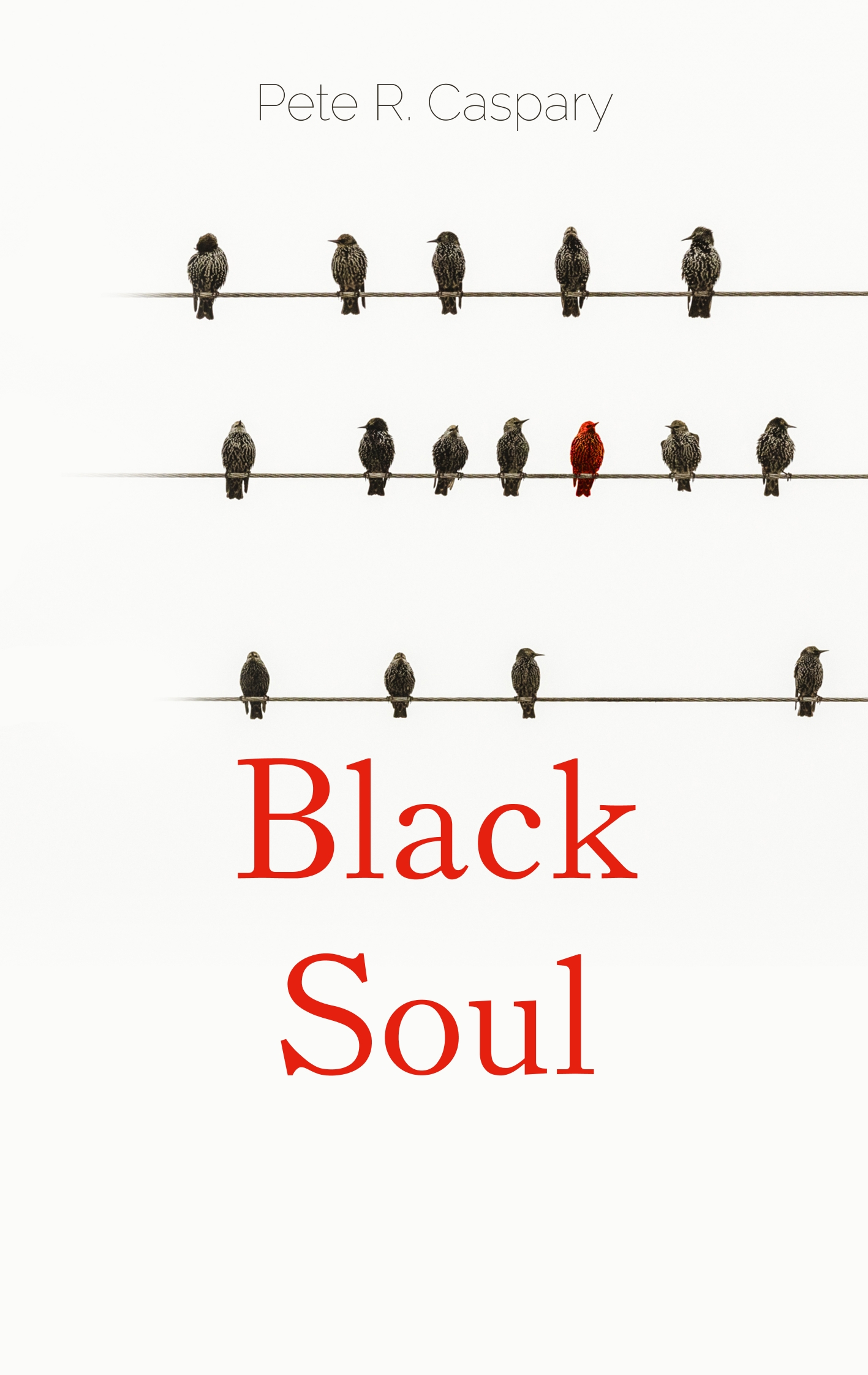
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Muss ein Mensch seine Last ertragen oder muss er sie überwinden? Kann es dafür eine eindeutige Antwort geben? Wilhelm von Popp erkennt auf ungewöhnliche Art, wie er seine Last doch überwinden kann. Nicht durch therapeutische Behandlung, sondern mit Hilfe einer Freundschaft zu Vicky, einem Gothic Girl. Doch Vicky muss selbst erst einen Suizidversuch begehen, um ihren eigenen Weg der Überwindung zu finden. Anders ist das bei Wilhelms Mutter, deren Last eine unüberwindbare Krankheit ist, der sie sich aufrichtig stellt, den sicheren Tod stets vor Augen. Und dann ist da noch Zola...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 1
Sonderbar wurde es zum ersten Mal vor etwa einem Jahr. Ich ging wie gewöhnlich durch das Treppenhaus nach unten, denn - ich glaube - ich wollte meine Samstagseinkäufe erledigen. Oder nein! Es kann nicht an einem Samstag gewesen sein. Aber Zola war auch nicht da an jenem Tag. Also muss es wohl ein Dienstag oder ein Donnerstag gewesen sein. Denn Zola kommt immer werktags, außer dienstags und donnerstags.
Wie dem auch sei: Ich ging also die Treppe runter und traf im dritten Stock seit langer Zeit mal wieder Herrn Hirmer, beziehungsweise Opa Hirmer, wie ich ihn nenne. Er stand, wie ich ihn schon so oft gesehen hatte, im Zwischengeschoss vor den gelben und weißen Glasbausteinen. Er hielt einen Schrubber mit einem Lappen daran in der Hand und wischte den Boden. Er wirkte dabei ziemlich gelangweilt, denn sein Wischen war kaum als Bewegung wahrnehmbar. Auch waren seine Augen ziemlich glasig und sein Blick ging stur geradeaus. Es schien nicht, als würde er irgendetwas fixieren. Mehr ein verlorener Blick war es. Kalt und ziellos.
„Guten Tag, lieber Herr Hirmer!“ begrüßte ich ihn wie immer.
Aber er reagierte nicht. Er starrte weiter geradeaus, als wenn ich nicht da wäre. Ich habe ihn nicht weiter beachtet, schließlich war er auch nicht mehr der Jüngste. Und außerdem hatte ich es eilig. Ich war unterwegs zur Universität. Ja, so war es, ich muss auf dem Weg zu einer Vorlesung gewesen sein.
Es war ein herrlicher Frühlingstag, noch etwas kühl, aber die Sonne kämpfte sich durch die Wolken und überall hatte es zu sprießen begonnen. Die Welt war wieder wie auferstanden nach dem besonders harten Winter mit all dem Schnee und den vereisten Gehwegen. Zum ersten Mal in diesem Jahr holte ich mein Rad aus dem Keller und fuhr die paar Kilometer bis zur Uni. Der hintere Reifen hatte zwar etwas wenig Luft, doch da ich so in Eile war und nicht noch wertvolle Minuten mit Aufpumpen verlieren wollte, musste ich den Berg hinauf ganz schön kämpfen. Aber als ich endlich am Hörsaal ankam, fühlte ich mich, als hätten mich die kühle Luft und die Anstrengung gereinigt. Wie eine Frühlingskatharsis.
Ich war zu der Zeit im siebzehnten Semester meines Psychologiestudiums und - jetzt weiß ich es wieder - ich beschäftigte mich zu dieser Zeit intensiv mit dem Schwerpunktthema Ernährungspsychologie. Der Vortragende war zwar noch relativ jung, aber bereits eine Koryphäe auf diesem Gebiet und die Vorlesung trug an diesem Tag den Titel „Genuss und Ekel“. Ausschweifend erläuterte uns der Dozent neben dem Einfluss durch ökonomische und habituelle Bedingungen vor allem auch seine neuesten Erkenntnisse zur emotionalen Wirkung der Ernährung.
Der Hörsaal war bereits einer der kleineren Räume auf dem Campus, aber auch der war noch nicht mal halb gefüllt. Die meisten meiner Kommilitonen schienen sich nicht besonders für dieses Thema zu interessieren. Aber mich hatte es gepackt, als der Dozent die These formulierte, dass sich das Essverhalten von Erwachsenen ohne Berücksichtigung der damit verbundenen Gefühle nicht dauerhaft verändern lässt. Nach der Vorlesung kam er an meinem Platz vorbei und wir wechselten noch ein paar Nettigkeiten. Wir kannten uns noch aus dem ersten Semester, denn wir hatten gleichzeitig angefangen zu studieren. Und es schien ihm nicht so häufig zu passieren, dass sich jemand so intensiv für seine Vorlesung interessierte. Oder er hatte mich einfach für einen Assistenten gehalten, das ist auch gut möglich.
Immer noch seine - wie ich fand - sehr vage These sinnierend, bin ich dann wieder die vier Stockwerke zu meiner Dachgeschosswohnung raufgestiegen. Und da stand er immer noch, an genau der gleichen Stelle und wischte regungslos.
„Guten Tag, mein lieber Herr Hirmer!“ rief ich ihm entgegen. Aber wie schon am Vormittag reagierte er nicht auf mich, weder auf meine Stimme noch auf meine Anwesenheit. Er trug, so wie ich ihn kannte, eine braune Cordhose mit hellblauem Hemd und beigen Hosenträgern. Dazu seine schwarzen Slipper und seine immer gleiche graue Schiebermütze auf dem Kopf.
Ich hielt kurz inne und überlegte, ob ich ihn vielleicht irgendwie unterstützen könnte. Aber er hatte weder einen Eimer mit Wasser in der Nähe, noch schien der Putzlappen auch nur im Ansatz feucht zu sein. Seine Haut war ziemlich fahl, wie wenn er schon längere Zeit nicht an der frischen Luft gewesen wäre. Seine Fingerknochen waren deutlich zu erkennen und sein Gesicht war unrasiert. Für seine Verhältnisse eher ungepflegt, hatte ich noch gedacht. Aber ich hatte ihn auch schon länger nicht mehr gesehen.
„Schönes Wetter heute. Der Frühling ist zurück“, versuchte ich es weiter in der Hoffnung, ihn damit etwas zu motivieren.
Aber es hatte keinen Zweck. Er blickte stumm auf irgendeinen bedeutungslosen Punkt an den Stufen über ihm und war zu keiner Konversation bereit. Als ich mich dann umdrehte und weiter die Stufen nach oben lief, glaubte ich auf einmal seine Stimme hinter mir zu hören.
„Bring‘ sie zu mir!“
Es war mehr wie ein Hauchen, ein starkes und angestrengtes Hauchen. Ich konnte den Satz am Anfang erst nicht richtig erfassen. Hatte er das wirklich gesagt?
Ich drehte mich um und starrte ihn an, doch er hatte seine Position in keinster Weise verändert. Ich verharrte einen kurzen Moment. Und als ich schon nicht mehr ganz sicher war, ob ich denn wirklich etwas gehört hatte, wiederholte er plötzlich sein Bitten:
„Bring‘ sie zu mir!“
Jetzt hatte ich es klar und deutlich vernommen. ‚Bring‘ sie zu mir‘ hatte er gesagt. Ich starre ihn erstaunt an und war mir nicht sicher, ob er überhaupt mit mir gesprochen hatte. Ich setzte einen Fuß nach unten und schaute ihm in die Augen. Ich stand jetzt nur noch etwas mehr als einen Meter von ihm entfernt.
„Herr Hirmer? Geht es Ihnen den Umständen entsprechend gut?“ fragte ich. Meine Mutter pflegt das immer zu sagen.
Aber er zeigte immer noch keine Reaktion. Wenn ihm irgendetwas wichtig gewesen wäre, dann hätte er es mir in dem Moment ja deutlicher sagen können. Wenn jemand mich um etwas bittet, dann helfe ich immer gerne. Das war ein Teil meiner guten Erziehung, darauf hatte meine Mutter immer Wert gelegt. Deswegen hätte ich Opa Hirmer auch gerne geholfen. Ich schaute mich nochmals intensiv um, ob irgendwo etwas lag, das ihm runtergefallen sein könnte. Auf der Treppe, unterwegs zu ihm hinauf, war mir aber ja auch nichts aufgefallen. Ich wusste mir beim besten Willen keinen Rat. Ich schaute ihn nochmal an, ob er vielleicht nochmal was sagen würde, oder vielleicht mehr Informationen geben würde, aber nach einer Weile gab ich ratlos auf und setzte meinen Weg zu meiner Wohnung fort.
Oben angekommen, zog ich mir erst einmal meine Casualhose und ein leichtes Shirt an und überlegte nach einem Blick in den Kühlschrank, was ich mir zu essen machen könnte. Auf dem Weg ins Wohnzimmer, wo ich die Balkontür öffnen wollte, um während der Zeit des Kochens einmal ordentlich durchzulüften, hielt ich nochmal bei meiner Wohnungstür zum Treppenhaus inne.
Hätte ich Opa Hirmer vielleicht doch irgendwie helfen sollen? Und was hat er gemeint? Was hätte ich ihm bringen können? Mir war doch auf dem Weg die Treppe hinauf wirklich nichts aufgefallen, das ihm runtergefallen sein könnte. Aber es muss ja was Weibliches sein, was ich ihm bringen soll.
Ich kam gedanklich keinen Schritt weiter und öffnete daraufhin erneut meine Wohnungstür, um mich nochmal davon zu überzeugen, dass es ihm gut ging. Aber als ich nach unten schaute, war er verschwunden. Vielleicht hatte er sein Problem gelöst und war zurück in seine Wohnung gegangen. Wie dem auch sei, er war nicht mehr da.
Ich habe mich dann um die Zubereitung meines Essens gekümmert - es gab Bandnudeln mit Kräutersoße, glasiertem Radicchio und Lachsstreifen - und habe den Rest des Tages in den Studien des heutigen Dozenten gelesen.
Am Abend habe ich mich dann noch um meine Kakteensammlung gekümmert, für die ich einen nicht unbeträchtlichen Teil meines Wohnzimmers verwendet hatte. Wie in einer großen Sandwanne mit tiefem Rand standen die schönsten Sukkulenten, Agaven und Opuntien. Besonders stolz war ich dabei auf meinen erst kürzlich erstandenen ‚Echinocactus grusonii‘, gemeinhin auch als Schwiegermutterstuhl bekannt. An Opa Hirmer hatte ich nicht weiter gedacht.
Eine Woche später dann, an einem ebenfalls sonnigen Freitag, ist es wieder passiert. Zola war bei mir und kümmerte sich gerade liebevoll um die Reinlichkeit meiner Küche. Sie schwebte quasi durch die Küche, so wie sie es eigentlich immer tat. Ich hatte ihr erlaubt afrikanische Musik einzulegen, wenn sie bei mir ist. Allerdings nicht zu laut, um die Nachbarn nicht zu stören. Aber ich genoss es, wenn sie zum Rhythmus der mir so fremden Klänge aus Trommeln und diversesten Saiten- und Blasinstrumenten tanzte und die ganze Wohnung mit Freude und Leben erfüllte. Der Rhythmus lag ihr im Blut. Und mir gefiel das, was es mit mir machte: es brachte Lebensfreude in meine Wohnung.
Zola kommt gebürtig aus Uganda und hat mit ihren gerade einmal 28 Jahren schon Einiges mitgemacht. Aber das lässt sie sich nicht anmerken. Ganz im Gegenteil: Wenn sie da ist, dann tanzt und lacht einfach alles. Sie ist meine gute Fee, verzaubert alles um sie herum. Sie hat die perfektesten Zähne, die man sich vorstellen kann. Und die zeigt sie ständig. Sie hat zwar eine leicht rundliche Figur, aber nicht dick würde ich sagen, und trägt stets traditionell afrikanische Kitenge in den buntesten Farben, die sie kunstvoll und gekonnt wickelt und dazu weiße Stoffschuhe. Bis auf ein einziges Mal hatte ich sie aber nie mit einer Kopfbedeckung gesehen. Sie trug ihr langes krauses, schwarz-braunes Haar immer offen, geschmückt mit allerlei geflochtenen Strähnen und eingebundenen Perlen.
Bei dem einen Mal, dem ersten Mal, als ich sie mit Kopfbedeckung gesehen hatte, hat sie sich ein gelboranges Kitenge-Tuch wie zu einem Turban um den Kopf gewickelt. Sie saß an der Universität am Brunnen vor dem Dekanat für Musik und weinte leise vor sich hin. Sie war ganz in Sommerfarben gehüllt, trug wie immer ihre weißen Schuhe, hatte die Arme auf den Beinen aufgestützt und hielt die Hände vor die Augen. Als ich auf dem Weg nach Hause an ihr vorbeikam, konnte ich ihr Schluchzen deutlich hören. Keiner schien sich darum zu kümmern. Alle gingen einfach weiter und ließen die arme Frau unbeachtet und allein mit ihrem Kummer dort sitzen.
Ich hielt kurz inne, um ganz sicher zu sein, dass ich mich nicht getäuscht hatte, dass sie wirklich weinte. Es war herzzerreißend, wie sie leidend in sich hinein schluchzte. Ich sah mich nochmal hilfesuchend um. Doch als sich weiterhin sonst niemand für diese Szene interessierte, bin ich langsam auf sie zugegangen und habe versucht, sie vorsichtig anzusprechen: “Kann ich irgendetwas für Sie tun?“
Sie reagierte erst nicht, doch sie unterbrach ihr Schluchzen kurz. Dann schüttelte sie den Kopf ohne aufzuschauen und erwartete wohl, dass ich weiterginge.
„Warten Sie hier, ich bin gleich zurück“, sagte ich zu ihr und ging schnellen Schrittes in die Cafeteria, um einen Kräutertee mit Honig zu besorgen. Der hat mir als Kind immer geholfen, wenn mir zum Heulen war.
Nach nur wenigen Minuten war ich mit dem Tee in der Hand zurück. Leider gab es in der Kantine keinen Honig, aber es würde auch so gehen.
„Hier, trinken Sie das erstmal“, sagte ich und setzte mich zu ihr. Sie zögerte kurz, nahm dann ihre Hände vom Gesicht und schaute mich ungläubig an.
„Sie mir helfen wollen?“ fragte sie so schüchtern, wie ich nie einen Menschen habe fragen hören.
„Geht es Ihnen besser?“ entgegnete ich.
Sie nickte nur und schaute fragend auf den Tee.
„Das ist Kräutertee mit Honig. Ich meine, nur leider ohne Honig. Aber der wird Ihnen guttun.“ Ich nickte ihr aufmunternd zu.
Sie sah mich verständnislos an, nahm den Tee und trank ihn schüchtern in kleinen Schlucken. Es verging eine ganze Weile, ohne dass einer von uns etwas sagte. Als sie den Becher halb ausgetrunken hatte, schaute sie mich von unten herauf mit ihren großen Augen fast schon schelmisch an und sagte:
„Schmeckt nicht gut!“
Ich musste lächeln und entgegnete: „Der Honig fehlt leider. Aber er scheint auch so zu wirken. Sie lachen wieder, wie ich sehe.“ Und das tat sie seitdem fast ohne Unterlass.
Sie erzählte mir, dass sie erst seit Kurzem in Deutschland sei. Sie habe sich gerade an der Universität einschreiben wollen: Musik und Deutsch als Fremdsprache. Aber man hatte ihr soeben im Büro des Dekans erklärt, dass sie erst eine Aufenthaltsgenehmigung haben müsse, bevor sie hier studieren könne. Und die hatte sie nicht. Noch nicht zumindest.
Wir gingen in die Cafeteria und ich lud sie zu einem kleinen Snack ein, weil sie mir sehr hungrig schien und ich das Gefühl hatte, ihr irgendwie helfen zu müssen. Ihre Gemütsverfassung passte so gar nicht zu ihrem Äußeren. Und sie war tatsächlich hungrig: Sie verdrückte einen ganzen Burger mit Pommes und Ketchup und dann nochmal eine ganze Portion Pommes hinterher. Ich aß lediglich einen kleinen Salat mit Balsamico-Dressing. Normalerweise esse ich nicht an der Universität, aber es erschien mir doch zu unhöflich, sie da allein essen zu lassen.
Jedenfalls erzählte sie mir ihre ganze Lebensgeschichte, die so packend und ergreifend war, dass wir ganze drei Stunden dort sitzen blieben. Wie auch immer: Am Ende brauchte sie einen Plan, wie sie die Zeit bis zur Ausstellung ihrer Arbeitserlaubnis überbrücken konnte. Da sie sich mit einer Freundin ein Zimmer teilte, brauchte sie nicht viel Geld. Ich überschlug in etwa, wie viel so zum Leben brauchen würde, wie lange sie dafür arbeiten müsste und ich bot ihr an, dass sie sich das Geld bei mir durch dreimal in der Woche im Haushalt helfen verdienen könne. Das sollte erst einmal reichen, bis sie dann mit ihrem Studium anfangen würde. Dann könne sie weitersehen. Und so kam Zola seit dieser Zeit jeden Montag, Mittwoch und Freitag zu mir und kümmerte sich um meine Wohnung und erledigte die üblichen Haushaltseinkäufe.
An einem jener Freitage war es also, als meine Wohnung wieder ganz von Zolas Leben erfüllt war. Ich hatte ein paar Bücher aus meinem Regal im Wohnzimmer aussortiert, die ich bereits gelesen hatte. Ich packte sie alle in einen kleinen Karton und wollte ihn in den Keller bringen. Zola war gerade dabei, den Kühlschrank auszuwaschen. Ich überlegte kurz, ob ich mich noch entschuldigen sollte, aber ich wäre sicher wieder zurück, bevor sie meine Abwesenheit bemerkte hätte. Also nahm ich kurzentschlossen den Karton und machte mich auf den Weg.
Es war schon komisch: Sobald ich die Wohnungstür hinter mir geschlossen hatte, war von den afrikanischen Klängen nichts mehr zu hören. Ich trat in das fahle, unnatürlich triste Licht des Treppenhauses und da war er wieder: Opa Hirmer stand an gleicher Stelle wie beim letzten Mal und wischte mit trockenem Lappen den Boden. Es war genau die gleiche Situation wie in der Woche zuvor. Er trug dieselbe Kleidung und starrte mit leerem Blick in die gleiche Richtung. Nur schien er durch das spärliche Licht im Treppenhaus noch bleicher zu sein als beim letzten Mal. Jedenfalls war mir dieses schummrige Licht beim letzten Mal nicht aufgefallen.
„Einen schönen guten Tag, Herr Hirmer“ rief ich ihm betont gut gelaunt entgegen. Wie ich es mir schon fast gedacht hatte, entgegnete er nichts. Keine Reaktion.
Ich lief an ihm vorbei in den Keller, stellte den Karton zu den anderen Bücherkartons, und machte mich wieder auf den Weg nach oben. Im Erdgeschoss schaute ich noch schnell nach der Post, aber es gab nur Werbung. Langsam ging ich hinauf in den dritten Stock und überlegte mir dabei, wie ich Opa Hirmer vielleicht doch mehr entlocken könnte. Ich weiß nicht mehr, was ich ihn fragen wollte, denn er kam mir zuvor. Bevor ich die letzten Stufen zu ihm herauf genommen hatte, hauchte er wie zuvor im gleichen monotonen Laut:
„Bring‘ sie zu mir!“ Aber ich konnte dabei keine Bewegung seiner Lippen wahrnehmen.
Ich blieb drei Stufen unterhalb von ihm stehen und betrachtete ihn ausgiebig. Seine Wangen waren nicht nur immer noch schlecht rasiert, sondern jetzt sogar regelrecht eingefallen. Er sah aus, wie ein extremer Alkoholiker. Das würde auch seine tiefen Augenringe erklären.
„Was meinen Sie denn, Herr Hirmer? Ist Ihnen vielleicht etwas runtergefallen?“ fragte ich ihn.
Aber er schien mich nicht zu hören. Seine Finger hielten verkrampft den Besenstiel und sein Blick veränderte sich kein bisschen. Es war nicht das geringste Geräusch zu hören, obwohl man zumindest den Rhythmus von Zolas Musik hätte wahrnehmen müssen. Es herrschte eine eisige Stille im Treppenhaus.
Ich ging die drei Stufen nach oben und stand nun direkt vor ihm.
„Herr Hirmer? Geht es Ihnen auch gut? Soll ich vielleicht Ihrer Frau Bescheid sagen?“
Ich schaute auf seine Schuhe, seine dünnen Beine. Und dann traf mich eiskalt der Schreck. Ich sah meinen spärlichen Schatten auf dem Boden neben uns, weil das Licht, das von draußen drang, einfach nicht mehr hergab. Aber eben nur meinen. Ich schaute nochmal genau, ob ich mich auch nicht getäuscht hatte. Aber es war so: Am Boden war lediglich mein Schatten zu sehen. Seiner hätte am Boden direkt daneben sein müssen, aber da war nichts.
Wie von einer kalten Hand gepackt bin ich sofort die letzte Treppe nach oben gerannt und habe hektisch die Tür zu meiner Wohnung aufgesperrt, wo mir sofort die warme Musik und das Leben entgegen schwappte.
„Zola!“ rief ich. „Bitte komm schnell her!“
„Mr. Wilhelm, was ist los? Alles gut?“ entgegnete sie vom Spülbecken aus, wo sie gerade die Böden des Kühlschranks schrubbte, die sie ausgebaut hatte.
„Ich… Komm doch bitte mal her“, stotterte ich immer noch sehr verwirrt. Ich blieb vor die Küchentür stehen und gestikulierte sie wild zu mir herüber.
Sie trocknete sich hastig die Hände ab und kam zu mir.
„Schau doch bitte mal die Treppe runter. Was siehst du da?“ fragte ich sie.
Sie schaute mich erst fragend an, trat dann aus der Wohnungstür ins Treppenhaus und sagte:
„Soll ich Treppe putzen?“
„Was? Nein!“ entgegnete ich und trat neben sie. Ich schaute nun ebenfalls wieder die Treppe hinunter und nahm den Ort auf einmal ganz anders wahr. Das Treppenhaus war viel heller, die Musik aus meinem Wohnzimmer war sicher überall im Haus zu hören und Opa Hirmer war weg. Als wenn er nie dagewesen wäre.
Ich lief die Treppe halb hinunter um zu sehen, ob er sich nicht einfach eine halbe Etage nach unten gestellt hatte. Aber nichts. Er war wieder weg. Wie beim letzten Mal.
„Alles gut?“ fragte mich Zola noch einmal. Ich musste auf sie einen sehr verwirrten Eindruck gemacht haben. Aber sie nahm es relativ gelassen.
„Ja, alles gut!“ erwiderte ich ziemlich irritiert und versuchte ihr gequält zuzuzwinkern.
„Sie sind lustig, Mr. Wilhelm“, meinte sie noch und damit war für sie die Sache erledigt.
Wir traten zurück in die Wohnung und ich empfand es als sehr tröstlich, wieder in Zolas Welt einzutauchen. Sie trocknete nun die Böden des Kühlschranks und setzte sie wieder ein. Ihre braunen schlanken Hände bewegten sich zur Musik und ihre Augen leuchteten. Der Rhythmus einer Eintonflöte gepaart mit tiefen Trommelgeräuschen hüllte mich wieder in ein bekanntes Wohlbehagen.
Zola musste an dem Tag früher los. Ich schenkte ihr die Bananen, die sie als Teil des Einkaufs mitgebracht hatte.
„Sie nicht mögen Bananen, Mr. Wilhelm?“ fragte sie mit erstauntem Blick.
„Nun ja, ich liebe Obst sehr, wirklich alles, außer Bananen“, bestätigte ich und zeigte angewidert auf die Anrichte. Sie lachte herzhaft und nahm die Bananen mit.
Als Zola gegangen war, dachte ich an den restlichen Inhalt des Kühlschranks, den sie vorher auf die Anrichte gepackt hatte und konnte mir damit die Zutaten für ein schnelles Mittagessen zusammenzustellen. Ich bereitete mir ein Kräuteromelette mit Kirschtomaten und zur Nachspeise etwas Magerquark mit geriebenem Apfel. Ich setzte mich mit dem Teller raus auf den Balkon und dachte daran, dass bald die Spargelzeit beginnen würde. Oder gab es gar schon den ersten? Ich ließ mir viel Zeit beim Essen, wie ich das immer tue.
Ich muss ziemlich lange dort gesessen haben, denn ich versuchte so viel von der immer noch kämpfenden Frühlingssonne einzusaugen, wie es eben ging. Ich genoss den weiten Blick von hier oben. Weit und ruhig.
Zu meinem Haus gehört ein relativ großer Garten, den der Hausmeister bewirtschaftet, der im Erdgeschoß wohnt. Und keins der umliegenden Häuser ist so hoch wie dieses hier, so dass auch keiner der Nachbarn auf meinen Balkon schauen kann. Wenn ich mich nicht hinstelle, dann sieht mich niemand.
Nur der Kirchturm, der aber weit genug weg ist, ist höher. Aber der Eingang der Kirche ist auf der anderen Seite und lediglich der Friedhof grenzt an meinen Garten. Alles in allem also eine sehr ruhige Gegend, denn die paar Friedhofsbesucher machen nun wirklich keinen Krach. Ganz im Gegenteil, ich liebe diese besinnliche Ruhe des Friedhofs. Und so habe ich mir auch an diesem Tag mein Buch geschnappt, doch noch eine dickere Jacke angezogen und habe mich auf die Bank am Rand des Friedhofs gesetzt, als mein Balkon leider schon im Schatten lag. Wohl wissend, dass ich mich wieder über die Zigarettenreste zwischen der Bank und dem Mülleimer ärgern würde.
Meine Wohnungstür hatte ich ganz vorsichtig geöffnet. Aber ich konnte gleich erkennen, dass das Licht im Flur das gleiche war, wie in dem Moment, als Zola neben mir stand.
Kapitel 2
Am nächsten Tag dann, ein Samstag, stand ich nach einer traumlosen Nacht wie immer gegen sechsuhrdreißig auf, absolvierte meine sportlichen Betätigungen bis um sieben, trank zwei große Gläser lauwarmes Wasser, machte dann die Morgentoilette und saß wie immer um siebenuhrfünfzehn am Frühstückstisch. Es gab etwas Müsli mit Milch und dazu schnitt ich mir einen ganzen Apfel mit Schale auf.
Ich saß gerade für mein weiteres morgendliches Sportpensum eine halbe Stunde auf meinem Trimmrad, als das Telefon läutete. Ich stieg ab, schaute auf die Anzeige des Telefons, doch der Anrufer hatte seine Nummer unterdrückt. Ich mag diese Art des Anrufens nicht, was für eine sinnlose Erfindung. Trotzdem hob ich nach dem zehnten Läuten den Hörer ab und meldete mich - wie üblich - mit meinem vollen Namen. Vom anderen Ende kam keine Antwort und ich dachte zuerst, jemand hätte sich verwählt oder es handele sich vielleicht um ein technisches Problem. Aber als ich genau hinhörte, konnte ich eine Luftbewegung vernehmen, die an sehr langsame und lange Atemzüge erinnerte. Nur viel mechanischer und exakt gleichmäßig. Als würde sich ein überdimensionierter Blasebalg ohne Unterlass bewegen. Ich drückte den Hörer fest an mein Ohr in der Erwartung, vielleicht doch noch mehr zu realisieren. Aber als sich außer dieser kühlen, mechanischen Monotonie jedoch weiter nichts tat, legte ich den Hörer auf und setzte mich wieder auf mein Trimmrad, um die volle Stunde Trainingszeit zu absolvieren. Danach trank ich einen großen Becher Kaffee und blätterte in der Zeitung vom Vortag, die ich noch nicht ganz ausgelesen hatte.
Nach ein paar Minuten hörte ich plötzlich, wie im Stockwerk unter mir eine Wohnungstür zuknallte. Ich blickte erschrocken auf, konnte aber erst einmal weiter nichts wahrnehmen. Es dauerte eine Weile, dann erklangen Schritte im Treppenhaus, sehr langsame, quälende Schritte. Man konnte quasi fühlen, wie sich da jemand die Treppe raufschob, mit immer längeren Pausen und einem Schnaufen, dass es langsam asthmatische Züge annahm.
Die Schritte wurden langsam aber zunehmend lauter und hörten dann vor meiner Wohnungstür auf. Es dauerte wieder eine lange Zeit, ohne dass etwas passierte. Ich hielt weiter die Zeitung in der Hand und starrte konzentriert vor mich hin, um mir anhand der Geräusche auszumalen, was da draußen vor sich ging. Wahrscheinlich musste die Person, oder was immer da draußen vor meiner Tür stand, erst einmal zu Kräften kommen. Oder etwas wartete geduldig, bis ich aus der Tür treten würde.
Doch dann läutete es. Ich legte die Zeitung beiseite, blieb aber erstarrt auf meinem Stuhl sitzen. Kurz darauf läutete es noch einmal und jemand klopfte an die Wohnungstür. Ich entschied mich, langsam aufzustehen und vorsichtig zur Tür zu gehen. Es klopfte noch einmal. Ich öffnete die Wohnungstür ganz langsam einen Spalt und erblickte das freundliche Gesicht von Oma Hirmer, die direkt unter mir wohnte.
„Hallo, junger Herr von Popp“, sprach sie mich wie gewohnt an. „Darf ich Sie einen Moment um Ihre Mithilfe bitten?“
„Aber natürlich gerne, jederzeit. Das wissen Sie doch“, entgegnete ich erleichtert, öffnete die Tür weit und machte eine einladende Geste, die sie sofort annahm. Mit einem weiteren Stöhnen kam sie herein. Ich schloss die Tür und zeigte ihr, sie solle sich doch bitte an den Esstisch im Wohnzimmer setzen.
„Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?“ fragte ich.
„Bitte machen Sie sich keine Umstände, lieber Herr von Popp“, entgegnete sie.
„Es macht keine Umstände. Ich habe gerade welchen frisch aufgebrüht." Sie zögerte kurz, schien unentschlossen und sagte dann aber:
„Na gut, dann gerne.“
Ich half ihr mit dem Stuhl und ging schnell in die Küche, um noch eine weitere Tasse zu holen. Als ich wieder zurückkam, saß Oma Hirmer am Tisch und schaute sich intensiv im Zimmer um. Sie trug wie immer ihre rotweiße Kittelschürze, darunter einen Rock und oben eine leichte, cremefarbene Strickjacke. Ihre schwarzen Schuhe erschienen mir viel zu klein, was aber auch daran liegen konnte, dass ihre Füße in den hellbraunen Strümpfen genauso dick waren wie ihre Beine und deshalb zu beiden Seiten raus zu quellen schienen.
„Wie ordentlich und geschmackvoll Sie es immer haben, junger Herr von Popp. Genau wie Ihre Eltern. Ihr Vater war ja so ein adretter Mann.“ Sie wartete meine Antwort erst gar nicht ab, sondern legte sofort nach: „Wie geht´s der werten Frau Mutter?“
„Danke, sehr gut. Den Umständen entsprechend. Ich werde sie morgen wieder in ihrer Alterspension besuchen“, antwortete ich.
Sie blickte mich zustimmend an. „Sie sind ein guter Sohn. Dann nehmen Sie der lieben Frau von Popp bitte meine besten Grüße mit.“
„Das mache ich gerne“, erwiderte ich.
Das schien für sie der nette Einstieg in ein weit wichtigeres Gespräch zu sein, das sie mit mir führen wollte.
„Und eine sehr gute Haushaltshilfe haben sie ja da, wie ich sehe“, sagte sie. Ich wusste nicht, woher sie wusste, dass Zola meine Haushaltshilfe und nicht etwa meine Freundin oder sonst was ist, wollte ihrer Informationsquelle aber auch nicht weiter auf den Grund gehen.
„Ja, Zola ist quasi hier bei mir die gute Fee“, erwiderte ich. „Hoffentlich war die Musik nicht zu laut? Hat Sie das gestört?“
„Musik?“ fragte sie. „Nein! Ich höre keine Musik.“
Okay, das war also auch nicht das Thema, weswegen sie extra die Treppe zu mir nach oben gekommen ist. Sie nahm vorsichtig einen Schluck vom Tee, als hätte sie schlechte Erfahrungen mit verbrühten Lippen gemacht, schaute mit der Tasse am Mund noch einmal ausgiebig durch den Raum, setzt die Tasse ab und atmete tief aus. Es vergingen wieder einige lange Sekunden, ohne dass einer von uns beiden sprach. Doch dann setzte sie an.
„Weswegen ich gekommen bin.“ Ich sah sie erwartungsvoll und auch etwas verunsichert an. Was konnte es wohl sein, wozu sie meine Mithilfe brauchte?
„Mein Pauli ist vorgestern Abend nicht nach Hause gekommen“, sagte sie dann mit sehr ernster Miene. Etwas enttäuscht sah ich sie an, um zu sehen, ob sie vielleicht doch noch etwas Tiefgründigeres hinzuzufügen hatte. Aber das war das ganze Problem. Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
Pauli war Oma Hilmers Kater. Ein ziemlich fetter und wohl auch schon ziemlich alter Kater. Oma Hilmer lässt ihn bei Bedarf aus der Wohnungstür und Pauli läuft durch die Katzenklappe unten in unserer Haustür auf die Straße. Wobei ich mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, frage, ob er denn überhaupt noch durch die Klappe passt. Vielleicht hat er draußen einen Vogel gefressen, der ihm irgendwie ins Maul geflogen ist, und jetzt passt er nicht mehr durch die Klappe und kommt nicht mehr ins Haus. Jetzt muss er draußen bleiben, bis er wieder abgenommen hat.
„Sie kennen meinen Pauli doch?“ fragte Oma Hilmer zögernd.
„Natürlich, werte Frau Hilmer“, antwortete ich. „Selbstverständlich kenne ich den lieben Pauli. Er ist ja schließlich schon sowas wie ein Ehrenmitglied unserer kleinen Hausgemeinschaft hier.“ Das schien ihr zu gefallen. Sie lächelte mich an, als wolle sie noch einmal sagen, was für ein lieber Junge ich doch sei.
„Sie wissen ja, dass er immer so verrückte Sachen macht. Auf Bäume klettert und so. Obwohl er ja, um einen Vogel zu jagen, auch nicht mehr der Jüngste ist“, sagte sie. Ich nickte nur, denn was hätte ich dazu sagen sollen.
Nach einer kurzen Weile der Besinnlichkeit für Pauli sagte ich dann, weil das Thema einfach erschöpft war:
„Ich bin mir sicher, dass er bald wiederkommt. Ich werde auf jeden Fall Augen und Ohren nach ihm offenhalten. Versprochen.“
Das wollte sie scheinbar hören, denn sie schnaubte zufrieden, als hätte sie eine schwierige Mission erfüllt. Einen Teilsieg errungen sozusagen. Sie hatte die Helfer informiert, die ihren fetten Kater wieder zurückbringen würden. Pauli war also quasi schon so gut wie gerettet.
„Darf es noch ein Schluck Tee sein?“ fragte ich. Sie winkte wild gestikulierend ab.
„Nein, nein. Besten Dank. Aber ich muss wieder runter. Ich will ja zu Hause sein, falls er kommt.“
„Ja, das macht sicher Sinn“, entgegnete ich verständnisvoll nickend. „Kommen Sie, ich helfe Ihnen noch kurz die Treppe hinunter zu Ihrer Wohnung.“
„Das ist sehr nett“, sagte sie. „Ich bin halt auch nicht mehr die Jüngste. Achtundachtzig werde ich dieses Jahr, wissen Sie?“
„Ich weiß“, antwortete ich. „Ich werde doch Ihren Geburtstag nicht vergessen.“ Meine Mutter erinnerte mich stets an die Geburtstage der Nachbarn, damit ich auch höflich gratulieren konnte.
Ich führte sie zur Wohnungstür, ließ sie vorausgehen und griff ihr dann an den Arm, um sie die Stufen zu ihrer Wohnung zu geleiten. Mit der anderen Hand umklammerte sie das Geländer. Langsam setzte sie stark gebückt gehend einen Fuß auf eine Stufe, zog den zweiten nach und machte jeweils eine kurze Pause. Ich überlegte erst, ob es nicht sogar sinnvoller wäre, wenn Oma Hirmer rückwärts die Stufen runterginge. Aber dann hatte ich Angst, dass sie das eventuell als zu demütigend empfunden hätte. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Bis zum Zwischengeschoss gingen wir so wortlos hinab. Als wir an der Stelle vorbeikamen, wo sonst immer Opa Hirmer stand, wagte ich mich vor:
„Ich wollte Sie auch noch was fragen, liebe Frau Hirmer“, begann ich.
Sie erwiderte nur mit einem bejahenden Schnaufen, ohne den konzentrierten Blick von ihren Füßen abzuwenden.
„Kann es sein… wie soll ich sagen?“ fing ich an.
Sie konzentrierte sich weiterhin auf ihre Schritte und begab sich über den Boden schlurfend an den zweiten Teil der Treppe.
„Kann es sein“, formulierte ich weiter, „also, dass es Ihrem Mann in letzter Zeit nicht besonders gut geht?“
Sie blieb auf der Mitte der Treppe wie eingefroren stehen, einen Fuß bereits nach unten gesetzt, schaute mit einer hastigen Drehung ihres Kopfes von den Füssen auf, mir fragend direkt ins Gesicht.
„Ich meine…“, stotterte ich. „Ich meine nur, er wirkt auf mich etwas…, ich meine vielleicht geistesabwesend?“ Ich machte eine kurze Pause, in der sie mich regungslos weiter anstarrte. „Und ich wollte sicher sein, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist“, fügte ich wie zur Rechtfertigung hinzu.
Ihre Augen schienen sich zu weiten, so als müsse sie erforschen, was ich mit meiner Frage bezwecken wollte. Als sich ihr Blick in Eiseskälte verwandelte, riss sie mit einem unerwartet starken Ruck ihren Arm los, so dass ich gleich von ihr abließ.
„Mein Herbert ist vor drei Jahren verstorben. Das wissen Sie doch!“ antwortete sie ziemlich barsch. Sie machte den beleidigten Eindruck eines kleinen Kindes, das sich auf den Arm genommen fühlt. Sie stieß ein ziemlich abfälliges Grunzgeräusch aus, nuschelte etwas unverständlich vor sich hin und zog endlich den zweiten Fuß nach um weiterzugehen. Ich wollte sie wieder unterstützen, aber sie wehrte sich.
„Lassen Sie das. Ich schaff das schon allein!“ schnippte sie mich nur an. Ich blieb stehen und wartete auf der Stelle, bis sie die letzten Stufen zu ihrer Wohnung geschafft hatte, um dann umständlich den Schlüssel aus ihrer Schürze zu kramen, zittrig nach dem Schlüsselloch zu stochern, umständlich in ihre Wohnung zu treten und endlich mit einem lauten Türzuschlagen darin zu verschwinden. Ich ging ebenfalls zurück nach oben ohne zu verstehen, was dieser Zwischenfall gerade zu bedeuten hatte. Nun ja, Oma Hirmer war eben auch nicht mehr die Jüngste.
Gegen Mittag habe ich mir dann eine leichte Mahlzeit zubereitet. Es gab Blumenkohl mit brauner Butter und dazu gebackene Spalten der Süßkartoffel. Als ich mit dem Abwasch fertig war, setzte ich mich auf die Couch, las ein Buch mit dem Titel ‚Ernährungslehre und Diätetik‘, während ich auf Hannes wartete.





























