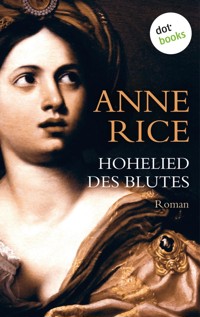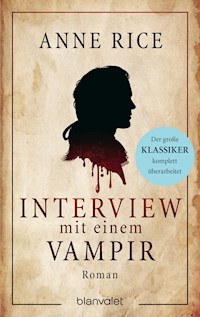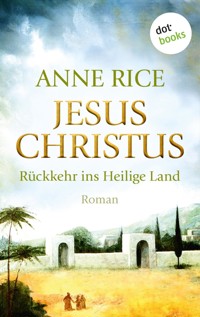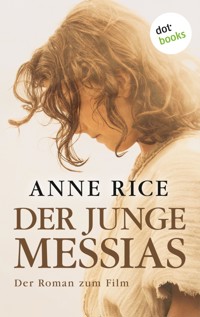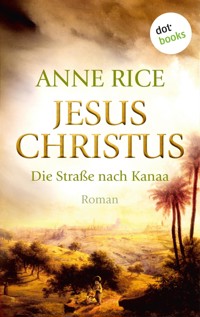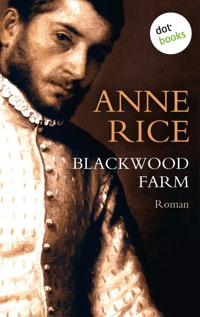
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Panoptikum voller Vampire, Hexen und Geister – erleben Sie "Blackwood Farm" von Bestsellerautorin Anne Rice jetzt als eBook bei dotbooks. "Er ist kein Geschöpf aus der Hölle, weder Engel noch Teufel, sondern etwas dazwischen." Willkommen auf Blackwood Farm! Hinter den weißen Säulen des imposanten Herrensitzes verbirgt sich ein düsteres Geheimnis: Seit frühester Kindheit wird Quinn Blackwood von Goblin heimgesucht, seinem geisterhaften Doppelgänger – kaum mehr als ein Schatten und doch real, zärtlicher Freund und jähzorniger Verfolger zugleich. Quinn hat gelernt, mit seinem ständigen Begleiter zu leben. Doch dann geschieht etwas, das Goblins Blutdurst weckt. Nun kann nur noch einer dem Erben von Blackwood helfen: Lestat, der legendäre Vampir … Opulent erzählt und durchdrungen von der fiebrigen Hitze der amerikanischen Südstaaten – ein rauschhaftes Lesevergnügen, in dem Anne Rice meisterhaft ihre weltberühmten Chroniken der Vampire mit der Saga um die stolzen Mayfair-Hexen verbindet: "Einer ihrer besten Romane!" Bild am Sonntag Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Blackwood Farm" von Bestsellerautorin Anne Rice. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1134
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Er ist kein Geschöpf aus der Hölle, weder Engel noch Teufel, sondern etwas dazwischen.«
Willkommen auf Blackwood Farm! Hinter den weißen Säulen des imposanten Herrensitzes verbirgt sich ein düsteres Geheimnis: Seit frühester Kindheit wird Quinn Blackwood von Goblin heimgesucht, seinem geisterhaften Doppelgänger – kaum mehr als ein Schatten und doch real, zärtlicher Freund und jähzorniger Verfolger zugleich. Quinn hat gelernt, mit seinem ständigen Begleiter zu leben. Doch dann geschieht etwas, das Goblins Blutdurst weckt. Nun kann nur noch einer dem Erben von Blackwood helfen: Lestat, der legendäre Vampir …
Opulent erzählt und durchdrungen von der fiebrigen Hitze der amerikanischen Südstaaten – ein rauschhaftes Lesevergnügen, in dem Anne Rice meisterhaft ihre weltberühmten Chroniken der Vampire mit der Saga um die stolzen Mayfair-Hexen verbindet: »Einer ihrer besten Romane!« Bild am Sonntag
Über die Autorin:
Anne Rice, geboren 1941 in New Orleans, studierte in San Francisco Englisch, Kreatives Schreiben und Politikwissenschaften. 1976 wurde sie mit ihrem Debütroman Interview mit einem Vampir weltberühmt. Mehr Informationen finden sich auf ihrer Website: www.annerice.com
Bei dotbooks erschienen aus der international erfolgreichen Serie Die Chronik der Vampire bereit die Romane Blackwood Farm und Das Hohelied des Blutes. Anne Rice veröffentlichte bei dotbooks außerdem Jesus Christus – Rückkehr ins Heilige Land und Jesus Christus – Die Straße nach Kanaa.
***
Die Originalausgabe dieses Romans erschien 2002 unter dem Titel »Blackwood Farm« im Verlag Alfred A. Knopf, New York
eBook-Neuausgabe September 2016
Copyright © 2002 by Anne O’Brien Rice. All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part of any form.
Copyright für die deutschsprachige Ausgabe © 2005 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg (www.hoffmann-und-campe.de)
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Gemäldes »Der Schneider« von Giovanni Battista Moroni
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-787-1
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Blackwood Farm an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne Rice
Blackwood Farm
Ein Roman aus der Chronik der Vampire
Aus dem Englischen von Barbara Kesper
dotbooks.
Meinem SohnChristopher Ricegewidmet
Meine Tage sind vergangen,
meine Anschläge sind zertrennet,
die mein Herz besessen haben.
Sie wollen aus der Nacht Tag machen
und aus dem Tage Nacht.
Wenn ich gleich lange harre,
so ist doch die Hölle mein Haus,
und in der Finsternis ist mein Bette gemacht.
Die Verwesung heiße ich meinen Vater
Und die Würmer meine Mutter und meine Schwester.
Was soll ich denn harren?
Und wer achtet mein Hoffen?
Hinunter in die Hölle wird es fahren
Und wird mit mir in dem Staub liegen.
Hiob 17, 11-16
Kapitel 1
Lestat,
wenn Sie diesen Brief in Ihrem Haus in der Rue Royale finden – wovon ich fest überzeugt bin werden Sie sofort wissen, dass ich Ihre Regeln gebrochen habe.
Ich weiß, dass New Orleans für Bluttrinker eine verbotene Zone ist und dass Sie jeden töten werden, den Sie dort finden. Anders als viele der Strolche, die trotzdem dort eingedrungen sind, verstehe ich Ihre Gründe dafür. Sie wollen nicht, dass Mitglieder der Talamasca uns sehen. Sie wollen einen Krieg mit diesem ehrwürdigen Orden übersinnlicher Detektive vermeiden, um derentwillen und um unserer selbst willen.
Aber ich bitte Sie sehr, lesen Sie, was ich zu sagen habe, ehe Sie nach mir zu suchen beginnen.
Mein Name ist Quinn. Ich bin zweiundzwanzig Jahre alt und seit nicht ganz einem Jahr ein Blutjäger, wie mein Schöpfer es nennt. Ich bin jetzt eine Waise, so sehe ich es jedenfalls, und deshalb wende ich mich an Sie um Beistand.
Aber ehe ich meinen Fall darlege, sollen Sie wissen, dass ich die Talamasca kenne, ja, dass ich sie schon kannte, ehe ich das Blut der Finsternis schmeckte. Mir ist bewusst, dass sie sich dem Guten verschrieben hat und allem Übersinnlichen neutral gegenübersteht. Ich habe mir große Mühe gegeben, nicht von ihnen ertappt zu werden, als ich diesen Brief in Ihrer Wohnung hinterlegte.
Ich weiß, dass Sie New Orleans telepathisch überwachen, und ich zweifle nicht daran, dass Sie den Brief finden werden.
Wenn Sie kommen sollten, um mich für meinen Ungehorsam zu bestrafen, so versichern Sie mir bitte wenigstens, dass Sie ihr Äußerstes tun werden, einen Geist, ein Astralwesen, zu vernichten, das mir seit meiner Kindheit ein Gefährte war. Dieses Wesen, ein Ebenbild meiner selbst, das länger, als ich denken kann, mit mir heranwuchs, stellt nun nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen eine Gefahr dar.
Erlauben Sie mir, das zu erklären.
Als ich noch ein kleiner Junge war, nannte ich diesen Geist Goblin, obwohl Kobold viel zu harmlos klingt. Das war schon, bevor ich die Kinderreime und Märchen gehört hatte, in denen dieses Wort vorkam. Ob ich diesen Namen von dem Geist selbst mitgeteilt bekam, weiß ich nicht. Ich konnte ihn jedoch stets herbeirufen, wenn ich seinen Namen aussprach. Oftmals kam er aber aus eigenem Antrieb und ließ sich nicht wieder vertreiben. Zu anderen Zeiten war er mein einziger Freund. All die Jahre jedoch war er mein Vertrauter, der reifte, wie ich reifte, und immer geschickter darin wurde, mir seine Wünsche zu offenbaren. Man könnte sagen, ich gab Goblin Kraft und formte ihn. Und so schuf ich unbeabsichtigt das Ungeheuer, das er nun ist.
Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, ohne Goblin zu leben, und doch muss ich mich mit dem Gedanken vertraut machen. Ich muss Goblin ein Ende bereiten, ehe er sich in etwas verwandelt, was sich gänzlich meiner Kontrolle entzieht. Warum ich ihn nun als Ungeheuer bezeichne – dieses Geschöpf, das einst mein einziger Spielkamerad war? Die Antwort ist einfach. In den Monaten, nachdem ich zum Bluttrinker wurde – wobei ich in dieser Angelegenheit keine Wahl hatte –, fand Goblin ebenfalls Geschmack an Blut. Jedes Mal, wenn ich getrunken habe, umschlingt er mich und saugt aus tausend winzigsten Wunden Blut, wodurch seine sichtbare Erscheinung verstärkt wird, und seiner Anwesenheit haftet ein zarter Duft an, den er zuvor nie hatte. Mit jedem Monat, der vergeht, gewinnt er mehr Kraft, und seine Angriffe auf mich werden immer dauerhafter.
Ich kann mich nicht mehr gegen ihn wehren.
Es wird Sie nicht überraschen, denke ich, dass mir diese Angriffe ein gewisses Lustgefühl verschaffen, zwar nicht so stark, wie wenn ich von einem Menschen trinke, aber eine gewisse Erregung kann ich nicht leugnen.
Es ist aber nicht der Umstand, dass ich Goblin gegenüber schutzlos bin, der mich bekümmert, sondern die Frage, wozu er sich entwickeln könnte.
Ich habe Ihre Vampirchroniken wieder und wieder studiert. Ich bekam sie von dem, der mir das Blut gab, einem uralten Bluttrinker, der mir dazu noch, wenn ich seinen Worten glauben kann, enorme Kräfte verlieh.
Sie erzählen in Ihren Büchern vom Ursprung der Vampire und zitieren einen ägyptischen Ältesten, einen Bluttrinker, der diese Sage dem weisen Marius anvertraute, der sie wiederum an Sie weitergab.
Ob nun Sie und Marius einiges davon nur erfunden haben, weiß ich nicht. Sie und Ihre Gefährten, der »Orden der Mitteilsamen«, wie man Sie nennt, können möglicherweise auch einen Hang zu Lügengeschichten haben.
Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich bin der lebende Beweis, dass es Bluttrinker gibt – ob man sie nun Blutjäger, Bluttrinker, Vampire, Kinder der Nacht oder Kinder der Jahrtausende nennt –, und die Art, wie ich dazu wurde, stimmt mit dem überein, was Sie beschreiben.
Und in der Tat benutzte auch mein Schöpfer dieselben Bezeichnungen wie Sie in Ihren Erzählungen, wenn er uns auch Blutjäger anstatt Vampire nannte. Er schenkte mir die Gabe der Lüfte, sodass ich mühelos reisen kann, und auch die Gabe des Geistes, damit ich die Sünden meiner Opfer telepathisch ausforschen kann. Außerdem gab er mir die Gabe des Feuers, mit der ich hier soeben den eisernen Ofen entzünde, um mich zu wärmen.
Deshalb also glaube ich Ihre Geschichten. Ich vertraue Ihnen.
Ich glaube Ihnen, wenn Sie schreiben, dass ein bösartiger Geist sich der ägyptischen Königin Akasha bemächtigte, indem er in jede Faser ihres Körpers eindrang. Schon lange zuvor hatte dieser Geist Geschmack an menschlichem Blut gefunden.
Ich glaube Ihnen, dass dieses Geistwesen – von den beiden Hexen Maharet und Mekare, die ihn wahrnehmen konnten, Amel genannt – nun in allen Vampiren lebt, und dass seine geheimnisvolle Essenz, oder wie man es sonst nennen will, wie eine wild wuchernde Schlingpflanze bis heute in jedem Bluttrinker, der von einem anderen geschaffen wird, zu neuer Blüte reift.
Aus Ihren Geschichten weiß ich ebenfalls, dass diese beiden Hexen ihre Fähigkeit, mit Geistwesen zu sprechen und sie zu sehen, verloren, als man sie zu Bluttrinkern machte. Mein Schöpfer erklärte mir, dass ebendas auch bei mir eintreten werde.
Aber ich versichere Ihnen, dass ich diese Fähigkeit nicht verloren habe. Ich wirke auf sie immer noch wie ein Magnet. Und vielleicht ist es diese Empfänglichkeit, verbunden mit meiner Weigerung, Goblin zu vertreiben, durch die er die Kraft gewann, mich zu quälen, damit er an das vampirische Blut gelangen kann.
Lestat, wenn diese Kreatur noch stärker wird – und anscheinend kann ich nichts tun, um ihn aufzuhalten –, ist es dann möglich, dass er, wie Amel einst, in einen Menschen eindringt? Ist es möglich, dass so eine neue Vampirart geschaffen würde und aus dieser Art vielleicht ein weiterer Zweig hervorginge?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frage Sie nicht beschäftigt, ebenso wie die Gefahr, dass Goblin vielleicht Menschen töten könnte – obwohl er im Moment bei weitem noch nicht stark genug dafür ist.
Ich denke, Sie werden mich verstehen, wenn ich sage, dass ich mich ängstige, ebenso um die, die ich liebe und schätze – meine sterbliche Familie –, als auch um jeden Fremden, den Goblin angreifen könnte.
Es fällt mir schwer, diese Zeilen zu schreiben, denn ich habe Goblin geliebt, solange ich lebe, und wenn man mir einreden wollte, dass er nur ein »eingebildeter Spielkamerad« oder eine »törichte Zwangsvorstellung« sei, habe ich das stets voller Zorn zurückgewiesen. Aber wir beide, die wir so lange heimliche Bettgenossen waren, sind nun Gegner, und ich fürchte seine Angriffe, da ich spüre, wie er zunehmend stärker wird. Goblin zieht sich, solange ich nicht jage, vollkommen von mir zurück und erscheint erst wieder, wenn frisches Blut in meinen Adern fließt. Wir pflegen keinen spirituellen Austausch mehr, Goblin und ich. Er scheint vor Neid zu glühen, weil ich ein Bluttrinker geworden bin. Es kommt mir so vor, als sei aus seinem kindischen Geist alles ausradiert, was er einst gelernt hat.
Dies alles bereitet mir tödliche Qualen.
Aber lassen Sie mich wiederholen: Ich schreibe Ihnen nicht um meinetwillen, sondern aus Furcht darüber, wozu Goblin sich entwickeln könnte.
Natürlich würde ich Sie gern mit eigenen Augen sehen und mit Ihnen reden. Ich möchte, wenn es möglich ist, in den »Orden der Mitteilsamen« aufgenommen werden. Und ich möchte, dass Sie, der Sie berühmt dafür sind, Regeln zu missachten, mir den Bruch Ihrer Regeln verzeihen. Ich möchte, dass Sie, der Sie selbst entführt und gegen Ihren Willen zum Vampir gemacht wurden, mich freundlich aufnehmen, da mir das Gleiche widerfahren ist.
Ich möchte, dass Sie mir mein unbefugtes Eindringen in Ihr Haus in der Rue Royale vergeben, wo ich diesen Brief hoffentlich verstecken kann. Sie sollen wissen, dass ich in New Orleans bisher nie gejagt habe und auch nicht vorhabe, je dort auf Jagd zu gehen. Und da ich schon vom Jagen rede – auch mich hat man gelehrt, nur die Übeltäter zu jagen, und auch wenn mein Sündenregister nicht blütenweiß ist, so lerne ich doch mit jedem Mahl dazu. Auch den »Kleinen Trunk«, wie Sie es so elegant nennen, beherrsche ich inzwischen, sodass ich lärmende Partys von Sterblichen besuchen kann und es nie auffällt, wenn ich flink und gewandt von einem Gast nach dem anderen trinke.
Aber im großen Ganzen ist mein Leben einsam und bitter. Gäbe es nicht meine sterbliche Familie, fände ich es unerträglich. Was meinen Schöpfer angeht, so weiche ich ihm und seinem Anhang aus, und das aus gutem Grund.
Diese Geschichte würde ich Ihnen übrigens gern erzählen. Und eigentlich nicht nur die. Ich bete, dass, was ich zu erzählen habe, Sie vielleicht davon abhalten wird, mich zu töten. Wissen Sie, wir könnten ein Spiel daraus machen: Wir treffen uns, ich beginne zu erzählen, und Sie töten mich, wenn die Geschichte eine Wendung nimmt, die Ihnen nicht passt.
Aber jetzt ernsthaft, der wahre Grund meines Schreibens ist Goblin.
Ehe ich schließe, lassen Sie mich Folgendes hinzufügen: Nachdem ich letztes Jahr zum Bluttrinker wurde, las ich Ihre Chroniken, um vielleicht daraus zu lernen, und seitdem war ich oft versucht, das Mutterhaus der Talamasca, Oak Haven, in einem Außenbezirk von New Orleans, aufzusuchen und die Talamasca um Rat und Hilfe zu bitten.
Als ich noch ein Junge war – und ich bin immer noch kaum mehr als das –, lernte ich ein Mitglied der Talamasca kennen, das Goblin ebenso deutlich und eindeutig zu sehen vermochte wie ich selbst. Dieser sanftmütige, unvoreingenommene Engländer namens Sterling Oliver beriet mich, was mein besonderes Talent anging, weil es eventuell zu stark werden könnte und ich es dann nicht mehr unter Kontrolle hätte. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte ich eine große Zuneigung zu Sterling.
Außerdem verliebte ich mich heftig in ein junges Mädchen, das in Sterlings Begleitung war, als ich ihn das erste Mal traf.
Sie ist eine rothaarige Schönheit mit beträchtlichen übersinnlichen Kräften, die Goblin ebenfalls sehen kann – die weitherzige Talamasca hat sich auch ihrer angenommen.
Dieses Mädchen ist nun für mich verloren. Ihr Name ist Mayfair, ein Name, der Ihnen nicht unbekannt sein dürfte, wenn auch dieses Mädchen wahrscheinlich bis zum heutigen Tag nichts von Ihrer Freundin und Gefährtin Merrick Mayfair weiß.
Aber mit Sicherheit stammt dieses Mädchen aus derselben Familie, deren Mitglieder alle über große übersinnliche Fähigkeiten verfügen – es scheint ihnen Vergnügen zu bereiten, sich Hexen zu nennen. Ich habe geschworen, sie nie mehr wiederzusehen. Mit ihren beachtlichen Kräften würde sie sofort erkennen, dass mir etwas Katastrophales widerfahren ist, und ich kann es nicht zulassen, dass das Böse in mir ihr zu nahe kommt.
Ich war ein wenig erstaunt, in Ihren Chroniken zu entdecken, dass die Talamasca sich nun gegen die Bluttrinker gestellt hat. Mein Schöpfer hatte es bereits erwähnt, ich hatte ihm jedoch keinen Glauben geschenkt, bis ich es dann selbst las.
Ich kann es immer noch kaum glauben, dass diese sanftmütigen Leute allen unserer Art eine Warnung zukommen ließen und so eine tausend Jahre währende Neutralität gebrochen haben. Sie schienen doch auf ihre lange Tradition der wohlwollenden Duldung so stolz zu sein und psychisch darauf angewiesen zu sein, sich selbst als weltlich und gütig zu betrachten.
Ganz offensichtlich kann ich mich nun nicht mehr an die Mitglieder der Talamasca wenden. Sie könnten sonst meine eingeschworenen Feinde werden, wenn ich es täte. Sie sind meine eingeschworenen Feinde! Und wegen meiner früheren Kontakte zu ihnen wissen sie genau, wo ich lebe. Aber was noch wichtiger ist – ich kann sie nicht um Hilfe bitten, weil Sie es nicht wollen.
Sie und die anderen Mitglieder des »Ordens der Mitteilsamen« wünschen nicht, dass einer von uns den Gelehrten eines Ordens in die Hände fällt, der nur zu eifrig darauf bedacht ist, uns aus nächster Nähe zu studieren.
Zu meiner rothaarigen Mayfair-Liebe versichere ich Ihnen abermals, dass ich nicht im Traum daran denke, mich ihr noch einmal zu nähern, wenn ich mich auch manchmal frage, ob sie mir mit ihren außergewöhnlichen Kräften nicht helfen könnte, Goblin für immer ein Ende zu bereiten. Aber ich würde sie mit Sicherheit ängstigen und verwirren, und ich will ihr Leben, ihre Zukunft als Sterbliche, nicht auf dieselbe Weise beenden, wie es mit mir geschah. Ich fühle mich von ihr stärker abgeschnitten denn je. Und so bin ich allein, sieht man einmal von den mir nahe stehenden Sterblichen ab.
Ich erwarte deshalb kein Mitleid von Ihnen. Aber vielleicht hält Ihr Verständnis für meine Lage Sie davon ab, mich und Goblin auf der Stelle und ohne jede Warnung zu vernichten.
Dass Sie uns beide aufspüren können, daran zweifle ich nicht. Wenn nur die Hälfte des in den Chroniken Berichteten wahr ist, dann sind Ihre telepathischen Kräfte offensichtlich unermesslich. Trotzdem will ich Ihnen berichten, wo ich mich aufhalte.
Als mein wahres Heim betrachte ich nun eine kleine Einsiedelei auf einer Insel namens Sugar Devil Island, die tief im Sugar Devil Swamp liegt, einem Sumpf im Nordosten Louisianas, nicht weit von den Ufern des Mississippi. Der Sumpf wird durch einen westlichen Arm des Ruby River genährt. Große Gebiete des dicht mit Sumpfzypressen bewachsenen Moorlandes gehören seit Generationen meiner Familie, und nicht einmal durch Zufall findet ein Sterblicher den Weg zur Sugar Devil Island, dessen bin ich mir sicher. Dennoch hat mein Ur-Ur-Urgroßvater Manfred Blackwood dort einst diese Klause gebaut, in der ich im Moment sitze und Ihnen schreibe.
Blackwood Manor ist unser angestammter Landsitz, ein auf einer Anhöhe gelegenes herrschaftliches, pompöses, neoklassizistisches Bauwerk mit vielen riesigen korinthischen Säulen.
Manfred Blackwood setzte sich damit ein Denkmal seiner Gier und seiner Träume, doch fehlt dem Haus in seiner ganzen prahlerischen Schönheit die Anmut und Würde der Herrschaftshäuser in New Orleans. Es ist um 1880 erbaut worden, und da keine Baumwollplantagen dazugehörten, diente es allein dem Zweck, seine Bewohner zu entzücken.
Dieser ganze Besitz – der Sumpf, das Monstrum von Haus und das Land ringsum – ist als Blackwood Farm bekannt.
Es ist nicht nur eine Legende, dass es im Haus und auf dem Gelände spukt, es ist Realität. Goblin ist zweifellos die stärkste übersinnliche Erscheinung hier, aber es gehen auch Gespenster um. Ob sie das Blut der Finsternis von mir wollen? Die meisten scheinen viel zu schwach dazu, aber wer weiß, ob Geister und Gespenster nicht lernen können? Ich habe nun einmal die Veranlagung, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie zum Leben zu erwecken. So geht es schon mein ganzes Leben lang.
Strapaziere ich Ihre Geduld? Ich hoffe bei Gott, dass es nicht so ist. Aber dieser Brief ist möglicherweise meine einzige Chance bei Ihnen, Lestat. Deshalb habe ich Ihnen mitgeteilt, was mir am meisten am Herzen liegt.
Wenn ich Ihre Wohnung in der Rue Royale betreten werde, setze ich meinen ganzen Verstand, mein ganzes Geschick daran, den Brief so zu verbergen, dass nur Sie ihn finden können.
Im Vertrauen auf diese Ihre Fähigkeit zeichne ich
Tarquin Blackwood,
allseits bekannt als
Quinn
PS: Vergessen Sie bitte nicht, ich bin erst zweiundzwanzig und ein wenig unbeholfen. Aber einen kleinen Wunsch muss ich noch hinzufügen. Wenn Sie wirklich Vorhaben, mich aufzuspüren und zu vernichten, könnten Sie mir das dann eine Stunde vorher ankündigen, damit ich der einen sterblichen Verwandten, die ich mehr als alles in der Welt liebe, Lebewohl sagen kann?
In dem Buch Merrick wird beschrieben, dass Sie ein mit Knöpfen aus Kameen besetztes Jackett tragen. Stimmt das, oder hatte da jemand nur eine blühende Phantasie?
Wenn Ihr Jackett wirklich damit geschmückt war – ja, wenn Sie selbst diese Kameen liebevoll und mit Bedacht ausgesucht haben –, dann erlauben Sie mir, um dieser Schmucksteine willen, mich von einer unglaublich charmanten und wohlwollenden alten Dame zu verabschieden, deren Lieblingsbeschäftigung es ist, Abend für Abend ihre riesige Kameensammlung auf einem Marmortisch vor sich auszubreiten und sie eine nach der anderen im hellen Lichtschein zu betrachten. Die Dame ist meine Großtante, meine Lehrmeisterin, eine Frau, die mich nach Kräften mit allem zu versehen suchte, was man braucht, um seinem Leben Bedeutung zu geben. Ich bin nun ihrer Liebe nicht mehr würdig. Ich bin nicht mehr lebendig. Doch das weiß sie nicht. Ich gehe äußerst umsichtig vor, wenn ich ihr meine nächtlichen Besuche abstatte, die ihr so lebenswichtig sind. Und sollte ich ihr ohne Vorwarnung und ohne Erklärung genommen werden, wäre das eine Grausamkeit, die sie nicht verdient hat.
Ach, ich hätte noch vieles über die Kameen meiner Tante zu erzählen – und welche Rolle sie im Zusammenhang mit meinem Schicksal spielten.
Jetzt jedoch erlauben Sie mir nur die inständige Bitte: Lassen Sie mich leben, und helfen Sie mir, Goblin zu vernichten. Oder bereiten Sie uns beiden ein Ende.
In aufrichtiger Verehrung,
Quinn
Kapitel 2
Nachdem ich den Brief beendet hatte, saß ich eine ganze Weile reglos da.
Ich lauschte den Geräuschen des Sugar Devil Swamp, hatte meinen Blick auf die Seiten vor mir geheftet, wobei mir die langweilige Gleichmäßigkeit meiner Handschrift ins Auge fiel. Die gedämpften Lampen ringsum spiegelten sich in dem Marmorboden, und durch die offenen Fenster strömte die Nachtluft herein.
In meinem kleinen Sumpflandpalast war alles, wie es sein sollte.
Keine Zeichen von Goblin. Nichts zu spüren von seinem Durst oder seiner Feindseligkeit. Nichts als die Natur ringsum und die leisen Geräusche, die aus weiter Ferne von Blackwood Manor her an mein scharfes Vampirgehör drangen. Dort erhob sich gerade meine Tante Queen, liebevoll gestützt von unserer Haushälterin Jasmine, und richtete sich auf eine nur wenig aufregende Nacht ein. Bald würde der Fernseher laufen, wo sie sich dann einen der bezaubernden alten Schwarz-Weiß-Filme ansehen würde, Schloss Drachenfels oder Laura, Rebecca oder Sturmhöhe. Nach einer Stunde vielleicht würde Tante Queen dann Jasmine fragen: »Wo ist denn mein kleiner Junge?«
Aber jetzt musste ich erst einmal Mut beweisen. Zeit, die Sache durchzuziehen.
Ich holte die Kamee aus meiner Tasche und betrachtete sie. Vor einem Jahr, als ich noch sterblich war – noch lebendig –, hätte ich sie ins Licht gehalten, doch nun konnte ich sie auch so deutlich erkennen.
Kunstvoll und bemerkenswert detailliert gearbeitet sah ich meinen eigenen Kopf im Halbprofil, aus einer Scheibe zweischichtigem Sardonyx gearbeitet, sodass sich das Bildnis vollkommen weiß vor dem schwarzen, glänzenden Hintergrund abhob.
Die Kamee, eine ausgezeichnete, kunstvolle Arbeit, lag schwer in meiner Hand. Ich hatte sie für meine geliebte Tante Queen anfertigen lassen, hatte sie als kleines Geschenk vorgesehen, eine Art Scherz, doch dann war das Blut der Finsternis dem passenden Augenblick zuvorgekommen, der nun auf ewig dahin war.
Wie zeigte die Kamee mich? Ein langes, ovales Gesicht mit zu zarten Zügen – die Nase zu schmal, die Augen rund mit gewölbten Brauen, volle Lippen, deren Amorbogen mich wie ein zwölfjähriges Mädchen aussehen ließ. Keine Spur von großen Augen, hohen Wangenknochen, kraftvoller Kieferpartie. Einfach nur sehr hübsch, ja, zu hübsch, weswegen ich bei den Fotoaufnahmen für dieses Porträt eine finstere Miene aufgesetzt hatte; doch der Künstler hatte meinen finsteren Blick nicht übernommen. Er hatte sogar den Hauch eines Lächelns hinzugefügt. Und mein kurzes, krauses Haar hatte er in einen apollogleichen, dicken Lockenschopf verwandelt. Hemdkragen, Jackettaufschläge und Binder waren äußerst fein gearbeitet.
Natürlich sah man auf der Kamee nicht, dass ich über ein Meter neunzig groß bin, auch nicht, dass mein Haar pechschwarz ist und meine Augen blau sind. Und meine überschlanke Figur sieht man ebenso wenig.
Außerdem habe ich die langen, schlanken Finger, die sich hervorragend zum Klavierspielen eignen, dem ich mich manchmal widme. Und meine Körpergröße zeigt natürlich allen, dass ich trotz der zu zarten Gesichtszüge und der femininen Hände ein junger Mann bin.
Da war also dieses rätselhafte Geschöpf recht lebensecht abgebildet. Ein Geschöpf, das um Mitgefühl bat, ein Geschöpf, das unverblümt sagte:
»Nun, Lestat, denken Sie darüber nach. Ich bin jung, ich bin ein wenig naiv. Und ich bin hübsch. Sie sehen es auf dieser Kamee. Ich bin hübsch. Geben Sie mir eine Chance.«
Ich hätte die Worte in winziger Schrift auf der Rückseite eingravieren lassen, aber sie wurde von einem kleinen Deckel verdeckt, hinter dem, als Beweis für die akkurate Wiedergabe meines Porträts auf der Vorderseite, ein Foto von mir steckte.
Ein Wort war jedoch in den goldenen Rahmen eingeprägt, direkt unter dem geschnittenen Stein: Quinn, mein Name in einer guten Imitation der schablonenhaften Handschrift, die ich immer schon gehasst habe – die Schrift eines Linkshänders, der versucht, normal zu schreiben. Die Schrift eines Geistersehers, der deutlich machen will: »Ich habe mich in der Hand, ich bin nicht geisteskrank.«
Ich nahm die Briefbögen, überflog sie noch einmal, wobei ich mich abermals über meine langweilige Handschrift ärgerte, dann faltete ich die Blätter und schob sie zusammen mit der Kamee in einen schmalen, braunen Umschlag, den ich versiegelte und in die Innentasche meines schwarzen Blazers steckte. Ich schloss den obersten Knopf meines weißen Hemdes und prüfte den Sitz der schlichten roten Seidenkrawatte. Quinn, immer todschick, Quinn, der es wert war, in die Vampirchroniken aufgenommen zu werden, Quinn, herausgeputzt, um Einlass zu erbitten.
Ich lehnte mich noch einmal zurück und lauschte. Kein Goblin. Wo war er? Ich fühlte mich allein und sehnte mich schmerzhaft nach ihm. Die kalte Nachtluft kam mir leer vor. Goblin wartete darauf, dass ich jagte, wartete auf frisches Blut. Aber heute Nacht hatte ich nicht vor zu jagen, obwohl ich ein wenig hungrig war. Ich war auf dem Weg nach New Orleans. Ich war vielleicht auf dem Weg in den Tod.
Goblin konnte nicht ahnen, was ich vorhatte. Er ist immer ein Kind gewesen. Sicher, äußerlich hatte er zu jeder Zeit meines Lebens ausgesehen wie ich, aber er war ein kleiner Junge geblieben. Wenn er mit seiner rechten nach meiner linken Hand griff, um Buchstaben zu formen, kam stets das Gekritzel eines Kindes dabei heraus, bis zum heutigen Tag.
Ich beugte mich vor und dimmte mit der Fernbedienung, die auf dem Marmortisch lag, die kandelaberartigen Wandstrahler, bis sie erloschen. Dunkelheit schlich sich in die Einsiedelei. Alle Geräusche schienen sich zu steigern: der Ruf des Nachtreihers, das tückische Plätschern des übelriechenden, schwarzen Wassers, das Rascheln der kleinen Tiere, die durch die ineinander verwobenen Kronen der Zypressen und Gummibäume huschten. Ich konnte die Alligatoren riechen, die sich jedoch vor der Insel ebenso in Acht nahmen wie die Menschen. Selbst die Hitze konnte ich riechen.
Der Mond war hell und ließ mich nach und nach ein Stück vom Himmel erkennen, ein klares metallisches Blau.
Hier rings um die Insel war der Sumpf besonders dicht; die tausendjährigen Zypressen umklammerten mit ihren knotigen Wurzeln das Ufer, spanisches Moos hing schwer von ihren verkrüppelten Ästen herab. Es war, als wollten sie die Einsiedelei verstecken – vielleicht verbargen sie sie ja wirklich.
Nur ein Blitz wagte hin und wieder einen Angriff auf diese alten Wächter. Nur der Blitz fürchtet sich nicht vor den Geschichten, die besagen, dass etwas Böses auf Sugar Devil Island hause: Fährst du hin, kommst du möglicherweise nie wieder zurück.
Man hatte mir von dieser Legende erzählt, als ich fünfzehn war. Und man tat es abermals, als ich einundzwanzig war, doch mein eitler Stolz und die Faszination, die von ihr ausging, hatten mich zu der Einsiedelei gezogen, zu dem Geheimnis, von dem das feste, zweistöckige Gebäude und das rätselhafte Mausoleum daneben umgeben war, und nun gab es kein Später mehr, es gab nur noch die Unsterblichkeit, die in mir brodelnde Macht, die mich von der Wirklichkeit und von der Zeit ausschloss.
Um zwischen den Baumwurzeln hindurch aus dem Sumpf herauszufinden, würde man mit einer Piroge eine gute Stunde brauchen, um die Anlegestelle am Fuße der Anhöhe zu erreichen, auf der Blackwood Manor so arrogant alleine stand.
Ich liebte die Einsiedelei eigentlich nicht wirklich, aber ich brauchte sie. Ich liebte das grimmig wirkende Mausoleum aus Gold und Granit mit den seltsamen lateinischen Gravuren nicht, obwohl ich mich darin am Tage vor der Sonne verbergen musste.
Aber Blackwood Manor liebte ich, liebte es mit einer irrationalen, besitzergreifenden Liebe, die uns nur wahrhaft große Häuser abringen können – Häuser, die sagen: »Ich war schon hier, ehe du geboren wurdest, und werde hier auch nach dir noch stehen«, Häuser, die sowohl Verantwortung bedeuten als auch ein Hafen für die eigenen Träume sind.
Blackwood Manors Geschichte hält mich nicht weniger gefangen als seine anmaßende Schönheit. Ich habe immer auf Blackwood Farm und in dem Herrenhaus gelebt, wenn man von meinen schönen Abenteuern im Ausland absieht.
Dass so viele Onkel und Tanten es fertig brachten, von Blackwood Manor fortzugehen, konnte ich nicht fassen, aber sie waren mir nicht wichtig, diese Fremden, die in den Norden gezogen waren und nur hin und wieder zu Beerdigungen wieder zurückkamen. Mich hatte das Haus in seinen Bann geschlagen.
Nun überlegte ich: Gehe ich noch einmal zurück, schreite noch einmal durch die Räume? Suche das große, rückwärtige Schlafzimmer auf, wo Tante Queen es sich jetzt gerade in ihrem Lieblingssessel bequem macht? Ich trug nämlich noch eine weitere Kamee bei mir, eine, die ich vor ein paar Nächten speziell für sie in New York gekauft hatte, und die sollte ich ihr doch noch geben. Es war ein wunderbares Exemplar, eine der schönsten.
Aber nein. Das würde fast schon einem Abschied gleichkommen, und das brachte ich nicht über mich. Ich durfte keine Andeutungen machen, dass mir etwas zustoßen könnte. Ich durfte sie nicht mit Geheimnissen konfrontieren, in denen ich nun lebte: Quinn, der nächtliche Besucher, Quinn, der plötzlich schummrig beleuchtete Räume mag und vor Lampen zurückscheut, als hätte er ein exotisches Leiden. Diese Art von ungewissem Abschied würde meinem geliebten, sanften Tantchen nicht gut tun.
Wenn ich heute Nacht scheiterte, würde auch ich in den Mythos aufgenommen werden: »Dieser unverbesserliche Quinn! Er wagte sich doch tatsächlich so weit in den Sugar Devil Swamp, obwohl ihm alle davon abrieten. Er ging immer wieder in diese verflixte Einsiedelei auf der Insel, und eines Nachts kam er einfach nicht wieder zurück.«
In der Tat glaubte ich einfach nicht, dass Lestat mich ins Jenseits schicken würde, zumindest nicht, ohne sich meine Geschichte, ganz oder teilweise, angehört zu haben. Vielleicht war ich einfach zu jung, um das glauben zu können. Vielleicht weil ich die Vampirchroniken so begeistert gelesen hatte, meinte ich, dass sich Lestat mir ebenso nahe fühlte wie ich mich ihm.
Es war Wahnsinn, höchstwahrscheinlich. Aber ich musste und wollte Lestat so nahe wie nur möglich kommen. Wie und von wo aus er New Orleans überwachte, wusste ich nicht. Wann und wie oft er seine Wohnung im French Quarter aufsuchte, wusste ich auch nicht. Aber der Brief und meine Gabe – die Kamee aus Onyx – musste heute Nacht dort deponiert werden.
Endlich erhob ich mich von dem mit Gold verzierten Stuhl aus Leder. Ich verließ die prächtige, mit Marmor ausgelegte Klause, und durch pure Gedankenkraft erhob ich mich mit dem Gefühl köstlicher Leichtigkeit langsam vom warmen Erdboden in die kühle Luft, bis ich von hoch oben den weiten, mäandernden schwarzen Sumpf überblicken konnte und die Lichter des großen Hauses leuchten sah, als stünde eine Laterne auf dem weichen Rasen.
Mit Hilfe der eigenartigsten meiner neuen Fähigkeiten, der Gabe der Lüfte, steuerte ich, nur von Willenskraft getrieben, auf New Orleans zu, überquerte den Lake Pontchartrain und näherte mich immer mehr dem berüchtigten Haus in der Rue Royale, das allen Bluttrinkern als der Sitz des unbezwingbaren Lestat bekannt war.
»Ein Teufelskerl«, hatte mein Schöpfer von ihm berichtet, »der seinen Besitz auf den eigenen Namen eingetragen hat, obwohl die Talamasca hinter ihm her ist. Er ist entschlossen, sie zu überdauern. Er ist barmherziger als ich.«
Barmherzigkeit, darauf zählte ich jetzt. Lestat, wo du auch bist, sei barmherzig. Ich komme nicht ohne Achtung vor dir. Ich brauche dich, das wird mein Brief beweisen.
Langsam, ein flüchtiger Schatten nur für vielleicht lauernde neugierige Blicke, sank ich auf den Boden, hinab in die wie Balsam scheinende Luft im Hinterhof des Hauses. Dann stand ich neben dem murmelnden Brunnen und schaute die geschwungenen gusseisernen Stufen hoch, die zur Hintertür führten.
Nun gut. Hier war ich also. Dann hatte ich eben die Regeln gebrochen! Ich stand im Garten des ungeratenen Prinzen persönlich. Mir gingen die Beschreibungen aus den Chroniken durch den Kopf, die so ineinander verwoben waren wie die üppige Bougainvillea, die sich an den eisernen Säulen empor bis zum Geländer im oberen Stockwerk wand. Ich kam mir vor wie in einem Schrein.
Um mich brandeten die Geräusche des French Quarter: Geschirrklappern aus den Restaurantküchen, die fröhlichen Stimmen der Touristen auf den Gehwegen. Selbst die leisen Töne der Jazzmusik, die aus den Türen in der Bourbon Street drang, hörte ich und das Motorgeräusch der Autos, die langsam an der Front des Hauses vorüberkrochen.
Der kleine Garten war allerdings ein wunderschönes, abgeschlossenes Refugium; die bloße Höhe der Ziegelmauern hatte ich nicht erwartet. Die glänzenden, grünen Bananenstauden waren die größten, die ich je gesehen hatte, ihre wachsartigen Triebe hoben hier und da die purpurfarbenen Steinplatten an. Aber dieses Haus war nicht sich selbst überlassen.
Jemand hatte die verwelkten Blätter aus den Bananenbüschen geschnitten und die verschrumpelten Bananen entfernt, die in New Orleans immer schon vertrocknen, ehe sie reif sind. Auch waren die überbordenden Rosenbüsche um den Patio zurückgeschnitten worden. Selbst das Wasser, das sich aus dem Füllhorn des steinernen Cherub schäumend in das Brunnenbecken ergoss, war frisch und klar.
All diese hübschen, nichtigen Einzelheiten verstärkten in mir das Gefühl, ein Eindringling zu sein, aber in meinem töricht übererregten Zustand fühlte ich einfach keine Angst.
Mit einem Mal sah ich Licht durch die hinteren Fenster scheinen, sehr schwach, als leuchte hinten im Innern eine Lampe.
Das schreckte mich natürlich, aber dieser Wahnsinn, der mich gefangen hielt, steigerte sich nur. Würde ich mit Lestat selbst sprechen können? Und was, wenn er mich bei meinem Anblick, ohne zu zögern, mit der Gabe des Feuers vernichtete? Der Brief, die schwarze Kamee, mein bitteres Flehen – alles vergebens!
Hätte ich doch wenigstens Tante Queen die neue Kamee gegeben! Ich hätte sie an mich drücken und küssen sollen! Hätte ein paar Worte zum Abschied sagen sollen! Ich würde gleich sterben.
Nur ein vollkommener Idiot konnte derart aufgekratzt sein wie ich in diesem Augenblick. Lestat, ich liebe dich! Hier kommt Quinn, bereit, dein Schüler und dein Sklave zu sein!
Vorsichtig, um nur kein Geräusch zu machen, eilte ich die geschwungene Eisentreppe hinauf. An dem rückwärtigen Balkon angekommen, stieg mir ein Geruch in die Nase – dort drinnen war ein Mensch! Ein Sterblicher. Was hatte das zu bedeuten? Ich blieb stehen und erkundete mit der Gabe des Geistes die Räume. Was ich erfuhr, war verwirrend. Da drin war ein Mensch, das stand außer Zweifel, jemand, der sich verstohlen und hastig bewegte, weil er sich deutlich bewusst war, dass er sich unbefugt hier aufhielt. Und dieser Mensch wusste von meiner Anwesenheit.
Eine Sekunde lang wusste ich nicht, was ich tun sollte. Selbst ohne Erlaubnis an diesem Ort, hatte ich einen anderen Eindringling auf frischer Tat ertappt. Ein seltsam beschützendes Gefühl wallte in mir auf. Dieser Mensch war in Lestats Haus eingedrungen. Wie konnte er es wagen? Was stolperte er hier herum? Und wieso konnte er wissen, dass ich hier war und dass ich ihn telepathisch ausgeforscht hatte?
Die telepathischen Fähigkeiten dieses merkwürdigen Fremden waren in der Tat beinahe so stark wie meine eigenen. Ich forschte nach seinem Namen, und sein Geist gab ihn preis: Sterling Oliver! Mein alter Freund aus der Talamasca. Und im gleichen Moment erkannte er auch mich.
Quinn, sagte er telepathisch, fast so, als ob er mich direkt anspräche. Aber was wusste er über mich? Ich hatte ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Spürte er schon die Veränderung, die mir widerfahren war? Konnte er das durch einen so kurzen telepathischen Kontakt feststellen? Lieber Gott, ich musste diesen Gedanken aus meinem Kopf verbannen. Noch konnte ich schnell von hier verschwinden, konnte zurück in meine Einsiedelei gehen und Sterling seinen verstohlenen Nachforschungen überlassen. Noch konnte ich fliehen, ehe er erkannte, was aus mir geworden war.
Ja, weg hier – sofort sollte er doch denken, ich hätte mich zu einem ganz gewöhnlichen Menschen entwickelt, der die Chroniken verschlang und von Neugier geplagt worden war. Ich würde wiederkommen, wenn er hier verschwunden war.
Aber ich brachte es nicht über mich. Ich war zu einsam. Und ich war zu sehr auf eine Konfrontation aus. Das stimmte wirklich. Immerhin war Sterling hier, und ich hatte damit vielleicht den Schlüssel zu Lestats Herz.
Aus einem Impuls heraus tat ich, was streng verboten war. Ich öffnete die nicht abgeschlossene Hintertür und betrat die Wohnung. Nur eine kurze atemlose Sekunde zögerte ich in dem eleganten Salon, der im Dunkeln lag, und warf einen Blick auf die impressionistischen Gemälde mit ihren explodierenden Farben, und dann ging ich den Korridor entlang, vorbei an den offensichtlich leeren Schlafräumen, und fand Sterling in dem zur Straße gelegenen Wohnzimmer, einem sehr förmlich eingerichteten Raum voller vergoldeter Möbel und Spitzenstores vor den Fenstern an der Frontseite.
Sterling stand mit einem aufgeschlagenen Buch in der Hand bei dem hohen Bücherregal zur Linken. Er sah mich nur an, als ich ins Licht des Kronleuchters trat.
Ich fragte mich, wie er mich sah, gab mir aber im Moment keine Mühe, es herauszufinden. Ich hatte genug damit zu tun, ihn zu betrachten, wobei ich merkte, wie gern ich ihn immer noch um der früheren Zeiten willen hatte, als ich ein achtzehnjähriger Junge war, der Geister sehen konnte. Und er sah noch immer aus wie damals – weiches graues, aus der Stirn zurückgekämmtes Haar, das an den Schläfen schon dünner wurde, und große graue, verständnisvolle Augen. Er wirkte kaum wie Anfang sechzig, ganz als hätte das Altern ihm nichts anhaben können; an seinem immer noch schlanken, kräftigen Körper trug er einen weißblau gestreiften Seersucker-Anzug.
Ich brauchte ein paar Sekunden, ehe ich merkte, dass er Angst hatte. Er sah zu mir auf – aufgrund meiner Größe müssen fast alle Leute zu mir aufsehen –, und wenn er auch versuchte, seine Würde aufrechtzuerhalten, die er unbestreitbar in großem Maße hatte, sah er doch, dass ich mich verändert hatte, nur war er sich nicht sicher, wie genau. Er wusste nur, dass er sich instinktiv und ganz bewusst fürchtete.
Nun bin ich ein Bluttrinker, der durchaus als Mensch durchgehen kann, jedoch nicht unbedingt bei solch einem hellen Kopf wie Sterling. Und dann war da ja noch die Sache mit der Telepathie, obgleich ich mein Bestes getan hatte, meinen Geist durch Willenskraft vor ihm zu verschließen, wie es mich mein Schöpfer gelehrt hatte.
»Quinn«, sagte Sterling, »was stimmt nicht mit dir?« Der weiche britische Akzent versetzte mich in Sekundenbruchteilen um viereinhalb Jahre zurück.
»So ziemlich alles, Sterling«, antwortete ich, ehe ich mich zügeln konnte. »Aber wieso bist du hier?« Dann kam ich ungeschickterweise sofort auf den Punkt: »Hast du Lestats Erlaubnis?«
»Nein«, sagte er sofort. »Ich muss gestehen, nein. Und du, Quinn?«, fragte er betroffen, während er einen Schritt auf mich zutrat. Ich wich zurück in den dämmerigen Korridor.
Seine Freundlichkeit ließ mich beinahe den Rückzug antreten. Aber inzwischen war etwas Unvermeidliches ins Spiel gekommen. Von Sterling ging ein süßer, deliziöser Geruch nach Mensch aus, und plötzlich sah ich ihn völlig losgelöst von allem Früheren. Ich sah ihn nur noch als Beute.
Ich spürte auch den immensen Abgrund, der uns nun trennte, und mich dürstete nach ihm, so als könnte zusammen mit seinem Blut seine Güte in mich hineinfließen.
Nur war Sterling kein Übeltäter. Er war keine Jagdbeute. Als ich ihn betrachtete, verlor ich, der junge Novize, meinen Vampirverstand. Die brennende Einsamkeit trieb mich. Mein Hunger verhexte mich. Ich wollte mich an ihm gütlich tun, aber gleichzeitig wollte ich ihm auch all meinen Kummer, meine Sorgen offenbaren.
»Komm mir nicht nahe, Sterling«, sagte ich, um einen selbstbeherrschten Ton bemüht. »Du dürftest gar nicht hier sein. Das steht dir nicht zu. Wenn du so überaus klug bist, warum kommst du dann nicht bei Tage, wenn dich Lestat kaum davon abhalten kann?«
Der Blutgeruch machte mich ganz verrückt; das und mein wildes Verlangen, den Abgrund zwischen uns zu schließen, sei es durch Mord oder durch Liebe.
»Ich weiß selbst nicht genau, Quinn«, sagte er, sein britischer Akzent unpersönlich und eloquent, obwohl sein Tonfall etwas anderes sagte. »Aber du bist der Letzte, den ich hier zu finden erwartet hätte. Quinn, bitte, lass dich anschauen.«
Wieder weigerte ich mich. Ich bebte innerlich. »Sterling, versuch nicht, mich mit deiner bekannten Art einzuwickeln«, beeilte ich mich zu sagen. »Du könntest jemanden hier finden, der dir um einiges gefährlicher werden kann als ich. Oder glaubst du Lestat seine Geschichten nicht? Erzähl mir nicht, dass du meinst, Vampire gebe es nur in Büchern.«
»Du bist einer von ihnen«, sagte er leise. Seine Züge verdüsterten sich, aber nur kurz. »War das Lestats Werk? Hat er dich umgewandelt?«
Ich war verblüfft über seine Frechheit, so höflich sie auch formuliert war. Aber schließlich war er um so viel älter als ich und so sehr daran gewöhnt, eine Autorität zu sein, und ich war peinlich jung. Wieder und wieder brandete die alte Liebe zu ihm auf, das alte Gefühl, ihn zu brauchen, und wieder verschmolz es perfekt mit meinem Durst. »Es war nicht Lestat«, sagte ich. »Genau genommen hatte er gar nichts damit zu tun. Ich suche hier nach ihm, Sterling, und nun ist mir diese kleine Tragödie passiert, dass ich ausgerechnet hier auf dich gestoßen bin.«
»Tragödie?«
»Was sonst, Sterling? Du weißt, wer ich bin. Du weißt, wo ich lebe. Du weißt alles über meine Familie in Blackwood Manor. Wie kann ich jetzt einfach wieder hier Weggehen, nachdem ich dich gesehen habe und du mich?«
Der Durst schnürte mir die Kehle zu. Mein Blick wurde trübe. Ich hörte mich sagen: »Versuch gar nicht erst, mir zu erklären, dass die Talamasca nicht hinter mir her ist, wenn ich dich gehen lasse. Sag nur nicht, dass du und deine Kohorten nicht herumstöbern und mich suchen würden. Ich weiß, wie es kommen würde. Das ist wirklich schrecklich, Sterling.«
Seine Angst wuchs, doch er versuchte, sich nicht hineinzusteigern. Ich konnte meinen Hunger kaum noch im Zaum halten. Wenn ich ihm nachgab, wenn ich nur den Hunger machen ließ, wäre die Tat unvermeidbar, und sonst brauchte mein Gewissen nichts als diese scheinbare Unvermeidbarkeit; aber ich durfte es nicht tun, nicht bei Sterling Oliver. Ich war hoffnungslos verwirrt.
Ehe mir bewusst wurde, was ich tat, schob ich mich dichter an ihn heran. Ich konnte das Blut in ihm nun nicht nur riechen, sondern sogar sehen. Und er machte fatalerweise eine falsche Bewegung. Er ging nämlich rückwärts, als könnte er nicht anders, und diese Geste schien ihn erst recht zum Opfer zu machen. Ich schob mich näher an ihn heran.
»Sterling«, sagte ich, »du hättest nicht hierher kommen sollen. Du bist ein Eindringling.«
Aber ich hörte, wie der Hunger meine Stimme ganz ausdruckslos machte, wie leer die Worte klangen. Eindringling, Eindringling, Eindringling.
»Du kannst mir nichts antun, Quinn«, sagte Sterling, seine Summe klang sehr ruhig und vernünftig. »Das würdest du nicht tun. Wir haben zu viel miteinander erlebt. Ich habe immer verstanden, was in dir vorgeht. Ich habe Goblin immer verstanden. Willst du all das jetzt verraten?«
»Das ist eine alte Schuld«, flüsterte ich. Ich wusste, ich stand im hellen Lichtkreis des Kronleuchters, sodass Sterling die sublime Verfeinerung sehen konnte, die die Umwandlung an mir vollbracht hatte. So kunstvoll war diese Umwandlung. Ach, so kunstvoll. Und in meiner krankhaften Verwirrung kam es mir vor, als hätte sich seine Furcht zu stummer Panik gesteigert, wodurch sich der Geruch seines Blutes noch verstärkte.
Können Hunde Furcht riechen? Vampire können das. Vampire zählen sogar darauf. Vampire finden den Geruch der Furcht appetitanregend. Vampire können ihm nicht widerstehen.
»Es ist nicht richtig«, sagte er. Doch auch er flüsterte jetzt, als ob allein schon mein durchdringender Blick ihn geschwächt hätte – und mit Sicherheit hat er diese Wirkung auf Sterbliche und Sterling wusste, es war sinnlos zu kämpfen. »Tu’s nicht, mein Junge«, sagte er, doch die Worte waren kaum zu hören.
Ich merkte, dass ich nach seiner Schulter griff, und als meine Finger ihn berührten, schoss ein elektrischer Schlag durch meine Glieder. Zerdrück ihn, zerquetsch seine Knochen, doch vor allem und zuerst saug mit seinem Blut auch seine Seele in dich hinein.
»Merkst du nicht…«, er brach ab, und ich holte mir den Rest seiner Worte aus seinem Geist – dass die Talamasca noch wütender werden würde, was für alle Beteiligten schlecht wäre. Die Vampire, die Bluttrinker, die Kinder der Jahrtausende, sie alle hatten New Orleans verlassen. Die Vampire waren im Dunkel verstreut. Es herrschte Waffenstillstand. Und nun war ich dabei, ihn zu brechen.
»Aber weißt du, sie kennen mich nicht«, sagte ich, »nicht in dieser Form jedenfalls. Nur du kennst mich so, alter Freund, und das ist das Entsetzliche. Du kennst mich, und aus diesem Grunde muss es eben sein.«
Ich beugte mich dicht zu ihm herab und küsste ihn auf den Hals. Mein Freund, einst mein engster Freund überhaupt. Und nun werden wir uns auf diese Art vereinen. Alte und neue Fust. Der Junge, der ich einst war, liebte ihn. Ich spürte, wie das Blut in der Schlagader pochte. Ich legte einen Arm um ihn. Tu ihm nicht weh. Er konnte sich nicht befreien. Er versuchte es nicht einmal.
»Es wird nicht wehtun, Sterling«, flüsterte ich. Ich versenkte meine Zähne sauber in seinem Hals, bis sich mein Mund langsam mit Blut füllte, und mit dem Blut ergossen sich sein Leben und seine Träume in mich.
Unschuldig. Das Wort brannte sich durch den Genuss. In einem gleißenden Strom von Gestalten und Stimmen tauchte er auf, drängte sich durch die Menge, Sterling, der Mann, flehte mich in diesem inneren Bild an und sagte: Unschuldig. Ich konnte nicht mit dem aufhören, womit ich begonnen hatte.
Jemand anderes tat dies für mich.
Ich spürte einen eisernen Griff an meiner Schulter und wurde mit einem Ruck von Sterling fortgerissen. Sterling taumelte, fiel beinahe hin, stolperte dann und sank seitwärts in einen Sessel am Schreibtisch.
Ich knallte gegen den Bücherschrank. Ich leckte mir das Blut von den Lippen und kämpfte gegen das Schwindelgefühl an. Der Kronleuchter schien wild hin und her zu schwanken, und die Farben der Gemälde schienen zu glühen.
Eine Hand legte sich fest gegen meine Brust, um mich zu stützen und aufrecht zu halten.
Und dann wurde mir bewusst, dass ich Lestat ansah.
Kapitel 3
Schnell gewann ich mein Gleichgewicht wieder. Lestat hatte seine Augen auf mich geheftet, und ich hatte nicht die geringste Absicht, den Blick abzuwenden, aber trotzdem konnte ich nicht anders, als ihn einmal von oben bis unten zu mustern; denn er war wirklich so atemberaubend, wie er sich selbst immer beschrieben hatte. Deshalb musste ich ihn einfach ganz genau sehen, und wenn er das Letzte war, was ich je sehen würde.
Der helle Goldton seiner Haut stand in wunderbarem Kontrast zu seinen violettblauen Augen, und sein Haar – wirklich eine goldblonde Mähne – fiel ihm in zerzausten Locken über die Schultern. Die Brille, deren getönte Gläser fast die gleiche Farbe wie seine Augen hatten, hatte er über die Stirn hinaufgeschoben; er sah mich durchdringend an, die goldenen Brauen leicht gehoben, vielleicht, weil er darauf wartete, dass ich meine Sinne wieder beisammen hätte; ich wusste es ehrlich nicht. Ich sah mit einem Blick, dass er den schwarzen Samtrock mit den Kameenknöpfen trug, der in dem Buch Merrick beschrieben worden war. Die kleinen Kameen waren so gut wie sicher aus Sardonyx; der Gehrock selbst war außergewöhnlich geschnitten, eng tailliert, doch mit ausgestellten Schößen. Sein Leinenhemd stand am Hals offen. Dazu trug er eine graue Hose und schwarze Schuhe, beides sehr dezent.
Was sich mir jedoch tief einprägte, war sein Gesicht – kraftvolle, straffe Züge, große Augen und ein wohlgeformter, sinnlicher Mund; die Linie des Kiefers zeugte von einer gewissen Härte; insgesamt waren seine Züge so wohl proportioniert und reizvoll, dass Lestat mit seiner Beschreibung eigentlich eher untertrieben hatte. Tatsächlich wurde sie ihm nicht einmal gerecht, denn sein Gesicht, obwohl gewiss mit diversen, sichtlich erfreulichen Gaben gesegnet, glühte von einem mächtigen inneren Feuer.
In seinem intensiven Blick lag kein Hass. Die stützende Hand hatte er fortgezogen.
Ich verfluchte aus tiefstem Herzen, dass ich größer war als er, er musste nämlich zu mir aufsehen. Vielleicht würde er mich schon allein deswegen mit Freuden zur Hölle schicken.
»Der Brief«, stammelte ich und flüsterte noch einmal: »Der Brief!«, doch obwohl meine Hand ziellos herumfummelte und meine Gedanken fahrig herum tasteten, fand meine Hand einfach nicht in meine Tasche. Ich wurde von Angst geschüttelt. Während ich noch zitternd und schwitzend dastand, griff Lestat in mein Jackett und zog den Umschlag hervor. Seine Fingernägel blitzten auf.
»Der ist für mich, nicht wahr, Tarquin Blackwood?«, fragte er. In seiner Stimme klang nur ein Hauch des französischen Akzents an. Plötzlich lächelte er und sah aus, als könnte er um nichts in der Welt jemandem etwas antun. Er war zu attraktiv, zu freundlich, zu jung. Aber das Lächeln verschwand so schnell, wie es gekommen war.
»Ja«, stammelte ich. »Der Brief – bitte lesen Sie ihn.« Ich stockte und fuhr dann fort: »Ehe Sie … eine Entscheidung treffen.«
Er schob den Brief in die Innentasche seines Gehrocks und drehte sich zu Sterling herum, der benommen und stumm mit getrübten Augen in dem Sessel hockte, dessen Lehne er mit den Händen umklammerte. Er war seitwärts in den Sessel gefallen, sodass der Rücken wie ein Schild vor ihm aufragte – ein recht nutzloser Schild, wie ich wohl wusste.
Lestat heftete den Blick wieder auf mich und sagte: »Wir trinken nicht von Mitgliedern der Talamasca, kleiner Bruder. Aber Sie« – er sah Sterling an –, »fast hätten Sie bekommen, was Sie verdient haben.«
Sterling starrte geradeaus und schüttelte nur den Kopf, unfähig zu antworten.
»Warum sind Sie hergekommen, Mr. Oliver?«, fragte Lestat.
Wieder schüttelte Sterling nur den Kopf. Ich sah die Blutströpfchen auf seinem gestärkten, weißen Kragen, und überwältigende Scham wallte in mir auf, so tief und schmerzhaft, dass für andere Gefühle kein Raum mehr blieb und dass sie selbst den leisesten Nachgeschmack des angestrebten Festschmauses ausschloss.
Innerlich wurde ich fast wahnsinnig.
Wegen meines unbeherrschten Durstes wäre Sterling fast gestorben. Zwar lebte er, aber Gefahr drohte ihm immer noch, Gefahr von Lestat. Lestat, der wie eine lohende Flamme vor mir stand. Er konnte als Mensch durchgehen, das ja, aber als was für ein Mensch – fesselnd und energiegeladen behielt er die Lage fest im Griff.
»Mr. Oliver, ich rede mit Ihnen«, sagte er jetzt in leisem Befehlston. Er zog Sterling an den Jackettaufschlägen in die Höhe und manövrierte ihn in die andere Ecke des Salons, wo er ihn in einen tiefen, satinüberzogenen Ohrensessel stieß.
Sterling sah schrecklich aus – und wem wäre es anders gegangen? Anscheinend war er immer noch nicht in der Lage, geradeaus zu blicken.
Lestat setzte sich auf das samtene Sofa dicht neben ihm. Für den Moment hatte er mich vollkommen vergessen, so nahm ich jedenfalls an.
»Mr. Oliver«, wiederholte Lestat, »ich frage Sie: Was veranlasste Sie, in mein Haus zu kommen?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Sterling. Er schaute zu mir hoch und dann wieder auf den Mann vor ihm, und ich konnte nicht anders, ich strengte mich an, diesen Vampir so zu sehen, wie er ihn sah – die Haut, die trotz ihrer Bräune wie von innen leuchtete, die Augen, die alle Farben des Prismas spiegelten und unleugbar wild glühten.
Die berühmte Schönheit Lestats war wie eine starke Droge. Und das krönende Licht des Deckenlüsters konnte man als erbarmungslos oder herrlich empfindende nach Standpunkt.
»Doch, Sie wissen ganz gut, warum Sie hergekommen sind.« Lestat sprach mit gedämpfter Stimme, der französischen Akzent kaum mehr als ein verführerischer Hauch. »Es genügte der Talamasca nicht, mich aus der Stadt zu vertreiben. Müssen Sie auch noch in mein Haus eindringen?«
»Es war falsch«, seufzte Sterling. Er legte die Stirn in Falten und presste die Lippen hart aufeinander. »Das hätte ich nicht tun dürfen.« Zum ersten Mal sah er Lestat gerade in die Augen. Lestat schaute zu mir hoch. Er beugte sich vor, schob seine Finger hinter Sterlings blutbefleckten Kragen, womit er Sterling einen schönen Schrecken einjagte, dabei funkelte er mich an und sagte mit einem flüchtigen, boshaften Lächeln: »Wir kleckern nicht beim Trinken, kleiner Bruder. Du musst noch eine Menge lernen.«
Das traf mich wie ein Tiefschlag und machte mich sprachlos. Hieß das etwa, dass ich lebend hier rauskommen würde?
Bring Sterling nicht um, dachte ich nur; dann lachte Lestat, der mich immer noch unverwandt ansah, plötzlich kurz auf.
»Tarquin, dreh den Stuhl da um und setz dich hin«, sagte er, indem er zu dem Schreibtisch hinüberzeigte. »Du machst mich ganz nervös, wenn du stehen bleibst. Du bist so verflixt groß. Und Sterling machst du auch nervös.«
Erleichterung schlug wie eine Welle über mir zusammen, aber ich versuchte, seinen Worten zu gehorchen, obwohl meine Hände derart zitterten, dass ich mich schon wieder schämte. Endlich hatte ich es geschafft und saß den beiden gegenüber, wenn auch in höflicher Entfernung.
Sterling zog die Stirn ein wenig kraus, als er mich ansah, aber mehr aus Mitgefühl; auch war er offensichtlich immer noch nicht ganz wieder in der Welt. Diese Benommenheit konnte nichts mit dem Blutverlust zu tun haben, dafür hatte ich nicht genug von ihm getrunken. Sie kam eher daher, dass ich es überhaupt getan hatte, dass ich von seinem Blut getrunken hatte. Das und der Umstand, dass Lestat aufgetaucht war. Lestat hatte mich gestört, Lestat war hier und verlangte nun abermals zu wissen, warum Sterling die Wohnung betreten hatte.
»Sie hätten genauso gut bei Tage kommen können«, sprach er ihn nun mit gleichmütiger Stimme an. »Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang habe ich menschliche Wachen hier postiert, aber Wachen bestechen kann die Talamasca ja gut. Warum wollten Sie diesen kleinen Wink nicht verstehen, dass ich mich nach Sonnenuntergang um meine Besitztümer selbst kümmere? Sie haben der Anweisung Ihres eigenen Generalobersten nicht gehorcht. Sie haben dem eigenen gesunden Menschenverstand nicht gehorcht.«
Sterling nickte, doch seine Augen schweiften ab, als fehlten ihm die Argumente, schließlich sagte er mit schwacher, aber würdevoller Stimme: »Die Tür war nicht verschlossen.«
»Beleidigen Sie mich nicht.« Lestats Ton war immer noch duldsam und gleichmütig. »Das ist mein Haus. Ich muss meine Türen nicht abschließen.«
Wieder schien Sterling Lestats Blick zu treffen. Er sah ihn fest an, dann sagte er mit etwas klarerer Stimme: »Ich hätte das nicht tun dürfen, und Sie haben mich dabei erwischt. Ja, ich habe den Anweisungen des Generalobersten nicht gehorcht, das stimmt. Ich kam, weil ich einfach nicht widerstehen konnte. Ich kam vielleicht, weil ich nicht ganz glauben konnte, dass es Sie gibt. Trotz allem, was ich über Sie gelesen und gehört hatte, konnte ich es nicht glauben.«
Lestat schüttelte missbilligend den Kopf und lachte abermals kurz auf.
»Also, bei sterblichen Lesern erwarte ich diese Ungläubigkeit, ja, sogar bei Novizen wie meinem Brüderchen hier. Aber doch nicht von der Talamasca, die uns so feierlich den Krieg erklärt hat.«
»Wofür es auch gut sein mag«, sagte Sterling, der langsam seine Kraft zurückgewann, »ich war gegen diesen Krieg. Ich stimmte dagegen, sobald ich von dieser Erklärung hörte. Ich war dafür, sogar das Mutterhaus in Louisiana zu schließen, wenn es sein musste. Aber schließlich … ich war auch dafür, unsere Verluste zu akzeptieren und uns in unsere Bibliotheken im Ausland zurückzuziehen.«
»Ihr habt mich aus meiner eigenen Stadt vertrieben«, warf Lestat ihm vor. »Ihr habt meine Nachbarn hier im Stadtteil ausgefragt. Ihr durchwühlt sämtliche Grundbesitzurkunden und Akten, die auf meinen Namen lauten. Und nun dringen Sie unbefugt hier ein und behaupten, Sie machen das, weil Sie nicht an meine Existenz glauben? Das mag eine Ausrede sein, aber kein Grund.«
»Der Grund ist, dass ich Sie sehen wollte«, antwortete Sterling, inzwischen mit kräftigerer Stimme. »Ich wollte, was andere Ordensmitglieder für sich in Anspruch nehmen konnten. Ich wollte Sie mit eigenen Augen sehen.«
»Und nun, da Sie mich gesehen haben, was werden Sie jetzt tun?«, fragte Lestat, schaute dabei wieder zu mir, ein Aufblitzen der Augen und ein Lächeln, das sofort wieder verschwunden war, als er den Mann in dem Sessel vor ihm ansah.
»Was wir immer tun – darüber schreiben, einen Bericht an die Ältesten verfassen, es in die Akte über den Vampir Lestat einfügen – vorausgesetzt, Sie entscheiden sich dafür, mich gehen zu lassen.«
»Ich habe bisher keinem von der Talamasca etwas angetan, oder?«, fragte Lestat. »Überlegen Sie doch. Wann habe ich einem echten, aktiven Mitglied der Talamasca geschadet? Geben Sie mir nicht die Schuld für die Taten anderer. Und seit Ihrer Erklärung, die einem Krieg gleichkommt, seit Sie versuchen, mich aus meiner Heimat, meinem Heim zu vertreiben, habe ich mich bemerkenswert zurückgehalten.«
»Nein, das stimmt nicht«, sagte Sterling ruhig.
Ich war empört.
»Wie bitte?«, fragte Lestat. »Was in aller Welt meinen Sie? Ich denke, ich habe mich in dieser Angelegenheit wie ein Gentleman verhalten.« Zum ersten Mal lächelte er Sterling an.
»Wie ein Gentleman, ja, aber dass Sie sich zurückhielten, sehe ich nicht.«
»Wissen Sie eigentlich, wie nahe es mir geht, aus New Orleans verbannt zu sein? Wie weh es mir tut, zu wissen, dass ich aus Furcht vor Ihren Spionen, die im Café du Monde hocken, nicht mehr das French Quarter durchstreifen oder die Rue Royale entlangschlendern kann, weil vielleicht einer Ihrer Möchtegern-Zuträger ebenfalls hier herumläuft? Wissen Sie, wie sehr es mich schmerzt, die einzige Stadt in der Welt hinter mir zu lassen, die ich wirklich liebe?«
Sterling richtete sich bei diesen Worten auf. »Aber waren Sie nicht immer viel zu gerissen für uns?«, fragte er.
»Nun, natürlich schon.« Lestat stimmte achselzuckend zu.
»Außerdem«, fuhr Sterling fort, »haben Sie sich nicht vertreiben lassen. Sie waren die ganze Zeit hier. Sie sind von unseren Mitgliedern gesehen worden, wie sie frech im Café du Monde vor einer überaus nutzlosen Tasse Milchkaffee saßen, könnte ich hinzufügen.«
Ich war perplex.
»Sterling!«, flüsterte ich. »Um Himmels willen, hör auf zu widersprechen.«
Wieder schaute Lestat mich an, aber nicht zornig. Dann wandte er sich erneut Sterling zu. Der war noch nicht fertig, sondern fuhr entschlossen fort: »Immer noch sind Gesindel und Abschaum Ihre Beute. Die Behörden kümmert das nicht, aber wir erkennen die Handschrift. Wir wissen, es ist die Ihre.«
Ich war verärgert. Wie konnte er derlei Reden führen?
Lestat konnte ein Lachen nicht unterdrücken.
»Und trotzdem kamen Sie in der Nacht hierher?«, wollte er wissen. »Sie wagten es, in dem Wissen, dass ich Sie hier finden könnte?«
»Ich denke …«, Sterling zögerte einen Moment, ehe er fortfuhr: »Ich denke, ich wollte Sie herausfordern. Wie ich schon sagte, ich denke, ich beging die Sünde des Hochmuts.«
Gott sei Dank für dieses Geständnis, dachte ich. »Beging die Sünde …«, wirklich gut gewählt, seine Worte. Ich bebte, von Sterlings furchtlosem Ton entsetzt, während ich die beiden beobachtete.
»Wir respektieren Sie mehr, als Sie es verdienen«, sagte er.
Ich schnappte nach Luft.
»Oh, das müssen Sie mir erklären!«, lächelte Lestat. »Wie äußert sich denn dieser Respekt, würde ich noch wissen wollen. Wenn ich wirklich in Ihrer Schuld stehe, würde ich mich gern bedanken.«
»St. Elizabeth«, antwortete Sterling, inzwischen flossen ihm die Worte wieder elegant von der Zunge, »das Bauwerk, in dessen Kapelle Sie so lange Jahre schlafend gelegen haben. Wir haben nie einen Fuß hineingesetzt oder herauszufinden versucht, was darin vorgeht. Und wie Sie vorhin bemerkten, im Bestechen von Wachen sind wir gut. Die Chroniken haben Ihren Schlaf berühmt gemacht. Und wir wussten, wir könnten in das Gebäude eindringen. Wir hätten Sie bei Tageslicht sehen können, wie Sie dort schutzlos auf dem Marmorboden lagen. Es war schon verlockend – ein schlummernder Vampir, der sich nicht mehr die Mühe machte, sich unter einem Sargdeckel zu verbergen. Die finstere, tödliche Entsprechung zu König Artus, der im Schlummer liegt, bis England seiner wieder bedarf. Aber nie schlichen wir uns in Ihre riesige Unterkunft. Wie gesagt, ich denke, dass wir Ihnen mehr Respekt zeigten, als Sie verdienen.«
Eine Sekunde lang schloss ich die Augen, überzeugt, dass gleich ein Unglück geschehen würde.
Aber Lestat gab sich nur abermals einem Heiterkeitsausbruch hin. Dann sagte er: »Kompletter Blödsinn! Sie und Ihre Ordensbrüder hatten Angst! Sie kamen dem Konvent nicht in die Nähe, weil Sie schlicht Angst vor den Alten unter uns hatten, denn die hätten Ihnen Ihr Lebenslicht ausblasen können, als wäre es nur ein Streichholz. Außerdem fürchteten Sie alle das verbrecherische Vampirpack, die Herumstreuner, die vor dem Namen Talamasca keinen Respekt haben – um die machten Sie dann doch lieber einen großen Bogen. Und was den helllichten Tag angeht – Sie konnten überhaupt nicht wissen, was Sie vorfinden würden, ob da nicht bezahlte Totschläger auf Sie lauerten, die Sie umgebracht und tief in den Kellerräumen unter dem Beton vergraben hätten. Sie hatten also sehr praktische Gründe, mich in Ruhe zu lassen.«
Sterling kniff die Augen zusammen. »Ja, vorsichtig mussten wir tatsächlich sein«, räumte er ein, »dennoch, es gab Zeiten …«
»Quatsch«, sagte Lestat, »um das mal klarzustellen, ich hatte meinen berüchtigten Schlummer schon beendet, ehe Sie Ihre Erklärung vom Stapel ließen. Und wenn ich öffentlich »in aller Frechheit« im Café du Monde saß – na und? Und überhaupt – wie wagen Sie das Wort »frech« zu benutzen? Sie tun so, als hätte ich kein Recht dazu!«
»Sie nähren sich von Ihren Mitmenschen«, stellte Sterling ruhig fest. »Haben Sie das allen Ernstes vergessen?«