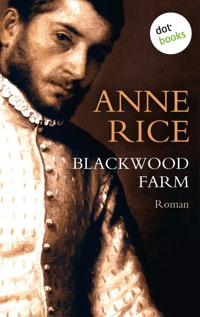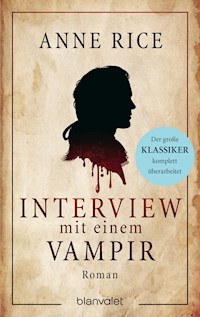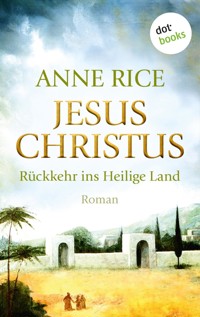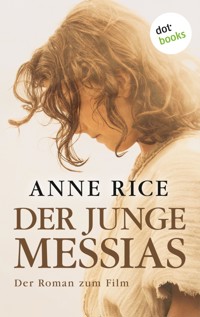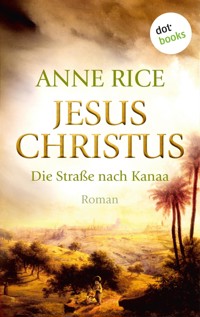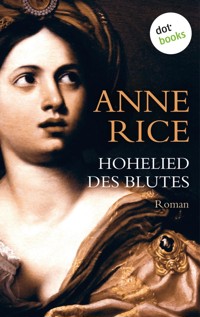
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sind Sie bereit für einen dunklen Rausch der Sinne? "Das Hohelied des Blutes" von Bestsellerautorin Anne Rice jetzt als eBook bei dotbooks. "Ich liebe dich, wie ich nie zuvor geliebt habe, mehr als allen Glanz des Bösen, mehr als Blut." Sie soll das Erbe ihres Geschlechts antreten – doch weder Magie noch Reichtum können die todkranke Hexe Mona Mayfair retten. Ihr bleibt nur eine Hoffnung: Wird Lestat, der mächtige Fürst der Finsternis, sie zur Vampirin machen? Doch dies ruft den erbitterten Widerstand ihrer Familie hervor, der Lebenden wie der Toten. Und während Lestat erkennt, welches düstere Geheimnis die Mayfairs hüten, gerät er in größte Gefahr – auch, weil er sich nicht gegen seine Gefühle für die schöne Hexe Rowan wehren kann … Liebe und Rache, Loyalität und Vergeltung – ein opulentes Lesevergnügen, in dem Anne Rice ihre weltberühmten Chroniken der Vampire mit der Saga um die Mayfair-Hexen verbindet. "Obwohl Rice viele Elemente ihrer vorherigen Romane in diesem vereint, werden sich neue Leser sofort zurechtfinden und die alten begeistert sein, wie sie die verschiedenen Fäden miteinander verknüpft." Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Hohelied des Blutes" von Bestsellerautorin Anne Rice. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie soll das Erbe ihres Geschlechts antreten – doch weder Magie noch Reichtum können die todkranke Hexe Mona Mayfair retten. Ihr bleibt nur eine Hoffnung: Wird Lestat, der mächtige Fürst der Finsternis, sie zur Vampirin machen? Doch dies ruft den erbitterten Widerstand ihrer Familie hervor, der Lebenden wie der Toten. Und während Lestat erkennt, welches düstere Geheimnis die Mayfairs hüten, gerät er in größte Gefahr – auch, weil er sich nicht gegen seine Gefühle für die schöne Hexe Rowan wehren kann …
Liebe und Rache, Loyalität und Vergeltung – ein opulentes Lesevergnügen, in dem Anne Rice ihre weltberühmten Chroniken der Vampire mit der Saga um die Mayfair-Hexen verbindet.
»Obwohl Rice viele Elemente ihrer vorherigen Romane in diesem vereint, werden sich neue Leser sofort zurechtfinden und die alten begeistert sein, wie sie die verschiedenen Fäden miteinander verknüpft.« Booklist
Über die Autorin:
Anne Rice, geboren 1941 in New Orleans, studierte in San Francisco Englisch, Kreatives Schreiben und Politikwissenschaften. 1976 wurde sie mit ihrem Debütroman Interview mit einem Vampir weltberühmt. Mehr Informationen finden sich auf ihrer Website: www.annerice.com
Bei dotbooks erschienen aus der international erfolgreichen Serie Die Chronik der Vampire bereit die Romane Blackwood Farm und Das Hohelied des Blutes. Anne Rice veröffentlichte bei dotbooks außerdem Jesus Christus – Rückkehr ins Heilige Land und Jesus Christus – Die Straße nach Kanaa.
***
eBook-Neuausgabe November 2016
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Blood Canticle« im Verlag Alfred A. Knopf, New York.
Copyright © 2003 by Anne O’Brien Rice. All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part of any form
Copyright © für die deutschsprachige Erstausgabe 2006 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg (www.hoca.de)
Copyright © der deutschsprachigen Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Gemäldes »La Sibilla Persica« von Domenico Zampieri
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-816-8
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Hohelied an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne Rice
Hohelied des Blutes
Ein Roman aus der Chronik der Vampire
Aus dem Englischen von Barbara Kesper
dotbooks.
Für Stan Rice
1942 – 2002
Die Liebe meines Lebens.
So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend;und lass dein Herz guter Dinge sein in deiner Jugend.Tue, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt,und wisse, dass dich Gott um dies alles wird vor Gericht führen.
DER PREDIGER SALOMO, 11,9
Kapitel 1
Ich will ein Heiliger sein. Ich will Millionen von Seelen erretten. Ich will überall auf der Welt Gutes tun. Ich will das Böse bekämpfen! Ich will, dass in jeder Kirche eine lebensgroße Statue von mir steht. Ein Meter achtzig, blondes Haar, blaue Augen …
Moment mal.
Wissen Sie, wer ich bin?
Vielleicht sind Sie ja ein neuer Leser und haben noch nie von mir gehört?
Dann erlauben Sie bitte, dass ich mich vorstelle.
Ich bin Lestat, der mächtigste und liebenswerteste Vampir, der je geschaffen wurde, übernatürlich und umwerfend, zweihundert Jahre alt, aber für alle Zeiten in der Gestalt eines Zwanzigjährigen, mit einem Gesicht und einem Körper, für den Sie sterben könnten – und es möglicherweise sogar werden. Ich bin unendlich erfindungsreich und unbestreitbar charmant. Krankheiten, der Tod, die Zeit und die Schwerkraft haben keine Bedeutung für mich.
Nur zwei Dinge sind mein Feind: das Tageslicht, denn es saugt das Leben aus mir und überlässt mich hilflos den tödlichen, sengenden Sonnenstrahlen – und mein Gewissen. Mit anderen Worten, ich bin auf ewig verdammt, in der Nacht zu leben, und bei meiner Jagd nach Blut ein ewig Gepeinigter.
Hört sich das nicht unwiderstehlich an?
Aber ehe ich meiner Phantasie weiter freien Lauf lasse, seien Sie versichert:
Ich weiß verdammt gut, was ein echter Spätrenaissance-, Fin-de-Siècle-, postmoderner Schriftsteller ist. Ich lasse keinen Raum für Interpretationen. Das heißt, dass Sie hier eine Geschichte erzählt bekommen – mit einem Anfang, einer Mitte und einem Schluss. Mit einer Handlung, Charakteren, Spannung, eben allem, was dazugehört.
Ich sorge schon dafür, dass Sie nicht zu kurz kommen. Also entspannen Sie sich, und lesen Sie weiter. Es wird Ihnen nicht Leid tun. Glauben Sie etwa, ich wäre nicht an neuen Lesern interessiert? Gier ist mein Name! Ich will Sie haben!
Da wir uns gerade eine Pause gönnen, von meiner Besessenheit, ein Heiliger zu sein, lassen Sie mich ein paar Worte an meine hingebungsvollen Anhänger richten. Jene, die neu sind, folgen mir einfach. Es wird Ihnen sicher nicht schwer fallen. Warum sollte ich es Ihnen auch schwer machen? Damit würde ich mir doch ins eigene Fleisch schneiden, stimmt’s?
Und nun zu Ihnen, die Sie mich verehren – also die Millionen von Lesern.
Sie sagen, dass Sie von mir hören wollen. Sie legen gelbe Rosen an meiner Türschwelle in New Orleans nieder, mit handgeschriebenen Notizen: »Lestat, lass wieder von dir hören. Schenk uns ein neues Buch. Lestat, wir lieben die Vampir-Chroniken. Lestat, warum haben wir nichts mehr von dir gehört? Lestat, bitte komm zurück.«
Aber ich frage Sie, meine geliebten Anhänger (stolpern Sie bitte nur nicht in Ihrem Eifer, mir zu antworten, alle übereinander), was, zur Hölle, war denn, als ich Ihnen Memnoch der Teufel schenkte? Hmmm? Das war der letzte Band der Chronik, der aus meiner eigenen Feder stammte.
Oh, Sie haben das Buch gekauft, darüber beschwere ich mich gar nicht, meine geschätzten Leser. Tatsache ist, dass Memnoch jeden anderen Band aus der Chronik der Vampire verkaufsmäßig übertraf; das nur mal als kleiner, unbescheidener Hinweis! Aber haben Sie das Buch ins Herz geschlossen? Haben Sie es verstanden? Haben Sie es ein zweites Mal gelesen? Haben Sie meinen Worten geglaubt?
Ich war im Reich des Allmächtigen Gottes und in den tiefsten Abgründen ewiger Verdammnis, ich vertraute Ihnen meine Bekenntnisse an, bis hin zum letzten Schauder aus Verwirrung und Qual, damit Sie verstehen konnten, warum ich vor der beängstigenden Möglichkeit geflohen war, wirklich ein Heiliger zu werden. Und was haben Sie getan? Sie haben sich beschwert!
»Wo war Lestat, der Vampir?« Das wollten Sie wissen. Wo war der Lestat in seinem eleganten schwarzen Gehrock, der lächelnd die kleinen Fangzähne aufblitzen lässt, während er in englischen Maßstiefeln durch die glitzernde Unterwelt eurer düsteren, hypermodernen Städte voller sich windender menschlicher Opfer schreitet, von denen die Mehrzahl den Vampirkuss verdient hat? Nur darüber redeten Sie!
Wo war Lestat, der unersättliche Bluträuber, der Seelenvernichter, Lestat, der Rachgierige, Lestat, der Listige, Lestat, der … nun gut … Lestat, der Herrliche.
Oh, das gefällt mir: Lestat, der Herrliche. Klingt gut, dieser Titel, gerade in diesem Buch. Und, wenn man es genau betrachtet – ich bin herrlich. Das muss ja einmal ausgesprochen werden. Aber zurück zu Ihrem Gezeter wegen Memnoch.
Diesen zerrütteten Schatten, der mit toten Seelen kommuniziert, wollen wir nicht, sagten Sie. Wir wollen unseren Helden! Wo ist seine berühmte Harley? Er soll sich draufschwingen und mit wehenden blonden Haaren durch die Straßen und Gassen des French Quarter donnern. Er soll, die violett getönten Gläser auf der Nase, zur Musik, die in seinen Kopfhörern hämmert, gegen den Fahrtwind ansingen.
Diese Vorstellung gefällt mir natürlich! Wirklich! Das Motorrad habe ich noch. Und ja, ich liebe Gehröcke über alles. Schließlich ließ ich sie mir ja schneidern; von mir hören Sie kein Wort gegen Gehröcke. Und die Stiefel, immer! Wollen Sie wissen, was ich gerade trage?
Ich werd’s Ihnen nicht sagen!
Naja, jetzt noch nicht.
Aber denken Sie doch mal darüber nach, was ich Ihnen zu sagen versuche:
Ich schenke Ihnen diese metaphysische Vision der Schöpfung und der Ewigkeit, eingeschlossen die gesamte Geschichte des Christentums (mehr oder weniger), und massenhaft tiefsinnige Betrachtungen über die größte Ära des Kosmos – und was ist der Dank dafür? »Was ist das denn für ein Roman?«, fragen Sie. »Wir haben dir nicht gesagt, dass du Himmel oder Hölle besuchen sollst! Wir wollen, dass du wieder der phantastische Unhold bist!«
Mon dieu! Sie machen mich krank! Wirklich, und das sollen Sie ruhig wissen! Sosehr ich Sie liebe, sosehr ich Sie brauche und nicht ohne Sie leben kann – Sie machen mich krank!
Also los, werfen Sie auch dieses Buch weg. Spucken Sie mich an. Schmähen Sie mich. Wagen Sie es! Entfernen Sie mich aus Ihrem geistigen Universum. Werfen Sie mich aus Ihrem Rucksack! Schleudern Sie mich in die Mülltonne am Flughafen. Lassen Sie mich auf einer Bank im Central Park liegen!
Was kümmert es mich?
Nein, nichts davon sollen Sie tun. Tun Sie es nicht.
TUN SIE ES NICHT!
Ich möchte, dass Sie jede Seite lesen, die ich schreibe. Ich möchte, dass Sie in meine Geschichte eintauchen. Wenn ich könnte, würde ich Ihr Blut trinken und Sie so in jede meiner Erinnerungen mitnehmen, in jeden Herzschlag, in jeden kurzen Triumph, in jeden kleinen Fehlschlag, jeden mystischen Augenblick der Hingabe. Und, ganz recht, ich werde mich dem Anlass entsprechend in Schale werfen. Kleide ich mich jemals nicht dem Anlass entsprechend? Und gibt es jemanden, der in Lumpen besser aussieht als ich?
Seufz.
Ich hasse mein Vokabular!
Wie kommt es, dass ich, egal wie viel ich lese, doch immer klinge wie ein rebellischer Straßenjunge?
Ein guter Grund dafür ist natürlich, dass ich davon besessen bin, meine Berichte für die Welt der Sterblichen so zu verfassen, dass sie für so ziemlich jeden lesbar sind. Meine Bücher sollen in Wohnwagensiedlungen und Universitätsbibliotheken gelesen werden. Verstehen Sie, was ich meine? Trotz meines kulturellen und künstlerischen Wissensdurstes bin ich nicht elitär. Das war Ihnen nicht klar?
Noch einmal seufz!
Ich bin verzweifelt! Eine permanent auf Hochtouren befindliche Psyche, das ist das Los eines brillanten, intelligenten Vampirs! Ich sollte sonst wo sein, einen Übeltäter töten, sein Blut lecken, als wäre es ein Eis am Stiel. Stattdessen schreibe ich ein Buch.
Deswegen können mich auch der größte Reichtum und die stärkste Macht nie lange zum Schweigen bringen, denn dieser Quell speist sich aus Verzweiflung. Was, wenn das alles bedeutungslos ist? Was, wenn hochglanzlackierte französische Möbel mit Ormolu- und Leder-Intarsien im großen Plan der Welt nicht zählen? In einem Palast kann man ebenso vor Verzweiflung zittern wie in einer Bruchbude! Von einem Sarg ganz zu schweigen! Aber den Sarg vergessen Sie besser ganz schnell! Ich bin nicht mehr das, was man einen Sarg-Vampir nennt. Völliger Unsinn. Das soll nicht heißen, dass ich nicht gern drin geschlafen hätte. Auf eine Art gibt es nichts Besseres – aber ich will nicht abschweifen.
Bevor ich fortfahre, lassen Sie mich bitte erst noch berichten, was meinem Geist bei der Konfrontation mit Memnoch angetan wurde. Und hören Sie gut zu, neue wie alte Leser:
Ich wurde von göttlichen, von heiligen Kräften in die Zange genommen! Man redet immer vom Geschenk des Glaubens, aber ich sage Ihnen, für mich war es eher wie ein Zusammenstoß! Es tat meiner Psyche Gewalt an. Ein richtiger Vampir zu sein ist Schwerarbeit, wenn man erst einmal Himmel und Hölle durchwandert hat. Sie alle sollten mir auf der metaphysischen Ebene ein wenig Freiraum lassen.
Hin und wieder kriege ich so einen kleinen Anfall: ICH WILL NICHT MEHR BÖSE SEIN!
Jetzt schreien Sie nicht alle auf einmal: »Wir wollen aber, dass du der Böse bist, du hast es uns versprochen.«
Klar doch! Aber Sie müssen auch verstehen, wie sehr ich leide. Das ist nur fair.
Und ich bin ja richtig gut darin, der Böse zu sein, natürlich, mein alter Slogan. Ich sollte ihn auf ein T-Shirt drucken lassen. Eigentlich möchte ich gar nichts schreiben, was man nicht auf ein T-Shirt drucken könnte. Eigentlich möchte ich nur auf T-Shirts schreiben. Eigentlich möchte ich ganze Romane auf T-Shirts schreiben; dann könnten Sie sagen: »Hey, ich trage Kapitel acht von Lestats neuem Buch, das gefällt mir am besten; oh, ich sehe, bei dir ist es Kapitel sechs …«
Hin und wieder trage ich tatsächlich – nein, Schluss damit!
KOMME ICH DENN ÜBERHAUPT NICHT DA RAUS?
Immerzu flüstern Sie mir ins Ohr, nicht wahr?
Ich schlurfe Pirates’ Alley entlang, ein Penner, bedeckt von dem aus moralischer Sicht unumgänglichen Staub, und Sie schleichen sich an mich heran und sagen: »Lestat, wach auf«, und ich wirbele herum – zisch! wie Superman in die typisch amerikanische Telefonzelle rauscht –, und voilà! Da stehe ich, eine unwirkliche Erscheinung im Abendanzug, wieder einmal in Samt gehüllt, und habe Sie bei der Kehle! Wir sind im Vestibül der Kathedrale (was dachten Sie denn, wohin ich Sie zerren würde? Wollten Sie nicht auf heiligem Boden sterben?), und die ganze Zeit betteln Sie um das Eine. Hoppla! Bin wohl ein bisschen zu weit gegangen, sollte eigentlich nur der Kleine Trunk werden … Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt! Wenn ich recht überlege – hatte ich Sie gewarnt?
Ja, okay, schon gut, vergessen Sie das, was soll’s, lassen Sie das Händeringen, ja doch, Schluss damit, ruhig, vergessen Sie’s, ja!
Ich geb’s auf. Natürlich werden wir genüsslich im Bösen schwelgen!
Wie käme ich auch dazu, meinen Ruf als der katholische Romanschreiber par excellence verleugnen zu wollen? Schließlich sind die Chroniken der Vampire meine Erfindung, wie Sie wissen, und ich bin nur dann NICHT das Monster, wenn ich mich an Sie wende, also, ich meine, darum schreibe ich das hier, weil ich Sie brauche, nicht atmen kann ohne Sie. Ohne Sie bin ich hilflos …
… Und ich bin zurück – seufz, kicher, muntere Stepptanzschritte, und nun bin ich beinahe so weit, dass ich die Seiten dieses Buches mit meiner erfolgreichen Erzählkunst fülle. Es wird einiges zusammenkommen, ich schwör’s beim Geiste meines verstorbenen Vaters, Abschweifungen gibt es in meiner Welt nicht! Alle Wege führen zu mir.
Stille.
Ein Pulsschlag.
Ehe wir jedoch zur Gegenwart kommen, gönnen Sie mir meinen kleinen Wachtraum. Ich brauche das. Ich bin kein oberflächlicher Typ, verstehen Sie? Ich kann nicht anders.
Und falls Sie diesen kleinen Ausflug wirklich nicht ertragen können, blättern Sie einfach weiter zu Kapitel 2. Los, tun sie sich keinen Zwang an!
Aber jene unter Ihnen, die mich wirklich lieben, die jede winzige Nuance der kommenden Geschichte verstehen möchten – Sie lade ich ein, mich zu begleiten. Kommen Sie:
Ich will ein Heiliger sein. Ich will Millionen von Seelen erretten. Ich will überall Gutes tun. Ich will, dass meine lebensgroße Statue in jeder Kirche überall auf der Welt steht. Ich, eins achtzig groß, mit blauen Glasaugen, in wallende purpurne Samtgewänder gehüllt, schaue, die Arme sanft ausgebreitet, auf die Gläubigen nieder, die meinen Fuß berühren und beten.
»Lestat, heile mich vom Krebs, hilf meinem Sohn, von den Drogen loszukommen, mach, dass mein Mann mich liebt, finde meine Brille.«
In Mexico City strömen junge Männer in das Priesterseminar, ein kleines Bildnis von mir in den Händen, während in der Kathedrale Mütter zu mir beten: »Lestat, rette mein Baby. Lestat, nimm mir die Schmerzen. Lestat, ich kann wieder gehen! Seht, die Statue bewegt sich, ich sehe Tränen!«
In Bogotá legen Drogendealer ihre Waffen vor mir nieder, Mörder fallen auf die Knie und flüstern meinen Namen.
In Moskau beugt der Patriarch, einen verkrüppelten Knaben im Arm, das Haupt vor meinem Bild, und der Knabe ist geheilt. In Frankreich kehren dank meiner Fürbitte Tausende in den Schoß der Kirche zurück, stehen vor mir und flüstern: »Lestat, ich habe mich mit meiner diebischen Schwester versöhnt. Lestat, ich habe meiner sündigen Geliebten entsagt. Lestat, ich habe das betrügerische Bankhaus entlarvt, zum ersten Mal seit Jahren gehe ich zur Messe. Lestat, ich gehe ins Kloster, nichts kann mich aufhalten.«
Als der Vesuv ausbricht, wird in Neapel meine Statue der Prozession vorangetragen, um dem Strom der Lava Einhalt zu gebieten, ehe er die Küstenstädte vernichtet. In Kansas City defilieren Tausende von Studenten an meinem Bild vorbei und geloben, nur geschützten Sex zu haben oder gar keinen. Überall in Europa und Amerika erfleht man während der Messe meine besondere Fürbitte.
In New York verkündet ein Gremium aus internationalen Wissenschaftlern der staunenden Welt, dass es ihnen gelungen ist, eine geruch- und geschmacklose, völlig unschädliche Droge zu entwickeln, die so high macht wie Crack, Kokain und Heroin zusammen, die spottbillig, für jeden zugänglich und absolut legal ist! Die Drogenbarone sind für immer ruiniert!
Senatoren und Kongressmitglieder weinen und fallen sich bei dieser Nachricht in die Arme. Meine Statue wird unverzüglich in der National Cathedral in Washington aufgestellt.
Überall schreibt man Lobgesänge auf mich, fromme Geschichten werden über mich verbreitet. Meine Heiligenbiographie (ein Dutzend Seiten stark) wird, farbig illustriert, milliardenfach gedruckt. Die Leute drängen sich in New York in der St. Patrick’s Cathedral, um ihre Bittschriften in einem Korb vor meinem Bildnis abzulegen.
Auf Frisiertischen, Arbeitsflächen, Schreib- und Computertischen in der ganzen Welt stehen kleine Figuren von mir. »Was, du hast noch nicht von ihm gehört? Bete zu ihm, und dein Ehemann wird sich in ein Lämmchen verwandeln, deine Mutter nörgelt nicht mehr herum, und deine Kinder kommen jeden Sonntag zu Besuch! Dann schick zum Dank eine kleine Spende an die Kirche.«
Wo sind meine sterblichen Reste? Es gibt keine. Mein gesamter Körper ist in Reliquien zerteilt worden, winzige Stückchen verdorrtes Fleisch, Knochensplitter und Haarlocken liegen in kleinen goldenen Schreinen, in den ausgehöhlten Rückseiten von Kreuzen oder stecken in Medaillons, die man an einer Kette um den Hals trägt. Ich kann sie fühlen, diese Reliquien. Ich kann ruhig schlummern im Bewusstsein ihrer Wirkung. »Lestat, hilf mir, mit dem Rauchen aufzuhören. Lestat, wird mein schwuler Sohn in die Hölle kommen? (Ganz bestimmt nicht.) Lestat, ich liege im Sterben. Lestat, nichts kann mir meinen Vater zurückgeben. Lestat, der Schmerz will nicht enden. Lestat, gibt es wirklich einen Gott? (Ja!)
Ich antworte jedem Einzelnen. Frieden, das ist die Gewissheit, dass es den Erhabenen gibt, die unwiderstehliche Freude des Glaubens, das Ende aller Schmerzen, die Aufhebung der Sinnlosigkeit.
Ich spiele eine Rolle im Leben der Menschen, bin berühmt. Man kann mir nicht entkommen. Ich schreibe Geschichte! Selbst die New York Times berichtet über mich.
Und ich bin unterdessen bei Gott im Himmel. Ich bin beim Herrn im Himmlischen Licht, beim Schöpfer, dem göttlichen Ursprung allen Lebens. Die Lösung der letzten Geheimnisse steht mir offen. Warum nicht? Ich kenne die Antwort auf alle Fragen.
Gott sagt zu mir: »Du solltest den Menschen erscheinen. Das gehört sich so für einen bedeutenden Heiligen. Die Leute da unten erwarten das von dir.«
Also verlasse ich das Licht des Herrn und treibe langsam auf den grünen Planeten zu. Ein klein wenig meiner vollkommenen Einsicht kommt mir abhanden, während ich in die Erdatmosphäre eintauche. Kein Heiliger darf den Menschen die vollkommene Erkenntnis bringen, denn die Menschen könnten sie nicht begreifen.
Ich hülle mich, könnte man sagen, in meine alte menschliche Gestalt, aber ein bedeutender Heiliger bin ich immer noch und mit den entsprechenden Gaben ausgestattet, um jemandem zu erscheinen. Und wohin wende ich mich? Was glauben Sie?
Die Vatikanstadt, das kleinste Königreich der Welt, ist totenstill.
Ich bin im Schlafzimmer des Papstes, einer kleinen Mönchszelle: nur ein schmales Bett, ein einzelner Stuhl. Ganz schlicht.
Johannes Paul II., zweiundachtzig Jahre alt, leidet. Seine Knochen schmerzen zu sehr, als dass er fest und tief schlafen könnte, das Parkinson-Zittern ist zu heftig, die Arthritis fortgeschritten, das Alter hat ihn erbarmungslos verwüstet.
Langsam schlägt er die Augen auf. Er begrüßt mich auf Englisch.
»Heiliger Lestat«, sagt er, »warum kommst du zu mir? Warum nicht Padre Pio?«
Na, das ist ja eine tolle Begrüßung!
Aber – er meint es nicht kränkend. Die Frage ist durchaus zu verstehen. Der Papst liebt Padre Pio. Er hat Hunderte von Heiligen kanonisiert, wahrscheinlich liebte er sie alle. Aber wie sehr liebte er Padre Pio! Was mich betrifft, ich weiß nicht, ob er mich liebte, als er mich heilig sprach, denn noch habe ich das Kapitel meiner Heiligsprechung nicht verfasst. Und jetzt, während ich dieses Buch hier schreibe, wurde Padre Pio gerade heilig gesprochen.
(Ich sah mir die ganze Geschichte im Fernsehen an. Vampire lieben Fernsehen.)
Aber zur Sache.
Frostige Stille in den päpstlichen Gemächern, die trotz der palastartigen Ausmaße so nüchtern sind. In der Privatkapelle des Papstes brennen Kerzen. Der Papst stöhnt vor Schmerzen.
Ich lege ihm meine heilenden Hände auf und banne sein Leiden. Ruhe strömt in seine Glieder. Er betrachtet mich mit einem Auge, das andere hat er, wie es häufig seine Art ist, zusammengekniffen, und plötzlich verstehen wir einander, oder besser gesagt, ich begreife langsam etwas, was die ganze Welt erfahren sollte:
Seine unermessliche Selbstlosigkeit, seine tiefe Religiosität rühren nicht nur von seiner Liebe zu Christus her, sondern auch aus der Tatsache, dass er in einem kommunistischen Land gelebt hat. Man vergisst das leicht. Der Kommunismus ist trotz seines Machtmissbrauchs und seiner Grausamkeiten in seinem Kern ein monströser religiöser Gesetzestext. Doch bevor dieses puritanische Regime Johannes Pauls frühe Jahre mit einem Leichentuch bedeckte, erlebte er den Zweiten Weltkrieg mit seinen schrecklichen Paradoxien und Furcht erregenden Sinnlosigkeiten, was seine Bereitschaft zur Selbstaufopferung und seinen Mut schulte. Dieser Mann verbrachte sein gesamtes Leben einzig und allein in einer religiösen Welt. Entbehrungen und Selbstverleugnung sind in seiner Lebensgeschichte verflochten wie eine Doppelhelix.
Es ist kein Wunder, dass er in seinem Inneren den lauten Stimmen, dem Reklamerummel der reichen kapitalistischen Länder zutiefst misstraut. Wie aus Überfluss Mildtätigkeit erwachsen soll, ist für ihn unbegreiflich. Er kann es einfach nicht fassen, dass in Sicherheit und Wohlstand Visionen möglich sind, dass, auch wenn jedes Bedürfnis aufs Üppigste gestillt ist, Selbstlosigkeit und Aufopferung sich entwickeln und andere mitreißt. Kann ich ihm dieses Thema jetzt, in diesem stillen Augenblick, unterbreiten? Oder sollte ich ihm nur versichern, dass er sich wegen der »Gier« der westlichen Welt nicht sorgen muss?
Leise spreche ich zu ihm und versuche, ihm diesen Umstand zu erläutern. (Ja, ich weiß, er ist der Papst, und ich bin ein Vampir, der gerade diese Geschichte schreibt; aber in dieser Geschichte bin ich ein berühmter Heiliger. Ich kann mich doch von den Risiken, die in meinem eigenen Werk lauern, nicht einschüchtern lassen!)
Ich erinnere ihn daran, dass die vornehmen Prinzipien der griechischen Philosophie in einer reichen Gesellschaft entstanden, und er nickt langsam und zustimmend. Er hat auch Philosophie studiert. Viele wissen das nicht. Ich muss ihm jetzt jedoch etwas ganz Grundlegendes vermitteln. Ich kann es wunderbar klar erkennen. Ich sehe alles.
Unser größter Fehler ist der, dass wir jede neue Entwicklung als einen Gipfel betrachten. Als den großen »Endpunkt« oder den zigsten Grad. Ein innerer Fatalismus passt sich permanent der in stetigem Wandel befindlichen Gegenwart an. Jeder Fortschritt wird erst einmal mit Panikmache begrüßt. Seit zweitausend Jahren »läuft alles aus dem Ruder«.
Daran ist natürlich auch unsere Betrachtungsweise schuld – das »Heute« stellt immer unsere Endzeit dar, wir sind vom Gedanken der Apokalypse besessen, und das schon, seitdem Christus in den Himmel auffuhr. Damit müssen wir aufhören! Wir müssen einsehen, dass wir an der Morgendämmerung eines edlen Zeitalters stehen! Feinde werden nicht mehr erobert, sie werden integriert und transformiert!
Ich muss es betonen: Modernismus und Materialismus – Elemente, die die Kirche so lange fürchtete – stecken philosophisch und praktisch noch in den Kinderschuhen! Dass sie sakramentaler Natur sind, wird gerade erst offenbar!
Lassen wir diese Kinderkrankheiten auf sich beruhen! Die elektronische Revolution hat die Industrieländer in einem Maß verändert, wie es niemand im zwanzigsten Jahrhundert voraussah, und wir leiden immer noch an den Geburtswehen. Kniet euch rein! Arbeitet dran. Reizt alles aus.
Das tägliche Leben ist für Millionen von Menschen in den entwickelten Ländern nicht nur komfortabel, sondern darüber hinaus eine Anhäufung von Wundern, die ans Märchenhafte grenzen. Und so erwachen neue spirituelle Sehnsüchte, die unendlich viel mehr Mut erfordern als die missionarischen Ziele der Vergangenheit.
Wir müssen beweisen, dass der politische Atheismus ein kompletter Fehlschlag war. Denken Sie nach! In die Tonne damit, mit dem ganzen System! Ausgenommen vielleicht Kuba. Aber was beweist uns schon Castro? Und selbst die säkularsten Börsenbroker ergehen sich ganz selbstverständlich in den höchsten Tugenden. Deshalb gibt es plötzlich all die Wirtschaftsskandale! Deswegen all die Aufregung! Ohne Moral keine Skandale! Wir sollten all die Bereiche der Gesellschaft einmal unvoreingenommen betrachten, denen wir so unbekümmert das Etikett »säkular« aufgedrückt haben. Wer lebt denn schon völlig ohne unerschütterliche altruistische Grundsätze?
Der auf dem Judentum fußende christliche Glaube ist die Religion des säkularen Westens, ganz egal, wie viele Millionen Menschen das auch zu ignorieren versuchen. Seine grundsätzliche Lehre haben auch die distanziertesten und intellektuellsten Agnostiker verinnerlicht, und es prägt das Verhalten an der Wall Street ebenso wie die alltäglichen Höflichkeiten, die man an einem überfüllten Strand in Kalifornien oder beim Treffen der Staatsoberhäupter Russlands und der Vereinigten Staaten austauscht.
Bald werden Technokraten zu Heiligen – wenn sie es nicht schon sind –, die die Armut von Millionen dahinschmelzen lassen, indem sie Güter und Dienstleistungen verteilen lassen. Die Kommunikation zwischen den Menschen wird Hass und Uneinigkeit auslöschen, Internet-Cafés werden wie Blumen in den Slums Asiens und des Orients aus dem Boden sprießen.
Kabelfernsehen wird unzählige neue Programme in die arabische Welt bringen. Selbst nach Nordkorea wird es vordringen.
Der Erfolg der elektronischen Medien wird dazu führen, dass Minderheiten in Europa und Amerika schließlich doch erfolgreich assimiliert werden. Wie schon beschrieben, wird die Medizin billiger unschädliche Ersatzdrogen für Heroin und Kokain finden und so den teuflischen Drogenhandel für immer ausschalten. Die Sprache der Gewalt wird der kultivierten Debatte und dem Wissenstransfer weichen. Terroristische Anschläge wird man weiterhin als Gräuel ansehen, vor allem weil sie extrem selten sein werden, bis sie schließlich endgültig aufhören.
Was Sexualität betrifft, so ist die Revolution auf diesem Gebiet eine so gewaltige, dass wir heutigen Menschen ihre Folgen noch gar nicht absehen können. Kurze Röcke, Kurzhaarfrisuren, Liebe im Auto, arbeitende Frauen, verliebte Schwule – die kleinsten Anfänge machen uns schon ganz wirr im Kopf. In unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Kontrolle über die Fortpflanzung liegt eine Macht, von der man in vergangenen Zeiten nicht einmal geträumt hat, und die unmittelbaren Auswirkungen sind nur ein blasser Abglanz des Kommenden. Wir müssen das Mysterium von Ei und Spermium respektieren, das Geheimnis der Chemie zwischen den Geschlechtern, das Geheimnis der Anziehungskraft bei der Partnerwahl. Unser wachsendes Wissen wird zum Gedeihen aller Kinder Gottes beitragen, aber ich wiederhole: Wir stehen noch am Anfang. Wir müssen den Mut haben, uns im Namen des Herrn die göttliche Schönheit, die in der Wissenschaft liegt, zu Eigen zu machen.
Der Papst hört zu. Er lächelt.
Ich fahre fort.
Das Bild des leibhaftigen Gottes, der, fasziniert von Seiner Eigenen Schöpfung, ein Mensch wurde, wird im dritten Jahrtausend als das höchste Sinnbild göttlicher Hingabe und unermesslicher Liebe triumphieren.
Den Gekreuzigten zu begreifen wird Jahrtausende in Anspruch nehmen, behaupte ich. Warum, zum Beispiel, lebte er dreiunddreißig Jahre auf der Erde? Warum nicht nur zwanzig? Oder fünfundzwanzig? Darüber könnte man ewig grübeln. Warum kam er als Säugling zu uns? Wer will schon ein Säugling sein? War dies ein Teil der Erlösung? Und warum wählte er gerade diese historische Zeit? Und dann dieses Land!
Überall Dreck, Staub, Sand, Steine – ich sah nirgends so viele Steine wie im Heiligen Land –, nackte Füße, Sandalen, Kamele; man stelle sich diese Ära vor. Kein Wunder, dass man damals Leute steinigte! Dass Christus gerade in jenem Zeitalter erschien, hatte das am Ende etwas mit der Kleidung und der Haartracht zu tun? Ich denke, ja. Man blättere in einem Buch über Gewandungen im Lauf der Geschichte – in einer guten Enzyklopädie, die von den antiken Sumerern bis zu Lauren führt –, man wird kein schlichteres Gewand, keine einfachere Haartracht finden als damals in Galiläa.
Ich meine das ernst, sage ich dem Heiligen Vater. Auch das bedachte Christus, das ist gar nicht anders möglich. Wie auch nicht! Sicher wusste er, dass sein Abbild überall verbreitet werden würde.
Darüber hinaus denke ich, dass Christus sich für die Kreuzigung entschied, weil Er zukünftig auf jeder Abbildung mit liebreich ausgebreiteten Armen zu sehen sein wollte. Sieht man die Kreuzigung erst einmal unter diesem Aspekt, ändert sich alles. Man sieht Ihn mit einer die ganze Welt umfangenden Geste. Er wusste, das Bild musste die Zeiten überdauern. Es musste abstrahierbar sein. Es musste vervielfältigt werden können. Es ist kein Zufall, dass wir das Abbild dieses schrecklichen Todes an einer Kette um den Hals tragen können. Gott bedenkt solche Dinge, nicht wahr?
Der Papst lächelt immer noch. »Wenn du nicht ein Heiliger wärst, würde ich dich auslachen«, sagt er. »Wann genau erwartest du denn übrigens diese technokratischen Heiligen?«
Ich bin glücklich. Jetzt sieht er aus wie der alte Wojtila – der Papst, der noch mit dreiundsiebzig Ski fuhr. Mein Besuch hat sich gelohnt. Und schließlich können wir nicht alle Padre Pio oder Mutter Teresa sein. Ich bin der heilige Lestat.
»Ich werde Padre Pio von Euch grüßen«, flüstere ich.
Aber der Papst döst. Er hat still vor sich hin gelacht und ist sanft eingeschlummert. So viel zu meinem beeindruckenden Mystizismus. Ich habe ihn in den Schlaf geredet. Aber was hatte ich sonst erwartet, gerade vom Papst? Er arbeitet hart. Er leidet. Er denkt. Er war dieses Jahr schon in Asien und Osteuropa, und bald wird er nach Toronto und Guatemala und Mexiko reisen. Ich weiß nicht, wie er das alles schafft.
Ich lege ihm meine Hand auf die Stirn.
Dann verschwinde ich.
Ich gehe die Treppen hinab in die Sixtinische Kapelle. Sie ist leer und dunkel. Kalt ist es auch darin. Aber keine Angst, meine Heiligenaugen sehen ebenso gut wie meine Vampiraugen, und ich kann die ganze Herrlichkeit erkennen.
Allein – von der Welt und allen Dingen abgeschnitten – stehe ich hier. Ich will mich auf dem Bauch ausgestreckt zu Boden werfen wie ein Priester bei seiner Ordination. Ich will ein Priester sein! Ich will die Wandlung vollziehen! Ich sehne mich schmerzhaft danach. ICH WILL NICHTS BÖSES TUN.
Aber in Wahrheit verblasst meine Phantasie vom heiligen Lestat langsam. Ich weiß, dass es nur eine Phantasie ist, und ich kann sie nicht länger aufrechterhalten.
Ich weiß, ich bin kein Heiliger, war nie einer und werde nie einer sein. Nie wurde auf dem Petersplatz ein Banner mit meinem Namen im Sonnenlicht entrollt. Nie jubelte eine hundert- oder tausendköpfige Menge bei meiner Kanonisierung. Nie strömten die Kardinäle zu dieser Zeremonie, denn sie fand niemals statt. Und ich habe diese geruchlose, geschmacklose, unschädliche Formel nicht, die Crack, Heroin und Kokain ersetzt, also kann ich die Welt nicht retten.
Ich stehe nicht mal in der Sixtinischen Kapelle. Ich bin weit, weit weg davon, an einem Ort, wo es warm ist, nur bin ich auch hier allein.
Ich bin ein Vampir. Seit mehr als zweihundert Jahren genieße ich das. Ich bin randvoll mit Menschenblut. Ich bin davon besudelt. Ich bin verflucht wie die Blutende, ehe sie in Kapernaum den Saum des Gewandes Jesu berührte. Ich lebe von Blut. Ich bin rituell unrein.
Und ich kann nur ein einziges Wunder wirken. Wir nennen es den Zauber der Finsternis, und ich bin im Begriff, ihn zu wirken.
Und glauben Sie etwa, meine Schuldgefühle würden mich davon abhalten? Nada, niemals, mais non, vergessen Sie’s, kein Gedanke, nicht in tausend Jahren, bitte, dass ich nicht lache, absolut nicht.
Sagte ich nicht, dass der alte Lestat wiederkommt?
Ich bin unbezähmbar, unverzeihlich, nicht aufzuhalten, schamlos, ohne jede Reue, herzlos, zügellos, ein Wildfang, unerschrocken, unbußfertig, unerlöst.
Ich höre den donnernden Ruf der Höllenmusik. Der Tanz kann beginnen!
ALSO LOS! WEITER ZU:
Kapitel 2
BLACKWOOD FARM: IM FREIEN, ABEND
Ein kleiner, ländlicher Friedhof am Rande eines Zypressensumpfes, mit etwas über einem Dutzend alter, zementierter Grabstellen, die meisten Namen darauf längst verblichen, und eine dieser rechteckigen, etwas erhöhten Grabplatten ist von einem kürzlichen Feuer rußgeschwärzt. Das kleine Geviert der Grabstellen ist von einem niedrigen Eisengitter und vier riesigen Eichen umgeben, Eichen mit schweren, tief hängenden Ästen. Der Himmel darüber ist in den schönsten Fliederfarben getönt, und die schmeichelnde Sommerwärme ist wie ein Streicheln, und –
– und wetten, dass ich meinen schwarzsamtenen Gehrock trage (Nahaufnahme: auf Taille geschnitten, Messingknöpfe) und die bekannten Motorradstiefel und ein nagelneues Leinenhemd mit Spitzen an Hals und Ärmeln (bemitleiden wir den armen Hinterwäldler, der deswegen über mich lächelt!), und ich habe meine schulterlange blonde Mähne heute Nacht nicht geschoren, was ich sonst zur Abwechslung schon mal tue, und ich habe die violett getönten Gläser weggelassen, denn es interessiert hier keinen, dass meine Augen Aufmerksamkeit erregen, und meine Haut ist immer noch intensiv gebräunt von meinem Jahre zurückliegenden Versuch, in der Sonnenglut der Wüste Gobi Selbstmord zu begehen, und ich denke –
– Zauber der Finsternis, ja, wirken wir dieses Wunder, sie brauchen dich da oben im Herrenhaus, dich, den flegelhaften Prinzen, dich, den Prunk liebenden Herrscher unter den Vampiren; Schluss mit dem düsteren Brüten und der Trauer, pack’s an, da oben im Haus wartet eine ziemlich knifflige Situation – und
ES WIRD ZEIT, IHNEN ZU ERZÄHLEN,
WAS GESCHAH, ALSO HIER, BITTE:
Ich hatte mich gerade aus meinem geheimen Versteck erhoben und schritt aufgewühlt hin und her, in bitterer Trauer um einen anderen Bluttrinker, der auf ebendiesem Friedhof von uns gegangen war, verschlungen in einem riesigen Feuer dort auf der erwähnten geschwärzten Grabplatte. Ohne die geringste Warnung hatte sie uns gestern Nacht verlassen, Merrick Mayfair, die erst seit drei Jahren oder sogar weniger zu den Untoten gehörte, und ich, ich hatte sie hierher nach Blackwood Farm eingeladen. Sie sollte uns helfen, einen bösen Geist zu exorzieren, von dem Quinn Blackwood schon seit seiner Kindheit verfolgt wurde. Quinn besaß das Blut der Finsternis noch nicht lange; er war zu mir gekommen, um mich wegen dieses Geistes um Beistand zu bitten, der ihn nach seiner Umwandlung vom Sterblichen zum Vampir nicht etwa verließ, sondern im Gegenteil noch stärker und boshafter wurde und sogar den Tod des Menschen bewirkt hatte, dem Quinn besonders innig zugetan war – seiner fünfundachtzigjährigen Großtante Queen. Dieser bösartige Geist namens Goblin hatte den tödlichen Sturz der alten Dame verursacht, und ich hatte um Merricks Hilfe ersucht, um ihn für immer zu vertreiben.
Merrick Mayfair war, ehe sie sich dem Blut der Finsternis verschrieb, sowohl Gelehrte als auch Hexe gewesen, weshalb ich davon ausging, dass sie die nötigen Kräfte besäße, uns diesen Geist vom Hals zu schaffen.
Also kam sie her und löste das Rätsel um Goblin. Aber nachdem sie auf einer der Grabplatten einen Altar aus Holz und Kohlen aufgetürmt und angezündet hatte, verbrannte sie nicht nur den Leichnam des bösen Geistes, sondern ging mit ihm zusammen in die Flammen. Der Geist verging, doch Merrick ebenso.
Natürlich versuchte ich, sie dem Feuer zu entreißen, aber ihre Seele war schon aufgestiegen, und ich konnte sie nicht ins Leben zurückholen, soviel von meinem Blut ich auch auf ihre verkohlten Überreste fließen ließ.
Während ich nun auf und ab schritt und zornig den Staub des Friedhofs mit den Füßen aufwirbelte, überlegte ich, dass Unsterbliche, die das Blut der Finsternis unbedingt wollen, wesentlich leichter ihr Leben zu lassen schienen, als die unter uns, die nicht darum gebeten hatten. Vielleicht gibt uns der Zorn über die uns zugefügte Gewalt die Kraft, die Jahrhunderte zu überstehen.
Aber wie gesagt: Etwas ging in dem großen Haus vor.
Ich dachte die ganze Zeit: Zauber der Finsternis, ja, der Dunkle Zauber, einen neuen Vampir schaffen.
Nur, wie kam ich dazu, das überhaupt in Erwägung zu ziehen? Ich, der ich mir doch heimlich wünsche, ein Heiliger zu sein? Bestimmt schrie Merricks Blut nicht aus dem Grab heraus nach einem neuen Vampir, die Vorstellung kann man vergessen. Und diese Nacht war eine von denen, in der auch der winzigste meiner Atemzüge mir wie ein kleines metaphysisches Unglück erschien.
Ich schaute hinüber zum Herrenhaus oben auf dem Hügel, mit seinen zwei Stockwerke hohen weißen Säulen und den vielen erhellten Fenstern, der Ort, der in den letzten Nächten der Sitz meines Schmerzes und meines Glückes war, und überlegte, wie ich diese Sache angehen sollte – zum Wohl aller Beteiligten.
Blackwood Manor wimmelte von ahnungslosen Sterblichen, die mir trotz kurzer Bekanntschaft sehr lieb geworden waren, und mit ahnungslos meine ich, sie hegten nicht den mindesten Verdacht, dass ihr geliebter Quinn Blackwood, Herr des Hauses, und sein mysteriöser neuer Freund Lestat Vampire sein könnten; und Quinn wünschte von ganzem Herzen, dass es auch dabei blieb und kein Unheil geschah, denn hier war sein Zuhause, und wenn er auch ein Vampir war, so wollte er doch dieses Band nicht reißen lassen.
Unter diesen Sterblichen Jasmine, die begabte schwarze Haushälterin, umwerfend gut aussehend (mehr davon später, denn das kann ich mir nicht verkneifen) und Quinns einstige Geliebte, sowie ihr kleiner Sohn Jerome, den Quinn gezeugt hatte, natürlich bevor er zum Vampir wurde. Jerome ist jetzt vier, er rennt gerade, seine Füße in Turnschuhen, die viel zu groß an seinem kleinen Körper wirken, vergnügt die gewundene Treppe hoch und runter; dann lebt dort Big Ramona, Jasmines Großmutter, eine königliche schwarze Lady mit weißem Haarknoten, die kopfschüttelnd mit sich selbst redet, während sie in der Küche für weiß der Himmel wen Abendessen zubereitet; schließlich ihr Enkel Clem, ein sehniger Schwarzer, der wie in seine katzengeschmeidige Haut hineingegossen wirkt; mit schwarzem Anzug und Binder angetan steht er innen vor dem Portal und schaut die Treppe hinauf, nicht unbegründet misstrauisch wegen der Dinge, die in Quinns Schlafzimmer vor sich gehen. Clem war der Chauffeur der kürzlich verstorbenen Hausherrin, Tante Queen, um die alle noch immer schmerzerfüllt trauern.
Ebenfalls im oberen Stockwerk sitzt in seinem Zimmer am Ende des Flurs Quinns ehemaliger Lehrer Nash Penfield zusammen mit dem dreizehnjährigen Tommy Blackwood vor einem ungeheizten Kamin. Tommy ist ein beeindruckender Jüngling, genau genommen Quinns Onkel, tatsächlich aber eher sein Adoptivsohn. Er weint immer noch leise über den Tod der alten, großen Dame, von der ich eben sprach. Tommy reiste mit ihr drei Jahre lang quer durch Europa, was seine Persönlichkeit geprägt hat.
Im hinteren Teil des Grundstücks sitzen abwartend die Stallburschen Allen und Joel in einem offenen, erleuchteten Teil des Stallgebäudes; sie lesen die Weekly World News und lachen immer wieder laut, während der Lärm eines Football-Spiels aus dem Fernseher dröhnt.
Was das Herrenhaus angeht, lassen Sie es mich detailliert beschreiben. Ich liebe es. Ich finde, dass es perfekt proportioniert ist, was man nicht immer von amerikanischen neoklassizistischen Gebäuden sagen kann, aber dieses hier, das stolz oben auf dem terrassenförmig abfallenden Grundstück prangt, ist mit seiner langen, mit Pekannuss-Bäumen bepflanzten Auffahrt und seinen herrschaftlichen Fenstern mehr als nur ansprechend und einladend.
Das Innere? Was Amerikaner riesenhafte Räume nennen. Staubfrei, gepflegt. Überall Kaminuhren, Spiegel, Bilder und Perserteppiche, und die unvermeidliche Zusammenstellung von Mahagoni-Möbeln des neunzehnten Jahrhunderts und Möbeln im imitierten Hepplewhite- und Louis-XIV-Stil, die man als traditionell amerikanisch oder antik bezeichnet. Über dem Ganzen liegt das Summen der auf Hochtouren laufenden Klimaanlage, die nicht nur wie durch einen Zauber kühlt, sondern gleichzeitig durch den konstanten Geräuschpegel bei Gesprächen die Privatsphäre wahrt.
Ich weiß, ich weiß, ich hätte zuerst die Szenerie beschreiben sollen und dann die Menschen. Na und? Ich konnte nicht logisch denken, dazu war ich viel zu sehr ins Grübeln vertieft. Merricks Schicksal nahm mich einfach mit.
Natürlich hatte Quinn behauptet, er habe gesehen, wie das himmlische Leuchten beide umfing, den unerwünschten Geist Goblin und Merrick, und für ihn war diese Szene hier auf dem Friedhof eine Offenbarung gewesen – doch für mich war es etwas völlig anderes, denn alles, was ich sah, war, dass Merrick sich selbst in die Flammen stürzte. Ich hatte geheult, geschrien, geflucht.
Okay, genug von Merrick. Aber vergessen Sie sie nicht, ich werde bestimmt später noch auf sie zurückkommen. Wer weiß? Vielleicht erwähne ich sie, wann immer mir danach zumute ist. Wer schreibt denn dieses Buch? Nein, nehmen Sie das nicht ernst. Ich versprach Ihnen eine Geschichte, also bekommen Sie auch eine.
Wichtig ist – oder war dass ich wegen der Vorgänge im Haus eigentlich gar keine Zeit hatte, Trübsal zu blasen. Merrick für immer verloren, die lebensprühende, unvergessliche Tante Queen auch. Rings um mich nichts als Kummer. Nur war gerade etwas sehr Überraschendes eingetreten, weshalb mich mein teurer Quinn unverzüglich brauchte.
Natürlich zwang mich niemand, an irgendetwas auf Blackwood Farm Anteil zu nehmen.
Ich hätte mich einfach raushalten können.
Quinn, der Zögling, hatte Lestat, den Herrlichen (ja, ich mag diesen Titel), gebeten, ihm dabei behilflich zu sein, Goblin loszuwerden, und da Merrick den Geist mit sich ins Jenseits genommen hatte, war ich hier im Grunde fertig und hätte hinaus ins sommerliche Abendrot reiten können, während sämtliche Angestellten sagen würden: »Wer war eigentlich dieser umwerfende Kerl?« Doch ich konnte Quinn nicht im Stich lassen.
Quinn steckte wegen dieser Sterblichen wirklich in der Klemme. Und ich war heftig in Quinn verliebt. Quinn, zweiundzwanzig, als er die Bluttaufe empfing, hatte Visionen und übersinnliche Träume, war charmant und stets freundlich, ein von Leid geplagter Jäger der Nacht, den nur das Blut der Verdammten und die Gesellschaft liebevoller, erbaulicher Menschen gedeihen ließ.
(Liebevolle, erbauliche Menschen? Wie zum Beispiel ich? Der Junge irrt wohl schon mal! Nebenbei gesagt, war ich derart in ihn verliebt, dass ich eine verdammt gute Show hinlegte. Und kann man mich dafür verurteilen, dass ich die liebe, die in mir Liebe zu wecken vermögen? Ist das so schlimm bei einem professionellen Ungeheuer? Sie werden bald schon verstehen, warum ich ständig über meine moralische Entwicklung rede! Aber erst einmal weiter.)
Ich kann mich in jeden »verlieben« – in Männer, Frauen, Kinder, Vampire, in den Papst. Es spielt keine Rolle; ich bin der ultimative Christ. Ich sehe in jeder Person das Geschenk Gottes. Quinn jedoch liebte einfach fast jeder. Jemanden wie Quinn zu lieben fällt leicht.
Aber nun zu dem augenblicklichen Problem, zurück in das Schlafzimmer, in dem Quinn sich in diesem heiklen Augenblick aufhält.
Ehe wir beide uns an diesem Abend erhoben – ich hatte den eins neunzig großen, schwarzhaarigen jungen Mann mit den blauen Augen in eines meiner geheimen Verstecke mitgenommen –, war ein sterbliches Mädchen hier im Herrenhaus aufgekreuzt und hatte alle ziemlich erschreckt.
Aus diesem Grund behielt Clem die Treppe nach oben im Auge, murmelte Big Ramona vor sich hin und ging Jasmine besorgt und händeringend im Haus umher. Und auch der kleine Jerome war aufgeregt und rannte immer noch die gewundene Treppe hoch und runter. Selbst Tommy und Nash hatten ihr betrübtes Gespräch unterbrochen, um einen Blick auf dieses Mädchen zu werfen, und angeboten, ihr in ihrer Notlage beizustehen.
Es war für mich ganz einfach, ihre Gedanken zu durchforschen, um mir ein Bild von diesem bizarren Ereignis zu machen, und auch Quinns Gedanken, um zu erfahren, zu welchem Resultat er gekommen war.
Ich begab mich auch in die Gedanken des sterblichen Mädchens, als sie da auf Quinns Bett saß, inmitten eines Riesenberges wild durcheinander aufgehäufter, prächtiger Blumen, und mit Quinn redete.
Eine wahre Kakophonie an Gedankenströmen setzte mich über alles ins Bild. Und das Ganze löste eine kleine Panikattacke in meiner großen, tapferen Seele aus. Den Zauber der Finsternis wirken? Einen mehr von unserer Art schaffen? Jammer und Not! Kummer und Elend! Hilfe, Mord, Polizei!
Will ich wirklich eine weitere Seele aus dem Schicksalsstrom der Menschen rauben? Ich, der ich ein Heiliger sein möchte?
Der einst mit Engeln auf du und du stand? Ich, der für sich in Anspruch nimmt, die Inkarnation Gottes gesehen zu haben? Ich soll abermals jemanden in das – passen Sie auf! – Reich der Untoten führen?
Anmerkung: Fast das Beste daran, Quinn zu lieben, war, dass nicht ich ihn zum Vampir gemacht hatte. Der Junge war mir quasi in den Schoß gefallen. Ich hatte mich gefühlt, wie sich wohl Sokrates gefühlt haben muss, wenn all die zauberhaften griechischen Jünglinge Unterricht bei ihm nahmen, zumindest, bis jemand mit dem Schierlingsbecher auftauchte.
Zurück zum Thema: Wenn irgendjemand auf der Welt mit mir um Quinns Herz rang, dann war es dieses Mädchen, und er war da oben und versprach ihr unter hektischem Flüstern unser Blut, unsere zwiespältige Gabe der Unsterblichkeit.
Ja, dieses eindeutige Angebot kam über Quinns Lippen. Du lieber Gott, Junge, ein bisschen mehr Rückgrat, bitte!, dachte ich. Letzte Nacht hast du das Licht des Himmels erblickt!
Das Mädchen hieß Mona Mayfair. Merrick Mayfair kannte sie jedoch weder noch hatte sie auch nur von ihr gehört. Also vergessen Sie diese Verbindung gleich wieder. Merrick war ein Achtelblut, war bei den »farbigen« Mayfairs aufgewachsen, die im alten Stadtkern lebten, und Mona gehörte zu den weißen Mayfairs aus dem Garden District; sie vernahm wahrscheinlich nie auch nur ein Wort über Merrick oder ihre farbige Verwandtschaft. Und Merrick ihrerseits hatte sich nie für ihren berühmten weißen Familienzweig interessiert, sondern ihren eigenen Weg beschritten.
Aber Mona war eine echte Hexe – so sicher, wie Merrick eine war. Was ist eine Hexe? Nun, sie kann Gedanken lesen, zieht Geister und Gespenster magnetisch an und besitzt weitere übersinnliche Talente. Und ich hatte von Quinn in den letzten Tagen genug über den illustren Mayfair-Clan gehört, um zu wissen, dass Monas Verwandtschaft, allesamt Hexen, wenn ich mich nicht irrte, Mona gerade dicht auf den Fersen war, zweifellos in verzweifelter Sorge um das Kind.
Drei aus dieser bemerkenswerten Sippe hatte ich mir bei der Totenmesse für Tante Queen aus nächster Nähe ansehen können (und einer dieser Hexenmeister war sogar Priester! Ich mag nicht daran denken!), und warum sie sich jetzt so lange für die Suche nach Mona Zeit gelassen hatten, war mir schleierhaft, es sei denn, sie gingen es absichtlich langsam an.
Wir Vampire mögen Hexen nicht. Raten Sie mal, warum! Jeder Vampir mit einem Fünkchen Selbstachtung kann, selbst wenn er drei- oder viertausend Jahre alt ist, Sterbliche zumindest eine Zeit lang hinters Licht führen, und junge Vampire wie Quinn gehen ohne jedes Problem als Menschen durch. Jasmine, Nash, Big Ramona – sie alle betrachteten Quinn als Menschen. Er war exzentrisch? Oder gar verrückt? Ja, das alles dachten sie über Quinn. Aber für sie war er ein Mensch, und er konnte durchaus für längere Zeit unerkannt mitten unter ihnen leben. Wie ich schon erklärte, hielten sie auch mich für einen Menschen, obwohl ich darauf wahrscheinlich nicht zu lange hoffen durfte.
Nun, bei Hexen sieht die Sache anders aus. Hexen können alle möglichen Kleinigkeiten bei anderen Geschöpfen aufspüren. Das liegt wohl daran, dass ihre Kräfte unterschwellig, aber ohne Unterbrechung wirken. Ich hatte das während der Totenmesse gespürt, als ich einfach nur die gleiche Luft wie Dr. Rowan Mayfair, ihr Gatte, Michael Curry, und Father Kevin Mayfair atmete. Aber glücklicherweise waren sie durch eine Vielzahl anderer Stimuli abgelenkt, weshalb ich mich nicht aus dem Staub hatte machen müssen.
So viel dazu. Wo war ich noch stehen geblieben? Mona Mayfair war also eine Hexe, und zwar eine ausgesprochen talentierte. Deshalb hatte Quinn sich, seit er vor etwa einem Jahr das Blut der Finsternis bekommen hatte, feierlich geschworen, sie nie wiederzusehen, obwohl sie dem Tod geweiht war. Er fürchtete nämlich, sie könnte sofort erkennen, dass etwas Unheilvolles, Böses ihn des Lebens beraubt hatte, und er wollte sie nicht damit infizieren.
Vor einer Stunde jedoch war sie aus eigenem Antrieb und zu jedermanns höchster Verwunderung hierher gekommen: Aus der Mayfair-Klinik, in der sie seit mehr als zwei Jahren auf ihren Tod wartete, war sie in der riesigen Limousine der Familie hergefahren; sie hatte sie dem Chauffeur unter der Nase wegstibitzt (der Unglücksrabe hatte eine Zigarette geraucht und sich die Füße vertreten, als sie davongebraust war, und das letzte Bild, das sie von ihm in ihrem Geist sah, war, wie er hinter ihr herrannte).
Dann hatte sie die Blumenläden, in denen der Name Mayfair Gold wert war, abgeklappert und gekauft, was sie an Blumen bekommen konnte, ohne warten zu müssen – dicke gebundene Sträuße und ganze Arme voll loser Blumen, und dann war sie über die lange Brücke, die den See überspannt, und die Auffahrt hinauf zum Herrenhaus gefahren. Barfuß, nur mit einem klaffenden Krankenhausnachthemd angetan, war sie aus dem Wagen gestiegen, ein Bild des Schreckens – ein Skelett mit einem Wust roter Haare und auf schwankenden Beinen, an denen die mit blauen Flecken übersäte Haut herabhing hatte sie Jasmine, Clem, Allen und Nash dazu gebracht, die Blumen in Quinns Zimmer zu bringen, wobei sie ihnen versicherte, dass sie Quinns Erlaubnis hatte, alle auf sein Himmelbett zu häufen – sie beide hätten einen Pakt geschlossen, nur keine Sorge.
Erschreckt, wie sie waren, hatten alle ihr gehorcht.
Immerhin wusste jeder, dass Mona Mayfair schon Quinns große Liebe gewesen war, ehe seine geliebte Tante Queen, weitläufige und wortgewandte Erzählerin, darauf bestanden hatte, dass Quinn sie auf ihrer »allerletzten Reise« durch Europa begleitete, die sich schließlich über drei Jahre hinzog. Und als Quinn heimkam, musste er feststellen, dass Mona im Mayfair-Klinikum auf der Isolierstation und für ihn unerreichbar war.
Dann hatte Quinn das Blut der Finsternis bekommen – gewaltsam und auf perfide Weise, und ein weiteres Jahr war vergangen, in dem Mona im Krankenhaus hinter Glas verschlossen war, selbst dafür zu schwach, Quinn eine Nachricht hinzukritzeln oder einen Blick auf die Blumen zu werfen, die er ihr täglich schickte, und …
Doch zurück zu den besorgten Hilfstruppen, die die Blumen nach oben in Quinns Zimmer brachten.
Das ausgezehrte Mädchen selbst – zwanzig war sie etwa, das ist für mich ein Mädchen – konnte es unmöglich die Treppe hinauf schaffen, und so hatte sie Nash Penfield, Quinns ehemaliger Lehrer, der geborene Gentleman (und verantwortlich für einen Großteil von Quinns »letztem Schliff«), ritterlich nach oben getragen und in »ihre Blumenlaube«, wie sie es nannte, gelegt, wobei das Kind ihm versicherte, dass die Rosen keine Dornen hatten. Mit eigenen Versen vermischte Shakespeare-Zitate auf den Lippen, war sie in das Himmelbett gesunken: »Ich bitt’, auf mein geschmücktes Brautbett lasst mich sinken, und streuet später sie dann auf mein Grab.«
In diesem Moment war der dreizehnjährige Tommy vor ihrer Tür aufgetaucht und, immer noch in frischer Trauer um Tante Queen, bei Monas Anblick so außer Fassung geraten, dass er zu zittern begonnen hatte, woraufhin ihn der besorgte Nash fortbrachte, während Big Ramona blieb und in einem Bühnenflüstern, das des großen Barden Albions würdig war, verkündete: »Das Mädchen liegt im Sterben!«
Woraufhin die kleine rothaarige Ophelia lachte. Und um eine Dose kaltes Mineralwasser bat.
Jasmine hatte gedacht, das Kind würde auf der Stelle seinen Geist aushauchen, was auch leicht hätte sein können, aber das Kind sagte, nein, sie warte auf Quinn, und bat alle, aus dem Zimmer zu gehen. Als Jasmine dann mit einem Glas Mineralwasser angehastet kam, in das sie einen gebogenen Strohhalm gesteckt hatte, mochte das Mädchen kaum etwas trinken.
Man kann sein ganzes Leben in Amerika verbringen, ohne je einen Menschen in einem solchen Zustand zu Gesicht zu bekommen. Im achtzehnten Jahrhundert allerdings, als ich geboren wurde, war dies nichts Ungewöhnliches. In Paris verhungerten die Menschen in jenen Tagen auf der Straße. Rings um einen herum starben sie. Die gleichen Zustände herrschten im neunzehnten Jahrhundert in New Orleans, als die hungernden Iren dort eintrafen. Man sah damals viele Bettler, die nur noch Haut und Knochen waren. Heutzutage muss man schon Missionsstationen im Ausland aufsuchen oder spezielle Hospize, um Menschen so wie Mona Mayfair leiden zu sehen.
Big Ramona hatte als Nächstes verkündet, dass jenes Bett ebendas war, in dem ihre Tochter (Little Ida) gestorben war, und dass es kaum das passende Bett für ein krankes Kind sei. Daraufhin hatte Jasmine, ihre Enkelin, »Pscht« gemacht und Mona so heftig lachen müssen, dass sie einen Erstickungsanfall bekam und sich qualvoll wand. Doch sie hatte sich gefangen.
Wie ich da auf dem kleinen Friedhof stand und die phantastischen Bilder dieser nahezu zeitgleich ablaufenden Ereignisse vor meinem geistigen Auge sah, dachte ich daran, dass Mona so um die ein Meter fünfundfünfzig groß war, sehr zartgliedrig gebaut und einst eine wahre Schönheit. Nun aber hatte die Krankheit, die durch eine traumatische Niederkunft ausgelöst worden war – etwas, was mir trotz all meiner telepathischen Talente noch recht unklar war –, an Mona so gründlich ihr Werk verrichtet, dass sie kaum dreißig Kilo wog, und ihr katastrophaler Zustand wurde durch den üppigen Wust roter Haare noch auf makabre Weise betont. Sie war dem Tod so nahe, dass einzig noch der pure Lebenswille sie in dieser Welt hielt.
Dieser Wille und ihre Hexenkünste – die hochgradige Suggestionskraft, die Hexen zu Eigen ist – hatten ihr zu den Blumen verholfen und bei ihrer Ankunft allen hier so viel Respekt und Unterstützung abgenötigt.
Aber nun, nachdem Quinn gekommen war, endlich an ihrer Seite stand und diese eine kühne Hoffnung, die sie während all ihrer Sterbestunden genährt hatte, erfüllt war, gingen die Schmerzen, die in ihren Organen und ihren Gelenken tobten, fast über ihre Kraft. Ihre Haut schmerzte fürchterlich, und selbst das Sitzen – inmitten all der köstlichen Blumen – verursachte ihr Qualen.
Dass mein tapferer Quinn nun allen Abscheu, mit dem er sein Schicksal betrachtete, verleugnete und ihr das Blut der Finsternis anbot, überraschte mich nicht sehr, muss ich zugeben, aber ich wünschte, dass er es nicht getan hätte.
Es ist schwer, jemanden sterben zu sehen, wenn man weiß, dass man diese böse, widersprüchliche Gabe besitzt; und Quinn liebte Mona immer noch, auf natürliche wie auf übersinnliche Art und Weise, sodass er es nicht ertragen konnte, sie leiden zu sehen. Wer könnte das schon?
Wie ich bereits erklärt habe, hatte Quinn jedoch in der vergangenen Nacht eine Offenbarung gehabt, als er Merrick und diesen Geist Goblin, seinen Doppelgänger, ins Himmlische Licht hatte eingehen sehen.
Warum also, um Gottes willen, hatte er sich nicht einfach darauf beschränkt, Monas Hand zu halten und sie beim Sterben zu begleiten? Sie würde nicht einmal mehr bis Mitternacht zu leben haben.
Tatsache ist, dass er nicht die Kraft hatte, sich von ihr zu lösen. Natürlich wäre Quinn niemals von sich aus zu ihr gegangen, sollte ich anmerken; er hatte sie stets tapfer vor seinem Geheimnis geschützt. Nun aber war sie selbst zu Quinn gekommen, hierher in sein Zimmer, mit der Bitte, in seinem Bett sterben zu dürfen, und er war ein männlicher Vampir, es war sein Territorium, seine Höhle, sein Versteck, und ein paar männliche Hormone taten ein Übriges, ob er nun ein Vampir war oder nicht, und als er Mona nun in den Armen hielt, übermannten ihn die heftigsten Besitzansprüche und die phantastische Idee, sie retten zu müssen.
Ebenso sicher, wie ich all das wusste, wusste ich auch, dass er den Zauber der Finsternis nicht wirken durfte. Er hatte es noch nie getan, und sie war viel zu hinfällig. Er würde sie ziemlich sicher umbringen. So ging es nicht. Wenn sich das Mädchen für das Blut der Finsternis entschied, landete sie womöglich in der Hölle! Ich musste da hoch! Vampir Lestat eilt zu Hilfe!
Sie denken jetzt: »Lestat, ist das etwa eine Komödie? Komödien wollen wir aber nicht!« Nein, es ist keine!
Okay, weiter. Ich wählte wie ein gewöhnlicher Sterblicher den Weg durch die Haustür, klapperdiklapp, was Clem erschreckt zusammenzucken ließ; ich warf ihm ein einschmeichelndes Lächeln zu: »Ich bin’s, Quinns Freund Lestat, ach, hab ich Sie erschreckt? Übrigens, Clem, halten Sie den Wagen bereit, wir wollen nachher noch nach New Orleans, okay, Mann?« Damit hastete ich die geschwungene Treppe hinauf, grinste im Vorbeigehen dem kleinen Jerome zu und drückte Jasmine, die verloren im Korridor stand, einmal kurz an mich, dann öffnete ich telekinetisch das Schloss an Quinns Tür und trat ein.
Trat ein? Warum nicht »ging rein«? Nun ja, das ist der gekünstelte Stil, den ich loswerden muss. Genau genommen schoss ich in das Zimmer.
Ich verrate Ihnen jetzt ein kleines Geheimnis: Telepathisches Sehen ist nur ein Zehntel so intensiv wie das, was ein Vampir mit seinen eigenen Augen sieht. Telepathie ist cool, zweifellos, aber was wir mit unseren Augen sehen, ist beinahe schon unerträglich intensiv. Deshalb spielt Telepathie in diesem Buch auch kaum eine Rolle. Ich bin schließlich ein Sinnenmensch.
Und Monas Anblick, wie sie da am Fußende des großen, kunstvoll drapierten Himmelbetts saß, zerriss mir das Herz. Das Mädchen litt stärker, als Quinn sich vorstellen konnte. Selbst sein Arm, den er um sie gelegt hatte, verursachte ihr Schmerzen. Ich rechnete aus, dass sie eigentlich schon vor zwei Stunden hätte sterben müssen. Ihre Nieren hatten versagt, ihr Herz stotterte, und ihr fehlte die Kraft, tief einzuatmen, um ihre Lunge mit Sauerstoff zu füllen.
Aber ihre makellosen grünen Augen waren weit geöffnet, als sie mich ansah, und ihr scharfer Intellekt verstand auf einer rein mystischen Ebene über alle Worte hinaus ganz klar, was Quinn ihr zu erklären versuchte: Dass ihr Sterben ins Gegenteil verkehrt werden könnte, dass sie sich uns anschließen könnte, dass sie für immer zu uns gehören könnte. Uns, dem Stand der Vampire, den Untoten. Unsterbliche Mörder. Für immer außerhalb des Lebens stehend.
Ich kenne dich, kleine Hexe. Wir leben ewig. Fast lächelte sie.
Würde der Zauber der Finsternis die Verheerungen rückgängig machen, die ihren einst so schönen Körper gezeichnet hatten? Darauf können Sie wetten!
Vor zweihundert Jahren, in einem Zimmer auf der Île St.-Louis in Paris, hatte ich gesehen, wie Alter und Auszehrung vom ausgemergelten Körper meiner Mutter abgefallen waren, als das Blut der Finsternis seinen Zauber in ihr wirkte. Dabei war ich in jenen Nächten nur ein blutiger Anfänger gewesen, den Liebe und Furcht zu der Umwandlung gedrängt hatten. Ich hatte es zum ersten Mal getan und nicht einmal gewusst, wie man es nennt.
»Lass mich den Zauber wirken, Quinn«, sagte ich, ohne zu zögern. Erleichterung durchflutete ihn förmlich. Er war so unschuldig, so durcheinander. Natürlich fand ich es nicht so toll, dass er zehn Zentimeter größer war als ich, aber eigentlich machte das nichts aus. Er war trotzdem mein »kleiner Bruder«. Ich hätte so ziemlich alles für ihn getan. Und dann war da ja noch Mona. Eine kindhafte Hexe, eine Schönheit, ein scharfer, lebhafter Geist, eigentlich fast nur noch Geist, an den der Körper sich verzweifelt zu klammern versuchte. Quinn und Mona schmiegten sich enger aneinander. Ihre Hand umklammerte die seine. Konnte sie sein widernatürliches Fleisch fühlen? Ihre Augen waren auf mich geheftet.
Ich durchquerte das Zimmer. Ich nahm die Sache in die Hand. Ich setzte ihr alles mit eindrucksvollen Worten auseinander. Ja, wir waren Vampire, aber sie, Mona, unser teurer Schatz, hatte die Wahl. Ich fragte mich, warum Quinn ihr nicht von dem Himmlischen Licht erzählt hatte? Er hatte es mit eigenen Augen gesehen! Er kannte das Ausmaß göttlicher Vergebung noch besser als ich.
»Du kannst dich später noch immer für das Himmlische Licht entscheiden, chérie«, sagte ich. Ich lachte. Ich konnte es nicht unterdrücken. Es war zu wunderbar.
Sie war so lange krank gewesen, hatte so lange gelitten. Und die Geburt, das Kind, das sie ausgetragen hatte, es war ein Monstrum gewesen, man hatte es ihr fortgenommen – diese Geschichte hatte ich immer noch nicht ganz durchschaut. Aber lassen wir das. Monas Vorstellung von Ewigkeit war einzig und allein, eine segensreiche Stunde lang keine Schmerzen mehr zu haben, eine segensreiche Stunde ohne Qual atmen zu können. Wie konnte sie jetzt eine Entscheidung treffen? Nein, für dieses Mädchen gab es keine Wahl. Ich sah den langen Flur, den sie so viele lange Jahre unerbittlich durchmessen hatte – die Blutergüsse von den Infusionsnadeln, die sie am ganzen Körper hatte, die Medikamente, die ihr Übelkeit verursachten, der von unterschwelligen Schmerzen gepeinigte Halbschlaf, das Fieber, der seichte, von trüben Träumen durchdrungene Schlummer, Bücher und Filme und Briefe, die sie hatte fortlegen müssen, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnte, und durch das gleißende, von den Jahreszeiten unabhängige Krankenhauslicht und das unentrinnbare, betriebsame Klappern und Klirren war ihr selbst die tiefe Dunkelheit versagt.
Sie streckte die Arme nach mir aus. Sie nickte. Ihre Lippen trocken und aufgesprungen. Rote Haarsträhnen. »Ja, ich will es«, sagte sie.
Und über Quinns Lippen kamen die unvermeidlichen Worte: »Erlöse sie.«
Sie erlösen? Wollte der Himmel sie etwa nicht?
»Deine Familie kommt«, sagte ich stattdessen. »Sie wollen dich holen.« Ich hatte nicht damit herausplatzen wollen. War ich selbst unter einen Bann geraten, als ich in ihre Augen blickte? Aber ich konnte sie deutlich hören, die Mayfairs, wie sie schnell näher kamen. Ein Krankenwagen, die Sirenen ausgeschaltet, bog in die Auffahrt mit den Pekannuss-Bäumen ein, direkt dahinter folgte die große Limousine.
»Nein, sie sollen mich nicht mitnehmen«, rief Mona, »ich will bei euch bleiben!«
»Süße, dies hier ist für immer«, sagte ich.
»Ja!«
Ewige Finsternis, ja, Verdammung, Gram, Isolation, ja.
Ach, und mit dir, Lestat, ist es doch immer das Gleiche, du Teufel; du willst es tun, du willst es sehen, du gierige kleine Bestie, du kannst sie einfach nicht den Engeln lassen, obwohl du doch weißt, dass sie warten! Du weißt, der Gott, der ihre Leiden heiligen kann, hat sie geläutert und wird ihr dieses letzte Aufbegehren vergeben.
Ich schob mich näher an sie heran, drängte Quinn sanft zur Seite.