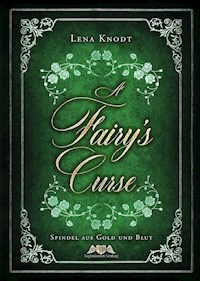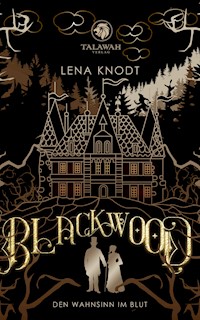
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Talawah Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine rätselhafte Vergangenheit. Ein finsteres Herrenhaus im Wald. Und ein Geheimnis, das Jack und Lively an die Grenzen ihres Verstandes stoßen lässt. England, 1905: Nach der Schließung ihres ehemaligen Kinderheims erhalten die Zwillinge Jack und Lively beunruhigende Hinweise über ihren Vater, die sie in das kleine Dorf Westingate und auf die Spur seiner mysteriösen Vergangenheit führen. Die Antworten auf ihre Fragen scheinen in der dunklen Villa Whitefir Mansion zu liegen, doch bei den Bewohnern stoßen sie auf nichts anderes als Schweigen. Woher kannte der Hausherr ihren Vater? Und was hat es mit den quälenden Schreien aus dem Keller auf sich? Je näher die beiden der Wahrheit kommen, desto weiter entfernen sie sich voneinander – und mit dem beklemmenden Misstrauen erwacht der Zweifel an ihnen selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Blackwood
Den Wahnsinn im Blut
von Lena Knodt
Besuchen Sie uns im Internet:
www.talawah-verlag.de
www.facebook.com/talawahverlag
erschienen im Talawah Verlag
2. Auflage 2021
© Talawah Verlag
Text: Lena Knodt
Umschlaggestaltung: Jaqueline Kropmanns,
www.jaqueline-kropmanns.de
Lektorat: Sascha Eichelberg
Satz: Julia Antonia Reimann
Julia Antonia Reimann - Buchsatz | Facebook
unter Verwendung von: © Pixabay
Illustration der Kapitel: Nemesis Forsa
Korrektorat: Anette Brauer
ISBN: 978 394 7550 593
Blackwood
Den Wahnsinn im Blut
Von Lena Knodt
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Vorwort
Liebe Leser_innen, stolz und aufgeregt präsentiere ich euch meinen sechsten Roman Blackwood – Den Wahnsinn im Blut. Bevor ich ein paar inhaltlich einleitende Worte verliere, möchte ich zunächst meinen Dank aussprechen an all die Menschen, die an diesem Buch mitgewirkt haben: Meine Testleser_innen, meinem Lektor Sascha Eichelberg, der Coverdesignerin Jaqueline Kropmanns und Annette Brauer und Julia Reimann, die sich um Korrektorat und Buchsatz gekümmert haben. Das mir größte Anliegen war und ist es immer, mich bei denen zu bedanken, die mir im privaten Bereich kompromisslos zur Seite stehen und die mich jeden Tag zum Durchhalten und Weitermachen motivieren – eine Tatsache, die ich niemals als selbstverständlich annehmen kann und will: Ich danke meiner wunderbaren Familie. Dieses Buch habe ich für euch geschrieben! Aber was erwartet euch Leser_innen auf den nächsten 300 Seiten? Blackwood ist düsterer als meine bisherigen Bücher, aber auch nachdenklicher, vielleicht ein wenig bildhafter. Die Idee zu Blackwood kam mir durch ein Lied und durch die Beschäftigung mit Schauerliteratur wie Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, was sich immer noch in den zentralen Motiven des Romans widerspiegelt.
Der Schreib- und Überarbeitungsprozess war dabei ziemlich aufwendig, da ich immer genau so viele Informationen preisgeben wollte, dass es spannend blieb, aber nicht zu unübersichtlich wurde. Innerhalb des Buches gibt es einige genretypisch etwas düsterere Szenen, die Themen behandeln, die für manche Menschen belastend sein könnten. Eine Aufzählung dieser Themen findet ihr am Ende des Vorworts. Jetzt bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen, bei eurer Suche nach dem Geheimnis der Blackwood-Familie und eurer Reise ins kleine aber gar nicht so verschlafene Westingate.
Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es euch gefallen wird – danke, dass ich euch mit auf diese Reise nehmen darf. Für Anregungen, Rezensionen, Meinungen und Fragen kontaktiert mich gerne!
Lena Knodt
www.lena-knodt.de
Inhalts-Hinweise: Mord, Alkoholsucht, Verlust, Gewalt im Kindesalter
Prolog
Nebelschwaden ruhten auf dem Wald wie eine weißgraue Decke. Verklebt in den Spitzen der Bäume, vor dem Morgen nicht zu weichen bereit.
Ezra schaute aus dem schmalen Turmfenster hinab auf das trostlose Bild, das sich ihm bot. Seine zitternden Finger kratzten über das Fensterbrett und er zog sie in eine Faust, in der Hoffnung, sie ruhig zu stellen.
Auch er selbst fühlte sich trostlos. Rastlos zwar, merkwürdig aufgeregt, aber trostlos. Schon den ganzen Tag hatte er das Gefühl gehabt, sein Herz schlüge schneller als sonst. Das Gefühl, als hätte ihn jemand gepackt und aus dem Rahmen gerissen, in den er eigentlich gehörte.
Ezra drehte sich um, humpelte, ignorierte den stechenden Schmerz in seinem Bein, in dem vor wenigen Stunden noch bis zum Anschlag ein Messer gesteckt hatte. Der Verband war bereits von rotem Blut durchtränkt und mit jedem weiteren Tropfen floss auch ein bisschen Wärme aus seinem Körper. Ein Stück Wille, ein Stück der Barriere, die er so hartnäckig aufrechterhielt. Die er aufrechterhalten musste, um jeden Preis.
Nicht mehr lange.
Nur noch ein paar Minuten.
Schmerz zog sich in seiner Bauchhöhle zusammen, ätzte in sein Fleisch. Die Gefühle, die er die letzten Wochen, ja Monate hatte verdrängen müssen, suchten sich nun einen Weg nach draußen. Angst und Schuld. Trauer und Panik. Doch schnell schob er sie an den Rand seines Bewusstseins, bevor sie seinen Geist schwächten. Jeder kleinste Riss in seiner Selbstbeherrschung konnte tödlich sein.
Er drehte sich um und schritt in die Mitte des Raumes bis an den Teppich, auf dem ihr kalter Leichnam lag.
Reine Schönheit. Die Konturen, ihre weiche Haut. Perfektion, nur zerstört von ihrem starren Blick, den panisch aufgerissenen Augen. Von dem Blut in ihrem Haar. Und von der zerfetzten Kehle.
»Und so geht es zu Ende, Röschen«, flüsterte Ezra. Jedes Wort kratze in seinem Hals. Die Erinnerung drohte, ihn jeden Moment zu überwältigen. Aber er war standhaft. Und er hatte sich daran gewöhnt.
Ein Blick auf seine Taschenuhr verriet ihm, dass es kurz vor Mitternacht war. Schnell warf er seinen Mantel über und wollte nach dem Zylinder greifen, bevor er verharrte. Es war ihm, als spürte er ihren Blick im Nacken. Brennend, vorwurfsvoll. Er wusste nicht, was ihn dazu verleitete, aber am Ende stieg er ohne Kopfbedeckung hinab und verließ das Haus.
Der Garten war im grausigen Licht des Mondes nichts als ein Meer aus Schatten. Bedächtig ging er weiter. Seine Schritte das einzige Geräusch in der stillen Nacht.
Er sah seinen Freund schon von weitem. Er stand auf dem gepflasterten Platz vor dem Brunnen und hatte ihm den Rücken zugewandt. Als Ezra einige Meter von ihm entfernt stehen blieb, drehte er sich um. Auf seinen Lippen ein Lächeln, das seiner sonstigen Erscheinung nicht entsprechen wollte. Sein Mantel war leicht geöffnet und ein weißes, zerknittertes Hemd schaute daraus hervor. Er war unrasiert, seine Tränensäcke angeschwollen. Eine Hand hatte er halb hinter dem Rücken versteckt und ... Ezra erstarrte.
»Du bist gekommen«, sagte sein Freund. Langsam hob er die Hand und richtete den Lauf der Pistole zitternd auf das Gesicht seines Gegenübers. »Wo ist sie?«
»Was soll das?«, fragte Ezra. Die Mündung der Pistole übte eine seltsame Faszination auf ihn aus. Er musste sich zwingen, seinem Freund ins Gesicht zu sehen und nicht auf das verheißungsvolle schwarze Rohr der Waffe.
»Du weißt, dass es besser so ist.«
Ezra sah, dass die Stirn seines Freundes nass von Schweiß war.
Wut stieg in ihm auf, Wut über diese Dummheit. Sein Freund wusste genau, dass eine Kugel ihn nicht besiegen konnte.
Unter seinen Fingerkuppen begann es zu kribbeln. Langsam breitete es sich aus, über die einzelnen Glieder bis in die Handflächen. Er wollte es unterdrücken, aber gleich darauf gab er auf. Nicht heute. Heute hatte er keine Kraft dafür.
Ein unangenehm drückendes Gefühl breitete sich in Ezras Kopf aus, doch er hielt seine Miene unbewegt. Es durfte nur nicht die Maske durchbrechen, die er nach außen hin aufrechterhielt.
Dann Ruhe.
Verharren.
Ein Moment der Verheißung, der Hoffnung. Ein Moment des letzten Atemzugs.
Dann explodierte es in seinem Kopf.
In Wellen aus Hitze breitete es sich weiter aus, sammelte sich in seinem Nacken und kletterte in quälender Langsamkeit seine Wirbelsäule hinab.
Ezras Finger verkrampften sich, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Und doch stand er aufrecht. Die Frage war nur, wie lang.
»Blackwood«, raunte sein Freund. »Was tust du da?«
Doch er war nicht mehr Blackwood. Nicht mehr Ezra. Und er besaß nicht mehr die Macht über seinen eigenen Körper.
Er wurde zurückgedrängt, als sich die brennende Masse durch seine Glieder schob, sich durch seine Blutbahnen wand, bis sie zu zerplatzen drohten. Es blieb kaum mehr als ein Funke seines Bewusstseins. Und selbst um diesen Funken musste er kämpfen wie ein wildes Tier.
Er sank auf die Knie und seine Finger bohrten sich zwischen die Bodenpflaster, sein ganzer Körper verkrampfte sich. Er hustete, Blut spritzte über den Stein.
Dann ein Schuss.
Mit Wucht schleuderte er ihn zurück, doch Ezra spürte keinen Schmerz. Nur Angst und Panik. Die Barriere um sein Herz zerbrach. Erst zeigten sich nur Risse, doch sie breiteten sich in rasender Geschwindigkeit aus, bis der Wall in sich zusammenstürzte.
Nun schlugen all die Empfindungen über ihm zusammen. Es gab keinen Grund mehr, sie zurückzuhalten. Er sah wieder ihr Gesicht, blass. Ihre Lippen, grau. Die Augen aufgerissen. Augen aus Glas.
Ein zweiter Schuss.
Verdammt.
Es war anders als sonst. Es fiel ihm schwerer, den Funken zu erhalten, der ihn ausmachte. Der ihn immer wieder zurückgeführt hatte.
Es war stärker.
Dieses Mal würde es ihn zerreißen.
Kapitel 1
Haltlos prasselte der Regen auf den Asphalt, als hätte der Himmel beschlossen, seine Schleusen zu öffnen und all die angestaute Wut auf sie hinabzuschütten. Dicht aneinandergedrängt eilten Jack und Lively über den Gehsteig, vorbei an gewundenen Gaslaternen, bis sie das verrostete Tor erreichten.
Es war nur angelehnt, also packte Jack das Metall und zog es auf. Sein Mantel lag schwer und von Wasser vollgesogen auf seinen Schultern. Hastig schob er sich die klatschnassen Strähnen aus dem Gesicht und trat voran durch die entstandene Lücke.
Das Kinderheim St. Alberts lag inmitten eines kleinen Parks, in dem man den vorgegebenen Weg zwischen all den wuchernden Pflanzen und Bäumen erst suchen musste. Vor allem, da das Wetter die Sicht noch verschlechterte.
Jack presste die Lippen aufeinander. Beklemmung ergriff von ihm Besitz. Eine Spannung, die er kannte. Ein wohlbekannter Geruch stieg ihm in die Nase. Er konnte ihn nicht benennen, ihn keinem speziellen Gegenstand oder keiner Person zuschreiben, doch er brachte die Erinnerungen zurück, als würde ihm jemand mit geballter Kraft ins Gesicht schlagen.
Er stolperte. Er sah Frauen in dunklen Kutten. Lange Stöcke in ihren Händen. Kinderschreie. Dann Kinderlachen. Stundenlange Versteckspiele im Park, bis man nicht mehr wusste, ob die anderen überhaupt noch suchten. Eintöniges Essen in kleinen grauen Schalen. Gespräche, viele Gespräche.
Ein kalter Raum im Keller. Ein noch kälterer Stuhl.
»Jack?«, fragte Lively sacht und legte ihm eine Hand auf den Rücken. »Alles in Ordnung?«
»Natürlich«, antwortete er etwas zu schnell. Er fuhr sich durch das Gesicht und zwang sich zu einem Lächeln. »Ich habe mich nur an die Versteckspiele mit Will erinnert.«
Lively betrachtete ihn skeptisch, fragte jedoch nicht weiter nach. Er war nur ihretwegen mitgekommen, denn eigentlich hatte er sich geschworen, nie wieder einen Fuß auf dieses Grundstück zu setzen. Doch als Lively von der baldigen Schließung ihres alten Kinderheims erfahren hatte, hatte sie ihn beinahe angefleht, mit ihr hierher zu gehen. Es wunderte ihn nicht, dass er nachgegeben hatte. Sie war schon immer seine größte Schwachstelle gewesen und würde es immer bleiben. Aber wenn er sie betrachtete, ihre vor Aufregung geröteten Wangen und ihre Hände, die sie immer wieder nervös in eine Faust zog und lockerte, bereute er es nicht. Er würde diese Erinnerungen schon überleben.
Schweigend stiegen sie die Stufen hinauf, bis sie vor der riesigen Tür aus schwarz angemalter Eiche standen. Jack plusterte die Backen auf und hielt für einen Moment die Luft an. Seit fünf Jahren hatte er dieses Gebäude nicht mehr betreten. Doch auch wenn er es in den Momenten des Schmerzes kaum geglaubt hatte – mit den Jahren verblasste er.
Lively drehte sich das letzte Mal mit einem nicht zu deutenden Gesichtsausdruck zu ihrem Bruder um. Die dunkelblonden Haare klebten an ihren Wangen. Dann hob sie die Hand, umfasste den Türklopfer aus Messing und schlug ihn dreimal heftig gegen das Holz.
Stille antwortete ihnen. Einige Sekunden starrten sie auf die Tür, dann warfen sie sich einen fragenden Blick zu. Nicht einmal Schritte waren auf der anderen Seite zu vernehmen.
»Vielleicht ist doch keiner mehr da«, flüsterte Jack. Aus irgendeinem Grund hatte er das Gefühl, die Stimme senken zu müssen.
Lively schüttelte den Kopf. »Doch, ich bin mir sicher.« Sie bediente den Türklopfer ein weiteres Mal. »Ist hier jemand?«, rief sie und versuchte, einen Blick durch eines der schmutzigen Fenster zu werfen.
»Macht nicht solch einen Lärm.« Eine Stimme ließ sie herumfahren. Jack musterte die Frau, die wie aus dem Nichts hinter ihnen aufgetaucht war. Sie trug eine schwarze Kutte und die Haare unter einem Tuch zusammengefasst, auf dem Regentropfen glitzerten. »Schwester Josepha«, sagte er und seine Mundwinkel hoben sich. Die Frau musterte sie einige Sekunden lang schweigend.
»Mr. und Miss Harpins«, sagte sie und ein Meer aus Falten überzog ihr Gesicht, als sie lächelte. Trotzdem war Jack nicht sicher, ob sie sich wirklich über ihren Besuch freute.
»Schwester!« Lively schob sich an Jack vorbei und reichte der älteren Frau die Hand. Diese umschloss sie mit ihren und drückte sie. »Wir dachten schon, alle hätten das Haus verlassen. Es schließt aber doch erst Ende der Woche, oder? Jedenfalls haben sie das im Pub erzählt.«
»Dem Geschwätz kannst du nicht glauben, Liebes.« Schwester Josepha machte eine wegwerfende Handbewegung. Man konnte ihr den Missmut bei Livelys Erwähnung des Pubs deutlich ansehen. »Die Kinder sind schon Anfang der Woche in ein neues Heim gebracht worden und auch die Plünderer haben sich bereits über das Inventar hergemacht.« Sie spuckte das Wort förmlich aus, obwohl sich Jack sicher war, dass sie nicht wirklich Plünderer meinte, sondern die Angestellten der Kirche, die das Haus noch nach Nützlichem abgesucht hatten.
»Nur ich bin noch da«, fuhr sie fort, untermalt von einem langen Seufzen. »Gerade habe ich mich von dem kleinen Garten verabschiedet. Es ist ein Jammer: Jahrelang habe ich ihn gepflegt und jetzt muss ich ihn der wilden Natur übergeben.«
Jack bekam unwillkürlich Mitleid mit der untersetzen Frau, auch wenn man diesen Garten selbst mit viel Wohlwollen nicht als gepflegt bezeichnen konnte. Er lächelte Schwester Josepha schmallippig an. Dann ließ er den Blick über die von dunklen Tannen umgebenen Beete schweifen und ein weiterer Schwall von Erinnerungen überströmte ihn. Hier hatte er als Kind gespielt, hier hatte er sich manchmal stundenlang vor seinen Peinigern versteckt. Meist waren sie zu langsam und schnell gelangweilt gewesen, sodass er sich nur hinter einen Busch hatte hocken und dort für eine Zeit verharren müssen. Es hatte nicht immer geklappt, das hatten die Spuren auf seiner Haut nur zu Genüge gezeigt.
Wieder musterte Josepha sie auf merkwürdige Weise und ein Glitzern trat in ihre Augen. »Ich würde euch gerne auf eine Tasse Tee einladen, Kinder.« Es klang mehr nach einem Befehl als einer Bitte.
Jack blickte zu Lively, doch seine Schwester zögerte keine Sekunde.
»Sehr gerne, Schwester. Heute ist die letzte Gelegenheit, in der wir in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgen können.«
Jack verengte die Augen und starrte seine Schwester von der Seite an, doch diese ging nicht darauf ein und folgte Josepha, die unter leise murmelnden Worten das Haus umrundete. Lively packte Jack ohne einen Blick in seine Richtung am Arm und zog ihn mit sich.
»Lively, ich weiß nicht ...«
»Sei still und komm mit«, entgegnete sie und starrte auf den Boden. Jack folgte ihrem Blick und versuchte, nicht über eine der Wurzeln zu stolpern, die die Steine des Gehwegs schon vor Jahrzehnten aufgebrochen hatten. Wahrscheinlich hatte die Kirche Recht, dass sie in diesen Ort hier kein weiteres Geld investieren wollte. Er sehnte sich nach dem Sessel am Kamin, in dem nur ein gutes Buch und keine unliebsamen Erinnerungen auf ihn warteten.
Er entriss seinen Arm Livelys klammerndem Griff und zog den Kragen seines Mantels um den Hals zusammen, um sich vor aufmüpfigen Regentropfen zu schützen.
Eine kleine Tür führte seitlich in die Räumlichkeiten, die Schwester Josepha gemeinsam mit den anderen Angestellten des Kinderheims bewohnt hatte. Sie betraten den schmalen Flur, der von einer brennenden Kerze auf einem Seitentisch schwach beleuchtet wurde.
Lively schälte sich aus ihrem nassen Mantel und hängte ihn an die Halterung neben der Tür. Jack zögerte einen Moment, hätte er seinen Mantel doch lieber anbehalten, um schnellstmöglich wieder aufbrechen zu können. Doch der strenge Blick seiner Schwester zeigte ihm, dass es keine Chance auf Entkommen gab. Mit einem Seufzen legte auch er seine Jacke zur Seite, während Lively der ehemaligen Heimleiterin in die Küche folgte. Seinen Zylinder legte er darunter ab.
Jack ging auf die Tür zu, bis sein Blick an der Kerze hängenblieb. Sie flackerte wild und beschien die hölzerne Marienfigur hinter ihr beängstigend. Die Schatten im Gesicht der heiligen Jungfrau sahen aus, als würde sie schwarze Tränen weinen.
Jack erschauderte und wandte sich von der Figur ab. Seit er das Kinderheim verlassen hatte, hatte er nie wieder eine Kirche von innen gesehen.
Als er die kleine Wohnküche betrat, hatte Josepha den Feuerherd bereits mit ein paar weiteren Scheiten bestückt und eine gusseiserne Kanne auf die Oberfläche gestellt. Es roch leicht nach Kamille, einem Duft, der auch der Ordensschwester immer anhing. Jack erinnerte sich nur zu gut daran, wie sie früher jedes Wehwehchen mit einem ihrer Kräuteraufgüsse behandelt hatte – von Prellungen bis Übelkeit. Das schien sich in den letzten Jahren nicht geändert zu haben, denn von der Decke hingen die verschiedensten Pflanzen getrocknet und ordentlich in kleinen Büscheln nebeneinander.
Jack zog den Kopf ein, bevor er sich seiner Schwester gegenüber an den Tisch fallen ließ. Er verengte die Augen und warf ihr einen halb scherzhaften bösen Blick zu, doch Lively verdrehte nur die ihren und grinste ihn herausfordernd an.
Josepha kehrte zu ihnen zurück, den Rücken gebeugt. Die Sorgenfalten auf ihrer Stirn verrieten, dass sie etwas beschäftigte. Mit einem energischen Kopfschütteln ließ sie sich auf dem freien Stuhl nieder. »Einfach geschlossen.« Sie senkte den Blick auf ihre Finger, die sie ineinander verschränkte. »Sie haben es einfach geschlossen. Wir sind ihnen vollkommen egal. Die Kinder sind ihnen vollkommen egal. Das Einzige, was ich bekommen habe, war ein Brief. Sie hatten noch nicht einmal den Anstand, es mir persönlich mitzuteilen.«
»Und wo werden Sie jetzt hingehen?«, fragte Jack und Mitleid regte sich in ihm. Für Schwester Josepha war dieses Kinderheim alles. Sie hatte es in jungen Jahren von ihrer Vorgängerin übernommen und es seitdem mit eiserner Hand und einiger Bestimmtheit geführt. Auch wenn er keine schöne Zeit hier verbracht hatte, hatte das sicher nicht an Schwester Josephas Engagement gelegen.
Josepha stieß einen herzzerreißenden Seufzer aus. »Ich gehe zurück ins Kloster. In mein Heimatkloster.« Ihrem Gesichtsausdruck zufolge war Heimat hier nicht mit positiven Gedanken behaftet.
»Wo liegt das?«, fragte Lively.
»In Barrytroot«, antwortete Josepha und kniff die Lippen so fest zusammen, dass alles Blut aus ihnen wich. Nun konnte Jack ihren Unmut noch besser nachempfinden. Barrytroot war eine winzige Hafenstadt, weit abgelegen und den Erzählungen nach zu urteilen der Inbegriff von Langeweile. Ein Exil, das nichts mit dem Trubel des Kinderheims gemein hatte.
»Sicherlich wird es nicht so schlimm, wie Sie denken. Sie können alte Freunde wiedertreffen und ...«
»Alte Freunde.« Schwester Josepha spuckte die Worte aus wie eine Beleidigung. »Dass ich nicht lache. Eher Speichellecker und hirnlose Gottesanbeterinnen.«
Jack stutze. Was für eine Ausdrucksweise für eine Nonne!
»Gott im Himmel! Ich war froh, ihnen und ihren beschränkten Welten entkommen zu sein. Und nun kehre ich zurück. Gescheitert.«
»Es ist doch nicht Ihre Schuld, dass das Waisenhaus schließen musste.« Lively rückte das Haarband auf ihrem Kopf zurecht. »Jeder weiß, was Sie hier für eine gute Arbeit geleistet haben.«
»Ja, das sagen sie auch. Das stand auch in dem Brief.« Sie seufzte und erhob sich, um das Teewasser vom Herd zu nehmen. »Aber in Wahrheit gibt es doch keinen anderen Grund. Ich hätte es besser machen müssen. Ich hätte es verhindern können.«
»Das wissen Sie doch gar nicht.« Lively richtete sich auf ihrem Stuhl auf. »Das kann alle möglichen Gründe haben, die Sparmaßnamen der katholischen Kirche voran ...«
Josepha hob eine Hand und Lively verstummte. Jack schmunzelte, denn es war schon eine Seltenheit, dass sich seine Schwester von jemandem maßregeln ließ.
Die Nonne lächelte ihr milde zu, griff nach der Kanne und goss den Tee in drei Becher. Danach brachte sie sie zum Tisch. Skeptisch betrachtete Jack die Brühe in dem Gefäß vor ihm, hob es hoch und roch probehalber daran. Nebenbei sah er, wie sich Lively wieder über den Tisch und in die Richtung von Schwester Josepha vorbeugte. Dieser Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes.
»Und nun ist das Haus leergeräumt? All die Möbel, die Bücher ... die Akten?«
Fassungslos starrte Jack sie an und bemerkte erst nach wenigen Sekunden, dass sein Mund offenstand. Wie dreist konnte man sein? Er blickte zu Schwester Josepha, die jedoch von Livelys offensichtlichen Hintergedanken nichts mitbekommen zu haben schien.
»Sie haben alles mitgenommen.« Schwester Josepha nickte bestätigend. »Alles, was sich noch zu Geld machen lässt.« Nachdenklich nahm sie einen Schluck Tee. »Die Akten holen sie in den Abendstunden ab. Ich muss sie noch in Kisten packen.« Bei diesen Worten schüttelte sie den Kopf.
»Nur die Akten der aktuellen Kinder oder auch der ehemaligen?«
Jack legte den Kopf schief, verengte die Augen und fixierte seine Schwester, die ihn jedoch geflissentlich ignorierte. Wieso wollte sie die Akten haben? Was erhoffte sie darin zu finden? Eine Dokumentation über all die Streiche, für die sie im Kinderheim bestraft worden war?
»Alle Akten«, antwortete Josepha. »Ich bin mir aber sicher, dass sie die alten verbrennen werden. Was kümmert sie meine jahrelange Arbeit und Sorgfalt?«
Jack hob den Becher an seine Lippen und nippte an der heißen Flüssigkeit. Sie schmecke nicht so schlecht, wie er Josephas Kräutervariationen im Gedächtnis gehabt hatte. Er fixierte seine Schwester. Noch wusste er nicht ganz, was sie im Schilde führte, aber er würde es sicherlich bald herausfinden.
»So ein Ärger. Diese verdammten Kirchenbeamten ...« Lively schüttele übertrieben empört den Kopf, doch Schwester Josepha verengte die Augen und fixierte sie.
Sie schwieg einige Sekunden, dann hoben sich ihre Mundwinkel. Ihre Stimme war fast beängstigend ruhig. »Es tut mir leid, Liebes. Aber ich werde euch eure Akten nicht geben.« Sie neigte den Kopf wie zur Bestätigung und nahm einen tiefen Schluck aus ihrem eigenen Becher.
Kapitel 2
Einige Sekunden lang starrte Lively die Frau ertappt an. Verdammt, sie war so kurz davor. Sie spürte es einfach. »Wieso nicht? Es würde niemandem auffallen.«
»Sie sind nicht für eure Augen bestimmt.«
Lively schnaubte und richtete sich auf. In ihr brodelte es und die Nonne sollte sich lieber in Acht nehmen. Sie wollte diese Akten, sie waren der verdammte Grund, wieso sie hierhergekommen war. Also würde sie sie bekommen. »Schwester Josepha, ich bitte Sie. Es ist fünf Jahre her, dass wir dieses Heim verlassen haben. Wir werden verkraften, was Sie über uns vermerkt haben.«
Der Blick in Josephas verengten Augen traf ihren. Er war so kalt und berechnend, dass sie selbst kurz erschauderte. Wie hatte sie sich nur einbilden können, diese Frau zu täuschen? Sie kannte sie besser als die meisten anderen.
»Ich weiß, dass es die Informationen über eure Herkunft sind, auf die du aus bist.«
Ein Anflug von Triumph wallte in ihr auf. Sie schlug mit einer Hand flach auf den Tisch. »Ich wusste es! Es gibt doch welche.« Tee schwappte über den Rand ihres Bechers und spitzte auf ihre Hand. Sie zog sie zurück und ignorierte den Schmerz. »Sie haben uns immer gesagt, dass über unsere Eltern nichts bekannt war.«
Josepha schnaubte. »Das sagen wir jedem.«
Lively spürte, wie Hitze ihren Hals hinaufkroch. Sie zog die Hand auf dem Tisch zitternd in eine Faust. Wenn diese Frau ihr nicht bald …
»Lively«, sagte Jack beruhigend. Ihr Blick zuckte kurz zu ihm, aber sie beachtete ihn nicht weiter.
»Wir haben ein Recht darauf, zu erfahren, wo wir herkommen.«
»Vielleicht habt ihr das.« Josepha ließ sich von Livelys Wut nicht aus der Ruhe bringen. »Doch es gibt Bestimmungen, an die ich mich halten muss.«
Das reichte! Lively sprang auf und krachend landete der Stuhl hinter ihr auf dem Boden. »Nach allem, was sie Ihnen angetan haben, halten Sie eher zu diesen Bürokraten als zu uns? Sie haben uns aufgezogen! Sie kennen uns besser als die meisten. Und das ist Ihnen nichts wert?«
Josepha schnaubte. »Ich bin nicht eure Mutter. Aber was viel wichtiger ist: Ich weiß, dass euch die Erkenntnis nicht glücklich machen wird. Ihr habt es über zwei Jahrzehnte ohne eure Eltern geschafft. Wenn ihr jetzt in eurer Vergangenheit grabt, kann das Dinge hervorbringen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Manches bleibt lieber im Verborgenen.«
»Aber es ist unsere Entscheidung!«, rief Lively aufgebracht. Es gelang ihr nicht mehr, die Verzweiflung aus ihrer Stimme fernzuhalten.
»Ja.« Jack streckte seine Hand aus und umfasste ihre. Nun wandte sie ihm doch den Blick zu. »Es ist unsere Entscheidung. Nicht deine allein.«
Fassungslos starrte Lively ihn an. Sie war so nah, so verdammt nah und jetzt war es Jack, der sich ihr in den Weg stellte? Ihr eigener Bruder? Dabei hatte sie die Akte doch nicht nur für sich, sondern für sie beide haben wollen. Forschend glitt ihr Blick über sein Gesicht. War er denn gar nicht neugierig? Sie spürte, dass seine Finger zitterten. Er hatte Angst. Trotzdem hätte er sich nicht so gegen sie stellen müssen.
Sie presste die Lippen aufeinander und schüttelte Jacks Griff ab. Dann schaute sie wieder zu Josepha. Vielleicht war noch nicht alles verloren. »Wollen Sie ihnen nicht eins auswischen? Der Kirche meine ich. Wie viele Jahre haben Sie für sie gearbeitet und nun treten sie Sie mit Füßen. Wenn eine Akte fehlt, werden sie das kaum merken. Aber es wäre eine stille Rebellion.« Sie wartete nicht, bis Josepha antwortete, sondern überquerte den Schritt, der sie trennte und umfasste die Hand der alten Nonne.
»Schwester Josepha«, sprach sie so eindringlich, dass sie sich nicht sicher war, ob es albern wirkte. »Wir sind erwachsen. Wir haben das Recht, selbst zu entscheiden, was mit unseren Leben geschieht. Sie sind nicht mehr die Kinderheimmutter, die ihre schützende Hand über uns halten muss. Wir sind frei. Und bevor Sie ins Exil geschickt werden, kann es Ihre letzte Tat sein, uns ein komplett freies Leben zu ermöglichen.« Lively lächelte und versuchte, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen, während sie ihren Kopf weiter nach Argumenten durchsuchte, die die Nonne überzeugen konnten. »Wie heißt es noch gleich in der Bibel?«, fragte sie. »Man soll Vater und Mutter ehren. Wie sollen wir das tun, wenn wir noch nicht einmal wissen, wer sie sind - oder wer sie waren?«
Josepha lachte trocken auf. »Wie ehrenhaft, Lively. Dabei hatte ich nie den Eindruck, du hättest der heiligen Mutter Kirche viel Aufmerksamkeit geschenkt. Schön, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat.« Sie streifte Livelys Hände ab und erhob sich, um ihre Tassen einzusammeln. »Also gut«, sagte sie plötzlich. »Ihr bekommt die Akte.«
»Was?«, fragten Jack und Lively wie aus einem Mund. Sie konnte sich den Anflug eines Grinsens nicht verkneifen, auch wenn sie sah, dass sich in Jacks Gesicht das Gegenteil von ihrer Begeisterung spiegelte. Oder gerade deswegen.
»Unter einer Bedingung«, ergänzte die Nonne schnell.
Lively stöhnte auf, verdrehte die Augen und ließ sich wieder auf ihren Stuhl sinken. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. »Was sollen wir tun? Unsere erstgeborenen Kinder der Kirche opfern?«
»Sarkasmus steht dir immer noch nicht«, entgegnete Josepha trocken. »Nichts dergleichen. Aber dein Bruder hat recht. Es geht nicht nur dich etwas an, mein Kind, sondern auch ihn. Ihr werdet die Akte bekommen, wenn ihr beide zustimmt. Vor heute Abend natürlich, denn da wird sie wie all die anderen abgeholt. Danach habe ich mit diesem Kinderheim abgeschlossen.«
Lively schaute von Schwester Josepha zu ihrem Bruder, der mit überschlagenem Bein am Tisch saß und nachdenklich an die gegenüberliegende Wand starrte. Er sah blass aus.
»Ich will es nicht wissen«, sagte er leise. Seine Stimme zitterte.
»Aber wieso nicht?«, fragte Lively. »Jacky, es geht um unsere Vergangenheit. Es geht darum, wer wir sind.« Es machte sie verrückt, dass die Chance auf die Antwort auf all ihre Fragen direkt vor ihrer Nase baumelte, der Dickkopf ihres Bruders jedoch dafür sorgte, dass sie unerreichbar für sie wurde.
»Ich weiß, wer wir sind«, entgegnete Jack mit eben der Ruhe, die sie jedes Mal schier wahnsinnig werden ließ. »Wir sind Jack und Lively Harpins. Und auch wenn nur irgendeine Behörde uns diesen Namen zugeteilt hat, kann ich damit doch mehr verbinden als mit dem Namen unserer Eltern, wenn wir ihn denn herausfinden würden. Es gibt einen Grund, wieso wir nicht bei ihnen aufgewachsen sind. Einen Grund, wieso wir hier in diesen trostlosen Wänden unsere Kindheit verbracht haben und nicht in einem behüteten Zuhause. Und egal, wie er aussieht - ich glaube, es ist mir lieber, ihn nicht zu wissen. So kann ich mir jedenfalls einbilden, dass sie dazu gezwungen waren, uns wegzugeben. Dass andere Umstände der Auslöser dafür gewesen waren und nicht ...« Er schluckte.
Seine Fassade bröckelte und Lively sah, dass ihn dieses Gespräch mehr bewegte, als er es zugeben wollte. Sanft drückte sie seine Hand. Sie kannte Jack. Er war vorsichtig, er hasste Veränderungen, aber sie wusste, dass er tief in seinem Innern genauso neugierig war wie sie. Aber wenn er der Meinung war, sie beide zu beschützen, konnte er das leicht untergraben. »Aber ich will es wissen«, sagte sie leise. »Verbau mir nicht die Chance auf meine Vergangenheit. Ich werde die Akte lesen und dir nichts davon verraten, wenn du es nicht willst.«
Jack seufzte vernehmlich und führ sich mit der Hand durch das Gesicht. Lively erkannte Ringe aus Falten um seine Augen. Wieso sah er so müde aus? »Wir beide wissen, dass du das kaum für dich behalten können wirst.«
»Ich bin kein Kind mehr, Jack«, entgegnete Lively. »Wenn ich dir sage, dass ich dir nichts verrate, dann kannst du dich darauf verlassen. Und du kannst deine Meinung jederzeit ändern.«
»Genau das macht mir ja Angst.« Er schüttelte vehement den Kopf. »Meinetwegen. Nimm die Akte, wenn es dich glücklich macht. Grabe so viel in der Vergangenheit, wie du willst und buddel alle Leichen aus, die dir zwischen die Finger kommen. Aber lass mich aus dem Spiel.« Er verengte die Augen. »Keine Andeutungen.«
»Keine Andeutungen«, echote Lively.
»Kein verräterisches Lächeln.«
»Kein verräterisches Lächeln.« Lively lächelte und verdrehte die Augen. »Manchmal denke ich, ich bin in deinen Augen immer noch das kleine Mädchen, das dir im Heim Streiche gespielt hat.«
»So ist es auch«, entgegnete Jack. Er erhob sich und musterte sie auf eine merkwürdige Art und Weise. Dann nickte er in Schwester Josephas Richtung. »Gebt ihr die Akte.«
Er drehte sich um, griff beim Hinausgehen nach Mantel und Hut und flüchtete in den Regen.
Kapitel 3
Jack setzte sich im Gehen den Zylinder auf den Kopf und zog die Krempe tief über seine Augen. Das Herz wummerte in seiner Brust und die Gefühle, die in ihm tobten, waren ihm vollkommen fremd.
Seine Schritte gingen im Prasseln des Regens beinahe unter. Er spürte, wie die Feuchtigkeit unter seinen Mantel drang und wünschte sich, er wäre bereits zu Hause.
Zweiundzwanzig Jahre. Zweiundzwanzig Jahre, in denen er nicht gewusst hatte, wo er herkam. In denen er nicht gewusst hatte, wer er war.
Es wäre gelogen, zu behaupten, dass er sich nie nach Eltern gesehnt hatte. Dass er nie vor dem Spiegel gestanden und sich gefragt hatte, ob seine schiefe Nase eher von seinem Vater oder von seiner Mutter abstammte. Ob einer von beiden auch Probleme damit gehabt hatte, die leicht gelockten Haare zu bändigen. Ob sie ihm als Kind vorgesungen hatten und ob sie ihn überhaupt angeschaut hatten, bevor sie ihn im Heim abgegeben hatten. Oft hatte er andere Kinder mit neidischen Blicken verfolgt, wenn er sie mit ihren Eltern in der Stadt gesehen hatte, wie sie Hand in Hand durch die engen Gassen schlenderten oder auf den Feldern neben der Stadt Drachen steigen ließen.
Aber im Gegensatz zu den anderen elternlosen Kindern im Heim war Jack nie einsam gewesen. Dank Lively. Jedes Mal, wenn er gedacht hatte, dass ihm etwas fehle, hatte er nur seine Schwester ansehen müssen, um sich vom Gegenteil zu überzeugen.
Er war wahnsinnig glücklich, sie zu haben. Sie gehörten zusammen, sie ergänzten sich. Genau deswegen wollte er nicht in ihrer Vergangenheit herumstochern. Er hatte Angst, dass es irgendetwas zwischen ihnen ändern würde.
Trotzdem fragte Jack sich, ob er sich nicht falsch entschieden hatte. Ein winziger Teil von ihm wollte auch wissen, was in dieser Akte stand, die Neugierde machte ihn fast wahnsinnig. Aber wenn er es ignorierte, wenn er so tat, als sei nie etwas gewesen, vielleicht konnte er Lively und sich selbst dadurch schützen. Er wusste nicht, was auf sie wartete, welche Enthüllungen, welche Geheimnisse. Verdammt, sie waren doch zufrieden! Sie hatten ein beschauliches Leben, er hatte eine Arbeit und konnte sie beide ernähren. Wieso wollte Lively das aufs Spiel setzen?
Aber vielleicht reagierte er auch über. Vielleicht stand in den Akten gar nichts, nur irrelevante Informationen, die Livelys Neugierde beruhigen würden und dafür sorgten, dass sie diesen Gedanken an ihre Herkunft für immer begrub. Wie es auch ausging: Jack war sich sicher, dass er es früher oder später erfahren würde. Denn wenn seine Schwester eines nicht konnte, dann ein Geheimnis für sich behalten. Vor allem, wenn es sich um ein Geheimnis von solcher Bedeutsamkeit handelte. Der Teil von ihm, der es wissen wollte, war aufgeregt. Aber er wusste nicht, was er denken sollte.
Eine Pferdekutsche preschte an ihm vorbei und schleuderte Wasser von der Straße auf den Gehweg vor ihm. Wie automatisch steuerten seine Schritte weg von dem Kinderheim. Er musste fort von hier, fort von den erdrückenden Erinnerungen, die an seinen Gedanken zupften und sich einen Weg in sein Bewusstsein bahnten. Wenn er ein bisschen Abstand zwischen sich und das Gebäude gebracht hatte, ging es ihm sicher besser. Er trat auf die Straße und stieß die Luft aus. Nachdenklich hob er das Gesicht zum Himmel und genoss den feinen Regen, der seine Haut besprenkelte. Er schloss für einen Moment die Augen und dachte an gar nichts.
Die Luft wog schwer von der Feuchtigkeit und das Geräusch des niederprasselnden Wassers überspielte den Lärm der Stadt. Trotz allem war da etwas in ihm, das sich nach Veränderung sehnte. Aber vielleicht entstammte diese Regung nicht ihm selbst, denn es war ihm, als gierte jeder Mensch im Moment danach, dass etwas passierte. Als läge eine zittrige Erwartungshaltung in der Luft, die er mit jedem Atemzug tief in seinen Körper aufnahm.
Mit einem Mal ergriff eine seltsame Spannung von ihm besitz. Ein Jucken, das sich von seinem Nacken den Rücken hinab ausbreitete. Er senkte den Kopf, rückte den Hut zurecht und schaute sich um. Er fühlte sich beobachtet. Sein Blick glitt die Straße hinauf und hinab. Die verschmutzte und aufgebrochene Straße. Schlamm, der sich an der seitlichen Rinne sammelte und bergabwärts lief. Aber keine andere Person außer ihm selbst. Er drehte sich um die eigene Achse und blickte zurück auf das Tor des Kinderheims, das er hinter sich geschlossen hatte. Doch auch von Lively war keine Spur.
Das Gefühl wollte nicht vergehen. Aus dem Augenwinkel sah er einen Schatten auf dem Bordstein, festgeklebt wie ein Fleck von ausgelaufenem Öl. Er drehte sich um, doch sobald sein Blick klar wurde, war er verschwunden.
Er stutzte. Hatte er sich das gerade nur eingebildet? Vielleicht war es aber auch nur eine schwarze Katze gewesen, die sich auf seine ruckartige Bewegung hin ins Gebüsch geflüchtet hatte. Beiläufig zuckte er mit den Schultern, doch in diesem Moment erklang ein Geräusch. Ein Lachen, leise. Kurz. Doch so nah, als würde jemand direkt hinter ihm stehen und ihm ins Ohr flüstern. Jack zuckte zusammen und wirbelte herum. Doch niemand war da. Niemand stand auf dem Bordstein und machte sich einen Spaß daraus, ihm Angst einzujagen.
Er schnaubte und schüttelte den Kopf über seine eigene Schreckhaftigkeit. Scheinbar hatten die Geister der Vergangenheit noch immer nicht von ihm abgelassen. Jack vergrub die Hände tief in den Taschen seines Mantels. Je schneller er Raum zwischen sich und dieses verdammte Heim brachte, desto besser. Zwischen sich und seine Schwester, die gerade diese verdammte Akte las.
Und wenn er ihr auch noch den Rest des Tages aus dem Weg gehen konnte, umso besser.
Kapitel 4
Lively bearbeitete ihre Unterlippe mit den Schneidezähnen und musterte Jack, der vollkommen in das Buch in seinen Händen vertieft war. Er ignorierte sie, hob einen Finger an den Mund und befeuchtete die Kuppe mit der Spitze seiner Zunge. Dann verharrte er einen Moment, seine Augen flogen über die Buchstaben, bevor er umblätterte. Den Bruchteil einer Sekunde schweifte sein Blick nach oben und streifte sie, bevor er sich wieder den Zeilen vor ihm zuwandte. Seine Augenbraue hob sich.
Lively beugte sich vor, stützte die Unterarme auf ihre Oberschenkel und musterte ihren Bruder weiter. Ihr Herz pochte zu schnell und ihr war so furchtbar heiß, dass sie am liebsten das Feuer im Kamin gelöscht hätte. Es prasselte unaufhörlich vor sich her und warf Schatten in dem kleinen Raum. Es war bereits dunkel draußen, nur schwach schien der Mond durch das einzige Fenster hinein.
»Lively«, sagte er nach einer Weile ruhig, ohne aufzusehen. »Ist alles in Ordnung?«
Ruckartig lehnte sie sich in dem ramponierten Sessel zurück, verschränkte ihre Hände im Schoß, umschloss die eine mit der anderen. Die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf und schweiften immer wieder zu der schwarzen Mappe. Der schwarzen Mappe, über die dringend Redebedarf bestand. Doch sie hatte ein Versprechen gegeben.
Mit einem genervten Stöhnen erhob sie sich und streunerte durch den Raum. Nicht nur, dass sie die Papiere in dieser verdammten Mappe gelesen hatte und daraufhin den ganzen Nachmittag durch die Stadt gestreift war, sie war auch der einzigen Person über den Weg gelaufen, die sie nicht hatte treffen wollen: Randly. Diesem verdammten Bastard, mit dem sie geschlafen hatte, um bei der Armee arbeiten zu dürfen. Der ihr die Sterne vom Himmel versprochen hatte, nur damit er ihren Körper unter seinen Händen spüren konnte.
Es war nicht so, dass sie es nicht genossen hatte. Randly war ein Soldat durch und durch. Aber sie hasste es, wenn man sie belog. Wenn sie sich wie ein naives, leichtgläubiges Mädchen fühlen musste, nur weil sie einmal Vertrauen in einen Menschen gesetzt hatte. Aber die Armee stand Frauen nicht offen, da konnte sie so viele Soldaten verführen, wie sie wollte. Sie fragte sich, wie sie nur für einen anderen Moment etwas anderes hatte denken können. Frauen gehörten in den Haushalt, arbeiteten als Dienstbotinnen oder stellten Kleidung her. Lively hasste diesen Umstand. Das war nicht das Leben, das sie sich für sich selbst wünschte. Sie wollte raus, wollte Abenteuer erleben. Aber es war, als band die Gesellschaft ihr tonnenschwere Gewichte an die Knöchel, nur weil sie eine Frau war.
Sie trat an den Kamin und umfasste die Dose mit dem Tabak mit einer Hand. Gott, sie musste fort aus dieser Stadt. Hier war sie niemand, nur die kratzbürstige junge Frau, die ihrem Bruder auf der Tasche lag. Hier war sie ein Nichts und versank von Tag zu Tag tiefer in der Bedeutungslosigkeit.
»Geht es dir gut?«, erklang die Stimme ihres Bruders hinter ihr. Natürlich wusste er, dass dem nicht so war. Dass sie genauso litt, wie er es vorausgesagt hatte.
»Bestens«, presste sie hervor und drehte sich um. Sie zwang ihre Mundwinkel hoch zu einem Lächeln. »Ist dein Buch spannend?«
»Durchschnittlich«, antwortete er und sein Blick glitt forschend über ihr Gesicht. Seine Augen blitzten. Machte er sich über sie lustig? Der Morgen war eine Folter gewesen, als er auf der Arbeit gewesen war, doch seine Anwesenheit machte alles noch schlimmer. Er hatte so recht gehabt. Ihr Blick strich über seine Züge, seine Nase und die dichten Augenbrauen, die seinem Gesicht eine markante Note verliehen. Er erwiderte ihren Blick geduldig.
»Zwei Stunden von hier«, stieß sie hervor und hasste sich im selben Moment dafür.
»Was?«, fragte Jack und eine seiner Brauen wanderte höher. Seine Unterlippe zuckte.
»Sie kommen aus einem Dorf, kaum zwei Stunden entfernt von hier«, flüsterte Lively, als würde die fehlende Lautstärke ihren Worten die Bedeutung nehmen.
Einige Sekunden lang starrte Jack sie an, dann schlug er sein Buch geräuschvoll zu. Er presste die Lippen aufeinander. »Wieso überrascht mich das nicht?«
»Du wusstest davon?«, fragte sie, wandte sich ihm vollständig zu.
Jack schnaubte. »Als ob. Es überrascht mich nicht, dass du es ausgeplaudert hast. Das passt zu dir.«
Kurz wallte Wut in Lively auf, die sie jedoch schnell wieder unterdrückte. Wenn dieses Gespräch in einen Streit ausartete, würde er ihr nie zuhören, geschweige denn die Mappe anschauen. »Du musst es wissen«, sagte sie nur. »Glaub mir. Wenn du wüsstest, was ich weiß, würdest du mir zustimmen.« Sie überwand den Abstand zwischen ihnen und umgriff die Handgelenke ihres Bruders. Er versuchte, sich ihr zu entziehen, gab sich jedoch nicht genug Mühe. Einige Sekunden hielt sie ihn fest, bis er die Gegenwehr einstellte, dann schaute sie hinauf in sein Gesicht. Hinter seinen hellgrauen Augen tobte ein Sturm, den sie selbst ausgelöst hatte. Sie war sich sicher, dass es hinter ihren genauso aussah. Diesen Sturm teilten sie sich - und das nicht nur in den letzten Tagen.
»Jack«, wiederholte sie und dämpfte ihre Stimme. »Hör mir zu. Ich brauche dich. Ich muss es dir erzählen.« Damit hatte sie ihn. Jack musterte sie und seine Züge wurden weich. Kurz hasste sie sich dafür, seine Gefühle so gegen ihn auszuspielen, doch ihre Worte waren nicht gelogen.
Sanft löste er seine Gelenke aus ihrem Griff und strich ihr abwesend über den Handrücken. Dann ließ er sich mit einem Stöhnen in seinen Sessel sinken. Tiefe Falten durchzogen seine Stirn. »In Ordnung. Sag es mir.«
Lively lächelte halb und setzte sich ihm gegenüber. »Sie wohnten in einem kleinen Dorf namens Westingate.«
»Wohnten?«, wiederholte Jack. Er verzog keine Miene, doch seine Stimme klang tonlos.
»Sie sind tot.« Lively nickte. »Sie waren es bereits, als wir im Kinderheim abgegeben wurden.« Die Worte lösten in diesem Moment dasselbe in ihr aus, wie in dem Moment als sie sie gelesen hatte: Gar nichts.
Jack nickte. Langsam lehnte er den Kopf auf die eine Seite. Doch auch er wirkte nicht sonderlich schockiert. Lively glaubte zu wissen, was er dachte. Vielleicht ist es besser so. Das wäre es auch, wenn die Geschichte an diesem Punkt zu Ende wäre. »Es steht nicht viel in der Akte. Wir wurden im Alter von fünf Monaten bei der Kirche abgegeben. Man legte uns nicht einfach auf der Schwelle ab, sondern eine Frau brachte uns her, sie war jedoch nicht mit uns verwandt. Niemand suchte uns danach noch auf. Niemand fragte nach uns.«
»Weiter?« Jack beugte sich vor. Seine Miene zeugte von Skepsis, doch es schien, als überwog nun die Neugierde. Mit der Spitze der Zunge befeuchtete er seine Lippen.
Lively hob zögerlich die Schultern. »In der Akte steht der Name unseres Vaters.«
Er schloss die Augen und stieß langsam die Luft aus. »Sein Name?«, flüsterte er. Dann öffnete er die Augen und sah sie flehentlich an.
Livelys Mundwinkel zuckten. »Es ist nur sein Name. Nur ein Name, den ich selbst noch nie gehört habe. Wenn wir dieser Sache nicht nachgehen, bedeutet er nichts.«
»Er bedeutet alles«, entgegnete Jack.
Kurz biss sie sich auf die Lippe, doch ließ sie gleich darauf wieder los. »Blackwood.«
Jack schluckte und schüttelte den Kopf. Der Blick in seinen Augen war trüb.
»Aber es scheint, als haben wir noch Verwandte, nicht weit von hier. In Westingate, dem Dorf, in dem wir geboren wurden. Vielleicht können sie uns unsere Fragen beantworten und uns sagen, woran unsere Eltern starben ...«
»Liv, ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist.«
»Stell dir vor, Jacky! Wir haben vielleicht Geschwister oder Großeltern! Vielleicht auch ein Zuhause!«
»Liv!«, unterbrach sie Jack energischer. Bedauern stand in seiner Miene und er überlegte lange, bevor er die Worte wählte. »Wir wurden in ein Kinderheim gegeben. Das wird einen Grund gehabt haben und bedeutet sicher nicht, dass da irgendwo unbekannte Verwandte auf uns warten und uns herzlich willkommen heißen werden.«
»Wir sollten hinfahren. Du musst mit mir kommen, Jack. Ich werde morgen früh fahren und ich will nicht allein gehen müssen.«
Mit offenem Mund starrte Jack sie an. »Ich ... ich weiß nicht, Liv.« Er klappte das Buch zu und wollte es ins Regal stellen, doch seine Finger zitterten so, dass es ihm aus der Hand glitt und zu Boden fiel.
Sie konnte sich nicht erinnern, ihren Bruder jemals so verwirrt gesehen zu haben. Normalerweise war er ruhig und wusste für alles eine Lösung. Schnell schloss sie den Mund und schluckte die Worte herunter, die sie noch hatte sagen wollen.
»Verdammt«, murmelte Jack und stand ruckartig von seinem Stuhl auf. Er durchquerte den Raum und riss seine Jacke vom Haken. Mit einer Hand auf der Klinke drehte er sich wieder um. Er hatte nicht mal seinen Zylinder mitgenommen. »Sie haben uns weggegeben, Lively. Sie ... sie wollten uns nicht mehr. Das musst du akzeptieren.« Unsicher warf er einen Blick auf sie und verließ die Wohnung.
Stumpf sah Lively ihm hinterher. Sie war wütend, weil er einfach abhaute, aber lange sauer konnte sie ihm nicht sein. Er würde draußen seine Runden ziehen, bis es dunkel wurde und dann zurückkehren. Manchmal brauchte er das – vor allem ein Mensch wie er, dessen Kopf zu jedem Zeitpunkt mit Sorgen, Ängsten und Überlegungen bis zum Bersten gefüllt war. Trotzdem hoffte sie, dass er sie begleiten würde.
Der Zug fuhr um fünf Uhr in der Früh. Es war einer dieser Tage, an denen die Kälte unter die Klamotten kroch und sich bis auf die Knochen durchbiss. Auch Livelys dicker Wintermantel, der sie im letzten Jahr die Hälfte von Jacks monatlichem Gehalt gekostet hatte, schützte sie nicht davor. Sie ließ den Blick den trostlosen Bahnsteig hinauf und hinab wandern. Außer ihr waren zwei Männer hier, die sie flüchtig kannte und die sich nur auf den Weg in das nächste Dorf machten. Auf sie wartete jedoch eine Zugfahrt von zwei Stunden. Sie warf einen Blick über die Schulter, doch die Straße hinter ihr war leer. Ein Teil von ihr hoffte noch immer, dass es Jack sich anders überlegen und sie begleiten würde. Doch nach ihrem Gespräch am letzten Abend war er lange nicht zurückgekehrt. Und auch danach hatte er kein Wort mit ihr gesprochen. Wie so oft.
Sie hatte das Gefühl, dass ihr Bruder lieber gar nicht kommunizierte, als zu streiten. Am Morgen war er wieder verschwunden gewesen. Sie hatte ihm einen Zettel auf dem Tisch zurückgelassen und sich dann an seiner Geldbörse bedient. Jack musste jeden Gedanken noch tausend Mal hin und her wälzen, aber sie für ihren Teil konnte nicht mehr warten. Etwas in ihr wühlte sie auf, zerrte sie nach Westingate. Ein gieriges Brennen, das nur mit Informationen gestillt werden konnte.
Mit einem Schnauben drehte sie sich um und blickte sehnsüchtig das Gleis entlang in die Richtung, aus der der Zug kommen würde. Bisher war sie noch nie mit der Eisenbahn gefahren und ihr Herz pochte in kindlicher Vorfreude.
Früher hatte sie manchmal die Züge beobachtet. Der Bahnhof lag unweit des Kinderheims und laute, Dampf ausstoßende Kolosse wirkten auf Kinder ungemein faszinierend. Wenn sie sich umdrehte, konnte sie das St. Alberts hinter den Spitzen der Bäume sehen.
Die Akte in dem Koffer in ihrer Hand wog plötzlich das Doppelte. Das Geräusch der nahenden Eisenbahn drang an ihr Ohr und sie schloss kurz die Augen. Sie presste die Lippen aufeinander. Sie war noch nie so weit von zu Hause fort gewesen. Oft hatte sie davon geträumt, sich jedoch immer erhofft, dass es unter besseren Umständen geschehen würde. Es fühlte sich wie ein Aufbruch an, ein Umsturz von allem, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte.
Auch wenn Lively ansonsten eher pragmatisch veranlagt war, konnte sie der Faszination einer herannahenden Eisenbahn nicht widerstehen. Das Rattern der Reifen, der dicke Qualm, der aus dem Stahlrohr der Lock strömte. Das Quietschen von Metall auf Metall. Sie kannte sich mit der Mechanik nicht aus, die es benötigte, um solch einen Riesen aus Eisen zu bewegen und Menschen damit zu transportieren, doch sie fand den Gedanken daran hochgradig faszinierend. Es war berauschend, darüber nachzudenken, was die Menschheit sonst noch alles erreichen konnte. Mit kreischenden Rädern hielt die Eisenbahn vor ihr, rutschte einige Meter weiter. Lively widerstand dem Drang, die Hände auf ihre Ohren zu pressen. Als die Eisenbahn vor ihr hielt, warf sie einen letzten Blick über die Schulter. Gerade, als sie sich wieder umdrehen wollte, sah sie am Ende der Straße eine kleine Gestalt mit einer Tasche in der Hand, die stetig näherkam.
Ein Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Sie war sich sicher gewesen, dass er kam, und er enttäuschte sie nicht. Lively wusste, dass sie Jacks Schwäche war. Bei weitem nicht seine einzige, mit Sicherheit aber seine größte.
Schnell wandte sie sich dem Schaffner zu, der sich den Aufstieg zum Abteil herunterschwang und dann neben ihr auf dem Boden zum Stehen kam. Es war ein junger Mann mit flachsblonden Haaren. Nachdem die beiden Männer vor ihr eingestiegen waren, musterte er sie betont langsam.
»Wo will die hübsche Dame denn hin?« Ein schmieriges Lächeln verzerrte seine Lippen.
Lively ignorierte den Kommentar und schenkte dem Mann einen Augenaufschlag, der nicht von Herzen kam, seinen Zweck aber erfüllte. »Könnten Sie noch einen Moment warten?« Sie nickte in Jacks Richtung, der schnellen Schrittes näherkam.
Das Lächeln des Schaffners verblasste. »Wir haben einen Zeitplan einzuhalten«, sagte er knapp und drehte sich um.
»Warten Sie.« Livelys Hand zuckte vor und schloss sich um den fadenscheinigen Ärmel des Mannes. Sie hörte Jacks Schritte hinter sich. Hatte er sich keinen früheren Zeitpunkt für seinen dramatischen Auftritt wählen können?
Der Schaffner schenkte ihr einen wütenden Blick, doch Lively setzte ihrerseits den Fuß auf die unterste Stufe und schob sich betont langsam hinein. Schnell ließ sie den Ärmel wieder los und versuchte, den Mann mit einem weiteren Lächeln zu besänftigen, doch der beachtete sie nicht weiter.
Sie hörte Jacks keuchenden Atem hinter sich und die gestammelte Entschuldigung, die er dem Schaffner zuwarf, als er hinter ihr den Wagen betrat. Lively lächelte in sich hinein, betrat dann das nächste Abteil und ließ sich auf einer der hölzernen Bänke nieder.
Jack verstaute seine Tasche in dem Fach über ihren Köpfen und ließ sich dann ihr gegenüber sinken. Sein Gesicht war gerötet und sein Atem ging stoßweise. Trotz der merkwürdigen Situation musste er lächeln. »Das war knapp.«
Lively presste die Lippen aufeinander und hob die Mundwinkel. »Das nächste Mal solltest du mich nicht so lange warten lassen.« Sie musterte ihn, seine zerwuschelten dunklen Haare. Sie sahen sich kaum ähnlich dafür, dass sie Zwillinge waren. Nur die Augenfarbe, das dunkle Braungrün, war gleich.
Jacks Miene wurde ernst. »Es tut mir leid. Deine Worte gestern, dieser Name ... irgendwie hat mich das überwältigt. Als wäre ich nicht mehr Herr über meine Gefühle gewesen.« Er ergriff ihre Hand. »Hast du wirklich gedacht, ich komme nicht?«
»Ich hätte es verstehen können, wenn du Angst gehabt hättest.«
Jack sah aus dem Fenster. Der Zug rollte an und nach und nach wurden die tristen Häuser ihrer Heimatstadt durch eine nicht weniger triste Landschaft abgelöst. »Habe ich auch. Aber das ist unwichtig.«
Dann schaute er ihr in die Augen und Lively las die wahre Bedeutung der Worte aus seinem Blick. Sie wusste, wie Jack zu ihr stand. Dass er trotz ihrer Differenzen das Gefühl hatte, jede Sekunde mit ihr auskosten zu müssen. Weil sie das Einzige war, was er hatte. Weil er dauerhaft mit der Angst lebte, dass sie irgendwann fort sein könnte. Lively wusste nicht, woher diese Angst kam, denn sie selbst verspürte sie nicht. Sie liebte ihren Bruder, aber der Drang nach Neuem war größer als das Gefühl, ihn an sich binden zu müssen.
Jack drückte ihre Hand. »Diesen Weg gehen wir gemeinsam.« Kurz schloss er die Augen, schwieg und stieß dann Luft durch seine Nase wieder aus. Er lächelte halb.