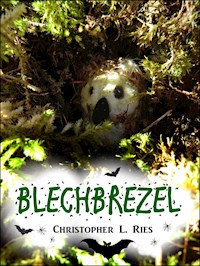
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Blechbrezel, knurre für mich. Spiel Beethoven!" Der Weihnachtsmann existiert! Das ist eine ungeheure Behauptung. Auf der Suche nach der Wahrheit und angespornt von den Schriften eines geheimnisvollen Manuskriptes, dringen Tassilo und seine Freunde tief in den Bauch der Mutter Erde ein, wo zahlreiche Gefahren auf sie lauern. Überleben oder Sterben? Im ultimativen Kampf gegen böse Mächte ist ´Blechbrezel` das Zünglein an der Waage. Dies sind die rasanten Abenteuer des jungen Tassilo, der den Mut besitzt, einer höchst unglaubwürdigen Geschichte Glauben zu schenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christopher L. Ries
Blechbrezel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ein Gerücht
Steven
Das mathematische Genie
Ganz dicke Freunde
Elsbot
Frettchen Karl hat eine gute Idee
Tobias wittert einen Komplott
Von zweitausend Jahre alten Rentieren
Jonathan
Das geheimnisvolle Buch
Eine Schlacht aber nicht den Krieg!
Knallharte Indizien
Ein Ding namens Google Earth
Ein ungeheuerlicher Plan
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Ein sonderbares Trio
Zander
Hinein in den Bauch der Erde
Im Schwarzen Tunnel
Donnertrud
Tick-tack, tick-tack
Die Zeitputzer
Borrokis Wunderwaffen
Eddy
Die Grotte
Der Boss
Hosenbodens Geniestreich
In der Höhle des Löwen
Das Herz des Bösen
Tassilos Rückkehr
Das Finale in den Bergen
Die Heimkehrer
Versuch einer Worterklärung
Impressum neobooks
Ein Gerücht
Zentraleuropa, irgendwo im Nirgendwo.
Am Anfang stand ein Gerücht. Der Wind trieb es vor sich her, scheuchte es durch Täler, über Bergkuppen und über die vom Schnee weißen, bewaldeten Hänge. Es irrte solange umher, bis es uns Menschen erreichte. Es gäbe da einen uralten Tunnel, flüsterten die Winde uns zu. Kühl, dunkel und tief versteckt im Bauch der Mutter Erde sollen weder der Moder noch die Feuchtigkeit ja nicht mal Väterchen Frost ihm je etwas anhaben können. Aus diesem Gerücht entstand im Laufe der Jahrtausende eine Legende. Sie besagt, dieser Tunnel beherberge schrullenhafte Kreaturen. Millionen an der Zahl und von diversem Gemüt verfügen sie angeblich über magische Kräfte. Über Kräfte, die nur dem Zweck dienen, ein Geheimnis zu behüten, das so alt ist, wie der Mensch zurückdenken kann.
Steven
Reykjavík, (Island). 24. Dezember, kurz vor einundzwanzig Uhr.
»Steven ... Steeeeeven! Herrgott noch mal, wo hat sich dieser Nichtsnutz bloß wieder verkrochen?«
Mary Bloomfield war in zweierlei Hinsicht wütend. Auf die anderen, weil niemand ihr antwortete und weil das so gar nicht ins Bild ihrer perfekten Welt passte. Und auf sich selbst, weil sie es eben diesen Menschen erlaubte, ihre perfekte Welt wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen zu lassen. Steven. Alles war seine Schuld! Er war die Quelle des Übels. Er war durch und durch schlecht. Er allein und davon war Mary felsenfest überzeugt, hatte direkt mit ihren längst ergrauten Haaren, mit ihrem Magengeschwür und ihren ständig schwankenden Launen zu tun. Steven war nicht wie sie. Genau das war der springende Punkt. Perfektionismus, Eifer und Zielstrebigkeit hatte Mary in ihrer Kindheit schon mit dem Löffel gefressen. Sie verachtete Nachlässigkeit und Dilettantismus und erklärte Allen und Jeden den Krieg, die nicht ähnlich dachten. Worte wie Flexibilität und Herzensgüte gab es in ihrem Lexikon nicht, selbst für schräge Ansichten wie die Fünf mal gerade sein lassen hatte sie nur ein müdes Lächeln übrig, obwohl: Mary Bloomfield lächelte nie! Träumer, rosa Sockenträger, Tollköpfe und Luftikusse wie dieser Steven Easterling, waren ihre erklärten Feinde. Und Feinde bekämpfte sie nach allen Regeln der Kunst. Auch in ihrer Eitelkeit war Mary gekränkt. Das hatte einen guten Grund. Es war Weihnachten und den ganzen Tag über hatte niemand auch nur ein einziges Wort darüber verloren, wie exzellent sie es wieder einmal geschafft hatte, alles für diesen wichtigen Anlass vorzubereiten. Rote Flecken als Zeichen der nicht genährten Eitelkeit im Gesicht, ließ sie ihren Blick über die von ihr angerichtete Tafel gleiten. Wie üblich hatte sie nichts dem Zufall überlassen. Nichts dem Zufall zu überlassen war ihre Stärke. Und genau das war Garant für das hohe Ansehen, das sie genoss. Nach fünfundzwanzig Jahren im Hause der Bertelsens konnte sie immer noch nach ihrem Gutdünken als Küchenchefin schalten und walten. Rare Delikatessen aufzutischen war für sie eine ganz besondere Herausforderung, doch dieses Mal hatte sie sich selbst übertroffen. Es gab Gänseleberpastete foie gras d‘oie, auf mit in Knoblauch angeröstetem Baguette; über brennenden Cognac flambierte Langusten, angerichtet mit indischem Reis, diesen wiederum beträufelt mit einer Spur ihrer Soße á la M. Bloomfield (sie würde sich eher die Zunge abbeißen, als ihr Rezept preisgeben); schwarze Trüffel aus dem Périgord und als Nachtisch ihr absolutes Meisterstück: Mousse au Chocolat! Von dem konnten die Bertelsens nie genug bekommen. Mary Bloomfield könnte mit sich selbst zufrieden sein und sich auf die Schulter klopfen, stünde sie nicht vor einer Tatsache, die sie als einen gegen sie geschmiedeten Komplott bezeichnete. Zwei Schalen mit ihrer sündhaft leckeren Mousse au Chocolat waren, wie sie zu ihrem Entsetzen feststellte, spurlos aus der Kühltruhe verschwunden. Kaum diese fürchterliche Entdeckung gemacht, trommelte sie unverzüglich ihren gesamten Küchenstab zusammen. Nicht mal zwei Minuten nach ihrem Befehl, in der Küche zu sammeln, stand das Personal vor ihr stramm. Na ja, fast.
»Wo ist Steven?«
Ihre Worte waren an alle gerichtet, doch sie starrte unentwegt auf Gudrun, Stevens Ziehmutter. Bleich und winzig, schüttelte diese nur den Kopf. Steven war, wie konnte es anders sein, wie vom Erdboden verschluckt. In Marys Augen kam sein Verschwinden einem Schuldbekenntnis gleich.
»Ich möchte ihn haben und das AUF DER STELLE!«
Schweigen.
Diese ´Auf der Stelle` war eine Wortkonstellation wie Mary sie nur einmal alle zehn Jahre gebrauchte. In der Küche roch es nach Gänseleberpastete, nach Mord und nach Totschlag. Als niemand ihr antwortete, stapfte Mary mit einem Bein so fest auf den Boden, dass sämtliche Küchengeräte zum Eigenleben erwachten und der Korken einer nahestehenden Champagnerflasche wie ein nervöses Raketengeschoss der Neonröhre zwei Meter über ihren Köpfen einen Besuch abstattete. Johansson, der dicke Koch, räusperte sich. Das tat er immer, bevor er das Wort ergriff. Er war nur etwa halb so groß wie Mary. Innerlich aufgewühlt fummelte er an seiner schmuddeligen Schürze herum. Dabei bedachte er Gudrun mit einem kumpelhaften Augenzwinkern, wagte es aber nicht, Marys Blick zu begegnen. Gudrun erwiderte das Zwinkern und stieß heimlich ein Stoßgebet zum Himmel. Sie wollte Johansson warnen, doch zu spät. Beherzt trat dieser einen Schritt nach vorne.
»Und wenn es diesmal nicht auf Stevens Mist gewachsen ist?«, fragte er und betrachtete dabei den blank polierten Küchenboden. »Fräulein Bertelsen hingegen«, so fuhr er etwas mutiger fort, »schlich den ganzen Morgen über in der Küche herum. Jeder von uns kennt ihre Vorliebe für Schokoladenpudding und ... «
Mary erblasste. »Schokoladenpudding?« Ihre Augen verschossen Blitze in Johanssons Richtung. »Du nennst meine Mousse au Chocolat SCHOKOLADENPUDDING?«
Ihre Stimme bebte, ihr Mund wurde zu einem schmalen Strich, blutleer und kalt. Sie hatte den Großteil des gestrigen Tages nur damit verbracht, an der Mousse au Chocolat herumzutüfteln, sie zu verfeinern und neue Geschmacksnoten mit einzubringen. Und nun nannte dieser Schmuddelkoch ihr Werk ganz banal Pudding? Gudrun, die Steven vor Mary immer in Schutz nahm, konnte sich gerade noch ein Grinsen verkneifen. Sie hatte Steven vor neun Jahren im Mülleimer vor dem Haus gefunden. An einem Ostermontag, wohlgemerkt. Deshalb auch sein Name. Easterling. Es war eine Mischung aus Ostern und Findling. Das … ling am Ende des Namens sollte auch ein Fingerzeig dafür sein, wie winzig er in Wirklichkeit war, doch egal. Gudrun hatte es irgendwie geschafft, dass er im Hause bleiben konnte. Sie selbst war kinderlos und sah in Steven einen Wink des Schicksals, Gottes Werk, wie sie es auch nannte. Doch schon von Anfang an lief alles schief. Mary, ebenfalls kinderlos, hasste Steven. Sie wünschte Gudrun heimlich zum Teufel, weil sie es gewagt hatte, sich über ihren Kopf hinweg bei den Bertelsens für Steven einzusetzen. Wäre er doch nur im Mülleimer erfroren, so dachte sie heimlich. Steven war in der Tat ein winziges Baby. Das änderte sich auch nicht, als er mit neun Monaten seine ersten Gehversuche absolvierte. Ab diesem Zeitpunkt begann für ihn die Hölle auf Erden. Verschwand etwas im Haus, gab Mary ihm die Schuld. Als ob ein Kleinkind das zwanzig Kilo schwere Reserverad des in der Garage stehenden Volkswagens gestohlen haben könnte. War das Essen versalzen oder verzuckert, Steven musste dafür den Kopf hinhalten. Zerbrach ein Glas oder ein Krug, schaute man erst in allen Ecken nach, ob nicht Steven in der Nähe war. Vor allem die langen Winternächte waren die Hölle für ihn. Also schrie er. Er brüllte acht Stunden am Stück, brüllte, wie eben nur in Mülltonnen gefundene Babys es konnten. Seine Schreie waren so laut, dass die Hausherren davon wach wurden. Die Bertelsens hatten natürlich nichts Besseres zu tun, als Mary dafür gehörig den Marsch zu blasen. Mary wiederum ließ ihre Wut an Gudrun und an Steven aus. Es war ein Teufelskreis, bei dem keiner so richtig glücklich wurde. Und so ging es all die Jahre hindurch, Tag für Tag, Nacht für Nacht, Woche für Woche. Mit Fünf schuftete Steven wie ein Ochsenknecht in der Küche. Man hatte es ihm angewöhnt, unterwürfig zu sein. Er musste für jede Kleinigkeit bitten und betteln, durfte nur dann das Wort zu ergreifen, wenn er gefragt wurde.
Schule?
Ja!
Umgang mit anderen Kindern?
Mary hatte darüber gelacht, als Gudrun es einmal gewagt hatte, zu laut darüber nachzudenken. Freunde hatte Steven nur einen. Zufall und etwas Glück helfend, fand er im Müll der Nachbarn eines Tages eine arg verbeulte Trompete. Er nannte sie Blechbrezel.
Sie in der Hand, schlich sich sein Faible für Musik auf leisen Sohlen in sein Gemüt. Die Liebe, die Steven der gold- und messingfarbenen Trompete entgegenbrachte, musste niemand begreifen. Sie war da. Spontan. Unwiderruflich! Johansson half ihm dabei, Blechbrezel wieder den Glanz besserer Tage zu geben und ihr erneut die ´soulige Seele` einzuhauchen, die sie vor Jahren wohl besessen haben mochte. Die Trompete wurde geschmiert, poliert, gehätschelt und liebkost und kurz darauf entlockte Steven ihr Töne, die zwar alle hören, doch die nur er wirklich verstehen konnte. Zusammen mit Blechbrezel erfand er Melodien, die sie beide, obwohl für andere schauerlich, von einer besseren Zukunft träumen ließen. Natürlich stand es ganz außer Frage, dass Steven im Haus spielte. Das hätte Mary nie zugelassen. Und so flüchtete er sich ein- oder zweimal die Woche in den nahen Wald. Dies geschah immer an den Tagen, von denen er wusste, dass Mary frei hatte. An ihren freien Tagen fuhr sie nämlich zu ihrer kranken Mutter ans andere Ende der Stadt. Die Stunden mit Blechbrezel waren die einzigen, die Steven ausgeglichen und glücklich verbrachte. Doch Mary schien richtiggehend darauf gedrillt zu sein, ihm Glück anzusehen und es zu zerstören. Mary jedenfalls, bekam Wind von der Liebesgeschichte und bereitete ihr ein Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Sie nahm Steven Blechbrezel weg und schloss sie in ihr Zimmer ein. Ein Punkt mehr für Mary Bloomfield. Einen Schritt näher an die kommende Katastrophe für Steven. Kurz darauf, es war letztes Jahr zu Weihnachten, hatte Stevie dann zum ersten Mal versucht, sich das Leben zu nehmen, doch das stumpfe Küchenmesser spielte da nicht mit. In der Küche hatte es danach ausgesehen wie in einer Schlachtstube. Was für eine Sauerei, war Marys einziger Kommentar. Aufwischen musste er diese Sauerei natürlich selbst. Auf Knien kriechend und mit blutigen Verbänden an den Handgelenken hatte er den Küchenboden solange geschrubbt, bis sein eigenes Blut Schnee von gestern war. Irgendwann im gleichen Jahr geschah es dann. Stevie setzte zum ersten Mal eine Art Hilferuf in Form eines zweiunddreißig Seiten langen Briefes auf. SOS an den Weihnachtsmann stand auf dem blütenweißen Umschlag. Einen bunten Weihnachtsbaum hatte er oben rechts darauf gemalt. Anstelle der Briefmarke, wie er dachte, taugte dieser gut. Er hatte vorher schon mal einen solchen Brief aufgesetzt. Das war kurz vor seinem Selbstmordversuch. Naiv wie er war, hatte er diesen dann einfach auf die Kommode im Flur gelegt. Er landete natürlich im Mülleimer. Beim zweiten Brief ging er dieses Risiko nicht ein. Irgendwann Ende November und kurz vor dem ersten Schnee, befestigte er den Brief direkt an die Ziegeln des Hausdaches direkt neben seinem Fenster im Dachgeschoss. Nächtelang wartete er gespannt, schielte bis weit nach Mitternacht vom Bett aus zum Fenster hinüber, harrte fast schon verkrampft auf ein Wunder. Eines Tages wurde sein Warten belohnt. Eine Eule, schneeweiß mit schwarzen, flauschigen Punkten auf ihrem Gefieder, landete mit einem kaum hörbaren Plopp genau neben seinem Manuskript. Ihre Augen funkelten wie Kohle, ja wie zwei von innen heraus glühende Kohlestückchen. Ein stummes Versprechen lag in diesen Feueraugen. Das war nie im Leben nur eine Eule, sagte sich Stevie. Er war von ihr fasziniert. Bevor sie, den Brief im gelb verhornten Schnabel, wieder davon flog, zwinkerte sie ihm aufmunternd zu und verschwand damit auf nimmer Wiedersehen. So blieb es dann auch … auf nimmer Wiedersehen! Stevie war enttäuscht und erleichtert gleichzeitig. Enttäuscht, weil sich die Eule in den kommenden Tagen gar nicht mehr blicken ließ. Erleichtert, weil er tief in seiner Seele wusste oder zumindest ahnte, dass er sie dennoch irgendwann wiedersehen würde. Die Zeit verging, Steven wurde älter und es kam der Tag, an dem er alles längst wieder vergessen hatte. Blechbrezel, die Eule, den Traum vom Weihnachtsmann … einfach alles! Hinzu kam, dass Mary ständig zu sagen pflegte: Weihnachtsmänner gibt es nur für (perfekte) anständige Kinder, nicht etwa für Bastarde. Weihnachten und den Weihnachtsmann kannte Steven also nur aus Büchern. Und von dem natürlich, was Gudrun ihm davon erzählte. Außerdem hatte Johansson ihm damals versichert, dass es in dieser Gegend längst keine Eulen mehr gab. Vor allem keine Schnee-Eulen, deren Augen wie Kohle glühten. Sicherlich hatte er die ganze Sache nur geträumt, na schöne Bescherung! Gudrun hatte sich oft schon überlegt, ob sie nicht das Haus verlassen sollte, doch Gott hatte ihr zu viele Handicaps in die Wiege gelegt. Ihr fehlte jegliches Selbstbewusstsein. Sie war weiterhin, um bei der Wahrheit zu bleiben, klein, nicht gerade zierlich und hässlich noch obendrein. Um den Kreis rund zu machen, hatte sie nie in ihrem Leben ein Schulgebäude von innen gesehen.
Mary Bloomfields krächzende Stimme riss Gudrun aus ihren düsteren Überlegungen.
»Du wirst mir diesen Bastard finden. Wenn nicht ... «
Gudrun ahnte, was dann passieren würde. Die Narben auf ihrem Rücken sprachen Bände. »Ja, Frau Bloomfield. Ich werde ihn finden und dann zu Ihnen bringen«, antwortete Gudrun, bevor sie geduckt von dannen schlich.
Am Abend dieses Tages sah Stevie wieder gespannt zum Fenster hinaus. Nicht etwa wegen der Eule oder wegen dem Brief. Das alles war Vergangenheit. Es gab da einen anderen Grund. Er glaubte zu wissen, dass heute schon wieder Heiligabend war. Bei Mary hatte er es sich rasch abgewöhnt, täglich auf den Kalender zu schauen. Ein Tag glich dem vorausgegangenem, wie ein Haar dem anderen. Ob Ostern, Weihnachten oder Geburtstag, alles war eine trübe Suppe, grau in grau. Vom Dachfenster aus beobachtete er die glitzernden, bunten Lichter, hinter den mit Reif beschlagenen, benachbarten Fensterscheiben. Der Geruch von gebackenen Äpfeln, von Zimt und frischen Marzipan schlug ihm verlockend entgegen. Irgendwo zwischen den Lüften hing der Duft einer gebratenen, gefüllten Gans. Steven musste seine Augen nicht schließen, um zu träumen. Er sehnte sich nach der Harmonie einer intakten Familie und danach, endlich mal den Weihnachtsmann zu sehen. Vielleicht, aber diese Frage konnte Stevie nur sich selbst beantworten, suchte er an diesem Abend im Unterbewusstsein nach einer Vaterfigur, hielt Ausschau nach jemandem, zu dem er aufschauen konnte, bewundernd, stolz, sich geborgen fühlend! Wieder blickte er durch die von außen angefrorenen Fensterscheiben, sah die Nachbarskinder, die, herausgeputzt und mit glänzenden Augen, Vater und Mutter an der Hand aus der Kirche strömten. Auch Stevens Augen glänzten feucht. Weihnachten! Es war in der Tat ein magisches Wort für den kleinen Stevie.
Ein Weihnachtsmann, noch dazu ein echter?
Nicht auszudenken, wenn es so etwas wirklich für ihn gäbe!
Vielleicht, eines Tages …
Oder war‘s doch alles nur Humbug?
Er wandte sich vom Fenster ab und wünschte sich weit weg von hier, weit weg von dem Ort, an dem …
Krchztttt.
Das kratzende Geräusch kam vom Dach genau über ihm. Es hatte sich angehört, als wäre ein Flugzeug darauf gelandet. Doch was wusste Stevie schon von Flugzeugen? Vielleicht war es auch nur Babbles, sein schwarzer Kater. Doch der, so stellte er mit einem Seitenblick fest, lag träge unter seinem Bett und leckte sich genüsslich die weißgetupften Samtpfoten. Plötzlich klopfte es an der Scheibe. Es war so ein dumpfes trockenes tock, tock, tock. Steven zögerte einen Augenblick. Hoffnung schüren, das wusste er nur allzu gut, ging meist ins Auge. Aber trotzdem. Was wäre, wenn der Weihnachtsmann wirklich existierte? Was, wenn er es war, der ungeduldig irgendwo dort draußen auf ihn wartete.
Niemals!
Aber, was hatte er schon zu verlieren?
Ungeschickt und mit einem dicken Kloß im Hals öffnete Steven Easterling schließlich das Fenster.
Das mathematische Genie
Von den Bergen her wehte ein kalter Wind. Noch schneite es nicht, doch das war sicher nur eine Frage von Tagen. Geldersbuch lag in einem Tal, das, eingekesselt von gleich vier Dreitausendern, nur selten die Sonne sah. Im Winter dauerten die Sonnentage fünf oder sechs Stunden und schon herrschte wieder Dämmerlicht. Wie das Wetter, so war auch das Gemüt der hier lebenden Menschen.
»Rumtreiber, Tippelbruder!«
Sie betrachteten ihn, als käme er vom Mars. Tobias, der Anführer der Bande, war ein rothaariger Angeber, ein Snob, der seine Esprit Baseballkappe ständig falsch herum auf dem Kopf trug. Auf der Frontseite der Kappe hatte er ein rundes Abzeichen drauf genäht, auf dem ein blutrotes T vor hellem Hintergrund zu sehen war. Er trat einen Schritt auf Tassilo, den Zigeuner, zu. Auf den Zehenspitzen wippend, sagte er: »Du stinkst und ich möchte wetten, dass Flöhe und Läuse auf deinem Kopf Samba tanzen.«
»Rumba«, erwiderte Tassilo trocken.
»Was?«
»Meine Läuse. Sie tanzen Rumba, nicht Samba.«
Einige Kinder lachten, die Mitglieder der Bande zogen lange Gesichter und Tobias, sein iPhone-7 in der Linken, kriegte den Mund nicht mehr zu. Hatte sich der Zigeunerjunge tatsächlich an ihn gewandt?
»Ich an deiner Stelle würde mich vorsehen. Läuse auf‘m Kopf ist wie Friedhof um halb zwölf.« Daraufhin hielt er Tassilo ein sorgfältig zusammengefaltetes Blatt Papier unter die Nase. »Hör zu. Ich will, dass du diesen Wisch vor versammelter Klasse vorliest. Kapiert? Und zwar Morgen, in der Mathestunde.«
Tassilo kniff die Augen zusammen. Instinktiv wollte er klein beigeben, doch diesmal siegte seine Neugier über die Vorsicht.
»Nein«, sagte er resolut. »Ich sehe mich nicht als dein Handlanger, Tobias.«
In den Reihen der Bande entstand Bewegung. Tobias Freunde wurden unruhig, sie wollten Taten sehen. Mit einem unauffälligen Seitenblick versicherte sich Tobias davon, dass sie noch hinter ihm standen und krempelte dann langsam die Ärmel hoch.
»Du hast es so gewollt, du verdammter Zehenzwischenraumabtrockner.«
Tobias war als Schläger bekannt. Seine Opfer, allesamt schwächer und kleiner als er, konnten ein Lied davon singen. Als Tassilo die Entschlossenheit seines Gegenübers spürte, verkrampfte sich sein Magen. Sein Vater, der ihn einst in die Kunst des Überlebens der ´Reisenden Leute` eingeweiht hatte, pflegte zu sagen: Kämpfe nur, wenn die Aussicht besteht, den Kampf auch zu gewinnen. Tassilo hob ebenfalls beide Fäuste. Er war sich nicht sicher, gewinnen zu können, hatte es aber satt, ständig vor Tobias davonzurennen. Von weitem hörte er den Schrei einer Eule, was ungewöhnlich war zu dieser Tageszeit. Irgendwo bellte ein Hund.
Ja. Sie würden es austragen. Hier und jetzt.
Tobias Grinsen wurde breiter. »Na also. Sonst rennst du immer davon wie ein Wiesel. Hast wohl heute deine Nike nicht an?« Er zog den Kopf zwischen die Schultern und setzte sich in Bewegung.
»Tu das nicht, Tobias!«
Alle Köpfe flogen herum. Erstaunt. Gespannt. Irritiert. Die Gestalt des Mädchens wirkte winzig. Angst ein Fremdwort, fegte sie wie eine Furie heran und zwängte sich zwischen die beiden Streithähne. Dabei bedachte sie Tobias mit einem Blick, der einen Grizzlybären in die Knie gezwungen hätte.
»Jenny?«
Respektvoll wich er einen Schritt zurück. Gleichzeitig sah er sich um. Seinen Freunden lag die Unsicherheit quer und schief im Gesicht. Sie hatten den Atem angehalten. Jenny hatte Tobias nämlich vor nicht allzu langer Zeit eine blutige Nase verpasst. Seitdem stand sie im Ruf, eine gnadenlose Kampffusel zu sein. Tobias fluchte innerlich, denn genau betrachtet blieben ihm nur zwei Möglichkeiten. Entweder vermöbelte er Jenny nach Strich und Faden, was unweigerlich seinen Ruf ruiniert hätte - welcher Kerl vergreift sich schon an einem Mädchen? - oder er machte einen eleganten Rückzieher. In beiden Fällen hätte er die A-Karte gezogen. Während es hinter seiner Stirn fieberhaft arbeitete, musterte er Jenny wütend.
»Halt dich da raus, Jenny. Das ist meine Sache.«
Jenny hörte ihm gar nicht zu. Mit dem Finger zeigte sie in Tassilos Richtung. »Er kann kaum lesen«, fauchte sie. »Na los, her mit dem Wisch. Ich übernehme das.«
Tobias griente. Tat sich da eine dritte Möglichkeit auf? »Du überrascht mich wieder einmal mehr. Aber bitte.« Er reichte ihr das Blatt. An Tassilo gewandt, sagte er. »Du kannst froh sein, dass sie aufgetaucht ist.«
Tassilo zuckte nur mit der Schulter. Er ließ seine Fäuste sinken und drehte Tobias den Rücken zu.
»Sieht so aus, als verdanke ich dir meine Rettung«, sagte er an Jenny gewandt.
Er kannte Jenny kaum. Bisher hatte er ihr nur flüchtige Blicke über die Köpfe der anderen hinweg zugeworfen und jedes Mal dabei gedacht, dass sie ein Mädchen war, das ihm ganz gut gefallen könnte. Was er jetzt aber sah, warf alles über den Haufen. Diese Jenny war Bombe! Jenny, recht irritiert, warf einen Blick auf den Text, den Tobias ihr überreicht hatte. Der begann mit ... alle Zigeuner sind Sockendealer und stinken wie Kanalratten! Es folgten die üblichen Schimpftiraden. Trotz ihrer Sympathie für Tassilo musste sie lächeln. Man konnte über Tobias sagen, was man wollte, einen fantasiereichen Wortschatz, den hatte er.
Sich der prüfenden Blicke Tassilos nur allzu sehr bewusst, straffte sie die Schultern. »Gaff mich nicht so an. Es sollte unter deiner Würde sein, dich mit dem da zu prügeln.«
»Ich hab nicht angefangen«, frotzelte Tassilo.
Jenny trat einen Schritt auf ihn zu, blieb aber so abrupt stehen, als wäre sie gegen eine unsichtbare Wand geprallt. Angewidert rümpfte sie die Nase. »Puh! Ich bin mir zwar fast sicher, dass du keine Flöhe und Läuse hast, aber eine heiße Dusche könnte dir trotzdem nicht schaden.«
Die Meute hinter Tobias brach in schallendes Gelächter aus. Einige rümpften ebenfalls die Nase, andere begnügten sich mit Ausrufen wie Stinkstiefel, Schweineigel, sogar ´wandelnde Jauchegrube` war zu hören. Tassilo war, als hätte ihm jemand ins Gesicht geschlagen. Einer Mauer von Hass und Ablehnung gegenüber stehend, fühlte er sich machtlos. Und einsam. Wie ein in die Enge getriebenes Tier sah er um sich. Er war Roma. Und er war stolz auf seine Herkunft. Aber wie, so fragte er sich, sollte er, Dreikäsehoch und schüchtern wie Vier, es schaffen, Vorurteile aus dem Weg zu räumen die schon seit Jahrhunderten existierten? Dass Zigeuner Zauberer und Wahrsager waren, wussten nur die wenigsten. Wie sollten sie auch, gab es doch niemanden, den es wirklich interessierte. Es gingen irrsinnige Gerüchte umher. Eines davon besagte, dass alle Zigeuner stinkreich wären. Weil sie keine Steuern zahlen müssten, oder so. Tassilo hatte seine liebe Mühe, das zu verstehen, denn seine Eltern waren von jeher arm wie Kirchenmäuse. Warum also diese Lügen, woher diese himmelschreiende Ungerechtigkeit? Das alles ging ihm in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf, während er gleichzeitig die Gesichter um sich herum musterte. Er horchte tief in sich hinein, suchte vergeblich eine Art von Erkenntnis, eine Antwort gar. Doch schließlich zuckte er nur mit den Schultern. Er weigerte sich fortan, über etwas nachzudenken, was sein Begriffsvermögen überstieg. Jenny und der Bande den Rücken zudrehend, schlenderte er ohne ein weiteres Wort zu verlieren davon. Auf dem Nachhauseweg und nachdem er sich versichert hatte, dass niemand ihn sehen konnte, brach er schließlich in Tränen aus. Am nächsten Tag saß Tobias, Arme und Beine gekreuzt, auf einen der hintersten Sitze des Klassenzimmers und wartete ungeduldig. Er genoss das Getuschel und die anerkennenden Blicke der anderen Mitschüler. Bei Schulbeginn hatten ihn alle, mit Ausnahme von Tassilo, einstimmig zum Klassensprecher gewählt. Nicht etwa weil er intelligenter als andere Schüler war oder in einem Fach besonders glänzte. Weit gefehlt. Sie hatten ihn gewählt, weil er mit seiner FIRMA, (so nannte Tobias seine Bande) gerade unter den jüngeren Schülern Angst und Schrecken verbreitete. Auf den Flugblättern, die sie heimlich auf der Toilette verteilten, stand in krakeliger Schrift zu lesen.
Liste der zur Wahl des Klassensprechers bereitstehenden Kandidaten.
Kandidat 1: Tobias, Strebermann.
Kandidat 2: Strebermann, T.
Kandidat 3: Tobias, S.
AGBs (Allgemeine Geschäfts-Bedingungen) für die Wahl des Klassensprechers: Nur einen Namen angeben! WARNUNG: Wer aus Versehen einen Kandidaten wählt, der NICHT auf der Liste steht, wird von der FIRMA, nach dem Motto, nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer, behandelt.
Pünktlich um acht war es dann soweit. Die Türe öffnete sich und der Lehrer betrat mit Jenny, Tassilo und einigen anderen Nachzüglern im Kielwasser das Klassenzimmer. Noch im Schulhof hatte Jenny Tassilo kurz am Ärmel gezupft und gesagt. »Ich werde ab heute immer ein Auge auf dich haben. Ein scharfes Auge!«
Wie sie das meinte, war Tassilo ein Rätsel. Bodenhausen, der Lehrer für Mathematik, war ein imposanter Mann mit einem spitzen, nach oben gezwirbelten Schnauzbart. Eine mit Silber beschlagene Nickelbrille mit winzigen, kreisrunden Gläsern à la Harry Potter thronte auf einer Nase, die mit roten, winzigen Äderchen durchzogen war. Man sagte ihm nach, dass er gerne tief ins Glas schaute, aber egal. Er war ein Mathematikgenie. Außer Mathematik lehrte er noch Geschichte und Biologie. Mit ihm war der Unterricht nicht nur ein stures Pauken, sondern ein leidenschaftliches Wühlen in der Vergangenheit und ein gnadenloses Vorstoßen in die Zukunft. War er mit den Schülern in Geschichte unterwegs, hatte er die Fähigkeit, den Lehrstoff so lebhaft und auch wirklichkeitsnah vorzutragen, dass seine Schüler glaubten, sie würden neben Hannibal die Alpen überqueren oder an der Seite einer Horde Kreuzritter Jerusalem gegen Salah ad-Dins Wüstenschergen verteidigen. Ebenso verhielt es sich mit Biologie und Mathematik. Jede Minute mit ihm als Pauker glich einem Erlebnis, aus dem man nicht nur als Held, sondern auch noch reich an vermitteltem Wissen hervorging. Bodenhausen, bei den Schülern allgemein bekannt unter dem Spitznamen Hosenboden, stürmte mit langen Schritten auf sein Pult zu. Dann begann eine den Schülern wohlbekannte Zeremonie. Er zog schweigend ein Bild aus seinem Portemonnaie und betrachtete es einige Sekunden lang. Das Bild zeigte ihn als Vierjährigen auf einem Dreirad mit ausgeleierten, verrosteten Stützen. Neben ihm stand seine inzwischen verstorbene Mutter. Er hatte sie vergöttert, vergötterte sie noch. Dann, die Augen feucht vom Raureif, den vermutlich der Wind durchs Klassenzimmer blies, musterte er über den Rand seiner Nickelbrille hinweg jeden seiner Schüler einzeln. Er kannte sie alle. Nicht wenige wichen seinem Blick aus, denn er konnte in ihren Gesichtern lesen, wie in einem Buch. Im Klassenzimmer herrschte derweil ein eisernes Schweigen.
»Tobias«, sagte er schließlich mit einer ungewöhnlich milden Stimme. »Ich muss gestehen, dass ich mich gewaltig in dir getäuscht habe.«
Die Klasse blieb auch nach dieser kleinen Rede stumm. Erst als der Pauker sich geräuschvoll räusperte, ging ein Tuscheln der Erwartung durch die Reihen. Pauker Hosenboden sprach mit Engelszungen? Vorsicht war also geboten!
Er winkte mit erhobenem Finger. »Komm nach vorne, mein Junge.«
Tobias war entsetzt. Er konnte kaum sprechen, geschweige denn laufen.
»Jenny!« Mit einem Kopfnicken rief Hosenboden auch Jenny zu sich.
Am Pult des Paukers angekommen, trat Tobias solange unsicher von einem Bein aufs andere, bis Hosenboden, nun an alle gewandt, endlich die Katze aus dem Sack ließ.
»Jenny wird euch nun einen Aufsatz vorlesen, den angeblich Tobias geschrieben hat.« Sein Blick fiel auf Tobias. »Na ja. Ihr alle kennt ja seine Schreibkünste.«
Die Klasse tobte.
»Der Brief ist Tassilo und seiner Familie gewidmet.«
Bodenhausen wählte seine Worte mit Bedacht, denn Tobias Vater war immerhin der Rektor der Schule. Tassilo errötete. Er wusste nicht so recht, wie er sich verhalten sollte. In der hintersten Reihe schoss derweil ein Finger in die Höhe. Es war Frank, einer von Tobias Bande.
»Schieß los, junger Mann«, forderte Hosenboden ihn auf. »Ich hoffe, es ist kein Unfug.«
Frank erhob sich. »Herr Lehrer. Es war abgemachte Sache, dass Tassilo diesen Wisch selbst vorliest, aber dafür ist er wohl zu dämlich. Und was Jenny angeht. Sie ist ein Mädchen. Und Mädchen sind doof, das lernen wir Jungs schon in der dritten Klasse. Im Deutschunterricht, bei Frau Watzke.«
Sofort war im Klassenzimmer die Hölle los. Andere Stimmen wurden laut, doch schließlich war es die lange Lisa die, ohne zu zögern, das Wort ergriff.
»Tobias soll vorlesen.«
Jawohl, Tobias soll selbst vorlesen!
Tobias, Tobias, Tobias, tönte es im Chor.
Hosenboden hatte alle Mühe, für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
»Ruuuhe«, brüllte er, während sein Zwirbelbart auf und ab hüpfte, was wiederum allgemeines Gelächter hervorrief. Jenny nutzte diese Gelegenheit, Tobias das Blatt zuzuschieben. Auf ihrem Gesicht erschien dabei ein unergründliches Lächeln.
In einem Büro eine Etage höher, hatte sich Rektor Strebermann, ein kleiner schmalbrüstiger Mann mit einem ständig selbstgefälligen Lächeln im Gesicht, gemütlich hinter seinem Schreibtisch niedergelassen. Er war stolz darauf, diesen Posten innezuhaben. Stolz, eine Schule zu leiten, in dessen Mauern Friede und Ordnung herrschten. Der einzige Dorn in seinem Auge war der Clan der Zigeuner und die schreckliche Gewissheit, dass einer von ihnen seine Schule besuchte. In Gedanken überquerte er den Schweinsbach und dachte an Tassilos Schwester in dieser verdammten Holzkiste, die sie bei ihren fragwürdigen Darbietungen einfach mittendurch sägten. Er wurde in seinen Gedanken unterbrochen, denn genau in diesem Augenblick begann es im Klassenzimmer unter ihm zu toben. Der Lärm schwoll an und wurde mit der Zeit so laut, dass das ganze Schulgebäude bebte.
Mit einem Satz war der Rektor auf den Beinen. Sicher, dass es sich um eine Rebellion, um einen Aufstand gegen seine Autorität und gegen seine Schule handelte, stürmte er mit wehenden Haaren die Treppe hinunter und flog förmlich ins Klassenzimmer, mitten hinein ins Getöse.
»Was zum Teufel geht hier vor?«
Schlagartig wurde es still. Nur die lange Lisa konnte nicht umhin, hinter vorgehaltener Hand zu kichern.
»Du da!« Strebermann zeigte mit dem Finger auf sie. »Steh gefälligst auf und erkläre mir dein unverschämtes Verhalten.«
»Wenn ich mich weigere?«
»... fliegst du von der Schule!«
Lisa ließ sich das nicht zweimal sagen. Mit einem triumphierenden Lächeln erhob sie sich, raffte ihre Siebensachen zusammen und schickte sich an, das Klassenzimmer zu verlassen. Kaum an der Tür angekommen, holte Strebermanns Stimme sie ein.
»Schon gut, schon gut. Ich wollte ja nur wissen, über was du dich lustig machst. Setz dich, dumme Gans.«
Lisa grinste, streckte Zeige- und Mittelfinger zum Victoryzeichen in die Luft und ging zurück zu ihrer Bank. Dort angekommen wandte sie sich an den Rektor.
»Da war noch etwas, Herr Rektor.«
»Ich höre.«
»Der Bart von Pauker Hosenboden wackelt wie der von einem alten Ziegenbock«, puffte sie.
»Sei still«, wies der Rektor sie scharf zurecht. Und mit einem Blick in die tobende Klasse. »Ich freue mich ja, dass unser Kollege Bodenhausen bei euch so ein gutes Echo findet, aber das ist zu viel.«
Alle Augen richteten sich auf Pauker Bodenhausen. Der jedoch schien sich köstlich zu amüsieren. Tobias und Jenny standen immer noch wie angewurzelt neben ihm. Tobias zitterte am ganzen Leib und so war es schließlich Jenny, die mit fester und lauter Stimme das Wort ergriff.
»Herr Rektor. Tobias hat sich dazu entschlossen einen Aufsatz vor versammelter Klasse vorzulesen, nicht wahr Tobias?«
Sie boxte Tobias dabei mit ihrem Ellbogen heftig in die Seite, was diesen aus seiner Erstarrung löste. Ein tückisches Grinsen huschte augenblicklich über sein Gesicht.
»Ja, Vater.«
Mit einer Geschwindigkeit, die niemand ihm zugetraut hätte, trat Strebermann einen Schritt auf Tobias zu und versetzte ihm eine saftige Ohrfeige. »Jawohl, Herr Rektor, heißt das«, korrigierte er ihn. »Was ist das für ein Aufsatz?«
Tobias begann zu lesen. »Zigeuner ...«, sprach er und stockte plötzlich mitten im Satz. Er sah aus, als hätte er einen Frosch verschluckt. Verwundert drehte und wendete er das Papier in seinen Händen.
»Lies weiter«, donnerte sein Vater.
Aller Augen richteten sich wie gebannt auf Tobias. Wohl auch deswegen sah niemand die Eule, die draußen auf der verschneiten Fensterbank saß, ins Klassenzimmer starrte und alles genau beobachtete. Dabei erweckte sie ganz und gar den Anschein, zu verstehen, was so alles gesprochen wurde. Hätte jemand genauer hingesehen, so wäre ihm sicher aufgefallen, dass sie sich sogar Notizen machte.
Zigeuner, begann Tobias heiser, sind ehrenwerte, aufrichtige Bürger. Sie zaubern Lächeln auf unsere düsteren Gesichter und bringen Licht in die trüben, dunklen Schatten unserer äh... unserer spießbürgerlichen Herzen. Mit ihren Künsten malen sie kunterbunte Begeisterung auf unsere vom Alltag abgestumpften Seelen. Und das alles für lächerliche zwei Euro fünfzig. Als Tobias den Aufsatz mit Zigeuner sind Menschen wie du und ich beendete, geriet die Klasse außer Rand und Band. Tosender Beifall erklang. Tobias hatte erreicht, was er ursprünglich wollte. Er stand im Mittelpunkt. Doch, so sagte er sich mit hochrotem Kopf, hätte er unter diesen Umständen gerne darauf verzichtet. Der Gewinner dieses abgekarteten Spieles war eindeutig Tassilo.
Ganz dicke Freunde
Zwei Wochen waren seit diesen Ereignissen vergangen. Weihnachten näherte sich mit riesigen Schritten. Es war bitter kalt, dicke Schneeflocken fielen vom silbergrauen Himmel und die Landschaft glich einer weißen Decke, sanft, weich, makellos. Jenny und Tassilo waren längst dicke Freunde geworden. Den Großteil ihrer Freizeit verbrachten sie mit Lisa und einem pausbackigen Jungen namens Karl unten am Schweinsbach. Ihr Terrain war das Lager der Zigeuner, auf der anderen Seite des Bachs. Dort, wo niemand hätte wohnen wollen, dort, wo es im Frühling und Herbst sumpfig und feucht, im Sommer knochentrocken und von Moskitos verseucht und im Winter kalt wie am Nordpol war. Karl saß Lisa gegenüber und hantierte mit einem gefährlich aussehenden Messer. Es hatte einen rabenschwarzen Griff, dessen Ende ein Knauf in Form eines Totenkopfes zierte. Die Augen des Totenkopfes funkelten wie Rubine. Als Zeichen ihres Freundschaftsbundes hatte er auf der silbernen Klinge eine fette 4 eingravieren lassen: Vier Freunde. Das machte schon was her!
»Und? Was habt ihr euch zu Weihnachten gewünscht?«
Diese Frage kam überraschend. Lisa, die sonst stets ein loses Mundwerk hatte und nie um eine Antwort verlegen war, wusste zunächst gar nichts damit anzufangen. Obwohl sie sich für solche Spielchen zu alt vorkam, arbeitete es tief in ihr. Schlimmer noch, nie, so gestand sie sich, hatte sie je eine Frage so berührt.
»Ich weiß nicht, was ich überhaupt davon halten soll«, gab sie zu und machte ein ziemlich ratloses Gesicht. »Ein Fahrrad wär mir ganz recht. So ein silbernes. Silbern wie ein Blitz. Dann könnt ich auf und davon fahren. Weg von hier. Dorthin, wo mich jeden Tag jemand fragt, was ich gern hätte, zu Weihnachten und überhaupt. Aber so einen Ort gibt’s ja nicht. Geldersbuch ist ein elendes Kaff, falls ihrs noch nicht geschnallt haben solltet.«
Karl, das Frettchen, wie er auch genannt wurde, hatte da seine eigene Philosophie.
»Ich finde Weihnachten t-t-toll«, sagte er mit einem süffisanten Grinsen. »Zumindest ist es mal was anders, als …«
»Das fände ich in deiner Situation auch«, unterbrach Lisa ihn scharf. Geniert starrte sie auf ihre Löcher in den Jeans. Die hatten mehr mit roten Zahlen als mit Trendmode zu tun. Frettchen Karl, und nur darauf spielte Lisas Kommentar ab, stammte aus einer reichen Familie. Karl überhörte den tadelnden Unterton in ihrer Stimme. Er redete einfach weiter drauf los. »Ich will ’n iPhone 8 und einen tragbaren DVD- Player von Philips, l-l-letzte Version für sage und schreibe dreihundert achtundneunzig Euro.«
Schweigen.
Erst jetzt merkte er, dass er etwas Falsches gesagt hatte. Er stand auf, zog sich die Mütze vom Kopf und verneigte sich: »Mea Culpa, tut mir leid. Sind wir trotzdem noch Freunde?«
»Klar«, sagte Lisa. »Manchmal aber bist du richtig Snob. Dann könnte ich ausrasten.«
Karl konnte die Zeichen an der Wand sehr wohl lesen. Schnell wechselte er deshalb das Thema. »Was mich an Weihnachten stört, ist, dass es keinen echten W-W-Weihnachtsmann gibt. Mit einer hammermäßigen Kutsche die von zwölf Rentieren gezogen wird oder so ...« Er schwieg eine Weile, während ein Schatten sein Gesicht verdunkelte. »Ellie mochte Rentiere«, fügte er ganz leise hinzu, während seine Augen sich langsam mit Tränen füllten.
Lisa und Tassilo wussten, wie sehr Karl unter dem Tod seiner Schwester litt. Sie kam vor nicht mal einem Jahr bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben. Ein LKW hatte ihren Volkswagen Beetle mit voller Wucht von hinten gerammt, als dieser bei Rot vor der Ampel stand. Karl und sein Vater wurden aus dem Auto geschleudert, doch Ellie, eingeklemmt und bei vollem Bewusstsein, verbrannte darin. Karl gab sich selbst die Schuld, denn normalerweise hätte er hinten sitzen müssen. Karl hatte bereits seinen Bruder verloren, doch diesen düsteren Gedanken verdrängte er, so gut es ging.
»Klugscheißer, Karlie«, sagte Tassilo, um ihn abzulenken. »Du glaubst also nicht, dass es Väterchen Frost gibt?«
Karl, zwölf und clever wie Einstein, glaubte fest an den Weihnachtsmann, doch er wollte sich keine Blöße geben. »Nicht die Bohne«, sagte er deshalb schnell. »Weihnachten an sich ist okay, aber an den Weihnachtsmann zu glauben ist was für Loser.«
Er hielt den Atem an und warf einen schnellen Blick in die Runde. Das Thema schien alle etwas zu verunsichern. Alle, außer Tassilo.
»Wie feiern übrigens Z-Z-Zigeuner Weihnachten?«
Abwesend an einem Strohhalm knabbernd, machte Tassilo ein nachdenkliches Gesicht. Er trug Bluejeans und einen dicken, schwarzen Rollkragenpullover mit einer roten Kapuze. Auf dem Rücken des Pullovers stand in weißen Buchstaben Polizei K-9. Ein schwarzer Schal schützte sein Gesicht vor der klirrenden Kälte.
»Weihnachten? Bei uns? Na ja, es wird viel getanzt. So viel, dass ich mir daheim manchmal vorkomme wie in der Zappelbude. Überhaupt ist es eine ganz schön flippige Angelegenheit. Jeder lacht, jeder singt. Enzo, mein großer Bruder spielt den ganzen Tag auf der Fidel. Drei Tage lang essen wir uns satt. Bis zum Platzen, ich schwöre es. Und ...« Er unterbrach sich. »Na ja, ehrlich gesagt schließe ich mich ganz Karls Meinung an. Die Geschichte vom Weihnachtsmann ist Kinderkram. Wir quatschen uns damit völlig unnötigerweise ein Kotelett ans Ohr.«
»Bingo, Mann«, sagte die lange Lisa. »Leider hast du so was von recht. Letztes Jahr bin ich bei uns im Keller auf eine alte Kiste gestoßen. Na prächtig kann ich euch sagen. Ich mache sie auf und was finde ich? Bart, Mantel und Kapuze. Zunächst dachte ich an Karneval oder daran, dass jemand von meinen Eltern Mantel-und-Degen Komödien à la Cyrano de Bergerac spielt. Bis mir dann ein Licht aufging. Weihnachtsmann? Showbiz, sag ich deshalb da nur. Der kommerzielle Kram steht im Vordergrund. Der Rest ist alles eine große verarsche.«
»Du willst doch nicht etwa b-b-behaupten, dass dein V-V-Vater sich als Weihnachtsmann verkleidet, oder?«
»Mein Vater, mein Onkel oder wer auch immer«, gab Lisa nüchtern zurück. »Tassilo hat's erfasst. Es gibt keinen Weihnachtsmann, aus, basta. Lasst uns damit aufhören, an das zu glauben, was andere uns partout weismachen wollen. Finden wir uns endlich damit ab: Die Welt, in der wir leben, ist realitäts- und schotterorientiert. Wer träumt und deswegen den Zug verpasst, bleibt auf der Strecke. Surfe im Net, bleib up to date und die Welt liegt dir zu Füssen. Sei Kind, schließ die Augen und fang an zu träumen und der moralische Untergang ist dir gewiss.«
Karl tat so, als hörte er Lisa nicht, obgleich die Worte die sie sprach, ihre Wirkung auf ihn nicht verfehlten. Er hatte so fest an den Weihnachtsmann glauben wollen und nun das. Schöne Bescherung. »Aber warum machen Erwachsenen sowas?«, empörte er sich. »Ich meine, warum kommen sie uns ständig mit diesen naiven Verwandlungskünsten an Weihnachten?«
»Warum?«, fragte Tassilo. »Sie lenken sich damit von ihren Alltagsproblemen ab, denken, wir merken es nicht. Für sie sind wir armselige Kniebeißer, mehr nicht.«
Lisa lachte. »Weißt du was Karl? Bei der nächsten Gelegenheit ziehst du einfach mal ganz fest am Bart vom Heuchel- Weihnachtsmann und fragst deinen Paps oder wer immer es auch ist, selbst.«
»Ich hasse Weihnachten!«
Alle Köpfe fuhren herum. Jenny, die bisher so getan hatte, als ginge sie das alles nichts an, stand mit verschränkten Armen vor ihnen. Lange Zeit sagte sie nichts mehr, starrte nur irgendwo ins Leere, wobei ihr Gesicht zuckte und sich dann förmlich in Tränen auflöste.
»Ich hasse Weihnachten ...«, rief sie erneut. »Der Weihnachtsmann kann mir gestohlen bleiben. Das Leben macht keinen Spaß und ich denke, es wird Zeit, sich daraus zu verabschieden.«
Kaum gesagt, stand sie auf und fegte wie der Blitz davon.
Frettchen Karl und die lange Lisa blickten sich verständnislos an.
»Habt ihr das genauso gehört wie ich?«, fragte Lisa.
»Die wird schon wieder«, gähnte Tassilo. »Mädchen in diesem Alter haben nun mal solche zickigen Anfälle.«
Karl schüttelte den Kopf. »Nicht Jenny. Wir müssen etwas unternehmen sonst tut sie es wirklich!«
»Was? Sich umbringen?«
Lisa nickte. »Ich hab läuten hören, sie hätte da ein Problem mit ihrem Vater. Was da alles so schief läuft weiß ich auch nicht. Karl hat aber recht. Jenny ist nicht der Typ, der leere Versprechungen macht oder nur dumm daher labert.«
Tassilo sprang auf. Er hatte genug gehört. »Worauf warten wir dann noch? Wir müssen ihr hinterher.«
Mit einem einzigen Satz heftete er sich auf Jennys Fersen. Draußen war es fast dunkel. Zu allem Überfluss schneite es inzwischen so stark, dass er kaum über seine Nasenspitze hinweg sehen konnte. Zunächst rannte er einfach blind darauf los, doch schon nach einigen Metern wurde er sich der Absurdität seines Handelns bewusst. Es gab keine Spuren im Schnee. Außerdem war Jenny viel schneller unterwegs als er. Leichtfüßig wie eine Gazelle war sie ihm auf kurzen Distanzen haushoch überlegen. Auch schien sie ganz genau zu wissen, wohin sie wollte. Plötzlich kam ihm ein Einfall.
Das Baumhaus, natürlich!
Der Hang, an dem sie es gebaut hatten, lag auf der anderen Seite des Schweinsbaches unmittelbar unterm Damm. Der Damm, eingebettet in einer Talmulde zwischen den Bergen, war zu dieser Zeit sicher längst zugefroren. Man konnte dessen fast hundert Meter hohe, bedrohlich aussehende Mauer, schon von weitem sehen. Tassilo hatte sich immer schon gefragt, was geschehen könnte, würde diese Mauer eines Tages dem extremen Druck der Wassermengen nachgeben. Jenny und er hatten eine ganze Woche an dem Baumhaus gearbeitet und es war ihr kleines, prickelndes Geheimnis. Dort konnten sie ungestört heile Welt spielen! Urplötzlich hörte es auf, zu schneien. Dafür blies ein eisiger Wind von den nahen Bergen, dessen Gipfel nun silbern glänzten. Ungeachtet der bitteren Kälte stapfte Tassilo weiter durch die dunklen Gassen. Am Ende der Stadt tat sich eine sanfte Hügellandschaft vor seinen Augen auf. Unter seinen Füssen krachten und knirschten kalte Eiskristalle, während sich heiße Schweißtropfen auf seiner Stirn bildeten und seine Spuren sich im Schnee verewigten. Einmal die ersten Hügel hinter sich, ging es urplötzlich steil bergauf. Der zähe Pappschnee reichte ihm bis an die Knie und es dauerte nicht lange, bis seine Beine sich anfühlten wie Blei. Sein Atem hörte sich an wie eine Babyrassel und er wünschte Jenny heimlich zum Teufel. Plötzlich hörte er eine Stimme. Lisa und Karl? Waren sie ihm gefolgt?
»Mach schnell.«
Da war sie wieder. Er blieb stehen, sah zurück.
»Nicht stehen bleiben!«
Die Stimme klang schrill. Und sie klang urig. Wie die ersten empörten Worte eines Trolls, so dachte er, der, tausend Jahre in eine Kiste gesperrt, erstmals das Licht des Tages wieder sah. Im Mondlicht konnte er Karls und Lisas Silhouetten ausmachen. Einige hundert Meter talabwärts, bahnten sie sich ihren Weg zu ihm herauf. Die Stimme. Sie konnte unmöglich von Karl und Lisa stammen. Er rieb sich die Augen, sah sich weiter um und erschrak heftig. Seine eigenen Spuren im Schnee! Sie waren nicht zu sehen. Es war, als hätte eine teuflische Hand die vor zehn Sekunden noch sichtbaren Spuren einfach weggewischt. Doch wer ...?
»Schwing die Hufe, Kamerad. Der Damm bricht, du musst schleunigst weg von hier!«
Das war hinter ihm. Er fuhr herum. Im vagen Licht, dort, wo keines hätte sein dürfen, stand eine uralte Eiche. Auf einem ihrer knorrigen Äste saß eine Eule. Sie starrte ihn unverwandt an.
»Na? Was denn nun?«, fragte sie ihn. Dabei wackelte ihr ganzes Federkleid. »Spreche ich chinesisch?«





























