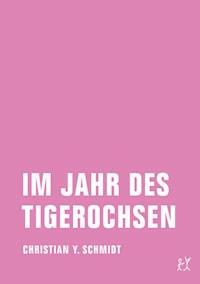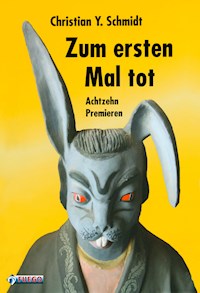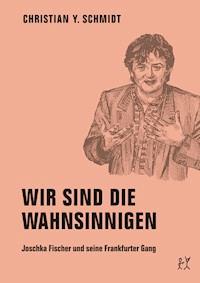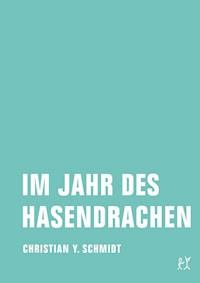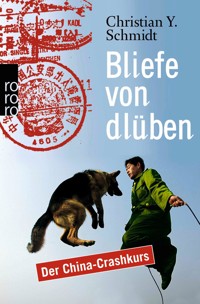
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Journalist und Satiriker Christian Y. Schmidt kennt sich in China bestens aus, ist er doch mit einer Chinesin verheiratet und lebt in Peking. Hier beobachtet, probiert und kostet er, was er an typisch Chinesischem, an Seltsamem und Bemerkenswertem so vorfindet. Fünf Jahre lang berichtete er darüber in seiner «Titanic»-Kolumne «Bliefe von dlüben». Jetzt gibt er alles: Er hat ein ganzes Buch geschrieben. Und zwar das Handbuch für künftige Chinaversteher. Kultur, Alltag, Politik – kein Bereich wird ausgespart. Mit viel Charme und zuweilen grellem Witz erzählt Schmidt, wie er sich unerschrocken durch den chinesischen Alltag manövriert: Im Restaurant bekommt er lebenden Fisch serviert, und die Raubkopie von «Bridget Jones», auf die er sich so freute, hat «Piano»-Untertitel. Außerdem kennen Taxifahrer hier keine Anschriften; sie orientieren sich grob am Stand der Sonne, dem Vogelflug und den Gezeiten. Aber es geht Schmidt auch um ganz solide Fragen, zum Beispiel, welche Folgen die von der chinesischen Regierung initiierten Zivilisierungsmaßnahmen (nicht rotzen, nicht rauchen, nicht im Pyjama rausgehen) für Chinas Kultur haben. Kurz: In diesem Buch findet sich alles, was man über China wissen will – komisch, unterhaltsam, lehrreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Christian Y. Schmidt
Bliefe von dlüben
Der China-Crashkurs
Über dieses Buch
Der Journalist und Satiriker Christian Y. Schmidt kennt sich in China bestens aus, ist er doch mit einer Chinesin verheiratet und lebt in Peking. Hier beobachtet, probiert und kostet er, was er an typisch Chinesischem, an Seltsamem und Bemerkenswertem so vorfindet. Fünf Jahre lang berichtete er darüber in seiner «Titanic»-Kolumne «Bliefe von dlüben». Jetzt gibt er alles: Er hat ein ganzes Buch geschrieben. Und zwar das Handbuch für künftige Chinaversteher. Kultur, Alltag, Politik – kein Bereich wird ausgespart.
Mit viel Charme und zuweilen grellem Witz erzählt Schmidt, wie er sich unerschrocken durch den chinesischen Alltag manövriert: Im Restaurant bekommt er lebenden Fisch serviert, und die Raubkopie von «Bridget Jones», auf die er sich so freute, hat «Piano»-Untertitel. Außerdem kennen Taxifahrer hier keine Anschriften; sie orientieren sich grob am Stand der Sonne, dem Vogelflug und den Gezeiten. Aber es geht Schmidt auch um ganz solide Fragen, zum Beispiel, welche Folgen die von der chinesischen Regierung initiierten Zivilisierungsmaßnahmen (nicht rotzen, nicht rauchen, nicht im Pyjama rausgehen) für Chinas Kultur haben. Kurz: In diesem Buch findet sich alles, was man über China wissen will – komisch, unterhaltsam, lehrreich.
Vita
Chinakenner Christian Y. Schmidt schrieb lange die legendäre «Titanic»-Kolumne «Bliefe von dlüben», die inzwischen unter dem Titel «Im Jahr des Ochsen» in der taz fortgeführt wird. Bis 1996 Redakteur der «Titanic», arbeitet er seitdem als freier Autor (u. a. für FAZ, SZ, Konkret, Merian, NZZ, Zeit, Jungle World); außerdem ist er Senior Consultant der Zentralen Intelligenz Agentur sowie Gesellschafter des Weblogs riesenmaschine.de. Zusammen mit Achim Greser, Heribert Lenz und Hans Zippert verfasste er «Genschman» (1990) und «Die roten Strolche» (1994). 1998 erschien «Wir sind die Wahnsinnigen», seine Biographie über Joschka Fischer; 2008 das vielbeachtete Reisebuch «Allein unter 1,3 Milliarden».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung China Daily/Reuters/Corbis;
ISBN 978-3-644-10351-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Walter Myna
«Five years in China is a long time.»
(Marlene Dietrich in Josef von Sternbergs Shanghai Express, 1932)
Der schnellste Weg zum China-Abitur
Seit mehr als dreißig Jahren öffnet sich China der Welt. Etwa genauso lange wimmelt es im Land auch von westlichen Journalisten und Reportern, die unablässig Bericht erstatten. So sind auf westlichen Fernsehkanälen mittlerweile unzählige China-Features gesendet worden, und es ist tonnenweise Chinaliteratur erschienen. Trotzdem haben fast alle Besucher, die zum ersten Mal zu mir nach Peking kommen, keinen Schimmer, was sie hier erwartet. Kaum einem war vorher wirklich bewusst, dass in China momentan die größte materielle Umwälzung stattfindet, die die Welt je erlebt hat. Und die meisten staunen darüber, wie dieses Land jetzt aussieht und was das für seltsame Auswirkungen auf den Alltag der Chinesen hat.
Diese Ahnungslosigkeit hat mehrere Gründe. Einer ist, dass es einfach einen Haufen von Mythen und Legenden über China gibt, die sich in den Köpfen der Westler festgefressen haben und hier die Aufnahme neuer Informationen verhindern. Ein solcher Mythos ist zum Beispiel, dass die Chinesen rätselhafte Menschen sind, die wir kaum verstehen können. Ein anderer, Chinesisch sei eine nur sehr schwer erlernbare Sprache. Ein schönes Beispiel für eine im Westen nicht auszurottende Überzeugung ist auch der Glaube, die Chinesen könnten kein R aussprechen. Tatsächlich sind sie dazu sehr wohl in der Lage. Für die Pekinger ist das typische Pekinger «r», das sie im Mund rollen wie die Siegerländer, sogar so etwas wie ihr Dialektmarkenzeichen schlechthin. Sie lieben diesen Konsonanten so sehr, dass sie ein n am Ende eines Wortes gerne durch ein r ersetzen.
Dafür ist im Westen kaum bekannt, dass viele Südchinesen kein Sch sprechen können, worüber sich die Nordchinesen nicht wenig lustig machen. Und keiner außer mir weiß, dass meine anmutige Dolmetscherin eine leichte H-Schwäche hat. So sagt sie statt «Gehirn» «gering», was sehr lustig klingt. Ich muss trotzdem jedes Mal widersprechen. Gering ist das Gehirn meiner Dolmetscherin nämlich nicht, denn sonst könnte sie mir ja wohl kaum Chinesisch so perfekt ins Deutsche übersetzen. Andererseits können tatsächlich manche Chinesen kein R schreiben, wie man auf dem chinesischen Cover einer Johnny-English-DVD nachlesen kann: «He kmows no feal, he knows no dangel, he kmows nothing», vgl. auch Seite 71. Nur aus diesem Grund ist das L-Wortspiel im Titel dieses Buches auch gerade noch so gerechtfertigt. Eigentlich wurde es aber nur um der besseren Verkäuflichkeit willen gemacht. In Deutschland findet man halt Bücher über China mit R-L-Fehlern sehr komisch.
Ein anderer Grund für die Unkenntnis im Westen ist paradoxerweise die Berichterstattung etlicher Journalisten. Dabei ist den wenigsten, die mit mir in China leben, etwas vorzuwerfen. Die meisten sind alte China-Hasen, die ihre Kundschaft zu Hause nach bestem Wissen und Gewissen mit Nachrichten und Einschätzungen beliefern. Das falsche Bild wird in der Regel zu Hause gemalt, von den Redaktionen, die die Informationen auswählen, kommentieren und bewerten. Menschenrechtsverletzungen, Umweltskandale, Bauernaufstände und Krawalle von Minderheiten gehen bei ihnen immer gut, gern wird auch etwas Folklore genommen. An positiven Meldungen, wie und warum China wirklich funktioniert und wie der durchschnittliche chinesische Großstädter so lebt, besteht dagegen weniger Interesse.
Dazu kommen die Berichte von Journalisten, die sich nur für ein paar Wochen in China aufhalten und sofort meinen, den vollen Durchblick zu haben. Ein schönes Beispiel für diese Spezies sind die Talkshowtante Sandra Maischberger und der Sportchef des Hessischen Rundfunks, Ralf Scholt. Beide glaubten offenbar, geschätzte zehn Minuten China-Briefing reichten aus, um die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking kommentieren zu können. Beim Einmarsch der Nationen ins Olympiastadion erzählten sie ihrem Millionenpublikum neben vielem sonstigen Unsinn, die deutsche Delegation würde das Stadion später als bei anderen Spielen betreten, weil sich die Reihenfolge der Mannschaften nach dem «chinesischen Alphabet» richte. Nun haben die Chinesen überhaupt kein Alphabet, sondern Zeichen, was etwas radikal anderes ist. So konnte sich der Einmarsch eben nicht nach der Reihenfolge der Anfangsbuchstaben der Ländernamen richten, sondern musste sich an der Komplexität der Zeichen orientieren, die im Chinesischen für das jeweilige Land stehen. Die Länder, deren Zeichen sich aus wenigen Strichen zusammensetzen, liefen also zuerst ins Stadion ein, die mit vielen Strichen erst später. Weil aber das Zeichen für Deutschland (= de) mit fünfzehn Strichen bereits ein hochkomplexes ist, kam die deutsche Delegation kurz vor Schluss. So einfach war das, aber offenbar für Frau Maischberger und Herrn Scholt bereits zu hoch, um es vor der Moderation zu lernen.
Erzählen die Quatsch, weil sie es nicht besser wissen, tun andere das, weil ihr Unsinn einfach besser zu einer These passt, die sie sich schon zu Hause zurechtgelegt haben. So behauptete im August 2008 ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der für die Olympischen Spiele offenbar kurzfristig nach Peking verschickt worden war, in seinem Blatt: «In der 17-Millionen-Einwohner-Stadt ist der Mundschutz zum ganz gewöhnlichen Kleidungsstück geworden – so wie Sonnenhüte am Strand oder Wollschals an der Skipiste.» Das ist nun schlicht erfunden. Mundschutz wird in Peking höchstens bei SARS-Epidemien, den Sandstürmen im Frühjahr und Erkältungswellen oder aber von ganz wenigen überkandidelten Damen getragen, sonst nicht. Zwar scheint diese Falschmeldung auf den ersten Blick nicht weiter dramatisch, doch impliziert sie auch, dass bei uns in Peking die Luft so schlecht sei, dass sich niemand mehr ohne Mundschutz auf die Straße traue. Dazu kann ich nur sagen: Die Luft hier ist zwar oft wirklich nicht besonders, aber längst nicht so miserabel, wie die westlichen Medien immer tun.
Diese Fehlerliste ließe sich noch lange fortsetzen, zumal bei der politischen Berichterstattung und Kommentierung. Und so werden die schönsten China-Irrtümer auch im Verlauf dieses Buches immer wieder ein Thema sein. An dieser Stelle soll nur noch kurz das kenntnisloseste Stück China-Impression gewürdigt werden, das mir bisher unterkam. Es handelt sich um die Tagebuchnotizen von Christine Morgenroth, einer Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Hannover, die im September 2002 zusammen mit Oskar Negt und anderen in China unterwegs war. Abgedruckt ist der Bericht am Schluss von Negts Buch «Modernisierung im Zeichen des Drachen», das eigentlich ganz interessant ist. Die von Morgenroth verfassten vierzig Seiten aber strotzen von Fehlern und Plattitüden. Sie schreibt Namen von Menschen, Städten und Sehenswürdigkeiten falsch, sodass aus der Stadt Fengdu «Fangdu» wird und aus Baidi Cheng, der White Emperor City, die «White Conqueror City». Ein Mondkuchen, der alles Mögliche enthalten kann, aber in der Regel keinen Mohn, wird bei ihr nichtsdestotrotz zum «Mohnkuchen». In Shanghai meint sie eine «Hafenrundfahrt» auf dem «Yangzi» zu machen, der Fluss, auf dem sie herumschippert, heißt jedoch Huangpu. Außerdem will sie dem Leser einreden, der durchschnittliche Monatslohn eines Arbeiters in der Boomstadt liege bei hundert Yuan, also umgerechnet zehn Euro. Tatsächlich betrug er aber schon 2002 das Zehnfache. Sie staunt allen Ernstes darüber, dass es in China reiche Menschen gibt, erklärt ihren Lesern, das Vermieten von Wohnungen sei verboten («es wäre privates Unternehmertum»), und Taxifahrer in Shanghai nähmen aus Angst vor der Polizei keine ausländischen Touristen mit. Beides ist natürlich Quatsch.
Diese völlige Verkennung der chinesischen Verhältnisse wäre eventuell noch zu akzeptieren, wenn Frau Morgenroth ansonsten bei Lidl an der Kasse sitzen würde und ihre Eindrücke unter der Überschrift «Mein schlimmstes Ferienerlebnis» in ihrem Privatblog veröffentlicht hätte. Von einer Professorin aber, die einen Aufsatz in einem Buch publiziert, das in einem renommierten Verlag erschienen ist, sollte man eigentlich ein Minimum an Recherche erwarten. Stattdessen aber schlägt sie in ihrem Text einen Ton an, der in seiner Blasiertheit schwer zu übertreffen ist. Anlässlich eines Vortrages, den sie zusammen mit Oskar Negt an der Shanghaier Tongji-Universität vor chinesischen Akademikern auf Deutsch hielt, schreibt sie: «Die Bedeutung der wechselseitigen Abhängigkeit von Gesellschaftlichkeit und Subjektivität und die subtilen und differenzierten Formen der wechselseitigen Beeinflussung, über die wir ja ständig nachdenken und wofür wir Konzeptualisierungen entwickeln wollen und müssen, diese Frage stellt sich den Chinesinnen und Chinesen hier vom Denkerischen her zunächst überhaupt nicht.» In vernünftiges Deutsch übersetzt muss das wohl heißen: «So richtig gut denken können die Chinesinnen und Chinesen nicht. Auf jeden Fall nicht so gut wie ich.»
Man stelle sich vor, ein Professor würde Ähnliches über die USA und die US-Amerikaner verbreiten. Den Hudson River in New York würde er in Mississippi umbenennen, aus dem Mount Rushmore würde er Mount Rashmore machen, und außerdem würde er seiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass alle Amis «vom Denkerischen her» etwas minderbemittelt seien. Die Aufregung wäre sicher riesengroß. Über China dagegen kann man alles Mögliche behaupten, egal, ob es nun stimmt oder nicht, und es ächzt höchstens mal ein Sinologe zu Hause an seinem Schreibtisch.
Oder ich. Denn ich habe dieses Buch auch geschrieben, weil ich mit einigen falschen Vorstellungen und Behauptungen über China und die Chinesen aufräumen will. Stattdessen soll dieser kleine Crashkurs in fünfunddreißig abwechslungsreichen Lektionen zeigen, dass China oftmals sehr viel anders ist, als man es sich in Deutschland vorstellt: viel lustiger, viel liberaler, viel anstrengender, viel komplizierter und viel widersprüchlicher, aber vor allem auch viel normaler. Den Stoff für dieses Buch habe ich mir im Laufe von zwei Jahren in Singapur und vier Jahren in China in harter Kleinarbeit angeeignet. Damit halten Sie allerdings nicht ein Buch voller Tipps in der Hand, die Ihnen verraten, wie man als Ausländer in China am besten klarkommt. Das in diesem Buch versammelte höchst disparate Wissen ist eher dazu gedacht, den Leser in die Lage zu versetzen, auf Partys zu glänzen. Es handelt sich also um typisches Angeber- und Aufschneiderwissen, das Sie wahlweise in Peking oder Shanghai, Berlin oder Bielefeld anbringen können. Sie müssen also gar nicht unbedingt nach China fahren wollen, um dieses Buch zu benutzen. Ein Ausflug in die Kneipe oder den Club um die Ecke reicht.
Aus Gründen der Didaktik und weil das Tor des Himmlischen Friedens in Peking fünf Tore hat, habe ich den Lehrstoff dieses kleinen Chinawissenskurses in fünf Abteilungen aufgeteilt: Vorschule, Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie eine Lektion, die Sie ganz gezielt auf das große China-Abitur vorbereitet, das Sie nach der Lektüre dieses Buches ablegen können. Der Unterstufenstoff beginnt mit der Lektion «Franz Lehár ist eine dumme Sau», in der die Irritationen beschrieben werden, die ich bei meiner Ankunft in Peking empfunden habe. Nur ein paar Monate später sind diese negativen Gefühle einer ungezügelten Begeisterung für die Stadt und ihre Bewohner gewichen. Da diese Emotion nur teilen kann, wer bereits einige Erfahrungen in Peking gesammelt hat, habe ich die Lektion, die diesen Stoff behandelt, dem fortgeschrittenen Mittelstufenwissen zugeschlagen. Das Oberstufenwissen umfasst dagegen einige Spezialinformationen, die sich eigentlich nur derjenige aneignen sollte, der wirklich alles wissen will und auf das China-Abitur scharf ist. Oft ist die Zuordnung des Lehrstoffes völlig willkürlich und an den Haaren herbeigezogen, so ähnlich wie im echten Leben.
Das heißt natürlich nicht, dass das ganze hier zusammengetragene Wissen über China und die Chinesen nicht wirklich gründlich recherchiert worden wäre. Das gilt auch für alle Sachverhalte, die komisch, bizarr oder unglaubwürdig klingen. Andererseits kann ich nicht für jede Information hundertprozentig garantieren. China verändert sich in einem Umfang und Tempo, wie sich in der Geschichte der Menschheit von der Steinzeit bis heute noch nie eine Region verändert hat, sieht man einmal von den Eiszeiten ab. So entspricht das, was in einem Chinajahr passiert, ungefähr dem von fünf Deutschlandjahren. Auch gilt manches hier Gesagte nur für Peking und die großen Städte und nicht in der Provinz. Innerhalb Chinas gibt es ein Wohlstands- und damit auch Lebensstilgefälle, das so groß ist wie zwischen einem mitteleuropäischen Land und Burkina Faso. Wenn Sie sich also ausschließlich für das Leben auf dem chinesischen Land interessieren, warten Sie lieber auf mein Buch «Das große chinesische Bauernabitur», das voraussichtlich in drei Jahren (deutsche Zeitrechnung) erscheinen wird. Außerdem mag in dem vorliegenden Buch auch deswegen manchmal etwas nicht stimmen, weil ich – wie ich in jahrelanger Forschungsarbeit herausgefunden habe – bedauerlicherweise auch hin und wieder Fehler mache. Ich hoffe nur, dass es sich dabei nicht um völlig dämliche handelt.
Hinweisen will ich hier noch darauf, dass viele der abgedruckten Lektionen in einem früheren Leben einmal Kolumnen waren, die in dem endgültigen Satiremagazin Titanic erschienen sind. Sie wurden für dieses Buch noch einmal komplett überarbeitet, aktualisiert und zum Teil stark erweitert. Um das bereits gesammelte China-Wissen abzurunden, wurden außerdem einige völlig neue Lektionen hinzugefügt. Titanic-Leser wissen natürlich auch, dass als Autor der Kolumne ein gewisser Walter Myna angegeben wurde. Vielfach wurde bereits vermutet, dass ich mit ihm identisch sei. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht völlig richtig. Tatsache ist, dass ich einige meiner eigenen Charakterzüge in meinem Freund Myna wiedererkannte, als ich ihn vor nunmehr sechs Jahren im Singapurer Mitre-Hotel kennenlernte. Wahr ist auch, dass ich die Titanic-Kolumne von Anfang an mit Walter Myna zusammen verfasst habe. Er verschwand dann allerdings Ende 2008 aus meinem Leben. Bei unserem letzten Treffen gab er an, von China inzwischen etwas gelangweilt zu sein. Er plante, sich ins Grenzgebiet zwischen Myanmar und Thailand aufzumachen, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Zum Abschied vermachte er mir sämtliche Rechte an unseren gemeinsamen Kolumnen sowie das Y. aus seinem Namen, von dem ich allerdings schon vorher Gebrauch gemacht hatte. Mit dem Verschwinden Mynas – der ja jetzt wohl Mna heißen muss – endete auch die Kolumne in der Titanic. Sie wird seitdem unter meinem eigenen Namen und unter einer anderen Überschrift in der Berliner tageszeitung fortgeführt.
Meine Dolmetscherin aber, von der in diesem Buch auch immer wieder mal die Rede ist, lebt nach wie vor in meiner Nähe. Hinter dieser Umschreibung verbirgt sich nämlich niemand anderes als meine Frau Yingxin. Ihr und ihrer Familie habe ich es zu verdanken, dass ich als jemand, der immer noch nicht viel Chinesisch kann, tiefere Einblicke in die chinesische Welt erhalten habe, als sie Sandra Maischberger oder Christine Morgenroth je haben werden. Yingxin hat – neben anderen – auch den gesamten Unterrichtsstoff dieses Crash-Kurses auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft und mir immer wieder mit Tipps und Übersetzungen aus chinesischsprachigen Medien geholfen. Sie taucht in den einzelnen Lektionen nur deshalb nicht als meine Frau auf, weil komische Texte, in denen Ehefrauen vorkommen, fast immer zum Gähnen öde sind.
Und noch eine letzte Bemerkung, bevor es wirklich losgeht: Natürlich wird in diesem Buch verallgemeinert, wenn ich hin und wieder von «den Chinesen» spreche. Und selbstverständlich ist das ungerecht, weil es «die Chinesen» ebenso wenig gibt wie «die Deutschen». Doch anders als mit ungerechten Verallgemeinerungen lassen sich manche Beobachtungen nicht auf den Punkt bringen, zumal, wenn man sie, so wie ich, gerne etwas zugespitzter formuliert. Sollte sich aber ein Chinese durch irgendeine Formulierung oder Behauptung hier verletzt fühlen, kann ich ihn nur bitten, zurückzuschlagen. Ich würde jedenfalls zu gerne ein ähnliches Buch wie dieses hier von einem chinesischen Autor über «die Deutschen» lesen, je ungerechter, komischer und gemeiner, desto besser. Dafür verspreche ich, dass der Titel meines Buches das allerletzte L-Wortspiel sein soll, das ich im Zusammenhang mit der chinesischen Sprache gemacht habe. Ich schwöle!
IVorschule
1Die chinesische Vorschule
Wer beschließt, sich in China niederzulassen, der ist gut beraten, sich zunächst einige Zeit in Singapur aufzuhalten. Dieser hübsche kleine Stadtstaat liegt an der Spitze der Malaiischen Halbinsel. Er ist damit zwar mindestens zweitausendfünfhundert Kilometer vom eigentlichen China entfernt, aber immerhin zu siebenundsiebzig Prozent von ethnischen Chinesen besiedelt. So kann man sich schon einmal damit vertraut machen, wie es sich mit diesem Menschenschlag so leben lässt. Andererseits ist man noch nicht ganz und gar allein unter den Chinesen: Auf der Insel leben auch eine große Anzahl Malaien, recht viele Inder und sogar Eurasier, die meisten mit portugiesischen oder holländischen Vorfahren. So sollte einem der Übergang von der gewohnten europäischen Gesellschaft zur chinesischen leichter fallen.
Einfacher als in China ist in Singapur schon mal die Sprache. Straßennamen und Fahrpläne kann man lesen, weil sie in lateinischer Schrift geschrieben sind. Man muss auch kein Chinesisch können, um sich zu verständigen. Die Arbeits- und erste Unterrichtssprache hier ist Englisch. In dieser Sprache erscheint auch die Straits Times, die wichtigste Zeitung des Landes. Dazu gibt es eine Reihe von englischsprachigen Radio- und Fernsehprogrammen, sodass man immer weiß, was um einen herum gerade passiert. Während man sich aber noch auf vertrautem europäischem Sprach- und Alphabet-Territorium bewegt, kann man sich bereits an die chinesischen Zeichen gewöhnen, denn auch die sind in Singapur überall präsent. Zwar lernt man nur durch dauerndes Anschauen kein einziges, außer vielleicht das für Mitte (Zhong – ein Oval in einem Kreis) oder Tür (Men – sieht fast so aus wie eine Tür), doch es mildert schon mal den Schock, der sich gewiss einstellen wird, wenn man später in China außerhalb der großen Städte nur noch diese Hieroglyphen sieht.
In Singapur kann man zudem schon ein Gefühl für die chinesische Grammatik entwickeln. Im Alltag wird hier nämlich ein spezielles Englisch gesprochen, das sich Singlisch nennt und der Struktur des Chinesischen sehr ähnlich ist. Auch im Singlischen steht das, worum es geht, immer am Anfang eines Satzes, in der Regel wird «to be» als Hilfsverb einfach weggelassen, man sagt «can» statt «yes», Substantive kann man auch als Verben gebrauchen, und Artikel gibt es gar nicht. «What talking you?» (statt «What are you talking about?») ist ein typischer singlischer Satz, der unter anderem so schön ist, weil sein Satzbau nicht nur dem chinesischen, sondern auch dem deutschen («Was sagst du?») gleicht.
Die Aussprache ist für Deutsche sowieso kein Problem. Auf Singlisch sagt man «orreddy» statt «already, «argly» für «ugly» und «eskew me», wenn «excuse me» gemeint ist. Spricht Herr Metzler vom Accounting Englisch, klingt das kaum anders. Hängt man dann noch ein «lah» oder «eh» an jeden Satz, dann hört sich das schon sehr einheimisch an. Ich für meinen Teil mochte Singlisch auch deshalb, weil es mir die Angst nahm, im Gespräch mit englischen Muttersprachlern Fehler zu machen. «Eskew me», erklärte ich dreist. «So sprechen wir in Singapur halt Englisch.»
Hat man sich an die sprachliche Umgebung gewöhnt, kann man sich an die nächste Lektion machen, die eher ein ganzes Blockseminar ist. Das Thema lautet: Wie alt ist mein chinesisches Gegenüber eigentlich? Für einen neuangekommenen Westler ist diese Frage schwer zu beantworten. Chinesen erscheinen ihm alterslos. Gestandene Frauen sind nicht von Mädchen zu unterscheiden, und mancher Mann im besten Alter sieht aus wie ein Konfirmand. Aber auch die Frage nach dem Alter lässt sich in Singapur leichter beantworten als in China selbst. Das liegt daran, dass es hier einfach sehr viel heißer ist als zweitausend Kilometer weiter nördlich, weshalb man sich leichter kleidet. Nun kann man aber an den Beinen und Füßen der Chinesen ihr Alter viel eindeutiger ablesen als am Gesicht. Ich jedenfalls ersparte mir so mehr als einmal peinliche Fehlannahmen. Mit etwas mehr Erfahrung ist man dann auch in der Lage, die Gesichter zu lesen. Auch bei Chinesen schreibt sich dort das Alter ein, wenn auch nicht auf so schreckliche Weise wie bei uns Europäern.
Die nächste China-Lektion lautet: Wie werde ich damit fertig, ein Loser zu sein? Auch das kann man wohl nirgendwo besser als in Singapur erfahren. Die hiesige Wirtschaft wächst bereits seit Ende der Sechziger. Selbst die Asienkrise in den Neunzigern konnte Singapur nicht viel anhaben, und erst die globale Wirtschaftskrise seit 2008 zwang auch den Stadtstaat in die Rezession. Trotzdem hat man hier immer noch das höchste Bruttoinlandsprodukt der Welt. Das heißt konkret: Von 4,6 Millionen Singapurern sind mehr als einunddreißigtausend Millionäre, und jedes Jahr kommen etwa tausend dazu. Damit hat Singapur auch die höchste Millionärsdichte auf der Erde. Neunzig Prozent aller Singapurer besitzen eine Eigentumswohnung, und zwanzig Prozent der Autos, die hier so rumfahren, gehören zur oberen Luxusklasse. Das sind die harten Zahlen der Ökonomielektion, die unter anderem auch besagen, dass Leute wie Sie und ich in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften in die Kategorie Verlierer eingeordnet werden. Für China gilt das zwar im Moment noch nur bedingt, aber auch hier hat sicher niemand auf Sie oder mich gewartet.
Die wichtigste Lektion aber, die der China-Novize in Singapur lernt, ist die Tatsache, dass das politische System hier anders funktioniert als zu Hause. China ist, das hat sich inzwischen auch in Deutschland herumgesprochen, keine Demokratie. Für Singapur gilt das Gleiche, selbst wenn man die Bevölkerung alle fünf Jahre pro forma wählen lässt. Tatsächlich wird aber «The Republic» – so der Spitzname Singapurs – seit 1959 von einer Quasi-Staatspartei regiert, der Peoples Action Party nämlich, die sich in puncto Machtausübung und -erhalt vor der Kommunistischen Partei Chinas nicht zu verstecken braucht. Die PAP hat alles, was eine waschechte KP braucht: Sie ist eine Kaderpartei, das heißt, nur ein kleiner Kreis von geheimen Parteikadern wählt die Führungsspitze. Geleitet wird sie von einem Zentralen Exekutivkomitee, an dessen Spitze ein Generalsekretär steht. Nur das Parteisymbol hat man sich ausnahmsweise nicht von den Kommunisten abgeguckt. Der rote Blitz in einem blauweißen Kreis gleicht eher dem Emblem der ehemaligen britischen Faschisten. Dafür sind die Rituale sehr kommunistisch: Den Ersten Mai feiert man zusammen mit der parteieigenen Einheitsgewerkschaft NTUC, ruft dabei Kampfparolen und grüßt mit der geballten Faust. Anlässlich des Kampftages werden auch Jahr für Jahr die «Helden der (Gewerkschafts-)Arbeit» ausgezeichnet. Sie heißen in Singapur nur etwas anders als früher in der DDR oder in China, nämlich «Comrade of Labour».
Und damit sind die politischen Parallelen zwischen Singapur und China keineswegs erschöpft. Wie in China werden auch auf der Insel sämtliche Medien zensiert. Das ist allerdings kaum nötig, weil jede Zeitung und jeder Fernsehsender über Beteiligungen sowieso dem Staat gehören. Zeitungen und Fernsehprogramme aus den Nachbarstaaten Singapurs sind auf der Insel genauso wenig erhältlich wie der Playboy. Einst war die Cosmopolitan verboten, weil das Magazin, so die Zensoren, «promiskuitive Werte» gefördert habe. Heute müssen ausländische Zeitungen, die in Singapur erscheinen wollen, zweihunderttausend Singapurdollar Kaution hinterlegen und einen Vertreter auf der Insel stationieren, den die Regierung zur Not verklagen kann. Das tut sie auch sehr gerne, und zwar immer dann, wenn in der Auslandspresse Singapur und seine Regierung nicht so gut wegkommen. Die Zeitungen – darunter solch subversive Blätter wie die Financial Times oder die Far Eastern Economic Review – haben bisher noch jeden Prozess verloren.
Natürlich darf man in Singapur auch nicht auf die Straße gehen, wenn einem etwas nicht passt. Zwar ist das Demonstrationsrecht in der Verfassung verankert, doch wer eine Demonstration anmelden will, bekommt keine Genehmigung. Unter solchen politischen Verhältnissen sind freie Wahlen nur ein Witz, den sich die Peoples Action Party gelegentlich erlaubt, um etwas Spaß zu haben. Am Ende gewinnen doch immer nur ihre Leute fast alle Sitze im Parlament – im Moment stellt die Opposition zwei von vierundachtzig Abgeordneten – und heißt der Premierminister Lee. Der jetzige nennt sich Lee Hsien Loong. Das ist der Sohn des Staats- und PAP-Gründers sowie Ex-Premierministers Lee Kuan Yew. Insofern kann Singapur eigentlich auch als Vorschule für Nordkorea gelten.
Seltsamerweise gibt es bei den in Singapur lebenden Westlern über das hiesige politische System kaum Beschwerden. Auch in Deutschland liest und hört man selten ein kritisches Wort über den autoritär regierten Stadtstaat, obwohl die meisten großen deutschen Zeitungen und Rundfunkanstalten Korrespondenten in Singapur stationiert haben. Das mag an den günstigen Shoppingmöglichkeiten hierzulande liegen.
Dabei geht es auf der Insel zuweilen noch ein bisschen härter zu als im gerne ausgiebig kritisierten China, zum Beispiel in Sachen Todesstrafe. Sowohl in Singapur als auch in China wird sie für eine Reihe von Verbrechen verhängt, doch nur in Singapur ist sie für bestimmte Delikte auch obligatorisch. Wer beispielsweise mit mehr als fünfzehn Gramm Heroin, dreißig Gramm Kokain, zweihundertfünfzig Gramm Speed oder fünfhundert Gramm Cannabis erwischt wird, den muss ein Richter zum Tode verurteilen, ob er will oder nicht, das Gesetz lässt ihm keine andere Wahl. So wurden in Singapur seit 1991 mehr als vierhundert Menschen hingerichtet. Das ist pro Kopf – was sonst? – der Bevölkerung die höchste Quote weltweit.
Singapur kann aber auch mit einer Bestrafungsspezialität dienen, die ansonsten nicht mehr so oft auf der Welt vorkommt, auch in China nicht. Dabei handelt es sich um das sogenannte Caning. Damit ist das Verprügeln eines Delinquenten mit dem Rotan, einem Stock aus Rattan, gemeint. Das hört sich nach veralteter Schulpädagogik an, ist aber ein sehr brutaler Akt. Der Delinquent wird dabei ausgezogen und auf einen Bock geschnallt, die Prügel empfängt er auf den nackten Hintern. Schon nach einigen Schlägen spritzt Blut, und manche der Geprügelten brechen ohnmächtig zusammen. Die Prügelstrafe ist eigentlich eine Erfindung der britischen Kolonialherren. Wurde jedoch unter den Briten nur bestraft, wer ein Gewaltverbrechen begangen hatte, setzt es im heutigen Singapur Dresche für alle möglichen Delikte. Man kann bereits für das Sprühen von Graffiti, den Verkauf von Feuerwerk und größere Verkehrsvergehen verprügelt werden. Und selbst, wer sich mehr als neunzig Tage illegal auf der Insel aufhält, darf sich auf einen gutgefüllten Teller Knüppelsuppe freuen.
Überhaupt bestraft man in Singapur gerne jede Lebensäußerung. Auf den Boden spucken oder Papier auf den Boden werfen kostet umgerechnet zweihundertfünfzig bis fünfhundert Euro, im Wiederholungsfall kann Zwangsarbeit verordnet werden. Wer an einem verbotenen Punkt über die Straße geht, zahlt zweihundertfünfzig Euro, wer privat Feuerwerk besitzt oder abfeuert, marschiert gleich für zwei Jahre ins Gefängnis. Als ich in Singapur lebte, stand auf «widernatürlichen fleischlichen Verkehr» nach Paragraph 377 des Singapurer Penal Codes noch bis zu lebenslänglich. Das hieß konkret, jeder konnte damit rechnen, für immer hinter Singapurer Gardinen zu verschwinden, wenn er zu Hause Anal- oder Oralverkehr praktizierte. Erst im Oktober 2007 wurde dieses Gesetz abgeschafft, allerdings nur für Heterosexuelle. Schwule können für ein bisschen Orales und Anales immer noch bis zu zwei Jahre ins Gefängnis wandern.
Als ich Singapur verließ, machte ich jedenfalls drei Kreuze. Das erste wegen des Oralverkehrs, das zweite wegen des staatlichen Kontrolleurs, der immer wieder unangemeldet in unserer Wohnung stand, um den Wasserstand in Blumentöpfen und Vasen zu checken – da sich darin Moskitos vermehren können, ist stehendes Wasser auch in der eigenen Wohnung verboten –, und das dritte wegen einer anderen Sache, über die ich hier nicht reden möchte. Dann machte ich noch ein viertes und ein fünftes. Das vierte, weil ich wusste, dass mir China nach der harten Singapurer Ausbildung wie ein Beispiel an Liberalität vorkommen würde. Das fünfte war für Singapur selbst. Abgesehen von seinen China-Vorschulqualitäten ist es nämlich ein überflüssiges Land, das schleunigst an Malaysia zurückgegeben werden sollte.
Wie hoch die Todesstrafenquote in Relation zu anderen Staaten ist, zeigt ein UN