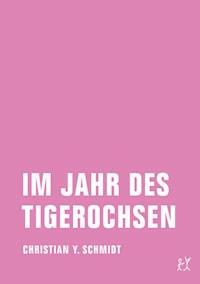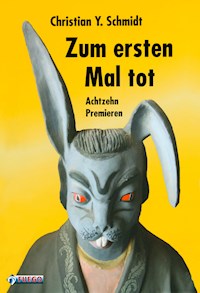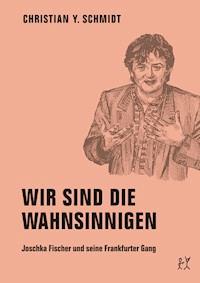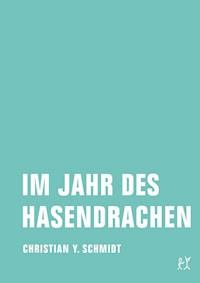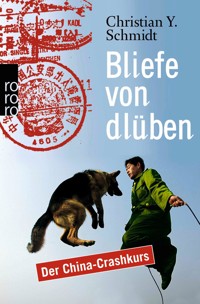9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gab es die Siebziger wirklich? Christian Y. Schmidt erzählt mit Witz und Verve von den Tücken des Erinnerns. Nach Jahren in Ostasien ist der Journalist und Hobbyornithologe Daniel S. zurück in Deutschland. Eigentlich will er hier nur noch seine Ruhe. Doch bereits das Begräbnis seines Jugendfreundes Viktor endet in einer wüsten Schlägerei. Danach läuft Daniels Leben völlig aus dem Ruder. Eine Frau aus der Vergangenheit taucht auf, an die er sich beim besten Willen nicht erinnert, Menschen werden ausgetauscht oder verschwinden, und überall sieht er versteckte Zeichen, die ihm verraten, dass er am 19. Oktober sterben wird. Kann Daniel diese Rätsel mit Hilfe der «Methode Cooper» lösen, wie es sein Psychiater, ein fanatischer David-Lynch-Fan, empfiehlt? Oder soll er auf seinen Berliner Dealer hören und mehr «ehrliche Siebziger-Jahre-Drogen» nehmen? Hilft googeln? Und was hat der ganze Irrsinn mit der Amerikafahrt zu tun, die Daniel 1978 mit seinen Jugendfreunden, den neodadaistischen «Huelsenbecks», unternahm? In seinem Romandebüt schickt Christian Y. Schmidt seinen Helden auf eine mysteriöse Reise zwischen Berlin und Mexiko, die ihn über verschlungene Pfade zur Wahrheit führt. Originell, kraftvoll und mit zuweilen düsterem Witz erzählt er von der Jugend in den angeblich so wilden Siebzigern, vom Scheitern großer Pläne und dem, was dabei herauskommt, wenn man sich selbst betrügt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christian Y. Schmidt
Der letzte Huelsenbeck
Roman
Über dieses Buch
Gab es die Siebziger wirklich? Christian Y. Schmidt erzählt mit Witz und Verve von den Tücken des Erinnerns.
Nach Jahren in Ostasien ist der Journalist und Hobbyornithologe Daniel S. zurück in Deutschland. Eigentlich will er hier nur noch seine Ruhe. Doch bereits das Begräbnis seines Jugendfreundes Viktor endet in einer wüsten Schlägerei. Danach läuft Daniels Leben völlig aus dem Ruder. Eine Frau aus der Vergangenheit taucht auf, an die er sich beim besten Willen nicht erinnert, Menschen werden ausgetauscht oder verschwinden, und überall sieht er versteckte Zeichen, die ihm verraten, dass er am 19. Oktober sterben wird. Kann Daniel diese Rätsel mit Hilfe der «Methode Cooper» lösen, wie es sein Psychiater, ein fanatischer David-Lynch-Fan, empfiehlt? Oder soll er auf seinen Berliner Dealer hören und mehr «ehrliche Siebziger-Jahre-Drogen» nehmen? Hilft googeln? Und was hat der ganze Irrsinn mit der Amerikafahrt zu tun, die Daniel 1978 mit seinen Jugendfreunden, den neodadaistischen «Huelsenbecks», unternahm?
In seinem Romandebüt schickt Christian Y. Schmidt seinen Helden auf eine mysteriöse Reise zwischen Berlin und Mexiko, die ihn über verschlungene Pfade zur Wahrheit führt. Originell, kraftvoll und mit zuweilen düsterem Witz erzählt er von der Jugend in den angeblich so wilden Siebzigern, vom Scheitern großer Pläne und dem, was dabei herauskommt, wenn man sich selbst betrügt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagillustration Simon Prades/Début Art
ISBN 978-3-644-10044-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für August, David und Stanley. Und Yingxin natürlich.
An allem ist zu zweifeln.
1Als fünftes Rad am Massengrab
Ich weiß nicht. Ob ich auch zu Viktors Beerdigung gekommen wäre, wenn ich geahnt hätte, dass das eine Kette von Ereignissen in Gang setzen würde, an deren Ende ich tot daliegen würde? Ich hatte sowieso keine Lust, wie Falschgeld auf dem Friedhof rumzustehen und mir Reden auf jemanden anzuhören, mit dem mich schon lange nichts mehr verband. Inzwischen wussten jedoch viele in der Stadt, dass ich wieder da war, und so konnte ich mich schlecht drücken. Das war der eigentliche Grund, weshalb ich an diesem April-Sonntag einen schwarzen Anzug trug, neben meinem Bruder Frank im Regen stand und versuchte, betrübt dreinzukucken.
Natürlich regnete es, ich hätte damit rechnen müssen. Die ganze Kindheit hatte es geregnet. Hier am Südhang mussten die Wolken einfach abregnen, die vom Meer herüberkamen. Das hatten wir schon in der Schule gelernt. Frau Schlottmann. Heimatkunde. Dritte Klasse. Volksschule war das noch, nicht Grundschule. Eigentlich hätte man in der Stadt zweitausend Worte für Regnen haben müssen. Wir hatten aber nur ein paar: plästern, pladdern, prasseln. Schnüre regnen. Bindfäden auch. Nieseln. Tröpfeln. Fisseln. Meine Mutter sagte immer: «Wenn es fisselt, pissen die Ameisen im Himmel.»
An diesem Sonntag fisselte es nicht. Es plästerte. Über die buchenbestandenen Hänge im Norden schob sich ein Krokodil mit aufgerissenem Maul, das nach kleinen grauen Fetzen schnappte. Das Krokodil verwandelte sich in einen chinesischen Drachen mit Basedow-Augen, der breit grinste. Hinter und unter ihm jagten Wolkenschlangen mit roten Zungen. Das war jedenfalls das, was ich sah. Ich war natürlich völlig bekifft. Vor der Beerdigung hatte ich mit Frank noch schnell ein kleines Pfeifchen an der Straßenbahnhaltestelle durchgezogen. Ohne zu kiffen, halte ich es schlecht in Gesellschaft aus. Außerdem brauche ich THC inzwischen wie ein Lebensmittel. Gegen das Zucken der Augenlider und um die ganzen Hongkonger Querelen zu vergessen. Ich habe die Trennung von einer Frau immer sehr schlecht verkraftet.
Als ich die Mail mit der Todesnachricht erhielt, erschrak ich doch wirklich etwas. Normalerweise erfüllen mich Todesnachrichten mit einer gewissen Befriedigung. Diese Reaktion war mir immer etwas unangenehm. Ich würde auch lieber Trauer empfinden, so wie es – glaube ich zumindest – andere Leute tun. Aber das hat bei mir nie funktioniert. Immer wenn ich von einem Todesfall erfuhr, jubilierte in mir etwas: Wie schön, den hast du jetzt auch überlebt. Und was für ein Glück, dass nicht du es bist, durch dessen Körper jetzt weiße Maden ihre Bahnen ziehen. Für einen kurzen Moment vergaß ich meine ganzen Probleme und freute mich: über das schöne Wetter, ein lustiges Kind, das vorbeitrottenden Hunden auf der Straße ein Bein stellte, oder wie gut doch gerade die Nudeln mit billiger Dosentomatensoße schmeckten.
Dass ich es bei Viktor anders empfand, lag sicher auch daran, dass er zwei Jahre jünger gewesen war als ich. Und außerdem war er eben der große Viktor. Ich hatte nie gedacht, dass er einmal sterben könnte. Jedenfalls nicht vor mir. Deshalb musste ich bei Viktors Tod sofort an meinen eigenen denken. Ich dachte: Scheiße, Scheiße, Scheiße … Jetzt geht das also mit dem Sterben los.
Solche Gedanken hatte ich in Hongkong nie gehabt. Jedenfalls solange das mit Sandy gutging. Die kluge Sandy, geboren in Mongkok, erzogen in den USA, mit vierundzwanzig zurückgekehrt in die duftende Hafenstadt, wo sie zu meiner Rechten saß. Erlöserin von all meinen Übeln. Ach, Quatsch, aber ich hatte mit Sandy einfach so in den Tag hineingelebt, ohne Gedanken an irgendeine Zukunft. Natürlich hatten wir unsere Probleme, wer hat die nicht? Kaum war ich aber dann in Deutschland gelandet, verfinsterte sich alles. Als Erstes erreichte mich die Nachricht von Viktors Tod. Und so stand ich also zum ersten Mal seit der Beerdigung meines Großvaters vor fünfundzwanzig Jahren auf einem Friedhof und sah dabei zu, wie man einen Menschen unter die Erde brachte.
Ich wunderte mich über den Aufwand, der betrieben worden war. Die ganzen Gebinde, Sträuße und Kränze. Als wir noch befreundet gewesen waren, hatte mir Viktor mal erzählt, dass seine Beerdigung eine große Party werden sollte, mit Alkohol und Drogen. Dabei sollten wir seine Asche in die Joints bröseln, sodass er von den Partygästen mit dem Rauch aufgenommen werden würde. So eine typische Siebziger-Jahre-Quatschidee eben.
Nun ja, ich sehe ein, das wäre schlecht gegangen. Aber Viktor wäre sicher der Typ für einen Ruhehain gewesen, wo alles der Natur überlassen wird, ohne Grabstein und ohne Grabpflege. Walter Neumann hatte man in so etwas begraben, Neumann, den sie alle nur Paul genannt hatten, wegen … na, wohl klar. Eine ziemlich große Nummer damals in der Szene. Er hatte sich erschossen, nachdem er sich ein ganzes Leben lang hatte tätowieren lassen. Erst die Arme, dann den Rücken, dann die Beine, dann den ganzen Rest. Am Ende war Paul ein richtiger Bildband, voller feuerspuckender Monster, Tribals, brennender Herzen und blutender Rosen. Und dann war er eines Nachts aufgestanden, ins Bad gegangen und hatte sich eine Kugel in den Kopf gejagt, mit einer Knarre, die er wer weiß woher hatte. Jedes Mal, wenn mir die Geschichte einfiel, dachte ich: Was für eine Verschwendung. Erst die ganze elende Tätowiererei, und jetzt fressen das die Würmer.
Ich hatte mich mit Frank bewusst etwas abseits der Beerdigungsgesellschaft gestellt. Schließlich konnte ich schlecht kondolieren. Was sollte man auch sagen? «Es tut mir so furchtbar leid»? Tat es doch gar nicht. Und dann ist Sterben an sich ja auch keine besondere Leistung. Selbst wenn einer ziemlich unbedarft ist, am Ende kann er es auch. Außerdem beobachte ich die Dinge gern aus der Distanz.
So fiel mir ziemlich bald auf, dass sich die von außen so einheitlich wirkende Beerdigungsgesellschaft in zwei ganz unterschiedliche Gruppen teilte. Die erste konnte sich gar nicht dicht genug um das dunkle Loch versammeln, in das gleich Viktors Sarg gesenkt werden würde. Die Friedhofsgärtner hatten ringsherum einen kleinen Damm aufgeworfen, damit es nicht voll Wasser lief. Direkt an dieser Grenze drängte sich die Gruppe. Es mussten Viktors Verwandte und engeren Bekannte sein, denn mitten unter ihnen erkannte ich eine Frau mit schwarzen Haaren und Marlene-Dietrich-artigen Wangenknochen. Ich war mir sicher, dass das Viktors Witwe Agnieszka war, von der ich schon einiges gehört hatte. Sie war allerdings nicht mit Viktor verheiratet gewesen, sodass ich mich fragte, ob Witwe in diesem Fall die angemessene Bezeichnung war. Mit ihrem schwarzen Gazeschleier sah sie allerdings sehr witwenhaft aus und starrte mit wahrscheinlich verweinten Augen in eine imaginäre Ferne.
Die Leute um Agnieszka entsprachen der üblichen Normalverteilung: ein paar Schlanke, ein paar Fette, ein paar Große, ein paar Kleine, ein paar mit vielen Muskeln, ein paar mit wenigen, ein paar einigermaßen gebildet wirkende Brillenträger, ein paar keineswegs gebildet wirkende Brillenträger, einige Leute ohne Brille, einige Leute ohne Haare, die obligatorischen zwei Rollstuhlfahrer und genau vier Leute mit einem debilen Gesichtsausdruck. Was sie alle verband, war die Tatsache, dass sie bessergestellt zu sein schienen. Das sah man an den Mänteln, bei denen trotz der von der Konvention vorgeschriebenen schwarzen Trauerfarbe gelbes Kamelhaar dominierte, an den diversen kleinen Stolas und vor allem an den Schuhen. Teuer bis sehr teuer, keine Frage.
Ich kannte niemanden von diesen Leuten und wunderte mich, dass Viktor so viele durchschnittliche Gestalten um sich geduldet hatte. Früher hätte er solchen Typen gleich ins Gesicht gespuckt. Okay, das nicht gerade, aber er hätte sie so lange seine Verachtung spüren lassen, bis sie sich aus seinem Umkreis entfernt hätten. Aber gut: Das letzte Mal, dass ich etwas mit Viktor zu tun gehabt hatte, war dreißig Jahre her. Das war noch zur Zeit der Huelsenbecks. Dreißig? Mein Gott, es würden bald vierzig sein.
Die zweite Gruppe auf dem Friedhof kannte ich besser. Die Leute stammten alle direkt aus meiner Vergangenheit. Schon durch ihre billigere Kleidung unterschieden sie sich von der Kamelhaargruppe. Ich wollte sie gerade etwas genauer inspizieren, da baute sich ein Trauerredner am Grab auf und sah sich aufmerksamkeitsheischend um. Der untersetzte runde Mann ohne Kopfbehaarung hatte über dem Nacken eine kleine glänzende Ausbuchtung, als wäre er als Kind einmal trepaniert worden, an der falschen Stelle allerdings. Seine Lippe war zu dick, er lispelte und betonte jedes dritte Wort falsch. Ich versuchte nicht hinzuhören, konnte aber nicht verhindern, dass ein paar Satzfetzen an mein Ohr drangen. Es war die alte Leier: «unsagbar traurig», «ewig in unseren Gedanken», «tönendes Erz», «klingende Schelle» und immer wieder «Viktor», «Viktor» und noch mal «Viktor», als ob er ihn gekannt hätte.
Die wirklich interessanten Dinge erzählte er natürlich nicht. Die Huelsenbecks zum Beispiel erwähnte er mit keinem Wort. Er verriet auch nicht, wie Viktor zu seinem neuen Bekanntenkreis gekommen war. Nichts über Agnieszka, zu der die Lippe ab und zu rüberglubschte. Je länger Lippe redete, desto mehr regte ich mich auf. Dieses Gequatsche, dachte es in mir, hast du doch aus dem Netz zusammenkopiert, bei trauerspruch.de oder meinbeileid.com, und erst ganz am Ende hast du dann den Namen eingesetzt, du dummer, dicker Simpel.
Da waren sie wieder, die bösen Gedanken, die ich nicht loswerden konnte. Ich würde diesem Mann höchstens fünfzehn Minuten zuhören müssen und danach nie wieder. Wieso konnte er mir nicht einfach egal sein? Ich zwang mich, wieder runterzukommen, atmete mehrmals tief ein und langsam wieder aus – und bekam dann doch noch ein paar aufschlussreiche Details mit. Viktor war offenbar an einem Herzinfarkt gestorben – «sein Herz hörte plötzlich auf zu schlagen» –, und das nicht in Deutschland, sondern – ein leises Raunen ging durch die Runde – in Israel nahe dem Gipfel des Berges Tabor.
Tabor. Ein Haus erschien vor meinen Augen, ein Haus in der Anstalt, das diesen Namen trug. Ein großer Klotz aus grauen Feldsteinen und roten Ziegeln, in dem Epileptikerinnen untergebracht waren, mildere Fälle, zum größten Teil älter, mit bunten Kopftüchern über ihren Schutzhelmen. Lippe assoziierte etwas anderes: «Ausgerechnet in Israel, dem Heiligen Land», trompetete er, «und dann noch auf dem Tabor, dem Berg der Verklärung» sei «Viktors Seele zum Himmel aufgefahren». Das war harter Stoff. Nicht für mich, der ich eine solche Sprache von frühester Kindheit an gewohnt war, sondern für die Leiche. Der Viktor, den ich gekannt hatte, hätte auf keinen Fall auch nur die Andeutung einer religiösen Botschaft an seinem Grab geduldet.
Ich blendete den Mann wieder aus. Beziehungsweise war das nicht ich, sondern mein Rücken. Er fing an zu schmerzen, dieser Wirbel direkt über dem Steißbein. Es fühlte sich an, als würde da einer ganz langsam einen Meißel reintreiben. Das musste am nasskalten Wetter liegen, denn seit ich in Deutschland war, bekam ich laufend solche Schübe. Ich hatte das Gefühl, in den wenigen Wochen, die ich seit meiner Landung hier verbracht hatte, um Jahre gealtert zu sein, und überlegte, gleich mit der nächsten Maschine nach Hongkong zurückzufliegen, bis mir wieder einfiel, dass das nicht ging. Damals, auf der Beerdigung, das kommt mir jetzt erst in den Sinn, war mir das offenbar noch klar.
Um mich von dem Schmerz abzulenken, konzentrierte ich mich auf die Leute in der zweiten Gruppe. Sie standen wie Frank und ich etwas abseits, in der Nähe eines kleinen Kiefernwäldchens. Eine Frau, die mich schon zur Begrüßung breit angegrinst hatte, strahlte immer noch wie ein Honigkuchenpferd. Sie war füllig und trug einen Schirm, auf dem Karikaturen dicker, nackter Männer mit Knollnasen abgebildet waren und auf dem It’s raining men! Hallelujah! stand. Überhaupt hob sich die zweite Gruppe von der ersten auch dadurch ab, dass hier alle unter verschiedenfarbigen Regenschirmen standen, während die Kamelhaarmantelleute einheitlich schwarze Regenschirme hielten. Ich wusste, dass ich das Honigkuchenpferd kannte, versuchte, sie irgendwo einzuordnen, doch umsonst.
Ich überflog die restlichen Gesichter der Gruppe, und mir wurde klar, dass ich eigentlich zu jedem irgendwann mal eine – wie sagt man? – persönliche Beziehung gehabt hatte. Doch mit den meisten ging es mir so wie mit der Dicken. Einige Namen lagen mir auf der Zunge, doch sosehr ich mich auch konzentrierte, ich kam einfach nicht auf sie. Stattdessen tauchten Erinnerungsfetzen auf. Verschwommene, ausgeblichene Bilder, kurze Sequenzen. Zu einer Frau mit faltigem Gesicht und einer Art lila Turban fiel mir ein, dass sie invertierte Brustwarzen hatte, die sich nur bei Erregung nach außen stülpten. Ich hatte das selbst mal erlebt, in meinem Bett, obwohl sie eigentlich mit einem Graphikdesigner zusammen war, der Helmut oder Herbert oder vielleicht auch ganz anders hieß.
Bei einem krank und zerstört aussehenden Mann kam nach langem Kopfzerbrechen wenigstens der Spitzname wieder: der «Leider». Der Typ hatte immer an allem demonstrativ gelitten, der Welt, den Frauen, dem Wetter, diversen Krankheiten der Regierung. Seine Leiden waren offenbar nicht geringer geworden; ich hätte ihn sofort für eine Endzeitserie besetzt oder für einen düsteren Krimi, der im Mississippi-Delta spielt. Neben ihm stand ein Mensch mit aufgeschwemmtem Gesicht, der alle zehn Sekunden nach Luft schnappte. Nie hatte ich verstanden, weshalb er nur «der Frosch» genannt worden war, jetzt begriff ich es. Wenn man ihn genau ansah, hatte er sogar etwas Grünliches im Gesicht. Damals glaubte der Frosch, einen revolutionären Pizzaofen entwickelt zu haben, womit er den Durchbruch schaffen wollte. Das aber hatte nie geklappt. Aufgrund der vielen Verkaufsgespräche, die er nachts in Kneipen geführt hatte, war der grüne Mann dann der Legende nach Alkoholiker geworden.
Ich war erleichtert, als ich Bea in der Menge entdeckte und sofort ihren richtigen Namen wusste. Bea war aber auch schlecht zu vergessen. Dieses blasse, schöne Modemagazin-Gesicht. Wenn sie ihre Augen zu kleinen Schlitzen zusammenkniff, weil sie mal wieder ohne Brille ausgegangen war, sah sie gleich doppelt so gut aus. Ich hatte Beas Schönheit immer nur aus der Ferne bewundert, weil ich etwas Angst vor ihr gehabt hatte. Anfang der Achtziger war sie mit einer Meute von Punks herumgelaufen, in schwarzem Leder, was sehr gut zu ihren rußschwarzen Haaren passte. Männern, die Bea doof kamen, kippte sie ein Glas Bier ins Gesicht oder trat ihnen zwischen die Beine.
Bea hatte mal was mit Viktor gehabt. War etwa auch das kleine blasse Mädchen, das sie an der Hand hielt, von ihm? Es mag ungefähr acht, neun Jahre alt gewesen sein und kniff die Augen immer wieder zusammen, als würde es gerade Zwiebeln schneiden. Eigentlich war sie zu jung, um Viktors Tochter zu sein. Bea und er hatten sich schon vor fünfundzwanzig Jahren getrennt. Aber was wusste ich schon, ich war ja praktisch aus der Welt gewesen.
Die Frau hatte etwas in meinem Kopf freigeschossen, denn jetzt fielen mir immer mehr Namen ein. Sich an die alten Außenseiter unserer Szene zu erinnern war allerdings auch nicht allzu schwer: Mäxchen mit den weißblonden Haaren und dem Totenkopfgesicht, Hugo, der kleingewachsene, kugelige Großdealer mit dem unsicheren Danny-DeVito-Lächeln, das sich über die Jahre nicht verändert hatte, und der transsexuelle Erbser, über den früher nur getuschelt wurde, weil Transsexuelle damals noch Zwitter hießen. Um die drei herum hatten sich längst im Erinnerungsdschungel verschollene Lemuren aus den Vorstädten gruppiert, und ganz außen dann: Eberhard Horstmann, genannt Horsti. Er merkte, dass ich ihn ansah, kuckte zunächst fragend zurück, um dann mit einem Mal das Gesicht zu einem Grienen zu verziehen.
Ich war überrascht, ihn hier zu treffen. Dass sich Viktor und Horsti bis aufs Blut verabscheut hatten, wusste jeder in der Stadt, zumindest jeder über fünfzig. Spätestens seit Horsti eines Nachts aus unbekannten Gründen mit einem Vorschlaghammer den antiken Citroën DS von Viktor zerlegt hatte, war der Riss zwischen den beiden nicht mehr zu kitten gewesen. «Dieses Null-Gehirn steht an der Spitze der Top Ten der Menschen, von denen ich in diesem Leben nichts mehr hören will», hatte Viktor danach jedem gesagt, der ihn auf Horsti ansprach. Was wollte Horsti bloß auf dieser Beerdigung? Zeigen, dass er sich freute?
So ging ich einen nach dem anderem in der Kiefernwäldchengruppe durch, bis ich meinen Rücken wieder spürte. Gleichzeitig merkte ich, dass das Regenwasser, was mir den Nacken hinunterlief, inzwischen beim Gürtel angekommen war. Ich fror, aber Lippe redete immer noch. Herrje, wie lange ging das denn schon? Wurde der Mann nach Zeit bezahlt?
Vielleicht täuschte ich mich aber auch. Stoned dehnt sich die Zeit ja manchmal ins Unendliche. Deshalb dauert ein Kifferleben subjektiv auch viel länger als das eines Nichtkiffers, selbst wenn der Kiffer früher stirbt. Betrachtete man es so, war Viktor gar nicht mit achtundfünfzig Jahren gestorben, sondern mit irgendetwas über hundert. Allerdings wusste ich gar nicht, ob er das Kiffen in den letzten Jahren nicht doch aufgegeben hatte.
Die Leute, die direkt an seinem Grab standen, sahen jedenfalls mehr nach Koks aus als nach Dope. Furchtbare Leute. «Alles soll leben», brummte ich Frank leise zu, «alles soll leben. Aber eins muss aufhören – der Bürger, der Dicksack, der Fresshans, das Mastschwein, der, der, der …» Der Rest des Zitats fiel mir nicht mehr ein. So wie es aussah, hatte Viktor alles vergessen. Und plötzlich stieg aus meinen Mandelkernen etwas auf, das ich als Ekel identifizierte.
Ich starrte zu Boden. Trotz des Regens krabbelten hier Tausende von Ameisen im Mulch herum. Sie bewegten sich auf einer Straße, die sich von einem Grab zum nächsten erstreckte. Einige schleppten sich mit schweren Fichtennadeln ab, andere liefen ohne ersichtlichen Grund durch die Gegend. Je länger ich sie anstarrte, desto größer schienen sie zu werden. Mit ihren goldenen Härchen und ihren Scheren an den Mäulern erinnerten sie mich an Säugetiere: außerirdische Löwen, die dabei waren, sich die Erde untertan zu machen.
Plötzlich hatte ich Lust, die Ameisen zu zertreten. Ich stellte mir vor, wie sich nach meinem Angriff die überlebenden Insekten ebenfalls um kleine Löcher versammeln würden, an denen Kreuze stünden, die Beerdigungsameisen aus den Fichtennadeln gebastelt hätten. Eine Ameisenlippe würde natürlich auch kommen und stundenlanges Blech von sich geben. Ameisenklageweiber würden Trauer simulieren, und ganz am Rande der Gesellschaft würde eine schwarze, böse Ameise stehen, die schlecht über den ganzen Ameisenrest denken würde.
Ich wollte gerade zutreten, da puffte mich mein Bruder in die Seite. Mit einer Kopfbewegung wies er auf einen Mann neben Bea, der dort eben noch nicht gestanden hatte. Ronny. Dieselben langen Zappa-schwarzen Haare wie immer, in die sich nur wenige graue Strähnen mischten. Ich war also doch nicht der einzige Huelsenbeck. Im gleichen Moment kam Lippe überraschend zum Schluss: «Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig, und die, die es sind, sterben nie. Es zählt nicht, dass sie nicht mehr da sind. Niemand, den man wirklich liebt …» Das in Nachrufen so beliebte Hemingway-Zitat. Kein Wunder, ging es mir durch den Kopf, dass man dem Mann am Ende Elektroschocks verabreichen musste.
Die Träger nahmen den Sarg vom Wagen und ließen ihn in das Loch hinab. Gleichzeitig stellte ein Hagerer mit buschigen Augenbrauen aus der Kamelhaarmantelgruppe eine knallgelbe IKEA-Plastiktüte neben das Grab. Darin war ein iPod mit Boxen. Der Mann fummelte ein bisschen an der Apparatur herum, und dann erklang Johnny Cashs «Ain’t no grave». Furchtbar. Nicht der Song, sondern die unappetitliche Idee, ihn hier zu spielen.
Als Erstes trat Agnieszka an den Rand des Grabs. In ihrem schwarzen Kostüm und mit den langen Handschuhen sah sie ein bisschen aus wie Jackie Kennedy bei der Beerdigung ihres Mannes. Sie nahm einen kleinen Spaten und schaufelte etwas Sand ins Grab. So vornübergebeugt sah sie unglaublich gut aus. Ich stellte mir vor, wie sie es mit Viktor getrieben hatte, auf dem Küchentisch oder unter der Dusche. Obwohl mir inzwischen das Regenwasser in die Poritze lief, bekam ich eine leichte Erektion. Und jetzt, so dachte es in mir, lag Viktor dort in diesem Loch, und sein Schwanz würde nie mehr hart werden. Das Bild eines verwesenden Penis tauchte auf, mit schwarzen und grünblauen Stellen. Je stärker ich mir das Bild verbot, desto deutlicher wurde es.
Erst als ich bemerkte, dass Bewegung in die Gruppe hinter Agnieszka kam, löste sich das Kiffgespinst auf. Ich erkannte Ronny, der sich ziemlich rüde seinen Weg durch den Pulk der Bessergekleideten bahnte. Genau hinter der Witwe blieb er stehen. Er konnte schlecht verbergen, dass er nervös war. Für ein paar Sekunden trat er von einem Bein aufs andere. Er sah aus wie ein kleiner Junge, der durch ein Missgeschick plötzlich fünfzig Jahre älter geworden war.
Die Witwe schaufelte weiter Sand ins Grab, da begann ein Kind zu plärren, das direkt neben Ronny stand. Seine platinblonde Mutter hatte ihm gerade das Handy weggenommen, offenbar, damit es am Grab nicht mehr spielen konnte. Bei dem ersten Plärrton zuckte Ronny zusammen. Dann hielt er es nicht mehr aus. Er trat einen großen Schritt nach vorne, schob die Witwe einfach zur Seite und warf einen Gegenstand ins Grab. Dazu rief er mit lauter, etwas vibrierender Stimme: «Versprochen ist versprochen.»
Ein paar Sekunden später ertönte aus dem Grab ein meckerndes Gelächter. Die Kamelhaargruppe erstarrte. Das Kind, das eben noch geweint hatte, stand jetzt mit vor Überraschung geweiteten Augen da. Ich war keineswegs schockiert, denn ich kannte dieses Lachen gut. Zum ersten Mal hatte ich es Anfang der siebziger Jahre bei Karstadt gehört, in der Spielzeugabteilung im fünften Stock. Hier war ein halbes Regal mit Lachsäcken vollgepackt, ein paar Meter von der Zooabteilung mit den lustigen Kapuzineräffchen entfernt. Der Lachsack war damals der große Renner. Nicht, dass er eine technologische Innovation gewesen wäre. Das Lachen wurde auf einer kleinen Schallplatte aufgezeichnet, wie bei Sprechpuppen, die «Mama» oder «Hab mich lieb» sagen konnten. Es war das ansteckendste Lachen, das da auf der Platte gespeichert war. Später las ich, dass es einem Finanzbeamten aus Nürnberg gehörte, der vom Lachsackproduzenten eintausend Mark dafür bekommen hatte, dass er ihm seine Lache überließ.
Wem das Lachen zum ersten Mal vorgespielt wurde, der musste mitlachen, ob er wollte oder nicht. Trotzdem konnte man sich dabei nicht wohl fühlen. Wer es öfter abspielte und dabei genau hinhörte, merkte auch, weshalb. Das Lachen war das reine Grauen. Am Anfang baute es sich langsam auf. Lachwelle türmte sich auf Lachwelle, bis sich die Wellen zu überschlagen schienen. Dann kippte es in etwas um, das an das Geschnatter einer Gänseherde erinnerte, durch die jemand mit einer Kettensäge ging. Der Schluss aber war das reine Entsetzen. Er klang wie ein Kind, das an einem Keuchhustenanfall erstickte.
Genau dieses Lachen erscholl jetzt aus dem Grab. Dabei war der Sack von Ronny so manipuliert worden, dass er ohne Unterbrechung weiterlachte. Die Lachwellen, die Todesangstgänse und das erstickende Kind wiederholten sich in einer Endlosschleife. Der Sack musste flach auf dem Sarg gelandet sein, wodurch dieser wie ein Resonanzkörper wirkte. So mischte sich das Lachsacklachen in die Stimme von Johnny Cash: «There ain’t haaaaaaaaahhaaaaaaa no grave hahahahaaaaahaaaaaa can hold haaaaaaaaahhaaaaaaa my body hääääääääähähähähähä down.» Es war, als würde Viktor seine eigene Beerdigung kommentieren.
Die Witwe starrte Ronny voller Hass an. Dann kam Bewegung in sie. Sie holte mit dem rechten Arm weit aus und versuchte, ihm eine zu knallen. Ronny wehrte den Schlag ab und gab einen leichten Stoß zurück. Agnieszka taumelte und wäre um ein Haar ins Grab gefallen. Das war das Signal für den Mann mit den buschigen Augenbrauen. Er und ein Typ mit Stiernacken lösten sich aus dem Kamelhaarpulk und stürzten sich auf Ronny. So begann die Schlägerei. Sie eskalierte innerhalb weniger Sekunden. Ein paar Kamelhaarmäntel sprinteten mit dem Ruf «Kommt her, ihr Scheiß-Asozialen» zur völlig perplex dastehenden Kiefernwäldchengruppe und teilten sofort aus. Andere, darunter Frauen und Kinder, sammelten Steine und Lehmbrocken vom Boden und begannen, Viktors alten Bekanntenkreis unter Feuer zu nehmen. Der ganze Kamelhaartrupp war offenbar fest überzeugt davon, dass alle in Ronnys Anschlag eingeweiht waren.
Die Kiefernwäldler stoben auseinander. Nur manche versuchten, sich zu wehren. Besonders die alten Außenseiter ließen sich nichts gefallen. Allerdings waren auch sie nicht mehr dieselben wie früher. Ich sah, wie Mäxchens Kopf gegen einen neumodischen Grabstein knallte, der die Form eines USB-Sticks hatte und in den das Wort «Leben» eingemeißelt war. Ich musste kurz in mich hineinlachen. Andere verblüffte der Angriff so sehr, dass sie regungslos verharrten – wie Biber im Taschenlampenkegel. Der dicke Frosch zum Beispiel war von den Kamelhaarleuten einfach umgerannt worden und lag im Schlamm. Die Mehrheit aber tat das einzig Richtige und floh stolpernd über die Gräber in Richtung Ausgang.
Ein Vorteil der Schlacht war, dass ich jetzt auch Leute zu Gesicht bekam, die in der dritten, vierten oder fünften Reihe gestanden hatten. Zum Beispiel die einst gertenschlanken Geschwister Düsselmann: Ulli, Anni und ihr Bruder Speedy. Die Mädchen waren für Heroin auf den Strich gegangen, und mit diesen beiden hatte ich den einzigen Dreier meines Lebens gehabt. Wir waren zusammen vollkommen betrunken auf einer fremden Matratze eingeschlafen und dann mitten in der Nacht aufgewacht. Alles Weitere hatte sich im Halbschlaf ergeben. Niemals hatten wir darüber geredet, und irgendwann hatte ich alles vergessen. Erst als die drei Düsselmanns unter den harten Schlägen zweier Kamelhaarmänner über den Friedhof flohen, fiel mir alles wieder ein.
Hinter den drei Geschwistern kamen die kleine Penny und ihr Freund zum Vorschein, Thomy Helpup, der ewige Punk. Mit ihm hatte ich zum ersten Mal Speed genommen und war dann zwei Nächte durch die Stadt gelaufen, erst durch die Clubs und Discos, dann auf die Burg rauf und wieder runter, bis ich nicht mehr konnte. Völlig verdreckt, verstunken und zerkratzt war ich einen Tag später wieder aufgewacht. Wolle Kopf erkannte ich eigentlich nur an den Narben im Gesicht, die ihm Babsi Eschengerd vor mehr als dreißig Jahren mit ihren bloßen Fingernägeln zugefügt hatte. Der alte Unglücksrabe hockte auf einem kleinen Bänkchen und blutete kräftig aus der Nase. Auch Claude machte ich aus, eine meiner Exxen. Sie trug immer noch denselben Bubikopf wie damals, nur dass er ihr nicht mehr dasselbe melancholische Aussehen verlieh, und kauerte mit Michis mittlerer Schwester Jenny hinter einem Grabstein-Ensemble aus Reisekoffern, auf denen «Ich bin dann mal weg» (der größte) und «Grandhotel Abgrund» (der kleinste) stand.
Immer deutlicher zeichnete sich ab, dass die Leute aus dem Witwentross überlegen waren. Sie hatten nicht nur das Überraschungsmoment für sich. Sie waren auch jünger und kräftiger als die Kiefernwäldchengruppe. Selbst Horsti war nicht mehr der Alte. Zwei Endzwanziger hatten ihn zu Boden gerungen, wo sie ihn mit harten Hieben bearbeiteten. «Schlagen, schlagen», hörte ich ihn aus der Ferne jammern, «das ist alles, was ihr könnt.» Dass ich einmal ausgerechnet Horsti, der als Türsteher und Bodyguard gearbeitet hatte und in seinem Leben wohl Hunderten von Menschen körperlich zu nahe getreten war, so reden hören würde, hätte ich nicht gedacht.
Ronny schlug sich zunächst recht wacker. Direkt am Grab wurde er von drei Leuten festgehalten, während zwei weitere auf ihn einschlugen. Trotzdem konnte er sich losreißen und ein paar anständige Hiebe verteilen. Schließlich versetzte ihm aber der Stiernackige mit einem Spatenstiel einen Schlag in die Kniekehlen, und Ronny ging zu Boden.
Mich und meinen Bruder beachtete der Kamelhaartrupp gar nicht. Sie hatten offenbar keinen Schimmer, zu wem wir gehörten, weil wir nicht bei den anderen gestanden hatten. Außerdem sahen wir einfach nicht so abgerissen und prekär aus wie das Gros der Kiefernwäldler. Wir mussten nur weiter absolut unbeteiligt tun, dann würden wir für die Schläger unsichtbar bleiben.
Ein großer Vogel flog torkelnd und sehr niedrig über das Getümmel und setzte sich am anderen Ende des Friedhofs auf den Kopf eines großen, oxidierten Bronzeengels. Ein Eichelhäher, wie ich gleich erkannte. Ich habe mich mein ganzes Leben lang für Vögel interessiert, seitdem mir meine Eltern zu meinem achten Geburtstag den großen Kosmos-Vogelführer geschenkt hatten, und die Häher habe ich immer sehr gemocht. Genau unter dem Kopf des Engels, auf dem der Vogel saß und sein schillerndes Gefieder putzte, stand eine junge Frau mit einem Pferdeschwanz, fünfundzwanzig vielleicht oder jünger, der das Prügelschauspiel mindestens so gut zu gefallen schien wie mir. Als sie bemerkte, dass sich mein Blick an ihr festfraß, hob sie die Augen und lächelte mich an.
Ich sah unwillkürlich weg, so wie man sich von einem zu grellen Licht abwendet. Dann schaute ich vorsichtig wieder hin. Das sanft gekerbte Kinn, die Stupsnase, die selbst auf die Entfernung immer noch leuchtenden blaugrünen Augen, die an die Schmuckfedern des Hähers erinnerten, überhaupt die blendende Offenheit ihres Gesichts: Kein Zweifel, ich kannte diese Frau. Nur hatte ich nicht den leisesten Schimmer, wer sie war. Ich wusste nur – was heißt wusste? –, ich ahnte, dass sie einmal wichtig für mich gewesen war. Gleichzeitig schien das ausgeschlossen: Denn dafür, dass wir eine gemeinsame Geschichte hatten, war sie viel zu jung.
Aber dieses Gesicht strahlte mich so an, als hätte es in mir tatsächlich einen alten Bekannten erkannt. Gleichzeitig verbarg sich unter diesem Strahlen so etwas wie Mitleid. Diese Mischung löste etwas in mir aus, das ich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt hatte. Es war, als hätte man mir MDMA direkt in die Vene gespritzt, gleich ein paar hundert Milligramm. Eine Glutwelle ging vom Solarplexus aus und lief über beide Schultern in die Armbeugen, in denen sich die Hitze sammelte. Innerhalb von Sekunden wurde ich ein paar Kilo leichter. Ich spürte noch, wie dieses Gefühl in ein anderes umzukippen drohte, als mir auffiel, dass es jemandem gelungen war, den Lachsack zu stoppen. Johnny Cash lief dagegen immer noch. «There is a train that’s heading straight» wehte herüber.
In der Erinnerung sehe ich diese Szene immer aus der Vogelperspektive. Ich schwebe über der blau schimmernden Kuppel der Friedhofskapelle, dem offenen Grab und dem Kampfgetümmel. Dann schwenkt mein Blick hinüber zu der etwas abseits stehenden Frau unter dem Bronzeengel. Ich sehe mich auch selbst dort stehen, und zwischen der Frau und mir eine feine, leuchtende Spur wie von diesen Lasern, mit denen die Nippes-Verkäufer abends am Strand von Repulse Bay Kunden anzulocken versuchen. Was ich aber nicht sehe, ist ein Gegenstand, der durch die Luft fliegt und mich hart am Kopf trifft.
Ich wunderte mich nur über einen plötzlichen Schmerz an der Schläfe und ging langsam in die Knie. Dann rappelte ich mich erstaunlicherweise noch einmal auf und betrachtete das Wurfgeschoss: Es schien ein Stein zu sein, mit Hochglanzpapier umwickelt.
Ich weiß noch, dass ich das Papier entfernte und darunter ein großer, grüner Kiesel zum Vorschein kam. Auf dem Papier selbst stand ein kurzer Text in schwarzen Buchstaben. Ich wollte ihn gerade lesen, als mehrmals hintereinander ein lautes Knacken ertönte, wie von einem elektrischen Gasanzünder. Der Boden unter meinen Füßen wölbte sich, und plötzlich hing der ganze Friedhof senkrecht in der Luft wie eine dreidimensionale Tapete. Danach wurde es sehr dunkel. Andhatāmisra, funkte es aus einem Winkel meines Neocortex. Die blinddunkle Hölle der Hindus, in die Selbstmörder und treulose Eheleute kommen. Dort wird man so lange von der Dunkelheit selbst gefoltert, bis man sogar die Idee von Licht verliert.
2Der Tod ist ein Märchen für Kinder
Ich glaube, bevor ich diesen Bericht fortsetze, muss ich etwas erklären. Die zwölf Jahre in Hongkong sind nicht spurlos an mir vorübergegangen. Unter anderem habe ich mich dort mit Sandys Geisterglauben infiziert – jedenfalls ein bisschen. Das ist ja auch kein Wunder. Jedes Jahr waren wir an Qingming zu ihren Großeltern auf den Pok-Fu-Lam-Friedhof gepilgert. Wir hatten hier Schnaps und Obst vor ihre Grabsteine gestellt, Räucherstäbchen angezündet und Totengeld verbrannt. Auch zu Hungry Ghost verbrannten wir Totengeld, meistens am Strand der Sea-Ranch-Siedlung, nicht weit von unserem Apartment. So gewöhnt man sich an die Gegenwart von Geistern.
Auch die Geschichte, die Sandy immer wieder erzählte, wenn einer in unserem Bekanntenkreis gestorben war, hatte ich verinnerlicht. Ihr zufolge kehrt der Geist des gerade Gestorbenen sieben Tage nach seinem Tod in das Haus zurück, in dem er gewohnt hat. Er überprüft, ob sich auch wirklich alle zu seinem Gedächtnis versammelt haben, und sieht sich noch einmal das ganze Haus an, um es sich einzuprägen. Erst danach zieht er sich endgültig in die Unterwelt zurück. So war ich erst einmal nicht übermäßig erstaunt, als Viktor nach seiner Beerdigung einfach wiederauftauchte und von mir Besitz zu ergreifen schien.
Aber ich greife vor. Erst einmal fehlten mir nach meinem Zusammenbruch auf dem Friedhof gut fünf Stunden meines Lebens. Mein Bruder hat mir nur grob davon berichtet, was in der Zwischenzeit passiert war. Erst hatte er mich aus der Kampfzone geschleppt und dann am Nordtor des Friedhofs einen Krankenwagen gerufen. Zu Franks Überraschung fuhr der mich in das Allgemeinkrankenhaus der Anstalt. Der Fahrer meinte, dass es das nächstgelegene Klinikum sei, obwohl das definitiv nicht stimmte. So landete ich im «Sinai». Ich kannte es sehr gut. Dort war ich geboren und in einem Haus, das keine fünfhundert Meter entfernt stand, aufgewachsen. Der Sinai ist ja der Berg, auf dem Moses Gott in einem brennenden Dornbusch sah und dann die Zehn Gebote empfing. Schon im Kindergottesdienst hatte man uns das eingetrichtert, genauso wie die Geschichten zu den anderen Häusern der Anstalt. Alle trugen sie biblische Namen: «Enon» war eine Stelle am Jordan, an der Johannes der Täufer getauft hatte. In «Arafna» hatte König David einen Altar errichten lassen, und «Mara» war eine bittere Quelle in der Wüste Schur. Jeden Sonntag lernten wir das, und wer es beim nächsten Kirchgang nicht mehr wusste, wurde von den Kindergottesdiensthelfern verspottet und fertiggemacht.
Als ich aus meiner Bewusstlosigkeit erwachte, saß Frank neben meinem Bett und spielte mit dem Handy. Ich hatte keinen Schimmer, wo ich war und weshalb es hier so stank. Ich fragte mich auch gar nicht, wieso mein Bruder auf dem Stuhl hockte. Mich interessierten nur zwei Sachen.
«Hast du gesehen, wer den Stein geworfen hat?», fragte ich als Erstes.
«Keine Ahnung, ich schätze mal, es war einer von den Kamelhaarmänteln.»
«Wer?»
«Die Typen, die mit der Prügelei angefangen haben.»
«Und die Frau?»
«Wer?»
«Na, diese junge, gutaussehende. So viele gab’s ja nicht. Die unter dem Engel stand.»
«Welcher Engel?»
«Was hast du überhaupt gesehen?»
«Einen großen Vogel. Eine Krähe oder so was. Flog sehr tief und irgendwie komisch. Und dann bist du umgefallen.»
Auch der Zettel, in den der Stein gewickelt gewesen war, schien verschwunden zu sein.
«Bin ich Altpapiersammler?», hatte Frank nur gefragt. Ich hätte noch einmal fünf Stunden meines Lebens gegeben, um zu erfahren, was auf dem Papier gestanden hatte. Dabei hatte ich den Zettel doch gelesen, bevor ich zusammengebrochen war. Auch im Koma wusste ich den Text noch. Aber nach dem Aufwachen: bumm, alles weg. Fast alles. Ich erinnerte mich noch an ein großes «C» und ein großes «T». Und obwohl mir nicht mehr einfiel, bereiteten mir diese beiden Buchstaben Unbehagen.
Und genau als dieses Unbehagen einsetzte, passierte es: Viktor begann zu lächeln. Ich sah ihn einfach überall. Sein wie bescheuert lächelndes Gesicht legte sich auf alle Dinge: auf den Lilienstrauß neben meinem Bett, auf die Sonnenblumen des Van-Gogh-Drucks an der Wand, auf den Paravent, der mein Bett von dem meines Nachbarn abschirmte, ja sogar über den Duschkopf in der stinkenden Nasszelle. Mir fiel ein, dass Viktor für sein Lächeln schon zu Lebzeiten berühmt gewesen war. Jeder, mit dem ich je über ihn geredet habe, kam sehr schnell darauf zu sprechen. Manche verglichen es mit dem Lächeln, das Malcolm McDowell in «A Clockwork Orange» oder ganz am Ende von «O Lucky Man!» aufsetzte. Und fast alle sagten, einerseits sei es ja wirklich gewinnend, freundlich, sogar eine gewisse Schüchternheit signalisiere es, andererseits habe man auch immer das Gefühl, dass hinter diesem Lächeln Verachtung, Misstrauen oder Tücke lauerten. «Es flackert da etwas», hatte meine Ex Brigitte mal gesagt, «ohne dass ich genau sagen könnte, was. Ich glaube aber, ich will nichts damit zu tun haben.»
Vier Tage später lächelte Viktor immer noch. Da saß ich bereits im ICE nach Berlin, auf dem Weg in mein Kabuff – eine Einzimmerwohnung mit einer winzigen Küche und Dusche im Prenzlauer Berg. Ich hatte sie von meinem letzten Geld gekauft, damals Anfang der nuller Jahre, als Wohnungen in Berlin noch nichts kosteten. Solange ich in Hongkong großzügig auf der Sea Ranch residierte, hatte ich den Verschlag kaum genutzt. Jetzt aber war er das letzte Refugium, das mir noch geblieben war.
Viktor lächelte also, und ich dachte daran, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, im Sommer 1978 – nein, Quatsch, 1977 war das –, am Fuß der Akropolis in Athen. Es war eines dieser Treffen, wie sie damals in den großen Ferien üblich waren. Man trampte durch die Gegend oder fuhr mit Interrail, hatte sich aber schon vor der Abreise verabredet: an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort. Auch wenn das heute unbegreiflich ist, klappten diese Treffen immer. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich verabredet gewesen war. Aber plötzlich stand da auch Viktor. Er war der Einzige von den acht oder neun Leuten, der alleine heruntergekommen war, nur mit einem dünnen Schlafsack und einer Zahnbürste im Gepäck. Viktor war schon damals der große Loner, ein Cowboy, der niemanden brauchte. Ich hatte alle möglichen Gerüchte über ihn gehört; jetzt stand dieser Typ plötzlich wirklich vor mir, mit schulterlangen Haaren und in einem verschwitzten T-Shirt. Er sagte nur: «Hi.» Und lächelte.
Bereits bei diesem ersten Treffen überstrahlte Viktor alle anderen. Ich war beeindruckt, wie man wohl nur in diesem Alter von jemandem beeindruckt sein kann. Ich glaube, gerade das Flackernde, Unbestimmte war es, das mich anzog. Das Treffen in Athen hatte nur ein paar Stunden gedauert, ich hatte es schon fast vergessen. Doch als ich wieder zu Hause war, passierte das absolut Unwahrscheinliche: Viktor, dieser Mythos, wurde Teil unserer Familie.
«Mein Vater ist völlig ausgerastet, als er erfahren hat, dass ich die Schule geschmissen habe», hatte er mir erzählt und hinzugefügt: «Es geht nicht mehr. Ich sterbe zu Hause.»
So etwas hatte ich von dem großen Viktor noch nie gehört. Er schien völlig am Ende. Dabei habe ich bis heute nicht herausgefunden, ob die Geschichte überhaupt stimmte. Ich fragte trotzdem meine Eltern, ob Viktor nicht bei uns wohnen könne.
«Nur vorübergehend natürlich.»
Meine Eltern hatten keine Einwände. Auch das ist heute wahrscheinlich unbegreiflich. Aber es waren die Siebziger, da galten andere Gesetze. Außerdem waren wir Christen: nicht irgendwelche Christen, sondern Anstaltschristen. Bei uns galt: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.» Und in diesem Fall hieß der Nächste Viktor.
Er durfte also in den alten Kohlenkeller ziehen. Der war für Frank zum Schlagzeugspielen umgebaut worden, nachdem in unserem Haus die Ofenheizungen durch Stadtgas ersetzt worden waren. Der Keller sah halbwegs wohnlich aus. Die Wände waren mit pinker Raufaserfarbe gestrichen, der Boden mit braungelben Teppichfliesen ausgelegt. Viktor machte das genauso wenig aus wie die dicken Gitterstäbe vor den Kellerfensterluken. Er stellte eine alte Truhe in den Raum, in der er ein wenig Wäsche aufbewahrte, und legte eine Matratze auf Europaletten. Auf die Truhe kam eine große Wasserpfeife, die Teppichfliesen wurden von einem Flokati verdeckt. Als einzige Zimmerpflanze platzierte er einen winzigen Peyote-Kaktus auf der Fensterbank einer der beiden Luken.
«Wenn der größer ist», sagte er zu mir, «werden wir ihn gemeinsam essen. Ich habe gelesen, dass man dann wirklich fliegen kann. Ein paar Meter nur. Aber es soll funktionieren.»
Immer noch leicht belämmert von der Ohnmacht und dem Krankenhaus saß ich in meinem ICE-Sessel und staunte, wie gut ich mich plötzlich wieder an diese ganzen Einzelheiten erinnern konnte. Mein Gedächtnis war zeit meines Lebens ein Sieb gewesen, meine Kindheit und Jugend eigentlich komplett ausradiert. Ich hatte das darauf geschoben, dass meine frühen Jahre eben einfach völlig normal und uninteressant gewesen waren. Außerdem hatte ich wohl zu lange in Hongkong gewohnt. Die ganzen Erfahrungen, die ich dort machte, die neuen Freunde und Bekannten, mein Leben mit Sandy, das alles hatte sich wie eine dicke Kruste über meine deutsche Vergangenheit gelegt.
Ich holte das neue Notizbuch aus der Manteltasche und schrieb hastig ein paar Stichworte hinein: «Erinnerungsflash. Viktor in Griechenland. Der Kohlenkeller. Rosa Raufaser. Peyote.» Das Notizbuch war Teil eines Deals, den ich mit Dr. Taessler, dem Arzt im «Sinai», geschlossen hatte. Nach vier Tagen im Bett hatte ich darauf bestanden, entlassen zu werden. Taessler äußerte große Bedenken und hätte mich gerne noch etwas länger dabehalten.
«Wir haben zwar im MRT nichts Außergewöhnliches feststellen können. Aber bei einem Schädel-Hirn-Trauma weiß man nie.»
Ich hatte ihm geantwortet, dass es mir ausgezeichnet ginge und ich unbedingt rausmüsste.
«Dann kaufen Sie sich so’n Moleskine und schreiben alles rein, was Ihnen auffällig vorkommt. Wenigstens in den nächsten Wochen. Sollte es doch noch zu Komplikationen kommen, findet Ihr behandelnder Arzt vielleicht in Ihren Aufzeichnungen einen Hinweis.»
Um meine Entlassung nicht zu gefährden, hatte ich Taessler nichts von Viktors omnipräsentem Dauerlächeln erzählt. Das trug ich jetzt im Notizbuch nach. Ich schrieb: «Viktors Lächeln. Permanent. Scheußlich. Wird aber schwächer.» Tatsächlich sah ich Viktors Lächelballon jetzt nur noch selten verschwommen aufglimmen. Stattdessen wurden die Erinnerungsbilder immer deutlicher. Ich sah, wie Viktor an einem sonnendurchstrahlten Herbsttag Ronny mit zum Essen brachte und meine Mutter ein zusätzliches Gedeck auf den Tisch stellte. Eine Woche später saß auch Ben bei uns am Mittagstisch, ein Abiturient, der noch auf das Gymnasium ging, das Viktor gerade verlassen hatte. Auch er wurde durch den berühmten Mann angelockt. Jetzt hockten wir zu viert bei Viktor im Keller, manchmal bis in die Nacht, immer um die Wasserpfeife herum, die Viktor nie ausgehen ließ. Während Ronny, Ben und ich fast die ganze Zeit bekifftes Zeug quatschten, blieb Viktor ganz ruhig. Nur ab und zu mal sagte er einen kurzen Satz, und in dem ging es immer um das Gleiche: «Wir müssen etwas Großes tun.» – «Wir brauchen eine Idee.» – «Wir müssen besser sein als die Wichser.»
Um diese Zeit muss ich wohl auch das Reclam-Heft in der Alternativbuchhandlung der Stadt entdeckt haben. Es war gerade erschienen und trug den Titel «Dada Berlin». Ein Professor mit dem seltsamen Namen Karl Riha – ich hielt das für ein absurdes Pseudonym – hatte hier Texte und Manifeste dieser Bewegung versammelt. Ich las es in einem Rutsch durch und zeigte es am nächsten Tag Viktor. Gelangweilt schlug er das Heft auf irgendeiner Seite auf und las den ersten Satz, der ihm ins Auge fiel, laut vor:
«Die Dinge müssen sich stoßen: Es geht noch lange nicht grausam genug zu.»
Viktor hatte den Satz extra albern betont, wahrscheinlich um mich und meine Entdeckung vorzuführen, doch schon während er las, hellte sich seine Miene auf.
«Das ist gut. Das ist sogar sehr gut», sagte er. Damit hatte ich freie Bahn. Ich schlug vor, unsere kleine Gruppe «Die Huelsenbecks» zu nennen, nach dem Autor des soeben vorgelesenen Satzes. Viktor war gleich einverstanden, und damit auch Ronny und Ben.
Von nun an machten wir im Keller Pläne. Als Erstes beschlossen wir, dass die Huelsenbecks ein angemessenes Outfit brauchen. Eine Art coole Uniform. Wir fanden sie in der «Brosamensammlung» der Anstalt, wo gespendete Klamotten und anderer Trödel für ein paar Mark verkauft wurden. Hier suchten wir uns die Pelzmäntel aus, die zu unserem Erkennungszeichen wurden. Viktor kaufte einen alten silbergrauen Nerz, der ihm fast bis zu den Füßen reichte, Ronny einen Mantel, der mit Waschbärenfell gefüttert war, und ich eine Seehundjacke mit Persianerbesatz. Dazu holten wir uns schwarze Stiefel, die wir im Keller auf Hochglanz polierten, und weiße Oberhemden mit steifen Kragen.
In der «Brosa» fiel uns Michi auf. Er hatte sich bereits so ausstaffiert, wie es uns vorschwebte. Das reichte, um ihn mit in den Keller zu nehmen. So fing das also an mit den Huelsenbecks. Fehlten nur noch die Aktionen. Meistens war ich es, der sie sich ausdachte. Dabei versuchte ich, mich von dem gelben Reclam-Heftchen inspirieren zu lassen, das inzwischen jeder Huelsenbeck bei sich trug. Viktor entschied, ob meine Vorschläge was taugten. Nur die Idee mit der Amerikafahrt stammte von ihm selbst. Eines Nachts trug er sie unerwartet im Keller vor: «Wenn wir es schaffen wollen», dekretierte er, «dann müssen wir aus diesem Dreckskaff raus. Und es gibt, meine lieben Huelsenbecks, nur einen Ort auf der Welt, an dem wir es wirklich schaffen können. Dieser Ort heißt: Amerika.»
All dies schrieb ich nun hastig auf, um bloß kein Detail der frisch hochgeschwemmten Erinnerungen auszulassen, und machte hinter «Brosa», «Pelze», «Gründung der Huelsenbecks» und «Amerikafahrt» jeweils drei Ausrufezeichen. Eine alte Marotte aus der Zeit, als ich noch professionell geschrieben hatte. Dann verlosch der Erinnerungsblitz ebenso plötzlich, wie er gekommen war. Ich klappte das Notizbuch zu und schrieb in Blockbuchstaben auf den Umschlag: «IRRENJOURNAL – To whom it may concern.»
Der Zug durchfuhr die Porta Westfalica. Die Grenze der Gegend, die schlichtere Gemüter Heimat nennen würden. Das dachte ich jedes Mal, wenn ich hier durchfuhr, als ob einer hinter mir stünde und mir den Satz soufflierte. Es regnete noch immer, und das Wasser der Weser würde bald wieder über die Ufer treten. Häuser und Straßen würden von den Fluten weggespült. Menschen würden auf Hausdächern stehen oder Hubschrauber steuern. Der Ausnahmezustand würde verhängt, und in sämtlichen Medien gäbe es nur ein Thema. Ich freute mich darauf. Ich liebte Katastrophen. Wie oft hatte ich auf der Sea Ranch am Fenster gestanden, dem Taifun bei seinem Wüten zugesehen und gedacht: Stärker, bitte, bitte, stärker.
Der Fokus meiner Augen veränderte sich, und ich sah mein Spiegelbild in der Scheibe. An der Stelle, an der mich der Stein getroffen hatte, klebte ein beeindruckendes Pflaster. Die Wunde darunter war nicht besonders groß und bestimmt schon längst verschorft. Spätestens morgen würde ich das Pflaster abmachen können. Die Narbe würde sicherlich okay sein. Gegen Narben ist nichts einzuwenden. Das Problem war mein Gesicht als solches. Es schien mir in den letzten Tagen übermäßig gealtert zu sein. Der Alterungsprozess vollzieht sich ja in Schüben, das weiß jeder. Jahrelang hat man das Gefühl, dass überhaupt nichts passiert, und dann kommt plötzlich über Nacht einer mit der großen Hässlichkeitswalze. Aber das, was ich in der Scheibe sah, war doch ein bisschen zu viel des Guten. Die ledrigen Falten im Nacken, die labbrigen Wülste am Hals, die aschgraue Haut, die müden, blutunterlaufenen Augen, die zu großen, roten Ohren: Es war schwer zu akzeptieren, dass dieses Gesicht mir gehörte.
Ich drehte meinen Kopf so schnell weg, dass einer meiner Halswirbel leise knackte. Auf dem Sitz neben mir lag eine Ausgabe der städtischen Tageszeitung. Die Schlägerei auf Viktors Beerdigung hatte es auf die zweite Seite des Lokalteils geschafft. In der Kurzmeldung hieß es, bei dieser «unwürdigen Keilerei» seien fünf Menschen verletzt worden, «darunter einer schwer». Keine Ahnung, ob ich damit gemeint war. Ich hatte die Zeitung längst ausgelesen; sie lag nur da, damit sich keiner neben mich setzte. Zum Beispiel so ein Typ wie dieser «Kreative» ein paar Sitze vor mir, erkennbar an dem Scheißvollbart, den man ja in dieser Szene seit ein paar Jahren tragen muss. Der Typ schien mir sehr groß, unerträglich gesund und eingebildet jung. Dabei habe ich nichts gegen junge Menschen. Aber kein Huelsenbeck war je auf diese widerliche Art jung gewesen. Wir hätten uns zu Tode geschämt.
Der Typ quatschte ohne Unterbrechung in sein Handy, mit einer überenthusiastischen Stimme, die einfach nicht auszublenden war. «Wir haben das mobile Marketing gerockt. Dann phat eingecasht. Ab ging’s mit dem Flieger nach New York. Zum Marathon, du weißt schon. NEW YORK MA-RA-THON. Also ich bin da mehr so mitgefedert.»
«Geil» sei das gewesen, «obergeil», aber auch «total flashy». Schließlich erhöhte sich die Tonlage seiner Stimme noch um eine weitere halbe Oktave: «Ich sag dir, da kommt ein Spirit rüber bei den Amis, das ist überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Diese funky freshness. Ganz andere Liga.»
Diese Sätze reichten, um mich innerlich zum Kochen zu bringen. Früher wären wir mit so einem ganz sicher anders umgesprungen. Viktor wäre zu ihm rübergegangen, hätte sein Gesicht nur wenige Zentimeter vor dem des Typen positioniert, hätte ihn für einige lange Sekunden angelächelt und ihm dann ins Gesicht gezischt: «It’s fuck-off time, mein Lieber.»
Das war Viktors Spruch, mit dem er auf Partys oder bei anderen Gelegenheiten Leute vertrieb, die ihm aus irgendeinem Grund nicht passten. Das Erstaunliche an solchen Auftritten war: Der Spruch wirkte jedes Mal. Ich hatte mehrmals beobachtet, wie Leute, die so bearbeitet worden waren, Land gewannen. Viktor strahlte immer etwas Ultimatives aus. Auch das hatte ihn für die Huelsenbecks so wichtig gemacht.
Statt den Kreativen anzumachen, zog ich meinen iPod heraus, schob mir die Kopfhörer über die Ohren und drückte auf Play. Robert Plant begann zu singen: «Babe, I’m gonna leave you», ein Blues, von Led Zeppelins Debütalbum. Ich hatte zeit meines Lebens wirklich keinen guten Musikgeschmack. Wahrscheinlich lag das an den vielen Chorälen in meiner Kindheit, den ganzen Oratorien und Passionen. In der Kirche muss es ja musikalisch immer knallen, damit von der Predigt etwas hängenbleibt. Das führte zu meiner Vorliebe für musikalischen Bombast.
Mir wurde gleich besser. Ich drehte die Lautstärke so laut auf, dass ich keinen anderen Laut mehr hören konnte, und allmählich gelang es mir, mich zu entspannen. Ich griff zum Bahn-Magazin und blätterte, die übliche einschläfernde Mischung: ein Interview mit einem Drei-Sterne-Koch, der einen Pferdeschwanz trug und die «tausendundein Geheimnisse der veganen Küche» verriet. Das Porträt einer jungen, blonden Schauspielerin, von der ich noch nie etwas gehört hatte und die auf jedem Foto einen hysterischen Eindruck machte. Die vom Verlag selbst bezahlte Rezension eines Buches, das wie immer «mit präziser Beobachtung, Witz und Selbstironie» geschrieben war. Genau das Sedativ, das ich jetzt brauchte.
Bei einem Artikel über die mexikanische Stadt Mazatlán blieb ich dann aber doch hängen. Was für ein Zufall. Mazatlán war eine Station auf der Amerikareise der Huelsenbecks gewesen. Natürlich bestand auch dieser Artikel nur aus den üblichen Phrasen, die man inzwischen in jedem Reisebericht unterbringen musste. Die aus irgendeiner kosmischen Zentrale ferngesteuerten Reiseredakteure verlangen von allen ihren Autoren Formulierungen wie «schimmerndes, türkisblaues Wasser», «mit Palmen bestandener Paradiesstrand», «der prächtige Malecón der Stadt» oder «Pedro Gonzales (89) bastelt trotz seines hohen Alters noch täglich phantasievolle Alebrijes aus Pappmaché und Kuhmist». Ich konnte so etwas wirklich nicht zu Ende lesen. Dafür sah ich mir die Fotos ganz genau an und prüfte, ob mir nicht irgendetwas bekannt vorkam. Doch Fehlanzeige. Alles wirkte fremd.
Das wunderte mich nicht. Ich erinnerte mich an diese Amerikareise genauso vage wie an den Rest meiner Jugend. Vielleicht hatte ich sie auch extra stark verdrängt. Die Reise, die im Sommer 1978 der Beginn eines weltweiten Aufstiegs der Huelsenbecks werden sollte, besiegelte in Wirklichkeit bereits das Ende unserer kleinen Gruppe. Rund 15000 Kilometer waren wir in einer für ein paar Dollar gekauften Schrottkarre durch die Gegend gefahren, von der Ostküste nach Kalifornien und von dort dann weiter nach Mexiko. Mazatlán war der südlichste Punkt unserer Reise gewesen. Von hier fuhren wir über die Ostküste Mexikos zurück in die USA und flogen wieder nach Hause. Aber was genau hatten wir unterwegs gemacht? Ich hatte nur noch vor Augen, wie wir uns praktisch ununterbrochen gestritten hatten. Fünf blutjunge Idioten mit Dauerlagerkoller. Anders als geplant hatte die Reise deswegen ja auch nur – wie ich zumindest damals noch dachte – fünf oder sechs Wochen gedauert.
Was für ein Aufwand, dachte ich, nur um sich mal so richtig streiten zu können. Die Idiotie der Jugend. Dann fiel mir doch noch eine konkrete Situation ein, die sich schon ganz am Anfang der Reise zugetragen hatte, auf dem Weg nach London. Viktor spielte natürlich wieder die Hauptrolle. In London wollten wir einen Billigflieger nach New York nehmen. Wir hatten die ganze Nacht auf der Fähre von Ostende nach Folkestone mit Whisky Cola durchgemacht und uns dabei prächtig mit einem deutschen Pärchen unterhalten, das auf Heroin war. So wie der Typ gelallt und die Frau mitten im Satz ganz beiläufig gekotzt hatte, stand das außer Frage. In Folkestone waren wir dann vollkommen verkatert an Land gegangen. Doch Viktor wollte plötzlich umkehren.
«Ich hab die Schnauze voll», schrie er morgens um fünf. «Ich kann mit so was wie euch nicht zusammen reisen.»
Jeder von uns zog gerade einen unten am Hafen geklauten Gepäcktrolley eine kleine Steigung hinauf. Am Ortsausgang wollten wir dann trampen, kamen jedoch kaum vorwärts, weil Viktor dauernd schrie, woraufhin auch Ronny zu schreien begann, und irgendwann dann auch ich. Wenn ich mich richtig erinnere, war Viktor sauer, weil wir uns mit dem Junkie-Pärchen auf der Fähre nicht cool genug unterhalten hatten. Wir? Hauptsächlich wohl ich.
«Mensch, das waren Junkies. Mit denen redet man nicht über so was wie Werktherapie in der Anstalt, du Wicht.»
Der ICE reduzierte seine Geschwindigkeit, und draußen begann Wunstorf vorbeizukriechen. Robert Plant schrie in mein Ohr: «We gonna go walkin’ through the park every day.» Der Schrei holte mich zurück in den Zug. Ich stopfte das Bahn-Magazin wieder in das Netz der Rückenlehne, kramte mein Notizbuch noch einmal heraus und schrieb: «Mazatlán. Die Folkestone-Schreierei. Du Wicht.» Dann stand ich auf, um ins Bordbistro zu gehen. Als ich den Kreativen passierte, drehte ich mich um, um einen Blick auf ihn zu werfen. Ich war verblüfft. Woher kannte ich diesen Vollbart?
Im Bistro bestellte ich mir einen Kaffee bei einer schlechtgelaunten, korpulenten Kellnerin. Sie war so dick, dass sie kaum hinter den Tresen passte. Nicht dass ich etwas gegen Dicke habe – ich selbst war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr schlank –, aber wird man eigentlich dick, nachdem einen die Deutschen Bahn eingestellt hat, oder ist das Einstellungsvoraussetzung? Beim Zahlen fiel mein Blick auf ihr Namensschild: «Evelyn Webster». Ich starrte der Frau etwas zu lange auf den kissengroßen Busen.
«Noch etwas vergessen?», fragte sie patzig.
«Äh, nein», stotterte ich.
Das Gegenteil war richtig. Evelyn Webster? So hieß doch die Mutter in der Familie, bei der wir ganz am Anfang unserer USA-Reise untergekommen waren. Da an der Ostküste in Rockland, dieser kleinen Stadt bei Brunswick. Als Austauschschüler hatte Michi hier ein paar Jahre zuvor gewohnt, also vor unserer Reise. Aber hatte die Frau nicht völlig anders ausgesehen, mehr wie eine etwas verlebte Doris-Day-Amerikanerin? Auch das Alter der Bahn-Trulla passte nicht. Und Webster ist schließlich auch kein seltener Name. Sogar ein Wörterbuch heißt so. Trotzdem: Was sollte das? Warum erinnerte mich hier alles an die Amerikareise der Huelsenbecks?
Der Zug hielt in Hannover. Durch das Fenster sah ich, wie der Vollbart ausstieg. Ich bemerkte, dass er leicht hinkte. Eine funkyfreshe Verletzung, die er sich beim Marathon zugezogen hatte? Ich ging an meinen Platz zurück, um auch das Erlebnis mit der Kellnerin zu notieren. Kurz vor Hildesheim kam dann die übliche Durchsage: «Oberleitungsprobleme … Halt auf unbestimmte Zeit». Wahrscheinlich lag es am Regen, der in Hannover noch einmal stärker geworden war.
Eine halbe Stunde lang starrte ich aus dem Fenster auf ein Graffito, das jemand eher unbeholfen auf die Lärmschutzwand gesprüht hatte. Wohl eine Kuh, die von einem großen, schwarzen Vogel angegriffen wurde. Vielleicht sollte es eine Krähe (Corvus corone) oder ein Rabe (Corvus corax) sein. Der Vogel stand im Begriff, der Kuh ein Auge auszuhacken.
Je länger ich das Bild ansah, desto mulmiger wurde mir. Ich schloss die Augen und versuchte, mich auf die Musik zu konzentrieren. Doch irgendetwas zwang mich, die Augen wieder aufzumachen und das Splatterbild zu betrachten. Die Hilflosigkeit der Kuh rührte mich, doch hinter dieser Rührung kroch langsam eine Angst in mir hoch, die ganz unten aus dem Kleinhirn zu kommen schien. Als ich die Augen wieder schloss, setzte sich der Zug in Bewegung. Und als ich sie erneut öffnete, war die Lärmschutzwand verschwunden. Ich sah eine Weide, auf der echte Kühe grasten.
Etwa fünfzehn Minuten später verlangsamte der ICE sein Tempo wieder, um den Bahnhof von Wolfsburg zu passieren. «Der schönste Bahnhof Deutschlands», sagte der Souffleur in meinem Kopf, und ich freute mich an den geschwungenen Bahnsteigdächern, den runden, schwarz gekachelten Wartehallen und der eleganten Typographie der Bahnhofsschilder. Vermutlich mochte ich diesen Bahnhof auch deshalb so sehr, weil er genauso alt war wie ich.
Aber irgendetwas schien heute anders. Ich sah nicht gleich, was es war. Dann wurde mir schlagartig klar: Praktisch jeder erwachsene Mann auf den Bahnsteigen rauchte. Und das war nicht alles. Es gab keine digitalen Anzeigetafeln mehr, keine Behindertentoilettenschilder, keine Warteglaskästen und keine weiße Linie an der Bahnsteigkante. Auch der Kiosk hatte geöffnet. Der Bahnhof sah genauso aus, wie Bahnhöfe in den siebziger Jahren ausgesehen hatten. Offenbar stammten auch die Leute auf dem Bahnsteig aus dieser Zeit. Nicht nur, dass sie überall rauchten. Sie trugen auch diese typischen Siebziger-Jahre-Frisuren. Die Haare der jüngeren Männer waren deutlich länger als heute, keiner stand mit unbedeckten Ohren da. Die meisten jungen Frauen trugen ihre Haare ebenfalls lang und offen, überall nur Hosen mit Schlag. Bloß die Alten sahen noch so aus, wie sie schon in den Fünfzigern und Sechzigern ausgesehen haben mussten.
Ich staunte diese seltsame Szenerie an und scannte mit den Augen den ganzen Bahnhof, um bloß keine Einzelheit zu verpassen. Und so entdeckte ich schließlich ihn, kurz bevor der Zug wieder beschleunigte, am hintersten Ende des Bahnsteigs. Er war eigentlich auch nicht zu übersehen, denn mit seinen hennaroten, fast hüftlangen Haaren und seinem glänzenden Nerzmantel fiel er selbst aus diesem Rahmen. Ich konnte es kaum fassen, aber dieser Mann war … Viktor. Er trug genau dieselben Sachen wie damals als einer der Huelsenbecks und war im selben Alter. Auch er schien mich im Zug entdeckt zu haben und grinste mich fröhlich an. Ich sah, wie sich sein Mund bewegte, und obwohl ich nicht hören konnte, was er sagte oder rief, las ich es ohne große Schwierigkeiten von seinen Lippen ab: «Daniel. It’s fuck-off time.»
Ich existiere nun schon längere Zeit ohne Körper, das heißt auch ohne Hormone und Neurotransmitter, ohne Gefühle. Deshalb fällt es mir schwer, den Schrecken zu beschreiben, den diese Drohung des toten Viktors in mir auslöste: Als würde eine eiserne schwarze Faust sich um meinen Magen legen und ihn zusammenpressen. Mir wurde entsetzlich schlecht.