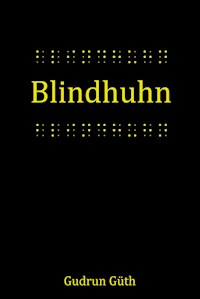
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Gesa liebt ihren blinden Vater. Aber dann bricht plötzlich ein Gefühlschaos aus: Scham, Wut, totale Unsicherheit alles auf einmal da. Und nur wegen dieses einen blöden Satzes ihrer besten Freundin Sophie. Zum Glück gibt es Matthis mit seinem Skateboard, Inka, die kleine Theo aus Nigeria, die auch blind ist, die neue Musikband und natürlich Gesas Familie. Ob alles am Ende wieder ins richtige Lot kommt? Ein Roman für Menschen ab 12.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
o
Blindhuhn
Gudrun Güth
o
Impressum:
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet: papierfresserchen.de
© 2021 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstraße 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchausgabe erschienen 2021.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Lektorat, Cover + Herstellung: Cat creativ - cat-creativ.at
ISBN: 978-3-96074-490-0 - Taschenbuch
978-3-96074-491-7 - E-Book
*
Inhalt
Vorwort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
*
Vorwort
Nein, das ist kein Buch über Blindhühner. Keine Ahnung, ob es die überhaupt gibt. Blindhuhn ist eigentlich eine Suppe. Eine Suppe ohne Huhn.
Aber es geht hier statt um Suppen oder Hühner um meinen Paps, damit das klar ist. Paps ist nämlich blind, total blind. Er hat ein Glasauge, ungelogen. Warum das Buch Blindhuhn heißt, weiß ich selbst nicht so genau. Es heißt eben einfach so. Vielleicht habt ihr eine Erklärung, wenn ihr das Buch gelesen habt.
Ihr kennt bestimmt das Wort Inklusion. Das heißt, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Eigentlich selbstverständlich, oder? Es kommt aber immer wieder zu Situationen, in denen Behinderte und die, die mit ihnen zusammenleben, ausgegrenzt werden oder sich ausgegrenzt und damit anders als die übrigen Menschen fühlen. Manchmal passiert das auch nur im eigenen Kopf, im eigenen Denken und Verhalten. Davon erzähle ich hier.
Auf jeden Fall bin ich sehr froh, einen blinden Vater zu haben.
*
1
„Du bist ja behindert – genau wie dein Vater.“ Sophie drehte sich um und stapfte davon.
Das saß.
Ich stand mit offenem Mund mitten auf dem Weg. Das hatte noch nie jemand zu mir gesagt. Bloß, weil ich an Sophies neuer Frisur herumgenörgelt hatte. Sie sah wirklich bescheuert aus. Pah, Zopfkrone! Die Haare waren aus der Stirn gekämmt und oben mit dieser albernen Glitzerspange festgeklemmt. Und das trotz ihrer hohen Stirn. Dabei habe ich das noch nicht einmal genauso gesagt, wie ich es gedacht hatte.
Klar war mein Vater behindert. Er war schließlich blind und kriegte jeden Monat Blindengeld. Wie viel das war, wusste ich nicht. Mein Bruder und ich lebten gut mit unserem blinden Vater zusammen. Mein Vater erzählte sonntags Geschichten, als wir klein waren. Wir lagen in seinen Armen, einer rechts, einer links. Erzählen konnte mein Vater. Man kann auch erzählen, wenn man blind ist. Vielleicht sogar besser. Wenn man blind ist, sieht man tief in das Innere. In das Innere von Menschen, Tieren und Pflanzen. Wenn mein Vater erzählte, konnten auch die Tiere und Pflanzen sprechen. Manche mit dünnen und hohen Stimmen.
Es fing an zu regnen. Ich stand noch genau an der Stelle, an der Sophie davongestapft war. Blöde Kuh! Sollte sie doch bescheuert aussehen. Was ging es mich an? Aber Sophie war eigentlich meine beste Freundin. Jedenfalls bis jetzt.
Das würde ich ihr nicht verzeihen, dass sie mich behindert genannt hatte. Sie hatte das Wort wirklich als Schimpfwort benutzt – so wie Assi, Arschgesicht, Opfer, Kanake, Nudelkarpfen und was allen sonst noch so einfiel.
Zu Hause ging ich sofort ins Bad und starrte mich im Spiegel an. Mit den tropfnassen Haaren sah ich tatsächlich ein bisschen behindert aus. Vielleicht hatte ich die Behinderung von meinem Vater geerbt und würde mit der Zeit auch blind werden.
Nach dem Abendbrot holte mein Vater wie an den meisten Abenden eine Hörbuch-CD raus. Seit zwei Wochen hörte er Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Oft hörte ich voller Spannung mit. Auch heute setzte ich mich dazu. Heimlich beobachtete ich meinen Vater. Er sah das ja nicht. Er fing an, an den Nägeln zu kauen. Gleich, bei einer besonders traurigen Stelle, würde sich sein Gesicht verziehen. Ich kannte das schon. Und richtig, jetzt kämpfte er mit den Tränen. Bevor ich selbst zu heulen anfing, stand ich auf und ging in mein Zimmer.
Freitags trafen wir uns nachmittags im Gelatinum, meine Crew und ich. Sophie war natürlich immer mit an Bord. Ich wusste nicht, ob ich diesen Freitag wirklich hingehen sollte. Ich war Sophie immer noch böse. In der Schule sprachen wir nur das Nötigste miteinander. So was wie: „Kann ich mal dein Radiergummi haben?“
Als sie eine Antwort auf die Frage unseres Mathelehrers nicht wusste, sagte ich ihr nicht vor. Ausnahmsweise hatte ich die Antwort parat, aber das brauchte Sophie nicht zu wissen. Selbst schuld! Sie wusste es wohl doch.
„Bitch!“, zischte Sophie.
Um Viertel vor vier beschloss ich, doch ins Gelatinum zu gehen. Tom, mein Bruder, spielte Tischtennis in seinem Verein. Zu Hause war es ziemlich langweilig. Die Crew war sicher längst da und ich wollte nicht abgehängt werden. Durch die Scheiben sah ich Sophie. Sie hatte immer noch diese alberne Spange im Haar.
„Hi, guys“, sagte ich betont lässig.
„Na, Hirni, alles klar?“
Lucia lächelte mir zu, dann wandte sie sich an die anderen, um den letzten Klatsch auszutauschen. Wer für wen schwärmte, wer die beste Mascara hatte, ob Smoothies wirklich gesund waren, was man am Wochenende so vorhatte.
Wieso Hirni? Hirni hatte Lucia noch nie zu mir gesagt. Sophie sah mich bedeutungsvoll an. Ich sagte nichts, saß bloß so da und zermarterte mir das Gehirn. Also doch Hirni.
Ich war sicher, dass Sophie den anderen von unserem Streit erzählt hatte. Sonst hätte Lucia, die meine zweitbeste Freundin war, mich niemals Hirni genannt. Ich biss mir auf die Lippen. Noch so eine blöde Kuh. Blöd die ganze verflixte Crew. Die anderen kriegten noch nicht einmal mit, dass ich bloß stumm dabei saß und mein Vanilleeis löffelte.
Nach einer halben Stunde stand ich auf und ging. In mir kochte es. Ich war wütend auf Sophie, auf Lucia, die blöden anderen, aber am meisten war ich wütend auf Paps. Alles nur, weil er blind war. Und ich musste das ausbaden!
Am Sonntag machte meine Familie einen Waldspaziergang. Eigentlich ging ich gern in den Wald. Ich mochte Bäume. Heute hatte ich wenig Lust. Sophie und Lucia lagen mir irgendwie im Magen. „Ich habe Kopfschmerzen“, sagte ich zu meinen Eltern.
„Die werden an der frischen Luft ganz schnell vergehen“, antwortete meine Mutter.
Ich murrte mir etwas in meinen nicht vorhandenen Bart, so was wie: „Bett würde mir guttun, ich brauche Ruhe, es ist zu windig.“ Aber als mein Vater davon sprach, in der Waldlust einzukehren, änderte ich meine Meinung. In der Waldlust gab es Sahnebecher mit frischen Früchten. Genau mein Ding, auch bei Magen- oder Kopfschmerzen. Sahnebecher waren wie Medizin.
Meine Eltern gingen Hand in Hand. In ihrem Alter! Ich fand das peinlich, obwohl ich wusste, dass mein Vater nicht allein gehen konnte. Wie oft hatte ich ihm schon vorgeschlagen, sich einen Blindenhund anzuschaffen. Der würde ihn durch dick und dünn führen und wir brauchten uns nicht mehr darum zu kümmern, dass mein Vater sich außerhalb der Wohnung sicher bewegte. Mein Vater war von meinem Vorschlag wenig begeistert. Genauso lehnte er es ab, eine Armbinde zu tragen, die mit den gelben Punkten, oder sich mit dem weißen Blindenstock den eigenen Weg zu bahnen. Immer musste einer von uns ran, wenn er irgendwohin wollte.
„Zum Glück“, sagte mein Vater, „sind solche Zeiten der äußerlichen Minuszeichen vorbei.“
„Was für Minuszeichen?“, wollte ich wissen.
„Gelbe Judensterne, rosa Dreiecke in der Nazizeit. Menschen wurden einfach aussortiert, zu Zwangsarbeit abkommandiert, gefangen gesetzt, vergast oder unfruchtbar gemacht. Mich hätte es sicherlich auch getroffen, aber jetzt habe ich euch und bin glücklich.“
„Aber einen Hund könnten wir doch ...“, sagte ich.
„Auch keinen Hund“, sagte mein Vater.
Tom und ich schwiegen und schauten bedrückt zu Boden.
Ich hörte meine Eltern lachen. Sie sahen irgendwie verliebt aus. Voll peinlich.
Mein Vater blieb plötzlich stehen. „Hört ihr das?“, fragte er.
Wir hörten nichts.
„Seid mal still.“
Dabei hatten mein Bruder und ich gar nichts gesagt.
„Ein Laubsänger“, sagte mein Vater und machte die Vogelstimme nach. Paps war gut im Nachahmen von allen möglichen Vogelstimmen. Er konnte die Kohlmeise, den Zaunkönig, den Pirol, das Rotkehlchen, Amseln und wer weiß noch was alles. Dafür liebte ich meinen Vater. Wer hatte schon so einen Vater? Ich versuchte die Laubsängerstimme auch.
„Nicht schlecht“, sagte mein Vater und legte mir die Hand auf den Kopf. „Noch Kopfschmerzen, Gesa?“
Meine Kopfschmerzen und das Magendrücken waren verschwunden.
„Frische Luft tut eben gut“, sagte meine Mutter.
Als wir weiter gingen, betrachtete ich meine Eltern von hinten. Sie gingen beschwingt, sahen gar nicht so alt aus, wie sie tatsächlich waren, und hielten sich immer noch an den Händen.
Kurz bevor wir die Waldlust in der Ferne sahen, nahm ich Paps’ Hand. „Darf ich einen Sahnebecher haben?“
„Etwa mit frischen Früchten?“
Mein Vater kannte mich gut.
„Und ich eine Waffel mit heißen Kirschen?“
Das war das Leibgericht meines Bruders.
Der Sonntag war gerettet.
*
2
Mit Sophie und mir ging es weiter abwärts. Was so eine neue Frisur und eine alberne Haarspange alles auslösen konnten.
Ich hatte diesen Knacks im Herzen, wusste nicht, ob ich schuld war oder Sophie. Jedenfalls hatte ich das Vertrauen zu ihr verloren, das zu mir selbst irgendwie auch. Wer mich behindert nannte und damit Paps kritisierte, durfte nicht meine beste Freundin sein. Dabei kannte Sophie meinen Vater gut. Wie oft war sie schon bei uns gewesen, auch zum Abendbrot, wenn mein Vater zu Hause war und mit am Tisch saß.
Lucia könnte jetzt eigentlich auf Platz eins rutschen, aber auch bei ihr war ich mir unsicher. Gut, Hirni genannt zu werden, war nicht wirklich schlimm. Klang fast niedlich.
Ich ging freitags nicht mehr ins Gelatinum. Mir war so, als gehörte ich nicht mehr dazu. Wieso sollte ich mich für dieses ewige Gerede über Jungenschwärme, Mascara und Smoothies interessieren? Ich hatte andere Probleme.
Mein Problem war Paps.
Ich liebte ihn und war sauer auf ihn, beides zur gleichen Zeit. Ging das überhaupt?
Um mich von allem abzulenken, fing ich an, für die Schule zu arbeiten. Ich brauchte lange, für die verschiedenen Fächer meine Hausaufgaben zu erledigen.
„Streber“, sagte mein Bruder Tom, wenn ich keine Lust – oder besser keine Zeit – hatte, mit ihm Mau Mau oder Uno zu spielen.
Ich heimste eine gute Zensur nach der anderen ein. Sophie nicht. Geschah ihr recht.
Als ich mit meiner ersten Eins in Mathe nach Hause kam, trug Paps mich auf seinen Schultern durch die Wohnung. Er eckte nirgendwo an. Ich umklammerte mit meinen Händen seine Stirn. Wir lachten. Mathe war immer mein schlechtestes Fach gewesen.
Am Küchentisch hatten Tom und Paps mir etwas Nachhilfeunterricht gegeben. Sonst hörte ich nie richtig hin, aber seit meinem Streit mit Sophie wollte ich es allen zeigen.
Von wegen behindert oder Hirni!
Ich freundete mich mit Inka an. Inka war neu in unserer Klasse. Mit ihren kurzen Haaren, dem Pixie Cut, gefiel sie mir. Hauptsache keine blöden Spangen.
Ich traf mich mit ihr freitagnachmittags auf dem Spielplatz, während die Crew im Gelatinum saß. Klar waren wir eigentlich zu alt für Spielplätze, aber es machte irgendwie Spaß, sich rasend schnell auf dem Karussell zu drehen. Wir saßen auf der Bank und quatschten über die Schule. Inka mochte meine alte Crew nicht besonders.
„Verwöhnte Blagen“, sagte sie. „Dass die sich jeden Freitag Eisbomben leisten können, ohne etwas dafür zu tun.“
Darüber hatte ich nie nachgedacht. Ich selbst bestellte immer nur eine Kugel. Für mehr reichte mein Taschengeld nicht.
„Mein Magen verträgt solche Eismengen nicht“, sagte ich, wenn Sophie nachfragte.
Jetzt sparte ich also mein Taschengeld. Das Karussell auf dem Spielplatz war umsonst.
„Kannst du Anita eben das Braillebuch vorbeibringen, Schatz? Ich habe versprochen, es ihr auszuleihen“, sagte mein Vater am Abend zu mir.
Braillebücher waren für Blinde, damit sie mit den Händen lesen konnten, so was wie Fühlbücher eben.
Anita wohnte nebenan. Sie war auch blind. In den drei nebeneinanderliegenden Häusern wohnten nur Blinde. Im Hof war eine Blindenwerkstatt. Dort machten die Blinden Besen, Körbe und Flechtstühle. Sie bestickten auch Frotteehandtücher mit Wappen und Namen. Anita und mein Vater arbeiteten nicht dort. „Zum Glück“, dachte ich, verstand aber nicht, warum ich das dachte. Ich wusste nur, dass es nicht richtig war, so zu denken. Gegen das eigene Denken kam man eben nicht an. Man hatte auch schlechte, böse Gedanken.
Anita fuhr jeden Tag in die Sparkasse. Was genau sie da tat, wusste ich nicht. Sie saß irgendwo hinten gut versteckt.
Paps arbeitete im Büro. Er tippte Geschäftsbriefe. Wenn mich einer fragte, was mein Vater von Beruf war, sagte ich Sekretär. Das klang irgendwie vornehm. Vor seiner Erblindung war mein Vater Schriftsetzer gewesen und mächtig stolz auf seinen Beruf.
Mein Bruder und ich haben nie wirklich erfahren, wieso mein Vater plötzlich erblindete. Ich glaube, die ganze Wahrheit wurde geheim gehalten. Warum auch immer. Irgendeine böse Krankheit war mit im Spiel. Nieren oder so. Ich verstand nicht, was Nieren mit Augen zu tun haben sollten, aber ich verstand zurzeit sowieso nicht allzu viel. War mal wieder eine Verstehe-ich-nicht-Zeit!
Ich hatte keine Lust, rüber zu Anita zu gehen, aber ich nahm das Braillebuch und schellte bei ihr. Anita freute sich über meinen Besuch. Ich mochte Anita nicht besonders, hatte aber immer ein schlechtes Gewissen deshalb. Sie konnte nichts dafür, dass ihre Augen so hin und her rollten. Sie sah das selbst ja nicht. Wenn ich ehrlich war, hatte ich ein bisschen Angst vor ihr. Jeder Besuch, jeder Kontakt war eine kleine Mutprobe für mich.
„Setz dich doch“, sagte Anita.
„Nee, ich muss noch den Rest Hausaufgaben machen.“
Das stimmte natürlich nicht. Ich hatte alles bereits erledigt, aber es war eine gute Ausrede, nicht allzu lange in Anitas Wohnung zu bleiben.
„Kann ich mal sehen, wie du aussiehst?“
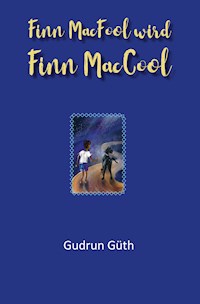















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












