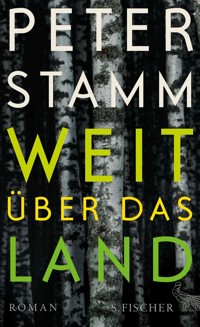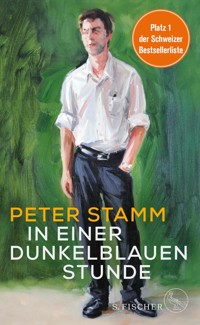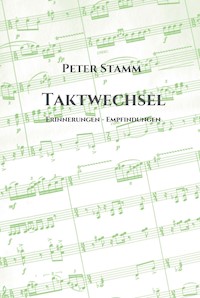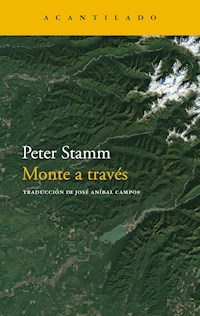7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wir haben viele Jahre gejammert, dass es keine Kurzgeschichten gibt. Jetzt haben wir einen Autor, der das Lebensgefühl der absoluten Vereinsamung, der Sprachlosigkeit ausdrückt.« (Verena Auffermann ) Sie sind jung und unabhängig, einsam oder ein scheinbar perfektes Paar. Sie sind auf der Suche nach etwas und finden doch nichts, ihr Leben gerät für einen Moment in Bewegung oder steht plötzlich still. Einziger Beobachter ist der Ich-Erzähler: kühl und distanziert, abwartend, rauchend. Peter Stamm zeichnet in seinen Erzählungen scharfe Momentaufnahmen eines flüchtigen Glücks und der Sehnsucht nach Veränderung. ›Blitzeis‹ erzählt Liebesgeschichten in bewegten Bildern, Geschichten, die unsere Zeit einfangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Peter Stamm
Blitzeis
Erzählungen
FISCHER E-Books
Inhalt
But I can’t be talkin’ of love, dear,
I can’t be talkin’ of love.
If there be one thing I can’t talk of
That one thing do be love.
Esther Mathews
Am Eisweiher
Ich war mit dem Abendzug aus dem Welschland nach Hause gekommen. Damals arbeitete ich in Neuchâtel, aber zu Hause fühlte ich mich noch immer in meinem Dorf im Thurgau. Ich war zwanzig Jahre alt.
Irgendwo war ein Unglück geschehen, ein Brand ausgebrochen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam mit einer halben Stunde Verspätung nicht der Schnellzug aus Genf, sondern ein kurzer Zug mit alten Wagen. Unterwegs blieb er immer wieder auf offener Strecke stehen, und wir Passagiere begannen bald, miteinander zu sprechen und die Fenster zu öffnen. Es war die Zeit der Sommerferien. Draußen roch es nach Heu, und einmal, als der Zug eine Weile gestanden hatte und das Land um uns ganz still war, hörten wir das Zirpen der Grillen.
Es war fast Mitternacht, als ich mein Dorf erreichte. Die Luft war noch warm, und ich hatte die Jacke nur übergehängt. Meine Eltern waren schon zu Bett gegangen. Das Haus war dunkel, und ich stellte nur schnell meine Sporttasche mit der schmutzigen Wäsche in den Flur. Es war keine Nacht zum Schlafen.
Vor unserem Stammlokal standen meine Freunde und berieten, was sie noch unternehmen sollten. Der Wirt hatte sie nach Hause geschickt, die Polizeistunde war vorüber. Wir redeten eine Weile draußen auf der Straße, bis jemand aus einem Fenster rief, wir sollten endlich ruhig sein und verschwinden. Da sagte Stefanie, die Freundin von Urs: »Warum gehen wir nicht im Eisweiher baden? Das Wasser ist ganz warm.«
Die anderen fuhren schon los, und ich sagte, ich würde nur schnell mein Fahrrad holen und dann nachkommen. Zu Hause packte ich meine Badehose und ein Badetuch ein, dann fuhr ich hinter den anderen her. Der Eisweiher lag in einer Mulde zwischen zwei Dörfern. Auf halbem Weg kam mir Urs entgegen.
»Stefanie hat einen Platten«, rief er mir zu. »Ich hole Flickzeug.«
Kurz darauf sah ich dann Stefanie, die an der Böschung saß. Ich stieg ab.
»Das kann eine Weile dauern, bis Urs zurückkommt«, sagte ich. »Ich gehe mit dir, wenn du magst.«
Wir schoben unsere Fahrräder langsam den Hügel empor, hinter dem der Weiher lag. Ich hatte Stefanie nie besonders gemocht, vielleicht weil es hieß, sie treibe es mit jedem, vielleicht aus Eifersucht, weil Urs sich nie mehr ohne sie zeigte, seit die beiden zusammen waren. Aber jetzt, als ich zum ersten Mal mit ihr allein war, verstanden wir uns ganz gut und redeten über dies und jenes.
Stefanie hatte im Frühjahr die Matura gemacht und arbeitete bis zum Beginn ihres Studiums im Herbst als Kassiererin in einem Warenhaus. Sie erzählte von Ladendieben und wer im Dorf immer nur die Aktionen und wer Kondome kaufe. Wir lachten den ganzen Weg. Als wir beim Weiher ankamen, waren die anderen schon hinausgeschwommen. Wir zogen uns aus, und als ich sah, dass Stefanie keinen Badeanzug dabeihatte, zog auch ich meine Badehose nicht an und tat, als sei das selbstverständlich. Der Mond war nicht zu sehen, aber unzählige Sterne und nur schwach die Hügel und der Weiher.
Stefanie war ins Wasser gesprungen und schwamm in eine andere Richtung als unsere Freunde. Ich folgte ihr. Die Luft war schon kühl gewesen und die Wiese feucht vom Tau, aber das Wasser war warm wie am Tag. Nur manchmal, wenn ich kräftig mit den Beinen schlug, wirbelte kaltes Wasser hoch. Als ich Stefanie eingeholt hatte, schwammen wir eine Weile nebeneinanderher, und sie fragte mich, ob ich in Neuchâtel eine Freundin hätte, und ich sagte nein.
»Komm, wir schwimmen zum Bootshaus«, sagte sie.
Wir kamen zum Bootshaus und schauten zurück. Da sahen wir, dass die anderen wieder am Ufer waren und ein Feuer angezündet hatten. Ob Urs schon bei ihnen war, konnten wir aus der Entfernung nicht erkennen. Stefanie kletterte auf den Steg und stieg von dort auf den Balkon, von dem wir als Kinder oft ins Wasser gesprungen waren. Sie legte sich auf den Rücken und sagte, ich solle zu ihr kommen, ihr sei kalt. Ich legte mich neben sie, aber sie sagte: »Komm näher, das hilft ja so nichts.«
Wir blieben eine Zeitlang auf dem Balkon. Inzwischen war der Mond aufgegangen und schien so hell, dass unsere Körper Schatten warfen auf dem grauen, verwitterten Holz. Aus dem nahen Wald hörten wir Geräusche, von denen wir nicht wussten, was sie bedeuteten, dann, wie jemand auf das Bootshaus zuschwamm, und kurz darauf rief Urs: »Stefanie, seid ihr da?«
Stefanie legte den Finger auf den Mund und zog mich in den Schatten des hohen Geländers. Wir hörten, wie Urs schwer atmend aus dem Wasser stieg und wie er sich am Geländer hochzog. Er musste nun direkt über uns sein. Ich wagte nicht, nach oben zu schauen, mich zu bewegen.
»Was machst du da?« Urs kauerte auf dem Geländer des Balkons und blickte auf uns herab. Er sagte es leise, erstaunt, nicht wütend, und er sagte es zu mir.
»Wir haben gehört, dass du kommst«, sagte ich. »Wir haben geredet, und dann haben wir uns versteckt, um dich zu überraschen.«
Jetzt schaute Urs zur Mitte des Balkons, und auch ich schaute hin und sah dort ganz deutlich, als lägen wir noch da, den Fleck, den Stefanies und mein nasser Körper hinterlassen hatten.
»Warum hast du das gemacht?«, fragte Urs. Wieder fragte er nur mich und schien seine Freundin gar nicht zu bemerken, die noch immer regungslos im Schatten kauerte. Dann stand er auf und machte hoch über uns auf dem Geländer zwei Schritte und sprang mit einer Art Schrei, mit einem Jauchzer, in das dunkle Wasser. Noch vor dem Klatschen des Wassers hörte ich einen dumpfen Schlag, und ich sprang auf und schaute hinunter.
Es war gefährlich, vom Balkon zu springen. Es gab im Wasser Pfähle, die bis an die Oberfläche reichten, als Kinder hatten wir gewusst, wo sie waren. Urs trieb unten im Wasser. Sein Körper leuchtete seltsam weiß im Mondlicht, und Stefanie, die nun neben mir stand, sagte: »Der ist tot.«
Vorsichtig stieg ich vom Balkon hinunter auf den Steg und zog Urs an einem Fuß zu mir. Stefanie war vom Balkon gesprungen und schwamm, so schnell sie konnte, zurück zu unseren Freunden. Ich zog Urs aus dem Wasser und hievte ihn auf den kleinen Steg neben dem Bootshaus. Er hatte am Kopf eine schreckliche Wunde.
Ich glaube, ich saß die meiste Zeit einfach nur da neben ihm. Irgendwann, viel später, kam ein Polizist und gab mir eine Decke, und erst jetzt merkte ich, wie kalt mir war. Die Polizisten nahmen Stefanie und mich mit auf die Wache, und wir erzählten, wie alles gewesen war, nur nicht, was wir auf dem Balkon getan hatten. Die Beamten waren sehr freundlich und brachten uns, als es schon Morgen wurde, sogar nach Hause. Meine Eltern hatten sich Sorgen gemacht.
Stefanie sah ich noch bei der Beerdigung von Urs. Auch meine anderen Freunde waren da, aber wir sprachen nicht miteinander, erst später, in unserem Stammlokal, nur nicht über das, was in jener Nacht geschehen war. Wir tranken Bier, und einer sagte, ich weiß nicht mehr, wer es war, es reue ihn nicht, dass Stefanie nicht mehr komme. Seit sie dabei gewesen sei, habe man nicht mehr vernünftig reden können.
Einige Monate später erfuhr ich, dass Stefanie schwanger war. Von da an blieb ich an den Wochenenden oft in Neuchâtel und fing sogar an, meine Wäsche selber zu waschen.
Treibgut
May God forgive the hands that fed
The false lights over the rocky head!
John Greenleaf Whittier
Ich wusste nicht, ob ich die richtige Nummer gewählt hatte. Auf dem Anrufbeantworter war nur klassische Musik zu hören, dann ein Pfeifton und dann die erwartungsvolle Stille der Aufnahme. Ich rief noch einmal an. Wieder kam nur die Musik, und ich hinterließ eine Nachricht. Eine halbe Stunde später rief Lotta zurück. Als wir uns besser kannten, erzählte sie mir von Joseph. Er sei der Grund, weshalb sie den Beantworter nicht bespreche. Er dürfe nicht wissen, dass sie zurück sei in der Stadt.
Lotta war Finnin und wohnte im West Village auf Manhattan. Ich brauchte für einige Zeit eine Wohnung. Eine Agentur hatte mir Lottas Nummer gegeben.
»Ich muss die Wohnung manchmal vermieten«, sagte Lotta, »wenn ich keine Arbeit habe.«
»Und wo wohnst du in der Zwischenzeit?«, fragte ich.
»Meistens bei Freunden«, sagte sie, »aber diesmal habe ich noch niemanden gefunden. Weißt du einen Platz für mich?«
Die Wohnung war groß genug, und so bot ich ihr an zu bleiben. Sie willigte sofort ein.
»Du darfst das Telefon nie direkt abnehmen«, sagte sie. »Warte immer, bis du weißt, wer dran ist. Wenn du mich anrufen willst, ruf mich. Dann stelle ich den Beantworter ab.«
»Warst du da, als ich zum ersten Mal anrief?«, fragte ich.
»Ja«, sagte sie.
Lotta wohnte im vierten Stock eines alten Hauses in der 11th Street. Alles war schwarz in der Wohnung, die Möbel, das Bettzeug, die Teppiche. Einige vertrocknete Kakteen standen auf dem kleinen eisernen Balkon, der auf einen Hinterhof hinausging. Auf der Kommode neben Lottas Bett und auf dem Glastisch mit dem Anrufbeantworter lagen verstaubte Muscheln und Korallenästchen. In den wenigen Lampen steckten rote und grüne Glühbirnen, die die Räume abends in ein seltsames Licht tauchten, als stünden sie unter Wasser.
Als ich die Wohnung besichtigt hatte, war Lotta im Pyjama an die Tür gekommen, obwohl es schon Mittag war. Nachdem sie mir alles gezeigt hatte, ging sie sofort zurück ins Bett. Ich hatte sie gefragt, ob sie krank sei, aber sie hatte den Kopf geschüttelt und gesagt, sie schlafe einfach gern.
Als wir dann zusammen wohnten, stand sie nie vor Mittag auf und ging meistens vor mir wieder zu Bett. Sie las viel und trank Kaffee, aber ich sah sie kaum je essen. Sie schien von Kaffee und Schokolade zu leben. »Du musst gesünder essen«, sagte ich, »dann bist du nicht immer so müde.«
»Aber ich schlafe gern«, sagte sie und lachte.
Mit uns lebte eine ganz junge schwarze Katze. Lotta hatte sie geschenkt bekommen und Romeo getauft. Später hatte sie erfahren, dass Romeo ein Weibchen war, aber der Name war geblieben.
Es war Oktober. Ich traf alte Freunde, Werner und Graham, die bei einer Bank arbeiteten. Ich schlug ihnen vor, für ein langes Wochenende ans Meer zu fahren. Graham sagte, wir könnten sein Auto nehmen, und ich lud Lotta ein, mit uns zu kommen. An einem Freitagmorgen fuhren wir los. Wir wollten nach Block Island, einer kleinen Insel, hundert Meilen östlich von New York.
Noch in Queens machten wir zum ersten Mal halt. Unsere Abfahrt hatte sich verzögert, und wir waren hungrig. An einem kleinen Imbissstand direkt an der Hauptstraße aßen wir Hotdogs. Lotta trank nur Kaffee. An einer Kreuzung, nicht weit von uns entfernt, stand ein Schwarzer. Er hatte eine Pappschachtel mit vakuumverpacktem Fleisch neben sich. Wenn die Ampel rot wurde, ging er von Auto zu Auto und versuchte, das Fleisch zu verkaufen. Als er uns sah, kam er mit einem der Pakete in der Hand auf uns zugerannt. Wir unterhielten uns eine Weile mit ihm. Sein Französisch war besser als sein Englisch, und wir fragten ihn, wie es ihn ausgerechnet nach Queens verschlagen habe. Er ging auf all unsere Scherze ein, hoffte wohl bis zuletzt, dass wir ihm etwas abkaufen würden. Als wir schon losfuhren, lächelte er noch, hob sein Fleisch in die Höhe und rief uns etwas nach, das wir nicht mehr verstanden.
Wir waren mit der letzten Fähre an diesem Tag auf die Insel gekommen. Das Auto hatten wir auf einem fast leeren Parkplatz auf dem Festland zurückgelassen. Die Überfahrt dauerte zwei Stunden, und obwohl es kalt war, blieb Werner die ganze Zeit über draußen an der Reling stehen. Wir anderen saßen in der Cafeteria. Das Schiff war fast leer.
Direkt am Hafen der Insel stand ein großes, heruntergekommenes Jugendstilhotel. Nicht weit davon entfernt fanden wir eine einfache Pension in einem leuchtend weiß gestrichenen Holzhaus. Es war selbstverständlich, dass Lotta mit mir das Zimmer teilte.
Vom Meer her wehte ein heftiger Wind. Trotzdem beschlossen wir, noch vor dem Abendessen einen Spaziergang zu machen. Am Strand entlang führte eine Promenade aus grauverwittertem Holz. Außerhalb des Dorfes hörte sie plötzlich auf, und wir mussten durch den Sand weitergehen.
Werner und ich gingen nebeneinander. Er war sehr schweigsam. Graham und Lotta hatten die Schuhe ausgezogen und suchten näher am Wasser nach Muscheln. Sie blieben bald zurück. Nur manchmal hörten wir noch einen Schrei oder Lottas hohes Lachen durch das Lärmen der Brandung.
Als wir eine Weile gegangen waren, setzten Werner und ich uns in den Sand, um auf die beiden zu warten. Im Gegenlicht sahen wir ihre Silhouetten schwarz vor dem glitzernden Wasser.
»Was machen die so lange da unten?«, fragte ich.
»Muscheln suchen«, sagte Werner ruhig. »Wir sind weit gegangen.«
Ich kletterte auf eine Düne, um zurückzuschauen. Sand kam in meine Schuhe, und ich zog sie aus. Das Dorf war weit entfernt. In einigen Häusern brannte schon Licht. Als ich zurückkam, war Werner zum Ufer hinuntergegangen. Lotta und Graham saßen im Windschatten der Düne. Sie hatten ihre Schuhe wieder angezogen. Ich setzte mich neben sie, und wir schauten schweigend zum Meer, wo Werner Muscheln oder Steine ins Wasser warf. Der Wind trieb den Sand in Wirbeln über den Strand.
»Ich friere«, sagte Lotta.
Auf dem Rückweg ging ich neben Lotta und half ihr, die gesammelten Muscheln zu tragen. Meine Schuhe hatte ich an den Schnürsenkeln zusammengeknotet und über die Schultern gehängt. Der Sand war kalt geworden. Graham lief voraus, Werner folgte uns in einiger Entfernung.
»Graham ist nett«, sagte Lotta.
»Sie arbeiten bei einer Bank«, sagte ich, »er und Werner. Aber sie sind o.k.«
»Wie alt ist er?«
»Wir sind alle gleich alt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen.«
Lotta erzählte von Finnland. Sie war auf einem Bauernhof aufgewachsen, nördlich von Helsinki. Ihr Vater hatte Stiere gezüchtet. Lotta war schon früh von zu Hause weggegangen, erst nach Berlin, dann nach London, nach Florenz. Schließlich, vor vier oder fünf Jahren, war sie nach New York gekommen.
»Letzte Weihnachten habe ich meine Eltern besucht. Zum ersten Mal seit Jahren. Meinem Vater geht es nicht gut. Ich wollte erst dableiben, aber im Mai bin ich dann doch zurückgekommen.« Sie zögerte. »Eigentlich bin ich nur wegen Joseph gegangen.«
»Was war denn mit Joseph? Wart ihr ein Paar?«
Lotta zuckte mit den Achseln. »Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich dir ein andermal.«
Kurz vor dem Dorf schauten wir uns nach Werner um. Er war weit zurückgeblieben und ging langsam, nahe am Wasser entlang. Als er sah, dass wir auf ihn warteten, winkte er und kam schneller auf uns zu.
Wir aßen in einem kleinen Fischrestaurant. Lotta sagte, sie sei Vegetarierin, aber Graham meinte, Fisch dürfe sie trotzdem essen. Wir luden sie ein, und sie aß von allem, aber trank keinen Wein.
Wenn Lotta eine Weile geschwiegen hatte, fielen Graham und ich manchmal in unsere Muttersprache. Werner sagte nichts, und Lotta schien es nicht zu stören. Sie aß langsam und konzentriert, als müsse sie sich jede Bewegung in Erinnerung rufen. Sie merkte, dass ich sie beobachtete, lächelte mir zu und aß erst weiter, als ich meinen Blick abgewandt hatte.
Nachts trug Lotta einen rosaroten Pyjama mit einem aufgestickten Teddybären. Ihr blondes Haar war kurz geschnitten. Sie musste über dreißig sein, aber sie wirkte wie ein Kind. Sie lag auf dem Rücken und hatte die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen. Ich hielt den Kopf aufgestützt und schaute sie an.