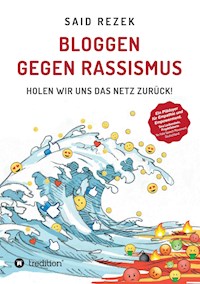
9,99 €
Mehr erfahren.
Viele Rassist:innen bloggen handwerklich perfekt, aber inhaltlich perfide. Die AfD und andere Hater:innen verbreiten Hetze in sozialen Netzwerken und vergiften das gesellschaftliche Klima. Aus Angst vor Hassrede beteiligt sich beinah die Hälfte der Internetnutzer:innen seltener an politischen Diskussionen im Netz. Wir dürfen den Rassist:innen nicht das Internet überlassen! Dies gefährdet die Meinungsvielfalt und die Demokratie insgesamt. Der Journalist und Blogger Said Rezek positioniert sich seit Jahren gegen Rassismus und Hass im Netz. Er ist überzeugt: "Jede:r kann der Hetze als Blogger:in Paroli bieten und positive Akzente für eine vielfältige, friedliche und demokratische Gesellschaft setzen." In seinem Buch beleuchtet Said Rezek die rechte Szene im Netz und zeigt den Leser:innen mit praktischen Beispielen, Übungen und Lösungen, wie sie -virale Blog-Beiträge gegen Rassismus und für eine vielfältige Gesellschaft produzieren, -ihre Reichweite in sozialen Netzwerken erhöhen, -spezielle Beitragsformen für soziale Netzwerke erstellen, zum Beispiel offene Briefe, Listicles, Tweets und Memes, -das Handwerk des Bloggens professionell einsetzen, zum Beispiel die Themen- oder die Bildersuche und nicht zuletzt die Recherche, -sich vor den Risiken des Bloggens schützen, darunter Hassrede, Filterblasen, Fake News und Verletzung der Privatsphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Said Rezek
BLOGGEN GEGEN RASSISMUS
SAID REZEK
BLOGGENGEGEN RASSISMUS
HOLEN WIR UNS DAS NETZ ZURÜCK!
Für meine Kinder,die hoffentlich ihr Leben langvon Rassismus verschont bleiben.
Falls sie der Rassismus doch trifft,können sie sich hoffentlich dagegen wehren.
Und wenn sie sich nicht wehren können,dann gibt es hoffentlich Menschen,die ihnen helfen.
© 2020 Said Rezek
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des
Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für dieelektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detailliertebibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
Umschlaggestaltung, Illustration: Christian Schulz
Lektorat: Franziska Bluhm und Monika Knaden
Schlusskorrektur: Susanne Schwartz, Text und Gestalt Berlin
Satz: Im Bambushain, Krefeld
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,22359 Hamburg
ISBN: 978-3-7497-7846-1
ISBN: 978-3-347-14338-8 (e-book)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Sina Laubenstein
Einleitung
1. Kapitel
Rassistischer Hass im Netz und auf der Straße
1.1 Was ist Hate Speech?
1.2 Hate Speech trifft vor allem die Benachteiligten
1.3 Hate Speech gefährdet die Gesundheit und die Demokratie
1.4 Rassistische Wortgewalt und Tatgewalt
1.5 Die Infokrieger: innen – Rechte Gegenöffentlichkeit im Netz
1.6 Die rechtsradikale AfD – Deutschlands aktivste Partei auf Facebook
2. Kapitel
Digitale Zivilcourage gegen Rassismus
2.1 Wer oder was sind Blogger: innen und Blogs?
2.2 Posten ist ein Privileg
2.3 Empathie als Mittel gegen Hetze
2.4 Werde Teil einer positiven Blogger: innen-Bewegung
3. Kapitel
Von Medienkonsument: innen zu Blogger: innen
3.1 Posten! Aber worüber?
3.2 Mit den Nachrichtenwerten zur Themenauswahl
3.3 Wie und wo findest du interessante Themen?
3.4 Die W-Fragen beantworten
3.5 Am Anfang war die Recherche
3.6 So lesen die User: innen in sozialen Netzwerken
3.7 Der Aufbau von Social-Media-Posts
3.8 Schreibe so einfach wie möglich
3.9 Social-Media-Posts sind keine Romane
3.10 Augen auf bei der Bildersuche
3.11 Fettnäpfchen Bilder: Urheberrechte beachten!
3.12 Sei kein Spammer!
3.13 Vom Gelegenheitsfenster in sozialen Netzwerken
3.14 Poste zur richtigen Zeit – So ticken die Uhren in sozialen Netzwerken
3.15 Vorsicht vor Fake News!
3.16 Stehe zu deinen Fehlern und Überzeugungen!
3.17 Der Pressekodex als ethische Orientierung für Blogger: innen
3.18 Objektiv bloggen – geht das?
4. Kapitel
Spezielle Beitragsformen für soziale Netzwerke
4.1 W-Fragen und Kommentar
4.1.1 Übung
4.1.2 Deine Lösung
4.1.3 Lösungsvorschlag
4.2 Offener Brief
4.2.1 Übung
4.2.2 Deine Lösung
4.2.3 Lösungsvorschlag
4.3 Listicle
4.3.1 Übung
4.3.2 Deine Lösung
4.3.3 Lösungsvorschlag
4.4 Frage stellen und selbst beantworten
4.4.1 Übung
4.4.2 Deine Lösung
4.4.3 Lösungsvorschlag
4.5 Vorurteil aufgreifen und selbst widerlegen
4.5.1 Übung
4.5.2 Deine Lösung
4.5.3 Lösungsvorschlag
4.6 Tweet
4.6.1 Übung
4.6.2 Deine Lösung
4.6.3 Lösungsvorschlag
4.7 Meme, Zitat- und Texttafel
4.7.1 Übung
4.7.2 Deine Lösung
4.7.3 Lösungsvorschlag
4.8 Jahrestag
4.8.1 Übung
4.8.2 Deine Lösung
4.8.3 Lösungsvorschlag
4.9 Persönlich-politisches Posting
4.9.1 Übung
4.9.2 Deine Lösung
4.9.3 Lösungsvorschlag
5. Kapitel
Risiken des Bloggens
5.1 Ziehe eine private Grenze
5.2 Vorsicht vor der Filterblase!
5.3 Das Internet vergisst nie
5.4 Bloggen als Chance und Hürde auf dem Arbeitsmarkt
5.5 Analoges Streitgespräch aufgrund eines Facebook-Posts
5.6 Fragen über Fragen: Du lieferst die Antworten!
5.7 Umgang mit Hasskommentaren
5.7.1 Strafrechtlich relevante Hasskommentare – unbedingt anzeigen!
5.7.2 Unzivile Kommentare – ignorieren, melden, löschen oder blocken?
5.7.3 Gegenrede-Strategien bei grenzwertigen Kommentaren – von sachlich bis sarkastisch
5.7.4 Wie ich in einen rechten Shitstorm geraten bin und wie mir Hunderte User: innen zu Hilfe eilten
5.7.5 (Hass-)Kommentare kosten Zeit
5.8 Fünf Tipps für deine emotionale Sicherheit im Netz
5.9 Sieben Tipps für deine körperliche Unversehrtheit
5.10 Die goldene Blogger: innen-Regel
Mein Appell: Holen wir uns das Netz zurück!
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Glossar
Danksagung
Vorwort von Sina Laubenstein
»Weil wir, die wir gemeint sind von diesem Hass oder ihn bezeugen, allzu oft entsetzt verstummen, weil wir uns einschüchtern lassen, weil wir nicht wissen, wie wir diesem Gebrüll und dem Terror begegnen sollen, weil wir uns wehrlos fühlen und gelähmt, weil es uns die Sprache verschlagen hat vor Grauen.«
Carolin Emcke, Gegen den Hass1
Hass und Hetze, Menschenfeindlichkeit und Rassismus hat es bereits vor den sozialen Netzwerken gegeben. Doch durch die Digitalisierung und die grenzenlosen Möglichkeiten der Partizipation und Kommunikation, die das Internet bereithält, haben Hass und Rassismus neue Dimensionen angenommen. Das Ziel der Hater: innen: Menschen und Menschengruppen aus der öffentlichen Debatte und der Gesellschaft auszuschließen. Entgegen naiven Annahmen, die seit Anbeginn des Internets bestehen, bleibt das, was im Netz geschieht, nicht nur im Netz. Es findet seine Wege in unseren analogen Alltag, so auch der Hass.
Als Menschen, die sich in der digitalen Welt bewegen, an ihr teilhaben und sie mitgestalten wollen, müssen wir uns dieser Schattenseiten des Internets bewusst sein. Andererseits ermöglichen die sozialen Medien und das Internet aber auch Solidaritätsbekundungen in ungeahnter Größenordnung und Wirksamkeit, über Landesgrenzen und Zeitzonen hinweg, erlauben Aktivismus sowie Kreativität. Es ist wichtig, hier und heute, im Netz und auf der Straße, nicht zu schweigen, nicht Augen und Ohren vor Menschenfeindlichkeit und Rassismus zu verschließen. Schweigen und Wegschauen sind keine Optionen. Wir, die wir uns für ein Miteinander, Menschenrechte und (Meinungs-)Vielfalt einsetzen, müssen laut und solidarisch sein, mit all denjenigen, die angegriffen werden und zu unseren Grundwerten stehen. Es braucht Gegenrede (→ Glossar) und Zivilcourage, online wie offline, digital wie analog. Und dies alles kann man lernen.
Dieses Buch von Said Rezek zeigt uns nicht nur den Hass und die Hetze in sozialen Netzwerken, sondern plädiert für Empathie und Empowerment. Wir müssen und dürfen uns nicht mehr aus dem Internet zurückziehen. Holen wir uns das Netz zurück, appelliert Said Rezek in seinem Buch – dieser Forderung sollten so viele User: innen wie möglich folgen. Holen wir uns das Netz zurück: laut und freundlich!
Sina Laubenstein ist Politikwissenschaftlerin (M. A.) und arbeitet bei den Neuen deutschen Medienmacher: innen als Projektleiterin des No Hate Speech Movement Deutschland. Seit 2016 setzt sie sich intensiv mit Online-Hassrede und den dahinterstehenden Strukturen auseinander und sucht – was viel wichtiger ist – nach Mitteln und Wegen zur Unterstützung von Betroffenen.
Einleitung
»Sie haben Ihre Stimme im Netz und auch in den Sozialen Medien. Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden, oder ob Sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen.«
Aus der Weihnachtsansprache des BundespräsidentenFrank-Walter Steinmeier am 25. Dezember 20192
Meine Tochter ist nur einen Tag nach ihrer Geburt als »gottloses Kind«, »Islamschmarotzerin« und »Kind Satans« beleidigt worden. Dies geschah im Kommentarbereich meines Facebook-Posts vom 11. Juli 2016.3 An diesem Tag habe ich meine Freund: innen und Follower: innen* darüber informiert, dass unser Kind zur Welt gekommen ist. Es gab viele herzliche Glückwünsche – und einen menschenverachtenden Kommentar.
Abb. 1: Hasskommentar auf Facebook gegen unsere neugeborene Tochter.
Meine islamische Religionszugehörigkeit war offensichtlich der entschei- dende Grund, warum unsere Tochter auf das Übelste beleidigt wurde. Den Hater kenne ich nicht, aber er musste erfahren haben, dass ich Muslim bin. Wahrscheinlich wusste er es, weil ich in sozialen Netzwerken und etablierten Medien regelmäßig Texte mit Islam-Bezug veröffentliche und mich deutlich gegen Rassismus (→ Glossar) positioniere. Dadurch bin ich immer wieder von Hate Speech** im Netz betroffen, wodurch ich gelernt habe, damit umzugehen. Aber der Hasskommentar gegen meine Tochter hat mich schockiert, weil sich die Hetze sogar gegen ein Neugeborenes richtete. Und ich bin bei Weitem nicht der Einzige, der Erfahrungen mit Hate Speech machen muss.
Etwa 6,9 Millionen Menschen in Deutschland waren schon einmal persönlich von Hasskommentaren im Netz betroffen (Stand: 2019).4 Als Leser: in dieses Buches bist du* vielleicht eine: r davon. Die meisten geraten aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Körpers in das Visier der Hater: innen. Hass im Netz kann aber auch jene treffen, die sich gegen Rassismus und für Benachteiligte einsetzen, aber selbst keiner diskriminierten Gruppe angehören, denn Hate Speech geht vor allem von den Rechten aus.5
Vielleicht hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, sozialen Netzwerken den Rücken zu kehren, weil dich die verrohte Sprache im Internet belastet. Zugegeben, mir gingen solche Gedanken auch schon durch den Kopf, aber wir dürfen den Hater: innen nicht das Netz überlassen! Jede: r kann der Hetze durch das Bloggen in sozialen Netzwerken Paroli bieten und positive Akzente setzen. Als Journalist und Blogger zeige ich dir in diesem Buch, wie du vor allem starke Social-Media-Posts gegen Rassismus und für eine vielfältige Gesellschaft veröffentlichen kannst. Die Inhalte in diesem Buch sind vor allem für diejenigen gedacht, die Texte in Kombination mit Bildern über soziale Netzwerke teilen möchten. Vieles gilt aber auch ganz allgemein für die Veröffentlichung von Beiträgen in unterschiedlichen Formaten und Kanälen.
Durch das Bloggen habe ich es geschafft, dass meine Beiträge teilweise tausendfach geteilt wurden, sodass ich Hunderttausende Menschen erreicht habe. Ein Beispiel hierfür ist mein offener Brief an Alexander Gauland. Als der AfD-Fraktionsvorsitzende in einer Rede die Verbrechen der Nationalsozialist: innen relativierte, reagierte ich mit einem öffentlichen Facebook-Post und verurteilte Gaulands Gedankengut. Daraufhin bin ich in einen rechten Shitstorm (→ Glossar) von über einhundert Hater: innen geraten, aber es dauertenicht lange, bis mir mindestens doppelt so viele User: innen zu Hilfe eilten. Auf die Vorgeschichte und die Konsequenzen werde ich in Kapitel 4 und 5 näher eingehen.
Das Buch ist wie folgt aufgebaut: Zunächst liegt der Fokus auf Hate Speech und darauf, welche Gefahren durch Hass und Hetze im Netz entstehen. An- schließend beleuchte ich die Strategien der rechten Gegenöffentlichkeit im Netz und analysiere insbesondere die Online-Aktivitäten der rechtsradikalen AfD (→ Glossar) als zentralem Akteur in der Szene. Im nächsten Schritt führe ich dich in die Welt des Bloggens ein und demonstriere an Beispielen, was Bloggen gegen Rassismus bewirken kann. Es folgt ein praktischer Teil, in dem ich dir zeige, wie du als Blogger: in aktiv werden kannst. Dazu erlernst du unter anderem auch die nötigen Fähigkeiten, wie die Themen- und Bildersuche, die Recherche und nicht zuletzt den socialmediagerechten Aufbau von Texten.
Im nächsten Schritt stelle ich spezielle Beitragsformen für soziale Netzwerke wie Memes, Tweets und Listicles vor. In realitätsnahen und praxisorientierten Übungen erhältst du die Gelegenheit, eigene Social-Media-Posts zu schreiben und diese mit meinen Lösungsvorschlägen zu vergleichen.
Abschließend gehe ich auf die Risiken des Bloggens ein. Zu diesen zählen Filterblasen, Fake News, emotionale und körperliche Gefahren, die aus Hasskommentaren resultieren können, die Verletzung der Privatsphäre, rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Copyright und nicht zuletzt der Zeitaufwand als Blogger: in. Im Glossar findest du ausführliche Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen, die dir im Buch begegnen werden.
Nach der Lektüre und mit etwas Übung bist bald auch du in der Lage, qualitativ hochwertige Blog-Beiträge in sozialen Netzwerken zu schreiben, die viral gehen können, also im Internet eine weite Verbreitung finden. Bloggen ist kein Hexenwerk, sondern ein Handwerk. Jede: r kann es lernen. Dafür werde ich hier meine wichtigsten Erkenntnisse weitergeben und Beispiele präsentieren. Dabei setze ich kein Vorwissen voraus, damit jede: r – unabhängig von den eigenen Erfahrungen – die Möglichkeit hat, sich einzuarbeiten.
Es geht in diesem Buch jedoch nicht nur darum, dir das Handwerk des Bloggens zu vermitteln, denn eine professionelle Technik kann auch für negative Zwecke missbraucht werden. Das beste Beispiel hierfür bieten die Rassist: innen in sozialen Netzwerken, allen voran die der AfD. Viele von ihnen bloggen handwerklich perfekt, aber inhaltlich perfide. Sie verbreiten Hetze in sozialen Netzwerken und vergiften das gesellschaftliche Klima. In diesem Buch geht es darum, dir das Handwerk des Bloggens zu vermitteln und zusätzlich Wege zu zeigen, wie du der Hetze im Netz etwas Positives entgegensetzen kannst. Lasst uns soziale Netzwerke für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen.
Holen wir uns das Netz zurück!
November 2020
Essen
Said
* Die Begriffe Follower: innen und Abonnent: innen werden in diesem Buch synonym verwendet.
** Die Begriffe Hate Speech, Hasskommentare und Hassrede werden in diesem Buch synonym verwendet. Auf unterschiedliche Definitionen von Hate Speech gehe ich im ersten Kapitel ein.
* Ich duze dich als Leser: in dieses Buches, weil die Anrede mit Vornamen in sozialen Netzwerken weit verbreitet ist.
1. Kapitel
Rassistischer Hass im Netz und auf der Straße
Rassismus ist real und Rassismus tötet. Rassismus kann sogar bis hin zum Völkermord führen. Die Genozide mit über 6 Millionen ermordeten Juden6 und 200.000 bis 500.000 ermordeten Sinti und Roma7 während der NS-Diktatur belegen dies auf eine brutale Weise.
Seit dem Ende der Schreckensherrschaft der Nationalsozialist: innen ge- hört Rassismus und speziell Antisemitismus in Deutschland jedoch nicht der Vergangenheit an. Dafür gibt es in der jüngsten Geschichte diverse Beispiele, darunter der Terroranschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) am 9. Oktober2019. Am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, versuchte dort ein schwer bewaffneter Rechtsterrorist* ein Blutbad anzurichten und laut eigener Aussage möglichst viele Juden zu töten. Doch die massive Eingangstür des jüdischen Gotteshauses, in dem sich zu der Zeit 52 Gläubige befanden, hielt den Schüssen und Sprengsätzen des Attentäters stand.8 Allein dadurch ist ein Massaker verhindert worden.
Nach seinem gescheiterten Versuch, in die Synagoge zu gelangen, habe sich der Rechtsterrorist entschlossen, »Menschen mit Migrationshintergrund zu töten«, so die Anklage. Dabei erschoss er eine zufällig vorbeilaufende Frau und tötete gezielt einen Gast in einem Döner-Imbiss, den er für einen Muslim hielt, wie der Attentäter vor Gericht aussagte. Auf seiner Flucht vor der Polizei verletzte er zwei weitere Menschen durch Schüsse schwer. Seine gesamte Tat hatte er gefilmt und die Aufnahmen per Livestream im Internet verbreitet, um eine »möglichst breite Wahrnehmung zu erreichen und Nachahmer zu animieren«, so der Attentäter weiter.9
Die Bundesanwaltschaft klagte den 28-Jährigen am Oberlandesgericht Naumburg im April 2020 wegen zweifachen Mordes und Mordversuchs in insgesamt 68 Fällen an. Ihm wird vorgeworfen, die Mordanschläge »aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus« ausgeführt zu haben.10 Bei einer Verurteilung droht dem Terroristen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem kommt eine anschließende Sicherungsverwahrung in Betracht. Das Urteil steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus (Stand: Oktober 2020).11
Der nicht vorbestrafte Attentäter war nach einem abgebrochenen Chemiestudium arbeitslos und verbrachte viel Zeit im Internet, wo er sich von den Sicherheitsbehörden unbemerkt radikalisierte. In der virtuellen Welt traf er auf Gleichgesinnte, mit denen er sich ein menschenfeindliches Weltbild aufbaute. Dazu gehörten Gewaltfantasien, Frauenhass, Rassismus, Judenhass, Holocaust-Leugnung und Hitlerverehrung.12
Ein weiterer rassistisch motivierter Terroranschlag ereignete sich am 19. Februar 2020 in Hanau. Ein Rechtsterrorist hat bei Anschlägen auf eine Shisha-Bar und den Kiosk eines türkischstämmigen Geschäftsführers neun Menschen durch Schüsse getötet, er verletzte sechs weitere und einen davon schwer – alle Opfer hatten einen sogenannten Migrationshintergrund (→ Glossar). Anschließend hat der Täter seine Mutter erschossen, bevor er sich selbst das Leben nahm.
In einem 24-seitigen Manifest und einem Video – beides veröffentlichte der 43-jährige Attentäter vor dem Anschlag im Netz – verbreitete er Verschwörungserzählungen (→ Glossar). Er spricht vom »Wirken Satans«,»Kinder-Folterstätten« und einer »Elite«, die das Volk durch Täuschung beherrsche. Gleichzeitig vertritt er ein eindeutig faschistisches Weltbild. So schreibt er über »destruktive Völker« mit »mehreren Milliarden« Menschen, die vernichtet werden müssten. Zwei Dutzend Nationen zählt er in erster Linie dazu, vor allem solche mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Und er merkt an, »dass nicht jeder, der heute einen deutschen Pass besitzt, reinrassig und wertvoll ist«. Auch hier soll eliminiert werden, was die Nazis »unwertes Leben« nannten.13
Trotz dieser eindeutig rechtsextremen Äußerungen leugnete der AfD- Parteivorsitzende Jörg Meuthen einen Tag nach dem Terroranschlag in Hanau ein rassistisches Motiv, indem er von der »wahnhafte(n) Tat eines Irren«14 sprach. Kein Wunder, dass er und andere AfD-Politiker: innen so argumentierten, denn durch ihre rassistische Hetze legen sie den geistigen Nährboden für solche Anschläge. Sie versuchen ihre Hände in Unschuld zu waschen und möchten gleichzeitig die rechtsextreme Gewalt in Deutschland relativieren.Generalbundesanwalt Peter Frank machte unmissverständlich deutlich, dass der Täter in Hanau aus einer »zutiefst rassistischen Gesinnung« gehandelt habe. Zu dieser Einschätzung gelangte auch der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer. Das Bundeskriminalamt arbeitet noch an einem Abschlussbericht, in der die Motivation des Attentäters final geklärt werden soll (Stand: Oktober 2020).15
Von dem Terroranschlag ahnten die Sicherheitsbehörden laut eigenen Angaben nichts, da sie den Attentäter nicht auf dem Radar hatten.16 Nach Informationen der Frankfurter Rundschau fiel der Rechtsextremist jedoch bereits vor den Morden in Hanau mit rassistischen und bewaffneten Drohungen auf, denen die Ermittler: innen nicht nachgegangen seien. So lag dem Generalbundesanwalt im November 2019 beispielsweise eine Anzeige des Attentäters vor. Darin gab er unter anderem an, durch eine Geheimorganisation ausspioniert zu werden, und es ist von der »finalen« Anzeige die Rede, Ausländerkriminalität, einer Bedrohung Deutschlands, Kriegen und einem inneren Feind. Die Generalbundesanwaltschaft weist die Kritik zurück, denn dies »rechtfertigte nicht die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens«. Es hätten sich »keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen oder eine Gefährlichkeit« ergeben, weshalb es nicht zulässig gewesen sei, andere Behörden zu informieren.17
Nach den rassistischen Terroranschlägen in Hanau prägten vor allem Erschütterung und Mitleid die öffentliche Debatte, aber nicht nur. In sozialen Netzwerken befürworteten diverse User: innen die Morde. Jemand hat beispielsweise geschrieben: »Endlich eine gute Nachricht.«18 Ein anderer kommentierte: »Selbst schuld, kein Mitleid, so wird es Merkel und die (sic!) anderen auch ergehen, und das ist gut so, wer sein Volk töten will, was (sic!) sie füttert hat nichts anderes verdient.«19 Insgesamt hat die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität nach den Anschlägen von Hanau 84 Verfahren wegen solcher Hasskommentare angestrengt20, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte.
Seit Januar 2017 erfasst das Bundeskriminalamt strafrechtlich relevante Hasspostings in einer eigenen Kategorie. Der Anteil politisch rechts motivierter Hasspostings liegt zwischen 2017 und 2019 konstant bei über 70 Prozent. Damit treten rechts motivierte Hasspostings deutlich häufiger auf als politisch linke oder solche, die durch eine ausländische oder religiöse Ideologie heraus begangen werden.
Tab. 1: Politisch motivierte Hasspostings von 201721, 201822 und 201923
In absoluten Zahlen sind die polizeilich registrierten Hasspostings von insgesamt 2.270 im Jahr 2017 auf 1.524 im Jahr 2019 gesunken. Das Bundeskriminalamt führt den Rückgang auf das gemeinsame Vorgehen von Polizei, Justiz und auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)24 zurück, das am 1. Oktober 2017 in Kraft trat.25 Doch die absteigende Tendenz der polizeilich registrierten Hasspostings ist kein Grund zur Entwarnung. Die Statistik beleuchtet nur die Spitze des Eisbergs. Aus der Studie Hass auf Knopfdruck des Institute for Strategic Dialogue und #ichbinhier aus dem Jahr 2018 geht hervor:
»Die Analyse von über 1,6 Millionen rechtsextremen Posts in sozialen Medien (Twitter und öffentliche Facebook-Seiten) im Zeitraum Februar 2017 – Februar 2018 zeigt, dass zwar explizit rassistische, antimuslimische und antisemitische Posts seit dem Inkrafttreten des NetzDG im Oktober 2017 abgenommen haben, aber koordinierte rechtsextreme Online-Hasskampagnen seit Dezember im Schnitt mehr als dreimal so weit verbreitet sind (ca. 300.000 Posts/Monat) wie in den zehn vorangegangen Monaten (ca. 90.000 Posts/Monat).«26
Gerade wenn es um Geflüchtete, sogenannte Ausländerkriminalität, Migra- tion, Heimat oder »den« Islam geht, sind Hasskommentare in sozialen Netzwerken oder in den Kommentarspalten vieler etablierter Medien so gut wie vorprogrammiert. So beteiligt sich etwa die Hälfte der Internetnutzer: innen nicht an Diskussionen im Netz, weil sie negative Erfahrungen mit Hate Speech befürchtet.27 Das ist nachvollziehbar, denn Hassrede kann die Gesundheit jedes Einzelnen gefährden, sowohl psychisch als auch physisch.28 Wortgewalt kann im schlimmsten Fall zur Tatgewalt führen.29 Hasskommentare bedrohen darüber hinaus die Demokratie, weil darunter die Meinungsvielfalt leidet und die öffentliche Meinung verzerrt wird.
Aber wir sind der Hetze nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt Möglichkeiten, wie wir uns davor schützen und dem Hass etwas entgegensetzen können. Im Laufe dieses Buches werde ich darauf eingehen, wie sich jede: r durch das Bloggen gegen Rassist: innen und für eine vielfältige Gesellschaft einsetzen kann. Zunächst müssen wir uns darüber klar werden, was Hate Speech überhaupt ist.
1.1 Was ist Hate Speech?
Bevor ich die Frage beantworte, was Hate Speech bzw. Hassrede ist, werfen wir einen Blick in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Dort wird in Artikel 5 Absatz 1 das Grundrecht auf Meinungsfreiheit garantiert, was weltweit alles andere als selbstverständlich ist.
Im Grundgesetz heißt es:
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.30
Die Meinungsfreiheit ist jedoch kein schrankenloses Grundrecht. Die Grenzen der Meinungsfreiheit werden in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz definiert:
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.31
In der Konsequenz sind beispielsweise Verleumdungen, Beleidigungen und Volksverhetzung nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, da es sich hierbei um Straftatbestände handelt. Der Begriff Hate Speech ist zwar nicht juristisch definiert, aber Hasskommentare können dennoch strafrechtlich relevant sein, wenn sie jenseits der Meinungsfreiheit liegen und Gesetzesverstöße darstellen.32 Justiziable Hasspostings in Deutschland umfassen im Wesentlichen folgende Straftatbestände:
• Volksverhetzung (§ 130 StGB)
• Beleidigung (§ 185 StGB)
• Nötigung und Bedrohung (§§ 240, 241 StGB)
• Propagandadelikte (§§ 86, 86a StGB)
• Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB)33
Die genannten Straftatbestände zeigen, dass das Verfassen von strafrechtlich relevanten Hasskommentaren kein Kavaliersdelikt ist. Volksverhetzung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.34 Außerdem hat der Bundestag am 18. Juni 2020 das Gesetzespaket zur besseren Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet verabschiedet. Dadurch sind die Sanktionen für Straftaten im Netz verschärft worden. Wer beispielsweise öffentlich im Internet andere beleidigt, kann künftig mit bis zu zwei Jahren – statt wie bisher mit bis zu einem Jahr –Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Bei Bedrohungen ist der Strafrahmen von bis zu einem Jahr auf bis zu drei Jahre Freiheits- oder Geldstrafe erhöht worden, wenn diese öffentlich im Netz erfolgen.35
Während die Sanktionen zu den unterschiedlichen Straftatbeständen klar sind, gibt es keine einheitliche und allgemeingültige Definition von Hate Speech. Unter politischen Institutionen, Wissenschaftler: innen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen gehen die Erklärungen teilweise auseinander. Die Empfehlung des Europarates erfährt jedoch eine breite Akzeptanz. Danach
»umfasst der Begriff ›Hassrede‹ jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit*, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen, einschließlich der Intoleranz, die sich in Form eines aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus, einer Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Einwanderern und der Einwanderung entstammenden Personen ausdrücken.«36
Diese Definition ist breit gefasst, denn sie umfasst »jegliche Ausdrucksformen«, ob nun online oder offline. Dabei kann es sich sowohl um das gesprochene als auch um das geschriebene Wort, Bilder sowie Videos handeln. Die Definition schließt darüber hinaus Ideologien wie den »aggressiven Nationalismus ein, die üblicherweise die Grundlage für Hate Speech bilden«.37
Definitionen, wie die des Europarates, haben gegenüber den erwähnten Straftatbeständen den Vorteil, dass sie sehr umfassend sind. Sie lassen sich für eine Anzeige bei der Polizei jedoch nur bedingt nutzen, weil nicht jeder Ausdruck von Hass strafrechtlich relevant sein muss. Es gibt demnach Hasskommentare, die zwar von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, aber von den Betroffenen als beleidigend, respektlos, aggressiv, verallgemeinernd und diskriminierend wahrgenommen werden. Derartige Kommunikationsformen, die sich vor allem durch Rassismus und Sexismus auszeichnen, werdengerade in der englischsprachigen Literatur als incivility (dt. Inzivilität) bezeichnet.38 Ich nenne solche Kommentare in diesem Buch unzivil – und auch wenn derartige Äußerungen gesetzeskonform sind, sollten sie aufgrund ihres verletzenden Charakters gesellschaftlich geächtet sein. Gegen welche Gruppen sich Hate Speech vor allem richtet, beantworte ich im nächsten Unterkapitel.
1.2 Hate Speech trifft vor allem die Benachteiligten
Wer Hasskommentare verfasst, verfolgt in der Regel das Ziel, Menschen abzuwerten oder zu bedrohen. Häufig sind Personen betroffen, die zu einer benachteiligten gesellschaftlichen Gruppe gehören oder sich für diese Menschen einsetzen. Die repräsentative Online-Befragung mit dem Titel #Hass im Netz: Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie ergab 2019, dass jede: r Zwölfte in Deutschland schon einmal direkt von Hate Speech im Internet betroffen war, bei den 18- bis 24-Jährigen ist es mehr als jede: r Sechste.39 Folgende Gruppen trifft der Hass im Netz am häufigsten:
• Menschen mit Migrationshintergrund (94 %)*
• Amtierende Politiker*innen (94 %)
• Muslim*innen (93 %)
• Geflüchtete Menschen (93 %)
• Politisch Andersdenkende (92 %)
• Arbeitslose Menschen (88 %)
• Frauen (88 %)
• Menschen, die nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen (88 %)
• Homosexuelle Menschen (87 %)
• Transsexuelle Menschen (80 %)
• Arme Menschen (78 %)
• Jüdinnen und Juden (73 %)
• Menschen mit Behinderung (73 %)
• Wohnungslose Menschen (71 %)
• Sinti*ze und Rom*nja (69 %)
Quelle: Auflistung übernommen aus Daniel Geschke40
Formen von Hate Speech können demensprechend Sexismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, Homophobie oder andere Ausprä- gungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sein. Damit ist gemeint, dass Menschen aufgrund eines Merkmals wie Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Religionszugehörigkeit in Gruppen eingeteilt, abgewertet und ausgegrenzt werden.41
Politiker: innen sind zwar keine benachteiligte Gruppe in der Gesellschaft, aber in der Öffentlichkeit sehr präsent. Wenn sie sich in kontroversen Debatten positionieren und dadurch polarisieren, können sie zum Hassobjekt werden. So war beispielsweise der SPD-Politiker Karl Lauterbachvon Hate Speech im Netz betroffen, weil er sich nachdrücklich für Alltagsbeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgesprochen hatte. Im Mai 2020 gab Lauterbach bekannt, dass er Morddrohungen erhalten habe.42 Dem Virologen Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, erging es ebenso. Dieser Hass hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, da Morddrohungen strafrechtlich relevant sind.43
1.3 Hate Speech gefährdet die Gesundheit und die Demokratie
Hassrede ist eine Gefahr für die Demokratie, da sie die Meinungsvielfalt einschränkt und die öffentliche Meinung verzerrt. Dies ist eine zentrale Erkenntnis der Studie #Hass im Netz: Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. In der Untersuchung stellen die Wissenschaftler: innen außerdem fest:





























