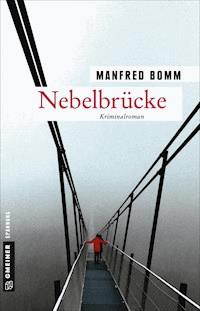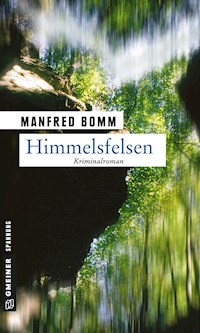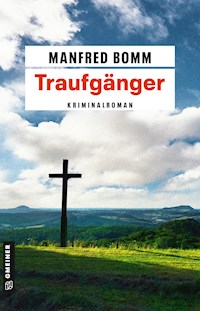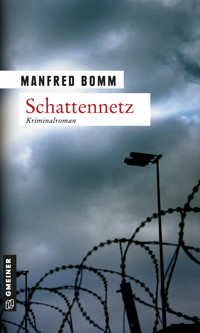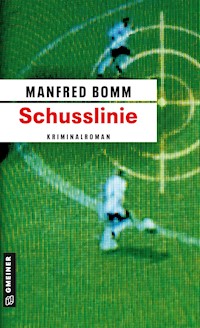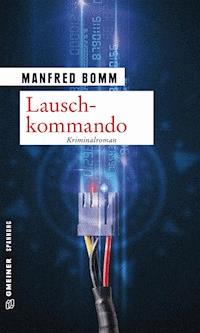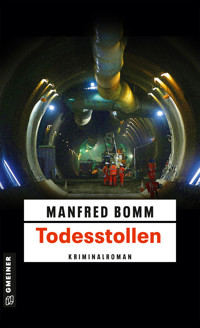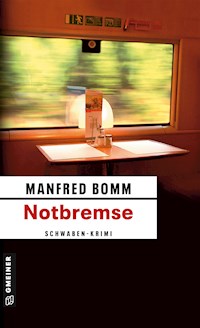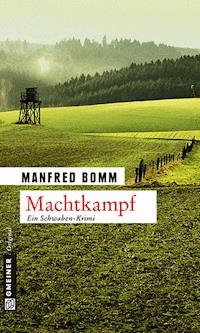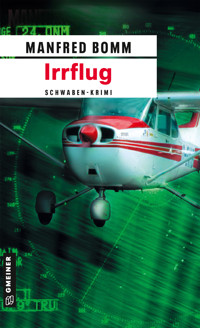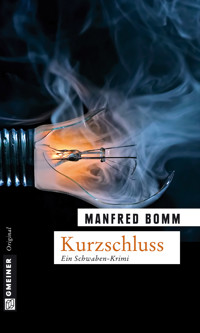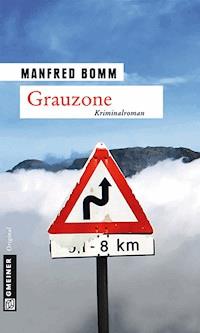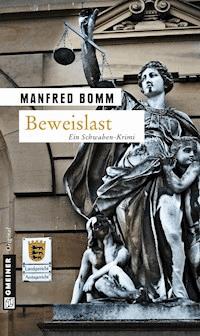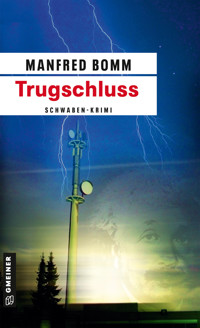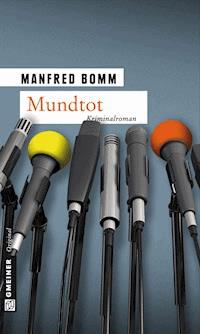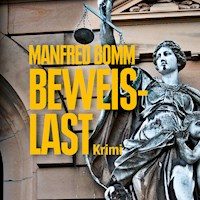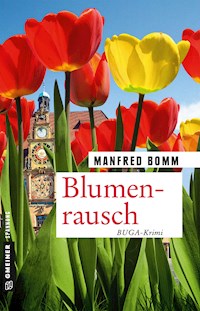
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Ein Dreivierteljahr vor der Eröffnung der Bundesgartenschau in Heilbronn trübt ein Mord die Vorbereitungen: Im Alt-Neckar wird die Leiche einer Frau gefunden, die als Biophysikerin an der Gestaltung des Großprojekts beteiligt war. Wissenschaftlich arbeitete sie aber in Ulm, wo sie zur Erforschung des Klimawandels einen Mini-Satelliten entwickelt hat, den der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst zur Raumstation ISS mitnehmen soll. Weil ein dubioser Amerikaner dies verhindern will, macht sich große Verunsicherung breit. Denn der Mord ist am Tag des Raketenstarts geschehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Blumenrausch
Der neunzehnte Fall für August Häberle
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Nebelbrücke (2018), Traufgänger (2017), Todesstollen (2016), Lauschkommando (2015), Machtkampf (2014), Grauzone (2013), Mundtot (2012), Blutsauger (2011), Kurzschluss (2010), Glasklar (2009), Notbremse (2008), Schattennetz (2007), Beweislast (2007), Schusslinie (2006), Mordloch (2005), Trugschluss (2005), Irrflug (2004), Himmelsfelsen (2004)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Eberhard / fotolia.com
und Jenzig71 / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5894-1
Ein paar Worte zum Nachdenken im Voraus
Gewidmet allen, die sich nicht von den Naturentwöhnten blenden lassen, deren Welt nur aus Bildschirmen und virtuellen Spielen besteht und die uns Glauben machen wollen, in greifbarer Nähe gebe es »da draußen« einen zweiten Planeten, der eine vergleichbare Schöpfung hervorgebracht hat. Selbst wenn es einen gibt, dann ist er unerreichbar von uns entfernt, getrennt durch Raum und Zeit.
Gewidmet ist dieses Buch deshalb allen, die sich des Wunders der Schöpfung bewusst sind und sie als etwas Kostbares und Einmaliges zu erkennen vermögen, das wir sorgfältig schützen und erhalten müssen. Ein jeder Käfer, eine jede Blume, ein kleines Bächlein und die Luft – alles ist Teil der Natur, die eine unergründliche Einheit bildet. Mag dieses Zusammenspiel für die einen nur ein Zufall sein, so werden alle jene, die bereit sind, sich tieferen Gedanken hinzugeben, unweigerlich das Werk einer großen Kraft und Macht vermuten.
Beschützen und hüten wir unseren Planeten, der von Schwärze und Eiseskälte umgeben ist, vor all denen, die nur der Gier und der Bilanzen wegen den unsäglichen Zwängen des betriebswirtschaftlichen Denkens oder dem gnadenlosen Machtstreben verfallen sind und nicht davor zurückschrecken würden, diese einzige Heimat zu zerstören, die wir und alle Mitgeschöpfe haben. Hüten wir uns vor denen, die nur an die materielle Welt glauben, die wahren Werte aber mit Füßen treten. Hüten wir uns ebenso vor den Unverantwortlichen und Ahnungslosen, die gerade in unserer Zeit in den höchsten Ämtern anzutreffen und in existentiellen Fragen der Menschheit beratungsresistent sind. Wehren wir uns gegen alles, was die Schöpfung in Gefahr bringt.
Meine Hochachtung gilt deshalb nicht den Schönrednern und »Totrechnern«, sondern allein jenen, die wirklich Wichtiges für die Menschheit hervorbringen: Naturwissenschaftlern, Medizinern und allen, die sich um ein friedliches Zusammenleben bemühen. Und jenen, die den Mut haben, auf innovative Weise in neue Sphären vorzustoßen.
Aber auch jenen gilt meine Hochachtung, die oft im Schatten stehen, weil ihre Arbeit von denen, die das Sagen haben, nicht würdevoll beachtet wird: den Hilfskräften landauf, landab ebenso wie dem Pflegepersonal in den Kliniken und Heimen, aber auch jenen, die sich trotz maroder Bildungssysteme ernsthaft und engagiert dafür einsetzen, dass junge Menschen lernen, mit der Natur im Einklang zu sein.
Prolog
Nie zuvor hatte er sich zu so etwas hinreißen lassen. Doch jetzt war die Gelegenheit günstig: eine stockfinstere Winternacht, dazu noch eisig kalt. Kein vernünftiger Mensch kam auf die Idee, sich bei diesem Wetter im Freien aufzuhalten. Schon gar nicht hier, wo Sperrgitter den Zutritt zu einem Areal verwehrten, das bis vor wenigen Jahren dahingegammelt war. Das Streulicht der nahen Stadt verlor sich in sanften Nebelschwaden, die aus dem vorbeifließenden Neckar waberten. Die Geräusche einiger weniger Autos lagen gedämpft in der feuchten Luft.
Nur schemenhaft war im Grauschwarz dieser Nacht die farblose Umgebung zu erahnen: die alte Schleuse, der Wilhelmskanal, irgendwo eine Eisenbahnbrücke und hier, ganz nah, die Auffahrt zu einer gesperrten Straßenbrücke, die über den Alt-Neckar zu dem jenseitigen Gelände führte, auf dem tagsüber seit Jahren schon fieberhaft gearbeitet wurde. Jetzt lag es still und friedlich im nächtlichen Schlummer. Übergangslos schien es mit dem ebenso schwarzen Himmel zu verschmelzen, der offenbar wolkenverhangen war. Ohne Mond, ohne Sterne. Einige hoch aufragende Gebäude standen wie eine gigantische Mauer vor ihm.
Ideale Bedingungen also für den Mann, dessen dunkle Kleidung ihn bestens tarnte. Allerdings drohte überall die Gefahr, von dem Sicherheitsdienst aufgespürt zu werden. Aber zwischen den Baumaterialien und Gerätschaften, die hier lagerten und herumstanden, bot sich genügend Deckung. Hier war er seit Stunden selbst zu einem Teil der Nacht geworden. Es roch nach frischem Beton und feuchter Erde.
Dass er jetzt am ganzen Körper zitterte, war der unguten Mischung aus Angst und Kälte geschuldet. Ein regelmäßiger Schluck aus dem handlichen Flachmann, den er in der Tasche seiner dicken Winterjacke stecken hatte, wärmte ihn nur für ein paar Minuten innerlich auf. Allzu viel durfte er davon allerdings nicht trinken, denn er musste seinen Geist wachsam halten.
Als sich ein Sattelzug mit dröhnendem Dieselmotor brummend näherte und drüben vor der Schranke zur abgesperrten Brückenauffahrt anhielt, war die bleierne Müdigkeit wie weggeblasen. Also doch. Das Warten hatte sich gelohnt. Der Lkw-Fahrer stieg aus und ging durch den Scheinwerferkegel zu dem spärlich beleuchteten Bürocontainer, in dem ein einsamer Posten den Zugang bewachte. Offenbar mussten jetzt Papiere überprüft werden, was aber nur wenige Minuten in Anspruch nahm.
Der Fahrer durchschritt wieder die Scheinwerfer seines Lkws und kletterte in das Führerhaus zurück. Dann heulte der Dieselmotor dumpf auf und das schwere Gefährt rollte über die Bleichinselbrücke.
Der Schwarzgekleidete hatte unterdessen ein Fernglas an die Augen gepresst, um aus seiner seitlichen Perspektive das Kennzeichen des Sattelauflegers ablesen zu können. Es war gelb. Wie erwartet. Eines aus den Niederlanden. Buchstaben und Ziffern konnte er aber nicht genau erkennen. Er stopfte das kleine Fernglas wieder in die Jackentasche – während der dröhnende Dieselmotor die nächtliche Stille zerriss und schnell abebbte, als die Schlussleuchten bei den ziemlich massig erscheinenden Neubauten verschwanden, die hier innerhalb eines Jahres hochgewachsen waren.
Von seiner Position aus konnte der heimliche Beobachter nicht erkennen, wie weit sich der Sattelzug entfernt hatte. Der Motor jedenfalls war ziemlich schnell verstummt.
Für den Schwarzgekleideten folgte jetzt der heikle Teil seiner Mission. Reflexartig verließ er die Deckung zwischen den Baumaterialien. Beinahe hätte ihm ein aufragendes Stück Gummischlauch die Mütze vom Kopf gerissen, als er wieselflink von einem nachtschwarzen Schatten zum nächsten huschte.
Er kannte sich aus, denn er war schon einige Male tagsüber mit einer Besuchergruppe hier gewesen. Trotzdem fiel es ihm schwer, sich den großen, noch eingerüsteten Bauten zu nähern. Der Regen der vergangenen Tage hatte den ohnehin morastigen Untergrund aufgeweicht, sodass er mehrmals bis zu den Knöcheln im weichen Erdreich versank und sofort die eisige Nässe in den Schuhen zu spüren bekam.
Er war erleichtert, als er endlich mit dem Schwarz eines der Gebäude verschmelzen konnte. Denn nun, auf dem finsteren Baustellengelände, boten Container, Materialien, Humushaufen und Fahrzeuge ein nächtliches Wirrwarr, zwischen dem eine schwarz gekleidete Person nicht auffiel. Allerdings war natürlich nicht auszuschließen, dass es neben dem Sicherheitsdienst auch noch Überwachungskameras gab. Dieses Risiko hatte er jedoch bewusst auf sich genommen. Schließlich war das, was er vorhatte, ziemlich ehrenwert, wenngleich natürlich nicht ganz gesetzeskonform. Und falls das Gelände tatsächlich flächendeckend überwacht wurde, würde er ganz bestimmt nicht zu sehen bekommen, was er sich erhoffte.
Jedenfalls hatte er sich die Aktion reiflich überlegt.
Die beißende Kälte war verdrängt, als er sich langsam, vorbei an hoch aufragenden Gebäuden, immer weiter auf knirschendem feinen Schotter in das Gelände schlich, über Steine stolperte und ihm erneut kurzatmig der Geruch von frischem Beton in die Nase stieg.
Doch dann schreckte ihn etwas auf. Stimmen. Tatsächlich, Männerstimmen. Kaum vernehmbar, aber real. Er verharrte, um zu lauschen. Vermutlich kamen sie aus einem der unbeleuchteten Wohnblocks, die nun beidseits den breiten Weg säumten. Er sah an der finsteren Fassade zum dunklen Himmel hoch. Alle Gebäude waren von Baugerüsten umgeben und allem Anschein nach noch nicht bezogen.
Wieder eine Stimme. »Alles okay?«, war jetzt deutlich zu verstehen.
Der Mann wagte noch immer nicht, sich zu bewegen, und konzentrierte sich auf die Richtung, aus der die Stimmen kamen.
»Halt’s Maul, du Arschloch!«, zischte jemand so laut, dass der schwarz Getarnte keinen Zweifel daran hatte, Ohrenzeuge einer dubiosen Aktion geworden zu sein. Auch wenn der Lkw ganz offiziell ins Gelände eingefahren war, so schien hier, in einer ziemlich finsteren Ecke, etwas Merkwürdiges vor sich zu gehen.
Er glaubte, nun die Richtung, aus der die Stimmen kamen, genauer geortet zu haben: von der Rückseite des links vor ihm stehenden Blocks.
Langsam setzte er einen Schritt vor den anderen, orientierte sich dicht an dem Neubau und vermied es, verdächtige Geräusche zu verursachen. Doch Augenblicke später schreckte ihn ein Scheppern auf. Metall auf Metall. Wurde jetzt eine Ladeluke geöffnet? Wie selbstverständlich ging er davon aus, dass es der niederländische Sattelzug war, an dem hantiert wurde. »Los, los, los – anpacken!«, schallte ein Kommando durch die Nacht.
Tausend Gedanken fuhren im Kopf des herangeschlichenen Mannes wild Achterbahn. Er durfte unter keinen Umständen ertappt werden. Denn mit Leuten wie diesen, die hier zugange waren, konnte man nicht vernünftig reden. Und vielleicht war er auch schon zu weit gegangen. Er könnte einfach abbrechen, denn er hatte doch gesehen, was er zu sehen gehofft hatte. Einfach abbrechen und alles Weitere anderen überlassen.
Aber noch fehlte ihm der letztendliche Beweis. Er wollte sich mit eigenen Augen vergewissern, ob es tatsächlich um den besagten Lastzug ging.
Deshalb wagte er einen nächsten Schritt. Kies knirschte unter seinen Schuhen. Neugier schlug für einen Moment in pure Angst um.
Unsinn, bläute er sich ein. Nichts davon würde an der Stirnseite des Hauses zu hören sein. Außerdem drangen von dort klappernde und scheppernde Geräusche herüber. »Verdammt noch mal, wie oft soll ich noch sagen, dass ihr leise sein sollt?«, giftete eine Männerstimme so wild und zornig, dass der Schwarzgekleidete abrupt stehen blieb, als habe die Frage ihm gegolten. Weil nun drei oder vier aufgeregte Stimmen gleichzeitig herüberhallten, waren einzelne Worte nicht zu verstehen. Den wilden Disput der Unbekannten nutzte er für weitere Schritte, ohne dabei auf Trittgeräusche achten zu müssen. Mut und Angst wechselten jetzt im Sekundentakt. Wieder waren es die Neugier und der Drang, etwas aufdecken zu wollen, die ihn antrieben und geradezu magisch nach vorne zu der Hausecke zogen, hinter der er das Geschehen vermutete.
»Und Oldi?«, drang eine Stimme laut und deutlich herüber. »Lässt der sich auch noch sehen?« Poltern und Rumpeln war zu vernehmen, wie es beim Stapeln schwerer Holzkisten entsteht.
Die Antwort auf die vorausgegangene Frage folgte ziemlich unfreundlich: »Der Oldi geht dich nichts an, kapiert? Oder hat man dir nicht gesagt, dass du den Namen niemals in den Mund nehmen darfst? Niemals.« Es klang nach höchster Alarmstufe. »Bei keiner Gelegenheit. Nirgendwo und bei niemandem.«
Obwohl ihn dies alles nichts anging, war der Lauscher an der Ecke von diesem Umgangston geschockt. Hier herrschten andere Sitten, als er sie gewohnt war.
Er ließ einige Sekunden verstreichen, während derer Kommandos erteilt wurden, die auf das Heben schwerer Gegenstände schließen ließen, die offenbar in ein anderes Fahrzeug umgeladen wurden.
Dann wagte er den letzten Schritt bis dicht an die Ecke des Gebäudes, sodass er klar und deutlich verstand, was eine verängstigte Männerstimme wissen wollte: »Und wo hast du die restlichen schwarzen Rosen?«
»Idiot!«, schallte es dem Fragesteller wohl entgegen. »Frag nicht so blöd. Wie immer, ganz vorne, wo sonst …?«
Der am ganzen Körper zitternde Mann an der Hausecke rang mit sich, ob er jetzt einen Blick riskieren konnte. In dieser Finsternis würde er bestimmt unbemerkt bleiben. Licht gab es keines, sonst hätte er längst einen schwachen Schimmer davon wahrnehmen müssen. Die Männer arbeiteten also vermutlich mit Hand- oder Stirnlampen.
Er holte tief Luft, tastete sich an der rauen Hauswand vollends bis zur Ecke vor und presste die linke Backe nun an das kühle Mauerwerk, an dem seine Winterjacke entlangstrich. Noch zwei, drei Zentimeter. Er brauchte nur kurz einen schnellen Blick um die Ecke zu werfen. Möglicherweise war es aber viel zu dunkel, um Details erkennen zu können. Doch selbst wenn nur Taschenlampen genutzt wurden, würde er sehen, ob dort ein Sattelzug stand. Er kämpfte mit den Warnungen seiner inneren Stimme, rang sich dann aber dazu durch, auf ein neuerliches Geräusch oder weitere Wortfetzen zu warten. Dann würden die Männer abgelenkt sein.
Doch außer hektischen Schritten und dem Stapeln von Kisten drang nichts mehr an seine Ohren.
Der Herzschlag jagte das Blut mit Hochdruck durch den ganzen Körper, ihm war kalt und heiß gleichermaßen. Gerade als er den entscheidenden Blick riskieren wollte, geschah etwas, was ihm beinahe den Verstand geraubt hätte. Es kam so plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Augenblicklich war er in eine Schockstarre versetzt. Es hatte sich wie ein Giftpfeil in seine Seele gebohrt: ein schriller Signalton. Nur ein einziger, aber mit einer gefühlten Lautstärke, die ihm den Atem raubte und sein Herz außer Takt brachte. Es dauerte den Bruchteil einer Sekunde, bis er überhaupt erst wieder in der Lage war, seinen Körper zu bewegen. Instinktiv wich er zwei, drei Meter zurück. Flucht. Bloß weg, schnell, dröhnte es durch seinen Kopf. Nein, gebot die Vernunft. Das konnten die doch gar nicht gehört haben. Die hinter der Hausecke.
Er erstarrte in der Bewegung, lauschte angespannt und war mit allen Sinnen auf das stockdunkle Ende des Hauses fixiert – auf Flucht programmiert, falls sie um die Hausecke gestürmt kamen, Waffen im Anschlag.
Sein Herz raste in höchster Not. Die Knie weich, der Kopf im Ausnahmezustand. Noch konnte er nicht realisieren, dass es nur der Signalton einer am Smartphone ankommenden WhatsApp-Nachricht gewesen war, die ihm alles vermasselt hatte. Nein, keine Sekunde länger wollte er hierbleiben.
Hinter der Hausecke war es plötzlich still geworden. Kein klapperndes Holz mehr, keine Stimmen. Verdächtige Ruhe.
1
»Worauf wir natürlich ganz besonders stolz sind, das ist unser Astronaut aus der Nachbarschaft.« Die Frau, die an diesem tristen Februartag des Jahres 2018 eine Gruppe Garten- und Landschaftsgestalter durch ein riesiges Baustellenareal führte, ließ ihrer Begeisterung freien Lauf. »Alexander Gerst kommt aus dem Nachbarkreis Hohenlohe, aus Künzelsau«, erklärte Heidi Miraldi, die seit zwei Jahren schon regelmäßig Besuchergruppen über jenes Gelände führte, auf dem die Bundesgartenschau von Heilbronn inzwischen deutlich sichtbar Gestalt angenommen hatte. Viele Bauten waren bereits errichtet, zwei künstliche Seen gefüllt und weit mehr als 2.000 Bäume gepflanzt. Nun galt es, die Ausschmückung mit Stauden, Hecken und Blumen voranzutreiben, denn in spätestens 14 Monaten sollte aus einer ehemaligen Gewerbebrache eine blühende Landschaft geworden sein. »Die Heilbronner sind so gut wie nie hierhergekommen«, berichtete die engagierte Frau, die in dieser Stadt vor knapp 40 Jahren geboren wurde und sich deshalb entsinnen konnte, wie verwahrlost das Gelände zwischen Alt-Neckar und dem großen schiffbaren Neckar einst gewesen war. »Da hätte jeder Krimi drin spielen können«, meinte sie süffisant, als sich die aus zwei Dutzend Personen bestehende Gruppe auf dem aufgeschütteten Wall versammelt hatte, der das völlig umgestaltete Gelände auf eine Länge von einem Kilometer von den angrenzenden Industriegleisen und dem Neckarhafen trennte. Dahinter ragten die Silos eines Futtermittelbetriebes in die Höhe.
Noch fiel es schwer, sich auf dem 40 Hektar großen Areal fröhlich gelaunte Besucher zwischen prächtig blühenden Stauden, bunten Wiesen, spiegelnden Wasserflächen und kleinen Weinberg-Parzellen vorzustellen. Wo noch lärmende Bagger Gräben zogen und jede Menge Handwerker wuselten, wo Leitungen und Rohre gestapelt waren, da würde es im Frühjahr 2019 so aussehen, als sei hier nie etwas anderes gewesen. Das einst topfebene Gelände war behutsam modelliert worden, sodass von den Erhöhungen ein herrlicher Ausblick geboten wurde – hinüber zum Bahnhof und über die Weinberge am nördlichen Stadtrand hinweg zum Wartberg mit seinem Turm.
Die Frau mit den blonden halblangen Haaren und dem freundlichen Auftreten wurde nicht müde, die architektonisch gelungene Verwandlung zu erläutern: »Nach dem Krieg, als die Briten die ganze Stadt und somit auch dieses Hafengebiet zerbombt hatten, siedelte sich sehr schnell alles Mögliche an.« Was sie damit meinte, konnte sie bereits im Schlaf aufzählen: »Schrotthändler, Lumpensammler, Altpapierhändler.« Sogar das Ufer des Neckars sei alles andere als ein Ort zum Bummeln und Wohlfühlen gewesen.
Die Mitglieder der Expertengruppe, die bereits eine Dreiviertelstunde in winterlicher Kälte über das eingezäunte Gelände gegangen waren und jetzt auf dem Erdwall ausharrten, fröstelten zusehends. Ein älterer Mann, dessen Gesicht von Wind und Wetter gezeichnet war, zeigte sich aber an dem Hinweis auf den Astronauten interessiert: »Dieser Gerst, der fliegt ja demnächst wieder. Wird das auch irgendwie bei der Gartenschau thematisiert?«
Heidi Miraldi stutzte für einen Moment. Mit dieser Frage war sie offenbar noch nie konfrontiert worden. »Er … ja, er fliegt in vier Monaten, glaub ich, zur ISS. Von Baikonur aus. Mit den Russen. Einen direkten Kontakt zu ihm hatten wir bisher nicht.« Sie lächelte verlegen. »Aber Sie haben natürlich recht. Gerst ist Sympathieträger ersten Ranges. Vor allem, was den Schutz unserer Erde anbelangt.« Für diese Feststellung erntete sie eifriges Kopfnicken. »In vielen seiner Interviews bringt er sein Anliegen zum Ausdruck. Umweltschutz und Natur würden zu unserem Gartenschau-Projekt hier passen.« Die Pressesprecherin überlegte, ob sie etwas erwähnen durfte, was nur intern bekannt war, entschied sich dann aber doch dafür: »Indirekten Kontakt zu Herrn Gerst gibt es allerdings.« Die Zuhörerschar horchte sichtlich auf. »Eine Biophysikerin aus Ulm, die externe Beraterin eines von uns beauftragten Planungsbüros ist, hat als Wissenschaftlerin irgendetwas entwickelt, was Herr Gerst bei seinem nächsten Flug ins Weltall testen soll.«
Die Besuchergruppe nahm’s mit Staunen zur Kenntnis. »Worum geht’s bei dieser Entwicklung?«, wollte eine der wenigen Frauen aus der Runde wissen.
»Da dürfen Sie mich nicht fragen«, wiegelte Heidi Miraldi ab. »Irgendetwas mit Klimaschutz und Treibhauseffekt.«
»Das hört sich ja so an, als sei das eine höchst geheime Angelegenheit«, meinte die junge Fragestellerin.
2
Christian Hofknecht war schlank und groß, zerzaustes Lockenhaar, raue Hände. Das braun gebrannte Gesicht wies mehr Falten auf, als es die 38 Lebensjahre hätten erwarten lassen. Die Arbeit im Freien war seiner Haut nicht zuträglich gewesen. Daran hatte sich auch nichts geändert, seit er seine gärtnerische Tätigkeit nun überwiegend in Gewächshäusern ausübte. Er war eben ein Naturbursche, der sich eng mit Acker und Scholle verbunden fühlte. Als Gärtnermeister hatte er stets nach Höherem gestrebt und mithilfe renommierter Fachfirmen entsprechende Kontakte geknüpft. So blieb es nicht aus, dass seine Ehefrau bisweilen den Eindruck hatte, er würde den eigenen Betrieb sträflich vernachlässigen. Auch heute, an diesem bitterkalten Wintertag, war er wieder zu einem Termin gefahren. Allerdings hatte ihn seine Frau dazu gedrängt. Der Mann, den er in Ulm treffen sollte, war so etwas wie die »letzte Rettung«. Sie hatten ihn voriges Jahr bei einer Gartenbauausstellung in der Ulmer Donauhalle kennengelernt. Sympathisch, um die 50, ein gemütlicher Bayer, dem man ohne Weiteres zutraute, einem hilfreich zur Seite zu stehen. Vielleicht auch finanziell. Zumindest hatte es damals so geklungen.
Rainer Warnecke galt in der Branche offenbar als ein angesehener Gartenbau-Großhändler aus München. Mit ihm waren Christian Hofknecht und seine Ehefrau damals ins Gespräch gekommen, als sie gerade ihren neuen Gärtnereibetrieb eingeweiht hatten. Natürlich war es um künftige Pflanzenlieferungen gegangen – und um Rabatte. Hofknecht hatte durchblicken lassen, dass ihn eine mächtige Schuldenlast drückte, worauf Warnecke geradezu väterlich beruhigt hatte: »Junger Mann, wenn’s mal ganz große Probleme gibt, dann melden Sie sich bei mir.«
Hofknecht hatte die Visitenkarte dankbar entgegengenommen. Jetzt, da die finanzielle Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer größer wurde, war von Katharina, seiner Ehefrau, der Vorschlag gekommen, den Mann zu kontaktieren und auf sein Hilfsangebot anzusprechen. Bei einem Telefongespräch hatte sich Warnecke sofort an den jungen Gärtnermeister erinnert – oder zumindest so getan, als sei ihm dessen Name noch bestens geläufig. Er war nach kurzem Überlegen bereit gewesen, sich mit ihm zu treffen, hatte dafür Ulm vorgeschlagen und spontan gefragt: »Mögen Sie Linsen mit Spätzle?«
»Ja, wieso?«, hatte der junge Gärtner irritiert geantwortet.
»Dann kommen S’ übermorgen um 13 Uhr in den ›Barfüßer‹ nach Neu-Ulm, direkt am Donauufer. Falls Sie mich nicht mehr erkennen: Ich hab die ›Süddeutsche‹ dabei.«
Hofknecht war pünktlich. Er stellte seinen weißen, ziemlich betagten VW-Kleinbus auf dem Parkplatz des Lokals ab, dessen Gartenwirtschaft in tiefem winterlichen Schlummer lag. Beim Betreten des großen Gastraumes schlug ihm wohlige Wärme entgegen. Die meisten der Plätze waren belegt, sodass er sich vor der wuchtigen Theke zunächst orientieren musste. Schon bei der Herfahrt hatte er versucht, sich an das Gesicht Warneckes zu erinnern, doch trotz aller Anstrengung wollte es sich in seinen Gedanken nicht formen. Während ihm bereits ein freundlicher Ober einen Platz avisierte, ließ er seinen Blick über die vielen Köpfe hinwegstreifen – bis er einen einzelnen Mann erspähte, der an der Fensterfront saß und eine Zeitung las, deren Titelblatt zu sehen war: Die »Süddeutsche«.
Hofknecht deutete dem Ober an, dass er sich »zu dem Herrn da drüben« setzen wolle und ging mit leichtem Lampenfieber auf den Älteren zu. »Herr Warnecke?«, fragte er zögernd, worauf der Mann die Zeitung beiseitelegte und höflich aufstand.
»Dann sind Sie Herr Hofknecht«, lächelte er, drückte die angebotene Hand und bot ihm den Platz gegenüber an. Hofknecht zog seine Jacke aus und hängte sie über die Stuhllehne. »Pünktlich wie die Maurer«, ergänzte der Münchner mit leichtem bayerischem Akzent.
»Ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen«, gab sich der Gärtnermeister aus Geislingen unterwürfig.
»Keine Sorge, junger Mann. Ich hab Ihnen doch damals versprochen, dass Sie sich stets vertrauensvoll an mich wenden können.« Warnecke konnte, wenn er wollte, nahezu astreines Hochdeutsch sprechen.
Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln empfahl er seinem Gast noch einmal Linsen mit Spätzle, die er hier immer esse, wenn er in Ulm sei. »Schon gar, weil’s auf der bayerischen Uferseite der Donau ist«, grinste er. »In Bayern versteht man, gut zu essen.« Er bestellte für sie beide diese Speise, dazu eine Halbe Bier.
Kaum hatte der Ober dies in seinen elektronischen Apparat eingegeben, kam Warnecke zur Sache: »Es klemmt finanziell?« Er verzog sein breites Gesicht zu einem mitleidsvollen Lächeln. »Jetzt sei’n S’ mal net so deprimiert«, fügte er, in seinen Münchner Dialekt verfallend, an und strich sich übers schüttere Haar.
»Das sagen Sie so leicht«, erwiderte Hofknecht leise. Er wollte vermeiden, dass die Personen an den Nebentischen mithören konnten. »Obwohl unser Laden gar nicht mal so schlecht läuft, kommen wir auf keinen grünen Zweig.«
»Das ist bei einem Gärtner immer schlecht, wenn er keine grünen Zweige hat«, griff Warnecke das Gesagte ironisch auf, bemerkte aber sofort, dass dem jungen Mann nicht zum Scherzen zumute war. »Sie glauben, dass die Sache mit Heilbronn was wird?« Er knüpfte mit dieser Frage an ihr kurzes Telefonat an, bei dem Hofknecht davon berichtet hatte, dass er sich von einer Beteiligung an der Bundesgartenschau neue Impulse für sein Geschäft erhoffe. Diese Bemerkung hatte Warnecke aufhorchen lassen.
»Die Buga ist eine Chance, über die Provinz hinaus bekannt zu werden«, meinte der Gärtnermeister und benutzte die gebräuchliche Abkürzung für die Bundesgartenschau.
»Provinz!«, empörte sich Warnecke gekünstelt. »Ihr Schwaben macht euch immer kleiner, als ihr seid. Geislingen an der Steige! Da kommen Sie doch her, stimmt’s?«
Hofknecht nickte stumm.
»Das mag zwar Provinz sein, aber doch eine mit Bedeutung. Wer kennt sie nicht, die Geislinger Steige? Die Eisenbahn, die dort erstmalig mit einer sensationellen Steigungsrate ein Gebirge überquert hat.«
»Sie sind Eisenbahnfan?«, entfuhr es Hofknecht.
»So ein bisschen. Ich bin, wenn sich’s einrichten lässt, mit der Bahn unterwegs, auch heute übrigens.« Er runzelte die hohe Stirn. »Deshalb fahr ich hin und wieder über die Geislinger Steige. Schade, dass das im Fernverkehr wohl bald vorbei ist, wenn die neue Trasse Stuttgart-Ulm vollends fertig wird.«
»Dann sieht man bei uns nur noch die langsamen Bahnen und die lärmenden Güterzüge«, bestätigte Hofknecht abwesend.
»Aber als Provinz braucht ihr euch deswegen nicht zu bezeichnen. Ich nehm doch an, dass die Eisenbahn bei euch touristisch vermarktet wird.«
Hofknecht wollte nicht darauf eingehen. Natürlich zog es Eisenbahn-Enthusiasten in die Stadt, insbesondere, wenn Dampfzüge angekündigt waren, aber mehr als einen Wanderweg um die Steige herum hatte ihnen die Stadt bisher nicht bieten können. Dafür wurde wenigstens umso mehr über den Tourismus geredet. Hofknecht hätte noch sehr viel Kritisches anmerken können, doch nun ging es um ihn selbst.
Der Ober stellte das Bier auf den Tisch, sagte »Zum Wohl« und entschwand wieder. Warnecke hob sein Glas, um mit Hofknecht anzustoßen. »Auf Sie«, sagte der Bayer und nahm einen kräftigen Schluck.
»Die Idee mit der Buga ist gut, aber erfordert eine Menge Arbeit«, meinte Warnecke und wischte sich mit dem Handrücken den Schaum vom Mund.
»Aber man kann mit der Teilnahme werben«, verteidigte Hofknecht sein Engagement.
»Sie treten dort als Friedhofsgärtner in Erscheinung – hab ich Sie da am Telefon richtig verstanden?«
»Ja, Schaugräber. Man hat sich bewerben können – und ich bin einer von denen, die akzeptiert wurden«, sprudelte es aus Hofknecht heraus. »Diese einmalige Chance darf man sich nicht entgehen lassen.«
»Aber Geld bringt’s net viel«, brummte Warnecke. »Sagen S’ mal, wie tief stecken S’ denn in der Kreide?«
Hofknecht holte Luft und fingerte an dem kalten Glas herum. »Noch geht’s«, wich er aus, »aber sobald die Zinsen steigen, wird’s eng.«
»Nur eng oder bedrohlich?«
»Tödlich«, flüsterte Hofknecht.
»Ach, reden S’ doch nicht daher. Tödlich ist gar nix. Wenn dir der Kittel brennt, gibt’s immer eine Feuerwehr.« Er sah seinem Gegenüber fest in die unsicheren Augen.
»Das sagt sich so leicht, Herr Warnecke. Ich will Sie auch gar nicht für weitere Rabatte anbetteln. Aber ich muss energisch sparen oder mir neue Einnahmequellen erschließen.«
»Die Konkurrenz ist groß bei euch?«
»Ja, da gibt es einige sehr innovative Kollegen. Ein Betrieb macht sogar kulturelle Events. In einem Gewölbekeller.«
»Aber Sie haben doch eine ganz moderne Anlage gebaut.«
»Modern schon«, Hofknecht lächelte verlegen, »aber auch ganz schön teuer.«
Warnecke überlegte und sah aus dem Fenster zu den winterlich eingemotteten Tischen und Stühlen. »Eine neue Einnahmequelle wollen S’ erschließen«, resümierte er. »Vielleicht könnte ich Ihnen da vorübergehend eine anbieten.«
»Ach?« Hofknechts Interesse stieg. »Und die wäre?«
In diesem Moment brachte der Ober das bestellte Essen.
»Lassen wir’s uns erst mal schmecken, Herr Hofknecht«, entschied der Bayer, als sich der Ober wieder entfernte. »Wir können uns übrigens gerne duzen. Ich bin der Rainer.«
Hofknechts Miene erhellte sich. »Und ich der Christian.« Sie stießen mit den Gläsern an. Nach einem kräftigen Schluck wandte sich Warnecke dem Essen zu und meinte: »Die Buga könnte für dich wirklich lukrativ werden. Wie gut sind deine Kontakte dorthin?«
»Kontakte?« Hofknecht wurde verlegen.
Warnecke erklärte, was er meinte: »Naja, persönliche Kontakte, Einblicke und so …?«
3
Was der Mann wollte, war ihr am Telefon nicht ganz klar geworden. Natürlich ging es um ihr Projekt, um ihr großes Experiment, das ihr in wissenschaftlichen Kreisen viel Ruhm und Ehre eingebracht hatte, obwohl es sich in den nächsten Monaten erst noch bewähren musste. Aber allein schon die Tatsache, dass es ihr als junge Biophysikerin gelungen war, ihr Experiment bei einer Mission in der Internationalen Raumstation ISS unterzubringen, galt in Fachkreisen als sensationell.
Vanessa Eickhoff, gerade mal 35 Jahre alt, in Ulm wohnhaft und Tochter eines angesehenen Arztes in Stuttgart, hatte ihr Studium zielstrebig durchgezogen und mit einem Thema promoviert, das so aktuell war wie nie zuvor: der Klimawandel. Seit der umstrittene US-Präsident Donald Trump Mitte vorigen Jahres angekündigt hatte, das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen zu wollen, waren die Stimmen jener lauter geworden, die sich um die Zukunft des Planeten sorgten. Allerdings gab es auch anderweitig Skeptiker, die Zweifel daran hegten, ob die Erderwärmung tatsächlich menschengemacht und damit auf den erhöhten Ausstoß von Kohlendioxid zurückzuführen war. Bereits vor der Industrialisierung, so argumentierten sie, seien die Gletscher abgeschmolzen. Klimaschwankungen habe es in der Geschichte der Erde schon häufig gegeben.
Vanessa kannte derlei Einwände zur Genüge und sie war auch bereit, darüber zu diskutieren, vorausgesetzt, sie hatte es mit Experten zu tun, die sich auf belastbare Fakten beriefen. In den Medien und auch in der Politik wurden hingegen oftmals Begriffe durcheinandergeworfen und jeweils der eigenen Weltanschauung wegen zurechtgebogen und interpretiert.
Noch gut hatte sie den Vortrag des Physiknobelpreisträgers von 1973, Ivar Giaever aus Norwegen, in Erinnerung, den sie vor drei Jahren auf einer Tagung in Lindau gehört hatte. Der Physiker war damals im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern nicht bereit gewesen, die sogenannte »Mainauer Deklaration 2015 zum Klimawandel« zu unterzeichnen und galt seither als »Klimaleugner«. Obwohl seine Thesen, wonach die globale Erwärmung natürlichen Ursprungs sei und nichts mit Luftschadstoffen zu tun habe, von der Wissenschaft nahezu einhellig verworfen wurden, blieb er seiner Linie treu. Die »globale Erwärmung«, so hatte Vanessa noch einen Satz von ihm im Ohr, sei eine »neue Religion geworden«, weil man sie nicht anzweifeln dürfe. Das war jetzt gewiss Musik in Donald Trumps Ohren.
Die Frau, die sich bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit von keinerlei Ideologie leiten ließ, sondern einzig und allein von objektiven Daten, war bei den distinguierten älteren Herrschaften der etablierten Forscherelite anfangs auf vornehme Zurückhaltung gestoßen – und dies, obwohl sie dem allgemeinen Mainstream der Klimaforschung entsprach. Als es ihr innerhalb kürzester Zeit gelang, zusammen mit ihrem Freund, einem Astro-Physiker, ein Experiment zu entwickeln, das aus dem Weltall die Verteilung des Kohlendioxids in der Erdatmosphäre nicht nur aufzeigen, sondern über ein ausgeklügeltes elektronisches Messverfahren auch winzigste chemische Reaktionen und deren Auswirkungen auf die äußeren Luftschichten analysieren konnte, da war das Interesse an ihr plötzlich gestiegen. Vollends ins Scheinwerferlicht rückte sie, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass ihr Experiment bei allen Auswahlverfahren als würdig betrachtet worden war, zur ISS gebracht zu werden. Auch dank vielfältiger Beziehungen hatte sie geschafft, wovon viele ihrer Kollegen aus der Forschung nur träumen konnten. Ganz besonders freute es sie, dass ihre Entwicklung dabei sogar von einem deutschen Astronauten betreut wurde, der genau wie sie aus Baden-Württemberg stammte, nur etwa 200 Kilometer von Ulm entfernt.
Außerdem sollte während Gersts Weltraummission ein Umweltprojekt des Radolfzeller Max-Planck-Instituts für Ornithologie installiert werden, mit dem die Wanderbewegungen von Tieren erforscht würden. Selbst Schmetterlinge, die mit winzigen, federleichten Minisendern ausgestattet waren, konnten dann vom Weltall aus verfolgt werden. »Icarus« wurde dieses Projekt genannt.
Dass sich nun viele Wissenschaftler und Klimaforscher auch für Vanessas Projekt interessierten, war sie mittlerweile gewohnt. Doch dieser Anruf eines Mannes, der vorgab, im Auftrag der NASA »einige Details« besprechen zu müssen, hatte sie stutzig gemacht. Am Display war keine Rufnummer übertragen worden und der Mann, der sich als Doktor Robert Olberding vorgestellt hatte, war nur bereit gewesen, ihr eine Handynummer zu geben – von einem deutschen Mobilfunknetz.
Als Treffpunkt hatte er ein Bürocenter beim Stuttgarter Flughafen vorgeschlagen und erklärt, er werde mit dem Flugzeug anreisen und müsse nach dem Gespräch sofort weiter. Deshalb sei es ihm zeitlich nicht möglich, zu ihr ins rund 100 Kilometer entfernte Ulm zu kommen.
Er habe für die Dauer von zwei Stunden einen Besprechungsraum angemietet. Nie zuvor hatte sich Vanessa Eickhoff auf Treffen dieser Art eingelassen. Und obwohl sie skeptisch war, genoss sie es inzwischen, eine begehrte Gesprächspartnerin geworden zu sein. Wenn es stimmte, dass Olberding mit der NASA zu tun hatte, dann konnten solche Kontakte nicht schaden.
Das Bürocenter lag direkt neben der B 27, nur ein kurzes Stück von der Landebahn des Stuttgarter Flughafens entfernt. Nachdem sie ihren dunkelgrauen Mercedes GLC in einem Parkhaus abgestellt hatte, meldete sie sich am Empfang des Gebäudes und wurde von einer jungen, leichenblass geschminkten Frau zu einem Aufzug geleitet, mit dem sie beide schweigend zwei Stockwerke hochfuhren. Vanessa hatte keine Lust auf Konversation und ließ sich über einen hellen Vorplatz zu einem der Büros führen, die sich in dieser Etage offenbar schmucklos aneinanderreihten. Nach kurzem Klopfen öffnete die Angestellte die Tür und sagte knapp: »Herr Doktor Olberding – Ihre Besucherin ist jetzt da.« Dann verschwand sie wieder und Olberding kam strahlend auf Vanessa zu. »Herzlich willkommen, Frau Doktor Eickhoff, ich bin hocherfreut, Sie zu sehen.« Er drückte ihr die Hand und bot ihr einen Platz an dem kleinen Besprechungstisch an, auf dem zwei Gläser und eine Flasche Mineralwasser standen. Alles um sie herum wirkte steril, dachte Vanessa. Helle Vorhänge, ein ziemlich farbloses abstraktes Bild an der Wand, ein weißes Schränkchen als Ablage.
Olberding entsprach ziemlich genau dem Typ Mann, den sie sich nach dem Telefongespräch vorgestellt hatte: um die 50, Anzugträger, Krawatte, korrekter Haarschnitt mit einem Schuss Gel, leicht angegraut, ein herbes Parfüm, groß, breitschultrig. Die Gesichtsfarbe vermutlich aus dem Bräunungsstudio. »Es war natürlich eine Anmaßung von mir, Sie von Ulm hierher nach Stuttgart zu beordern«, sagte er mit leicht amerikanischem Akzent, während er sich setzte und die Gläser mit Wasser befüllte. Es klang ziemlich selbstbewusst und überheblich.
»Von ›herbeordern‹ kann keine Rede sein«, stellte Vanessa kühl fest. So, wie sie in ihrem schwarzen Hosenanzug vor ihm gestanden war, groß und schlank, hatte sie schon rein optisch gleich gar keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wie sie Machos zu begegnen pflegte. »Ich hab ohnehin in Stuttgart zu tun«, log sie überzeugend. »Meine Zeit ist deshalb eng bemessen, kommen wir also gleich zur Sache.«
Olberding war überrascht. Sie hatte ihm wohl klargemacht, dass sie sich mit ihm durchaus auf Augenhöhe unterhalten konnte. Er stellte die Flasche zurück und lächelte wieder. »Nun ja, gnädige Frau, es ist mir natürlich eine Ehre, eine so erfolgreiche junge Wissenschaftlerin treffen zu dürfen.«
Vanessa musterte ihn mit versteinerter Miene. »Kommen wir zur Sache«, forderte sie noch einmal und nahm einen Schluck Wasser.
»Nun ja«, er räusperte sich. »Ihre Entwicklung hat in der Fachwelt für großes Aufsehen gesorgt. Es ist anzunehmen, dass damit die Diskussion um die globale Klimaveränderung noch weiter angeheizt wird.«
»Ich wüsste nicht, was es darüber noch zu diskutieren gibt«, konterte sie eine Spur unterkühlter, überlegte kurz und stellte fest: »Sie haben am Telefon gesagt, Sie hätten etwas mit der NASA zu tun. Soweit ich weiß, ist die Mission, die jetzt unmittelbar bevorsteht, eine Sache der ESA, der Europäer.«
Über seine rechte Wange huschte ein überhebliches Lächeln. »Die Europäer, ja«, echote er, »die sollten nicht vergessen, wer die ISS federführend auf den Weg gebracht hat.«
»Und Sie sollten nicht vergessen«, fuhr sie ihm über den Mund, »dass die NASA seit Jahren überhaupt kein Vehikel mehr hat, um einen Astronauten auch nur einen einzigen Meter von der Erdoberfläche hochzuheben.« Sie grinste und genoss es wieder einmal, einem Mann Kontra gegeben zu haben. »Also«, drängte sie energisch, »was ist nun der Zweck unseres Meetings?«
Olberding spielte nervös mit einem Kugelschreiber. Er hatte sich offenbar verschätzt. Die junge Frau ließ sich nicht so einfach einschüchtern. »Oh, verzeihen Sie«, wurde er deshalb eine Nuance höflicher, »ich habe das Vergnügen, eine Institution zu vertreten, die so etwas ist wie die diplomatische Vertretung der NASA.«
»Ach«, staunte Vanessa, »um ehrlich zu sein, von einer solchen Einrichtung hab ich noch gar nichts gehört.«
»Können Sie auch nicht. Unsere Aufgabe besteht nur darin, zivile Kontakte zu knüpfen zu Industrie und Wirtschaft oder sonstigen Institutionen, um die Nutzlasten für die ISS zu koordinieren.«
»Sind Sie wissenschaftlich tätig? Oder Lobbyist?«
»Nein, ich bin kein Wissenschaftler, aber wie Sie gewiss selbst erfahren haben, ist der Andrang, ein Experiment für die ziemlich beschränkte Nutzlast eines Transports zur ISS unterzubringen, sehr groß …«
»… und das Auswahlverfahren nicht gerade einfach«, unterbrach ihn Vanessa leicht gereizt. Sie musste sich zusammennehmen, um nicht laut hinauszuschreien, dass ihr dieses Geschwätz höchst zuwider war. »Falls Sie gekommen sind, um mit mir etwas zu koordinieren, dann kommen Sie ein Dreivierteljahr zu spät.«
Er presste die Lippen zusammen. »Natürlich ist uns bekannt, welch hohe Investition um Ihr Experiment getätigt wird, aber Ihnen ist sehr wohl bewusst, dass es auch jene Ergebnisse erbringen muss, die Sie sich erhoffen. Wenn nicht, dann werden die Kritiker des Klimawandels Oberwasser kriegen.«
»Ja, und dies ist in erster Linie Ihr ›sehr verehrter‹ Mister President«, keifte sie.
»Darum geht es überhaupt nicht«, blieb Olberding ruhig. »Aber ist es nicht ein bisschen viel Aufwand, um ein Ergebnis zu erzielen, das für Sie und wahrscheinlich viele andere von vorneherein feststehen muss? Die Geldgeber werden wohl kaum Millionen in den Wind schießen wollen, um sich ihre eigenen, jahrelang schön zurechtgelegten Mainstream-Theorien von Ihnen zunichtemachen zu lassen.«
Vanessa ballte ihre linke Hand zu einer Faust und versteckte sie unterm Tisch. Sie hatte in den vergangenen Jahren bei unzähligen Konferenzen gelernt, Emotionen zu verbergen. Aber jetzt fiel es ihr besonders schwer. Hatte dieser Kerl doch gerade deutliche Zweifel an ihrer wissenschaftlichen Reputation geäußert und ihr Kumpanei mit den Geldgebern vorgeworfen – als ob sie sich dafür bezahlen ließe, den globalen Klimawandel auch dann als realistisch darzustellen, falls doch ernsthafte Fakten dagegensprächen.
Vanessa hob eine Augenbraue und nahm ihr Gegenüber angriffslustig ins Visier. »Sie wollen mir unterstellen, dass es uns nur einseitig darum geht, Argumente für die globale Erwärmung zusammenzuschustern – und dies so hieb- und stichfest, dass auch ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nicht daran vorbeikommt?«
Olberding winkte ab und lehnte sich lässig zurück. Auf seiner Stirn glitzerten Schweißperlen. »Vielleicht möchte ich Sie, die Wissenschaft und alle, die an dem Experiment der ISS beteiligt sind, vor einer Blamage bewahren, Frau Doktor Eickhoff. Sehen Sie das mal so.«
Die junge Frau ließ sich nicht beeindrucken. »Und jetzt werden Sie mir gleich sagen, ich solle mein Experiment zurückziehen.«
Er lächelte und lockerte seinen Krawattenknoten. »Oh nein, gnädige Frau. Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass nicht alles, was heute die so weit verbreiteten Populisten, egal welcher Couleur, als Tatsachenbehauptung hinstellen, auch gleich wissenschaftlich untermauert werden muss – wenn Sie versteh’n, was ich meine.«
»So?«, machte Vanessa interessiert weiter. »Vielleicht sollten wir mal bei den angeblichen Tatsachenbehauptungen des Herrn Trump anfangen. Aber für diesen Herrn sind ja alle Fakten, sobald sie nicht in sein etwas merkwürdiges Weltbild passen, nur Fake-News. Hab ich recht?«
»Um es klar zu sagen, Frau Doktor Eickhoff«, wurde Olberding jetzt leicht verstimmt. »Sie sollten sich nicht für so wichtig nehmen und mutmaßen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika würde sich höchstpersönlich für Sie interessieren.«
»Warum eigentlich nicht?«, zeigte sich Vanessa bissig. »Dafür ist er doch bekannt, der Herr Trump – dass er sich für Frauen interessiert. Muss ich zitieren, was auf der Tonspur eines Videos aus dem Jahre 2005 zu hören ist?« Die junge Frau war damals so empört gewesen, dass sie die entscheidende Textstelle aus der Zeitung noch immer parat hatte: »Als Star könne man alles machen. ›Pack ihnen an die Muschi. Du kannst alles machen.‹« Vanessa wurde energisch: »Falls er wirklich hinter Ihrem Auftauchen hier steckt, dann sagen Sie ihm: Mit dieser Vanessa Eickhoff kann er solche Spielchen nicht machen. Solche nicht – und andere auch nicht.«
Olberding war nun sichtlich überrascht und innerlich aufgewühlt, weshalb er sich zu einer Bemerkung hinreißen ließ, die er Augenblicke später am liebsten gleich wieder zurückgezogen hätte: »Manchmal spielt man mit dem Feuer, ohne es zu merken, Frau Doktor Eickhoff. Denken Sie einfach mal an Columbia und Challenger.«
Vanessa Eickhoff fühlte sich wie vom Donner gerührt. Was hatte der Mann soeben gesagt? War das jetzt ein böser Traum oder ein schlechter Film? Drei Sekunden eisiges Schweigen. Natürlich wusste sie, was er meinte: Es waren die Namen zweier Spaceshuttles, die verunglückt waren: die Raumfähre Challenger im Januar 1986 und die Columbia im Februar 2003.
Olberding räusperte sich. »Wäre es nicht besser, Sie persönlich würden sich deshalb auf Ihre Blümchen in Heilbronn konzentrieren – anstatt auf das ganze Drumherum?« Er lächelte überlegen. »Vor allem das Drumherum, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn man sich allzu viel um Nebensächlichkeiten kümmert, könnte das Wichtigste aus den Augen verloren werden.« Er sah sie eindringlich an. »Sie wollen doch auch, dass Ihr Weltraumexperiment gelingt, oder nicht?«
Vanessa hatte es buchstäblich die Sprache verschlagen, weshalb er nachsetzen konnte: »Wenn man zu viele Eisen im Feuer hat, könnte leicht eines davon außer Kontrolle geraten. Oder das eine Eisen, weil es zu heiß geworden ist, das andere verbrennen.« Er spürte, wie sie innerlich kochte, womit er erreicht hatte, was er wollte, und sie vollends zum Siedepunkt brachte: »Vielleicht sollten Sie ein Feuer löschen, bevor es ein anderes gefährdet, Ihr Lieblingsprojekt.«
Vanessa sprang auf und verließ wortlos, aber türenschlagend, das Büro.
4
»Es wird was ganz Großartiges.« Die Frau, die an diesen eiskalten Spätwintertagen 2018 so euphorisch werden konnte, war diplomierte Landschaftsarchitektin und Inhaberin eines renommierten Fachbüros, das für einen Teilbereich der Bundesgartenschau im nächsten Jahr in Heilbronn verantwortlich war. Maleike Cortes, Mitte 40, sportlich-elegante Erscheinung und nicht nur am Computer eine begnadete Gestalterin, sondern auch draußen im Gelände, wo ihr zwischen Baumaschinen und kleinen Humushaufen gerade eisiger Wind entgegenschlug. Ihre zwei Dutzend Mitarbeiter schätzten es besonders, dass sie sich selbst bei miesestem Wetter nicht zu schade war, selbst irgendwo mit anzupacken.
Dass sie einen so großen Auftrag hatte an Land ziehen können, empfand sie als besondere Ehre. Schließlich war eine Bundesgartenschau nicht irgendeine gewöhnliche Blumen- und Pflanzenausstellung, sondern immer auch ein Projekt, mit dem eine Stadt ihr Erscheinungsbild auf ganz besondere Weise aufpolieren konnte. Hier in Heilbronn hatte man die Chance ergriffen, das sogenannte Fruchtschuppen-Areal, ein ehemaliges Hafen- und Industriegelände, völlig neu zu gestalten. »Ich will keine Nullachtfuffzehn-Geschichte«, pflegte sie immer wieder zu sagen, wenn sie mit ihren überwiegend jungen Mitarbeitern die Umsetzung der Pläne bis ins kleinste Detail diskutierte und – wie heute – direkt vor Ort ihre weiteren Vorstellungen erläuterte. Ihre Zuhörer waren in dicke Winterkleidung gehüllt, mit klammen Fingern versuchten sie, großformatige Pläne aus dem böigen Wind zu halten oder auf Tablets Daten abzurufen. »Dieser kleine Weinberg ist eine super Idee«, lobte sie, nachdem sie sich alle vor den Rebstöcken versammelt hatten, die bisher offenbar gut durch den Winter gekommen waren. Nebenan, im »Inzwischenland«, schienen auch die 1.700 dicht aneinanderstehenden und bereits zwei Meter hohen Pappeln zu gedeihen.
Einer der jungen Männer, der als Praktikant zum ersten Mal an einer solchen Besprechung teilnahm, konnte sich eine kritische Bemerkung nicht verkneifen: »Das mit den Pappeln ist zwar originell, aber problematisch. Ich kann mir schon jetzt vorstellen, was es für einen Aufschrei geben wird, wenn die schönen Bäume nach der Buga abgeholzt werden.«
»Das ist nicht von der Hand zu weisen«, nickte die Chefin ernst. »Deshalb nennen wir den Bereich ja auch ›Inzwischenland‹ – womit jedem klar sein muss, dass diese Pappeln nur eine begrenzte Zeit stehen. Wir wollen damit die energetische Verwendung von Holz als regenerativen Energieträger thematisieren.« Wie immer verstand sie es auch diesmal wieder, kritischen Nachfragen eine humoristische Seite abzugewinnen: »Bloß wenn sich dort der Juchtenkäfer ansiedelt, wird’s ein Problemfall für uns.« Sie spielte schmunzelnd auf jenen legendären und streng geschützten Krabbler an, der den Erbauern des Stuttgarter Bahnhofsprojekts schwer zu schaffen gemacht hatte.
Gerade jetzt war vom nahen Heilbronner Bahnhof das Geräusch eines einfahrenden Zuges zu vernehmen. »Ich glaube«, meldete sich eine mit Schal dick eingepackte junge Frau zu Wort, »wir sollten eher die aktuellen Probleme angehen. Die Sache mit den Rosen …«
Maleike Cortes zögerte für einen Moment, nickte kurz und drehte sich wieder zu den Reben. »Wie ich schon ein paarmal gesagt habe: Alles, was wir hier machen, muss etwas Besonderes sein. Nichts soll so sein, wie es anderswo schon war. Wir wollen keinen Abklatsch der früheren Bugas, sondern neue Farbkompositionen, neue Ideen.«
»Aber die Lieferanten«, warf ein ziemlich korpulenter Mitarbeiter ein, »werden sich an das klammern, was bisher schon …«
»Was bisher war«, fuhr ihm Frau Cortes schnell über den Mund, »das interessiert uns nicht. Wir wollen bei uns in Heilbronn etwas Exklusives. Keine Sorge, das steh’n wir durch. Außerdem wird sich auch Frau Doktor Eickhoff für uns starkmachen. Es war gut, dass wir sie mit an Bord geholt haben. Externe sind es gewohnt, etwas energischer aufzutreten als wir. Die brauchen sich nicht mit so viel Befindlichkeiten herumzuschlagen.«
Der Korpulente, der viel älter erschien, als er war, runzelte die Stirn und grinste. »Wenn’s um viel Kohle geht, könnte mancher auch versuchen, seine Aufträge über ein Hintertürchen zu holen.«
Maleike ließ sich nicht beirren und wurde deutlich: »Bei uns nicht, Herr Plasser. Das ist bisher nicht geschehen und das wird auch jetzt nicht mehr passieren. Das dürfen Sie mir glauben. Ich werd mir hinterher nicht nachsagen lassen, irgendeinen Lieferanten bevorzugt zu haben. Von wegen Korruption und so. Vergessen Sie nicht, wenn’s nachher ans Abrechnen dieses Projekts geht, werden die ›Kontrollskis‹ in ihren Amtsstuben jede Rechnung zehnmal prüfen.« Sie ging schnell weiter – den sanften, künstlich aufgeschütteten Hügel hinauf zu dem Erdwall, der das Gelände von der jenseitigen Industriebahn trennte. Der eisige Wind pfiff ungewöhnlich rau aus östlicher Richtung.
Die meisten Mitarbeiter, die bereits seit dem ersten Spatenstich 2013 mit dem Projekt befasst waren, staunten immer wieder, wie schnell sich das Gelände verändert hatte. Und schon in einem halben Jahr musste alles so weit fertig sein, dass sämtliche Außenanlagen noch vor dem nächsten Winter vollends hergerichtet werden konnten, um den Besuchern am Eröffnungstag, dem 17. April 2019, eine prachtvolle Frühlingsblumenlandschaft präsentieren zu können. Für insgesamt 173 Ausstellungstage ein immenser Aufwand – der sich aber nach Überzeugung aller lohnte, wurde damit doch Nachhaltiges geschaffen.
Plasser, der Korpulente, hatte Mühe, den Anstieg zum Erdwall schwer atmend hinter sich zu bringen. Vor fünf Jahren war er schon dabei gewesen, als das Grünflächenamt der Stadt damit begonnen hatte, Mauereidechsen in einen Bereich außerhalb des Baugeländes umzusiedeln. Später war auch für Zauneidechsen eine neue Habitatfläche gefunden worden. Seltsam, dachte Plasser, dass sich diese Tierchen meist gerne in der Nähe von alten Eisenbahnanlagen ansiedelten. Ihnen hatte es eben der Gleisschotter besonders angetan.
»Jetzt kommt erst die filigrane Arbeit«, hörte er die Teamleiterin sagen, als er endlich die Gruppe wieder eingeholt hatte. »Sagen wir mal so: Die Hardware ist geschafft, nun kommt die Software – unsere eigentliche Aufgabe.«
Anhand eines großformatigen Plans, den vier Mitarbeiter auseinandergefaltet hatten und an dem nun der Wind heftig zerrte, schilderte sie, wie sie sich die Bepflanzung rund um die beiden künstlichen Seen vorstellte. »Und da lassen wir uns von niemandem reinreden«, betonte sie. »Das muss bei der Eröffnung so aussehen, als sei das schon immer so gewesen.«
Sie alle wussten, dass die Wasserflächen an die früheren drei Hafenbecken erinnern sollten – an Karl-, Floß- und Winterhafen. Man hatte sie vor Jahrzehnten bereits zugeschüttet. Als sie jetzt wieder ausgebaggert wurden, trat Seltsames ans Tageslicht: ein Neckarkahn, ein kompletter Eisenbahnwaggon für Stückgut, 120 Gasflaschen und ein leerer Tresor. Auch sonst war man bei den Tiefbauarbeiten nie davor gefeit gewesen, auf Unerwartetes oder Mysteriöses zu stoßen – ganz zu schweigen von Bomben, Granaten und Minen aus dem Zweiten Weltkrieg. Als am 4. Dezember 1944 die Briten einen Luftangriff auf Heilbronn geflogen hatten, waren fast zwei Drittel der Stadt zerstört worden, darunter die gesamte historische Innenstadt. 6.500 Menschen kamen ums Leben. Nach dem Krieg war sogar daran gedacht worden, die Stadt an anderer Stelle komplett neu aufzubauen.
Das Fruchtschuppen-Areal – darüber hatten sich die Gartenschau-Planer ausgiebig informiert – war ziemlich konzeptlos und unkoordiniert wiederbesiedelt worden. Höchste Zeit also, es völlig umzukrempeln. Mit nahezu jeder Baggerschaufel aber, so hatte sich seit Baubeginn gezeigt, war auch deutlich geworden, wie sehr mit der Umwelt Schindluder getrieben worden war. So tauchte eines Tages auch ein leckgeschlagener Tank mit Schweröl auf. Insgesamt war man auf 300 Tonnen Schrott gestoßen. Die jungen Mitarbeiter des Planungsbüros hatten sich jedenfalls gewundert, dass nicht auch noch skelettierte Leichen entdeckt worden waren.
In derlei Gedanken versunken, folgte Plasser wieder den anderen, die viel zu schnell, wie er es empfand, hinüber zum Neckarufer gingen, wo einst die aufgegebene Kalistraße vorbeigeführt hatte. Sie hätte das Buga-Areal vom Fluss getrennt, der nun wieder erlebbar gemacht wurde.
»Romantisch und ideal zum Flanieren«, schwärmte Maleike Cortes vor sich hin, wohl wissend, dass die momentane Wetterlage nicht gerade zu einem Spaziergang einlud. Sie alle kannten natürlich noch den verwilderten Zustand des diesseitigen Ufers. Man hatte den Neckar wirklich jahrzehntelang ziemlich stiefmütterlich behandelt. Inzwischen waren diese Sünden schon weitgehend ausgemerzt und es wurde dem Betrachter veranschaulicht, dass sich hier, bei der historischen, noch von Hand betriebenen Schleuse, der weiter flussaufwärts abgezweigte Wilhelmskanal wieder mit dem Alt-Neckar vereinigte. Dieser Kanal, der heute das Hafenbecken der Sportboote darstellte, diente früher dazu, die Mühlen zu umgehen, die am parallel fließenden Alt-Neckar lagen. Statt ihrer staute dort nun das Wasserkraftwerk der ZEAG Energie AG den Fluss auf – vom Wilhelmskanal getrennt durch die schmale Kraneninsel.
Die Berufsschifffahrt benutzte hingegen den breiten Neckar, die sogenannte Hauptschifffahrtsstraße, die vor rund 90 Jahren angelegt wurde und heute den eigentlichen Hafen darstellt, an dem die Frachtschiffe anlegen können. Hier fließt das meiste Wasser abseits des Stadtzentrums an Heilbronn vorbei. Längst war der Neckar zwischen seiner Mündung in den Rhein bei Mannheim einerseits und Plochingen andererseits auf eine Länge von 203 Kilometern schiffbar.
Maleike Cortes hatte sich tief in die Geschichte des Neckars eingelesen und musste oft an die noch kühneren Pläne denken, die bis 1978 offenbar aktuell gewesen waren: Man hatte den kanalisierten Neckar bis Göppingen – unter Einbeziehung der Fils – weiterführen und letztlich eine Verbindung zur Donau bei Ulm herstellen wollen. Und dies über die Schwäbische Alb hinweg. In Geislingen (Steige) waren sowohl eine Untertunnelung des Mittelgebirges als auch ein Schiffshebewerk ins Auge gefasst worden. Ziemlich verrückte Pläne, dachte Maleike jedes Mal, wenn sie sich derlei Aufwand für eine Wasserstraße vorstellte. Da war es vergleichsweise einfach, eine neue Eisenbahnstrecke über die Schwäbische Alb zu bauen – wie es derzeit geschah.
Maleike verdrängte all diese Gedanken. Um sich aufzuwärmen, eilte sie nun immer schneller voraus – hinüber zur Bleichinselbrücke, die den Neckar unweit jener Stelle querte, an der der Wilhelmskanal mit seiner historischen Schleuse in den Alt-Neckar mündete.
»Nur noch schnell einen Blick auf die Parzellen der Friedhofsgärtner«, kommentierte sie die eingeschlagene Richtung. Dort, direkt am Ufer, gegenüber vom Rollsportstadion, das sich beim nahen Europaplatz rechts in eine Parkanlage duckte, konnten sich Friedhofsgärtner mit der Gestaltung von Gräbern präsentieren. Wer von den vielen Bewerbern zu dieser Ehre kam, hatte man durch ein entsprechendes Auswahlverfahren festgelegt. Für sie war die Teilnahme an der Buga sogar eine Art Wettbewerb, weil die Gräber letztlich von einer Jury bewertet wurden. Ein vorderer Platz war auch der Werbung fürs eigene Geschäft dienlich.
»Da ist der Konkurrenzkampf groß«, kommentierte Maleike, nachdem sie ihren Mitarbeitern noch einmal den Lageplan der einzelnen Gräber erläutert hatte. Noch war hier nur aufgeweichtes Erdreich zu sehen, das sich dick und schwer an die Schuhe klammerte. Ein Radlader hatte tiefe Spuren hinterlassen.
Dann wurde die Planerin von einem Handyanruf unterbrochen. Sie meldete sich, lauschte kurz und sagte dann in die fröstelnde Runde: »Tut mir leid. Ich muss weg. Wir sehen uns.« Mit jedem Wort kondensierte ihr Atem in der kalten Winterluft.
Schnellen Schrittes eilte sie über die morastige Böschung zur Brücke hinauf, um das umzäunte Gelände zu verlassen. Auf dem abgesperrten Teil der Straße parkte ihr rotes Mercedes SLK-Cabrio, bei dessen Anblick sie stutzte: Hinterm Scheibenwischer des Fahrersichtfeldes steckte ein schmaler, länglicher Gegenstand. Instinktiv verlangsamte sie ihre Schritte, um dann zu erkennen, worum es sich handelte: um eine merkwürdig anmutende Blume. Eine schwarze. Eine Rose. Und der Stiel unterhalb der Blüte geknickt.
5
Was wusste dieser Robert Olberding – und worauf hatte er angespielt? Diese Frage plagte Vanessa Eickhoff, seit sie den Mann vor einigen Wochen, türenschlagend, hatte sitzen lassen. Wäre es nicht besser gewesen, sich seinen Andeutungen zu stellen? Eine böse Ahnung machte sich in ihr breit. Natürlich, es war eine versteckte Drohung gewesen.
Aufgewühlt und von tausend schlimmen Gedanken zermürbt, warf sie ihre schulterlangen schwarzen Haare nach hinten. Sosehr sie auch bei Google klickte, der Monitor erbrachte nicht, was sie erhofft hatte. Zum Namen »Robert Olberding« ließ die Suchmaschine zwar wissen, dass es rund 91.400 »Ergebnisse« gebe, aber wohl keines, das mit der NASA in Verbindung zu bringen war. Je mehr die junge Wissenschaftlerin recherchierte, desto ärgerlicher wurde sie über sich selbst. Weshalb hatte sie sich auch so blauäugig auf dieses Treffen in Stuttgart eingelassen? Warum hatte sie nicht zuvor schon im Internet recherchiert? Auch hätte eine kurze Rückfrage bei den Verantwortlichen der ESA ausgereicht, um Gewissheit zu bekommen. Jetzt aber hatte man sie einfach überrumpelt. Und sie war, weil sie sich vom Interesse eines NASA-Vertreters geschmeichelt gefühlt hatte, geradezu laienhaft darauf hereingefallen. Was konnte dieser angebliche Olberding nicht alles sein? Ein Spion? Ein Terrorist? Oder einer, der sie tatsächlich nur einschüchtern wollte, um sie von etwas abzuhalten, was sie seit einigen Wochen bewegte, sie aber zu verdrängen versuchte.
Wie war die Bemerkung des Mannes zu verstehen, es könne leicht eines der vielen »Eisen im Feuer« außer Kontrolle geraten? Je mehr sie darüber nachdachte, desto stärker machte sich das Gefühl breit, das Interesse des Mannes an ihrer wissenschaftlichen Arbeit könnte nur vorgeschoben gewesen sein.
Nun musste sie sich eingestehen, einen dilettantischen Fehler begangen zu haben. Vielleicht war sie allzu leichtfertig und sorglos an ihre Aufgabe herangegangen – beflügelt von ihrer erfolgreichen Forschungsarbeit zum Klimaschutz.
In wessen Auftrag war dieser Olberding unterwegs? Hatte jemand tatsächlich Interesse daran, sie an ihrer Arbeit zu hindern? An jener für den Klimaschutz – oder an ihrem Engagement, im Sinne von Umwelt und Natur an der Planung für die Bundesgartenschau mitzuarbeiten? Oder …?
Sie verwarf den Gedanken, womöglich ins Visier von Agenten geraten zu sein – um im selben Moment von einer inneren Stimme ermahnt zu werden, dass ihr Wohnort Ulm als Wissenschaftsstadt gewiss ein Ziel von Spionen war, die sich für innovative Entwicklungen interessierten. Außerdem war draußen in der Weststadt eines der größten Rüstungsunternehmen dieser Republik angesiedelt, das sich mit der Entwicklung von Radarsystemen befasste, die sogar Flugzeuge aufspüren konnten, die sich gegen herkömmliches Radar tarnten. Wesentliche Produkte dieses Unternehmens, so hatte Vanessa einmal gelesen, waren Primärradar, Sekundärradar und Passivradar. Sie konnten Drohnen aufspüren und abwehren sowie Funknetze mit einem Störsender außer Gefecht setzen und Fernzündungen von Bomben verhindern. Den Fahrzeugkonvois, die damit ausgerüstet waren, hatten sie den Namen »Jammer« gegeben – nach dem englischen »jam« (Blockierung). Alles höchst geheim natürlich. Für einen Moment musste sie an ihren Vater denken, der sich einstens gegen alles gestellt hatte, was eine militärische Konfrontation hätte auslösen können. Damals, in den frühen 80ern, als er Vorkämpfer gegen die am Stadtrand von Heilbronn – auf der Waldheide – stationierten amerikanischen Atomraketen gewesen war.
Aber was, so überlegte Vanessa zum wiederholten Male, war an ihrer Entwicklung zur Erforschung des Klimawandels derart wichtig, dass sich Agenten, offenbar amerikanische, dafür interessierten? Als äußerst beunruhigend empfand sie den Hinweis auf die beiden verunglückten Raumfähren. Wie gut dieser angebliche Olberding über alles Bescheid wusste, hatte ja allein schon die Bemerkung bewiesen, sie solle sich doch lieber um die »Blümchen in Heilbronn« kümmern. Also doch ein versteckter Hinweis auf diese Tätigkeit? Hatte die Drohung möglicherweise mit ihrer Arbeit in Heilbronn zu tun? Etwas, was damit zusammenhängen könnte?
Vanessa beschloss, sich dem Leiter ihrer wissenschaftlichen Forschungsgruppe anzuvertrauen – und auch ihre direkte Ansprechpartnerin bei der Bundesgartenschau, Maleike Cortes, einzuweihen. Die Freude über ihr erfolgreiches Projekt war mit einem Schlag getrübt.
6
Luftlinie 4.000 Kilometer östlich, in der Steppe von Kasachstan. Die bitterkalten Wintertage mit ihren unbarmherzigen Schneestürmen gehörten noch lange nicht der Vergangenheit an. Man schrieb erst den 12. Februar – und der Frühling war noch weit. Irgendwo dort im Nirgendwo, in der Weite dieser lebensfeindlichen Ebene, wo im Sommerhalbjahr starke Winde den grau-bräunlichen Sand aufwirbelten, jetzt aber tiefer Frost herrschte, hatte die Sowjetunion Ende der 50er-Jahre eine Ansiedlung aus dem Boden gestampft, die bis heute kaum einen Touristen anzog. Wäre da nicht der mächtige Fluss Syrdarja, gäbe es in dieser Einöde kaum etwas, an dem sich das Auge des Besuchers festhalten könnte.
20 Kilometer nördlich der Stadt befand sich jedoch das Kosmodrom, der größte Raketenstartplatz der Welt. Weitaus größer als das amerikanische Cap Caneveral in Florida – und inzwischen auch viel bedeutender. Denn seit die NASA im Juli 2011 nach insgesamt 135 Starts ihre zuletzt noch drei Shuttles eingemottet hatte, konnten bemannte Missionen zur Internationalen Raumstation ISS nur noch mit den russischen Sojus-Raketen erfolgen – hier, von Baikonur aus. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1992 lag dieser Weltraumbahnhof allerdings nicht mehr auf Russlands Territorium – sondern im selbstständigen Staat Kasachstan. Um den Startplatz weiterhin nutzen zu können, bezahlten die Russen alljährlich 200 Millionen Euro Miete. Deshalb hatten sie inzwischen auf eigenem Staatsgebiet eine neue Anlage errichtet – weit weg, in Wostotschny, nahe der chinesischen Grenze.
Noch freilich war Baikonur das Tor zur Internationalen Raumstation. Doch wer als Zuschauer zu einem Raketenstart kam, hatte entweder gute Beziehungen oder er zählte zu den VIPs, die auf Einladung der Raumfahrtagentur jenes Landes, das für die jeweilige Mission zuständig war, anreisen konnten. Im Gegensatz zum Cape Canaveral, wo der Tourismus boomte, fehlte es in Baikonur an der nötigen Infrastruktur. Raketenstarts waren nie als Touristenmagnet gesehen worden. Einer der früheren deutschen Astronauten hatte es einmal so formuliert: »Einige Sachen sind bei den Russen anders, aber nicht schlechter.« Und Alexander Gerst, der jetzt zum zweiten Mal zur ISS fliegen sollte, hatte einstens von Baikonur geschwärmt und gesagt, es sei »schöner als erwartet«. Der große Fluss und die Wüstenlandschaft böten eine »großartige Atmosphäre«.
Für so etwas hatten die drei Männer, die zu einer Delegation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gehörten, keinen Blick. Sie waren als Missionsmanager angereist, um den Start der nächsten Sojus-Kapsel vorzubreiten. Immerhin sollten damit Gerst und seine beiden Kollegen bereits Ende April starten. Hier draußen am Kosmodrom waren die Vorbereitungen planmäßig gelaufen, doch dann hatte man den Start plötzlich auf den 6. Juni verschoben. Angeblich, um japanischen Astronauten, die sich derzeit auf der Internationalen Raumstation befanden, mehr Zeit zum Forschen zu geben. Immerhin habe Japan mit einem finanziellen Anteil an der ISS von knapp 13 Prozent mehr Mitspracherecht als Europa mit seinen mickrigen 8 Prozent. So jedenfalls hatte die NASA argumentiert und auf die Verschiebung gedrängt.
»Was auch immer sonst dahinterstecken mag«, meinte der deutsche Missionsmanager, der von der ärgerlichen Terminänderung erfahren hatte. Sie würden auf jeden Fall noch einmal heimfliegen.
Wenn nicht wieder etwas dazwischenkam, dann würde die Sojus-Rakete also erst am 6. Juni von Startrampe LC 1 mit Gerst und den beiden anderen Wissenschaftsastronauten Sergej Prokopjew und Serena Auñón-Chancellor als nächste ISS-Besatzung abheben.
Immerhin galt die Sojus, die in den vergangenen 40 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt worden war, als dienstältestes und meistgeflogenes Modell der Welt. Inzwischen hatte es schon mehr als 850 Starts gegeben – und seine Zuverlässigkeit wurde mit 97,5 Prozent angegeben. Das Restrisiko war demnach verschwindend gering. Immerhin hatten die Amerikaner von ihren einst fünf Shuttles zwei verloren.
Vorige Woche allerdings, das hatten alle in Baikonur mit Interesse verfolgt, war in Cape Canaveral die größte derzeit aktiv genutzte Weltraumrakete abgeschossen worden. Nicht von der NASA, sondern von dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX, dessen Chef Elon Musk war, der Produzent des Elektroautos Tesla. Seine »Falcon Heavy«-Rakete konnte mehr als 60 Tonnen Nutzlast ins All transportieren. »Ein richtiger Himmelhund, dieser Musk«, meinte einer der Männer, die sich in Baikonur darüber lustig machten, dass Musk mit einer Rakete ein rotes Tesla-Cabrio hochgeschossen hatte. Der Plan, es zum Mars zu bringen, musste jedoch gleich nach dem Start aufgegeben werden, weil der Kurs nicht eingehalten werden konnte. Nun würde die Rakete mit dem Auto für eine halbe Ewigkeit durchs Sonnensystem kurven.
Trotzdem war das Vorhaben spektakulär und dazu angetan, die Raumfahrt wieder ins Interesse der Öffentlichkeit zu rücken. Darin waren sich die Männer einig, die an diesen Tagen in Baikonur für den reibungslosen Ablauf der bevorstehenden Mission mit der Bezeichnung »Horizon« zuständig waren. Sie überblickten von der obersten Etage eines schmucklosen Baus das weitläufige Raketengelände, von dem aus einst Juri Gagarin am 12. April 1961 als erster Mensch in eine Erdumlaufbahn geschossen worden war.
»Die Amerikaner sind unberechenbar geworden«, stellte Marko Jankus, einer der Männer, fest. »Und soll ich euch was sagen? Je mehr ich darüber nachdenke, halte ich die plötzliche Startverschiebung wegen der Japaner für ziemlich fadenscheinig.«
»Woran denkst du?«, wollte sein Kollege Stefan Nowak wissen, der ebenso wie Florian Winkler seit Bekanntgabe der Verschiebung immer wieder über deren Ursache rätselte.
»Ich kann’s euch nicht sagen. Aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein.«
Marko sah jetzt den Moment gekommen, seine weiteren Erkenntnisse preiszugeben: »Die Russen haben«, er blätterte in einigen Unterlagen, »vergangene Nacht gegen 1.17 Uhr hiesiger Ortszeit eine Unregelmäßigkeit im internen Datennetzwerk festgestellt, das beim Start der Sojus die Systeme überwacht.«
»Wie bitte?«, entfuhr es Stefan empört. »Und das sagst du uns erst jetzt so nebenbei?«
»Und was bedeutet das genau?«, verlangte Florian gleich nach mehr Informationen.
»Die Raumfahrtbehörde Roskosmos hat gestern sogar den Start ihres Frachters zur ISS gestoppt.«
»Wie bitte?«, wiederholte Stefan erstaunt.
»Ja, offiziell heißt es, die Triebwerke seien weniger als eine Minute vor dem Start automatisch abgeschaltet worden. Neuer Startversuch ist morgen, ausgerechnet der Dreizehnte …« Er überlegte. »Ist wohl nicht weiter schlimm, die Transportkapsel soll ja nur Treibstoff, Lebensmittel und Güter zur ISS bringen.«
»Also kein Zusammenhang mit den merkwürdigen Signalen?«
Marko gab sich betont zurückhaltend – wie er dies immer zu tun pflegte, wenn es galt, keine Aufregung aufkommen zu lassen. Ruhe zu bewahren, in allen noch so brenzligen Situationen, das hatte er schon in der Ausbildung zur Privatpilotenlizenz gelernt. »Noch haben wir fast vier Monate Zeit bis zum Start«, wandte er deshalb ein. »Das Kontrollzentrum in Moskau ist schon dabei, die Quelle der merkwürdigen Signale herauszufinden.«
»Signale?«, staunte Florian. »Was denn für Signale? Ich denke, es geht um Unregelmäßigkeiten …?«
Marko sah seinen beiden Kollegen nacheinander in die Augen: »Na ja«, er kramte in seinen Unterlagen, auf denen eine Grafik mit einer zackigen Kurve zu sehen war, »die Jungs können es sich nicht genau erklären, woher es kam. Ob aus dem Netz oder über eine ihrer Funkanlagen.«
Die beiden anderen stutzten. »Ein Angriff über die Funknetze?«, staunte Florian.
»Denkbar ist alles. Zunächst dachten sie wohl, es handle sich um eine natürliche Quelle aus dem Weltall …«