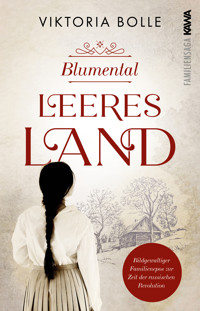
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Blumentalsaga
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte einer deutschen Familie zur Zeit der russischen Revolution Olga und ihre Familie leben als freie und wohlhabende Bauern, bis Stalins Regime ihre Welt auf den Kopf stellt. Als Kulaken und Deutsche werden sie von der Roten Armee verfolgt, enteignet und zur Arbeit im Kolchos gezwungen. Doch Olga gibt nicht auf. Inmitten von Hunger, Willkür und Leid kämpft sie ums Überleben und muss dabei ihre tiefsten Überzeugungen aufgeben. Dieses Buch erzählt von Mut, Zusammenhalt und dem unerschütterlichen Willen, trotz allem weiterzumachen und Hoffnung zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Während in Deutschland die Rechtspopulisten immer mehr an Stärke gewinnen, wütet in der Sowjetunion das Regime mit politischen Säuberungen und Massenexekutionen. Mit der stalinistischen Regierung fällt der Startschuss zur Verfolgung und Enteignung deutschstämmiger Kulaken – eine seit dem 19. Jahrhundert verwendete Bezeichnung für relativ wohlhabende Bauern. Nach der Oktoberrevolution von 1917 und im Rahmen der Zwangskollektivierung in den zwanziger Jahren wurde die Bedeutung des abwertenden Begriffs »Kulak« auf alle selbständigen Bauern ausgedehnt. Im Rahmen der Kulakenoperation werden diese Personen als Klassenfeinde behandelt. Sie werden zunächst enteignet und in einer neuen Repressionswelle zwischen 1937 – 1938 verschleppt, in Arbeitslager deportiert oder erschossen.
Nach wahrer Begebenheit
Mit diesen Worten beschreibt ein russischer Generalstabsoffizier 1863 die deutschen Siedler und ihren wirtschaftlichen Erfolg im Russischen Reich.
»Die Kolonisten sind unsere Amerikaner, die die wüste Steppe in herrliche Dörfer mit Gärten und Fluren verwandeln, unsere kapitalistischen Landwirte, die von Jahr zu Jahr reicher werden und immer mehr Land einnehmen und ihm Wert zumessen und den Preis der Arbeit durch ihre außergewöhnliche Nachfrage maßlos erhöhen. Die völlige Überzeugung von der Notwendigkeit der Arbeit, die Einfachheit des Lebens, die bis zum Stoizismus reicht, das Bewusstsein des sozialen Vorteils gegenseitiger Unterstützung und der Pflichten gegenüber der Regierung kennzeichnet sie.«
Detlef Brandes / Von den Zaren adoptiert – München, 1993, S. 454
Teil I Sibirische Heimat
Ein herrlich’s Land verheißt uns Gott, welch‘ ein Glück! Welch‘ ein Glück! D’raus ist verbannt all‘ Schmerz und Not. Welch‘ ein Glück! Welch‘ ein Glück! Dort hören wir der Engel Gang, der heil’gen Geist und Harfenklang, Gott lobend Ewigkeiten lang.
(Auszug aus Olgas Gesangbuch der deutschen Kolonisten von 1895)
Prolog
Sommer 2004, Deutschland
Was wird gefeiert?« Irritiert schaue ich meine Tochter an, den Arm unter ihren gehakt. Erna führt mich langsam zur festlich gedeckten Tafel. Das Gehen fällt mir zunehmend schwerer, doch einen Wagen als Gehhilfe habe ich bis heute ausdrücklich abgelehnt. Ein Gehstock ist das einzige Zugeständnis, das ich an meine nachlassenden Kräfte mache. Aufgrund der Feierlichkeit verzichte ich heute auch auf diesen.
»Mutter, wir feiern deinen 90. Geburtstag.« Erna sieht mich so an, als würde sie das heute nicht zum ersten Mal sagen. Bestimmt ist es so, aber ich habe es wieder vergessen. Ich mag zwar auf den ersten Blick körperlich stabil wirken und alles scheint für mein Alter ganz normal zu sein, dennoch weiß ich mindestens bei der Hälfte der Anwesenden nicht, wer diese Menschen sind.
Erna spricht von Demenz und sagt, dass ich von dieser heimtückischen Krankheit betroffen sei. Das Unheimliche daran sei der Verlauf – langsam, schleichend, fast unmerklich und nie genau gleich. Manchmal vergesse ich auch Erna.
Es sei die Krankheit der Angehörigen, behauptet meine Tochter, die am meisten darunter leidet. Trotzdem bringt sie es nicht übers Herz, mich, ihre alte Mutter, den Pflegerinnen und Pflegern zu überlassen, kümmert sich unermüdlich, mit bemerkenswert großer Geduld um mich, rund um die Uhr, jeden Tag. Diese Geburtstagsfeier zu Ehren meines hohen Alters hat sie ebenfalls organisiert.
»Schau, sie sind alle deinetwegen hier. Deine Kinder, Enkel und Urenkel mit ihren Familien.« Erna rückt mir den Stuhl zurecht und lässt mich Platz nehmen. »Erkennst du sie wieder?«
Mein Blick wandert über die Gesichter der Menschen im Festsaal und fixiert schließlich einen unsichtbaren Punkt in der Ecke des Raumes. Meine Aufmerksamkeit hat sich etwas anderem zugewandt. »Wo is Friedl? Warum is sie nett to?«, frage ich im Dialekt meiner Heimat, der bis heute in der Familie fest verwurzelt ist.
Erna nimmt behutsam meine runzlige Hand und streichelt sie sanft. »Frieda lebt nicht mehr«, antwortet sie leise.
»Und mein g‘liebter David?« Meine Stimme klingt brüchig.
»Du meinst wohl deinen ersten Mann?«
Ich nicke und blicke mich suchend um.
»Er ist im Zweiten Weltkrieg verschollen«, erklärt Erna wiederholt.
»Du liebes Heiland! Aber er hun doch v‘rsproche, er würd z‘rückkumme.« Auf meinem Gesicht muss sich Schrecken abgezeichnet haben, denn Erna reagiert beunruhigt.
»Mutter, ich habe so gehofft, dass der heutige Tag einer deiner guten werden würde.«
»Motter?« Die Stimme eines jungen Mädchens lässt mich herumfahren. So sehr ich mich bemühe und anstrenge, das junge, blonde Mädel, das vor mir steht, erkenne ich nicht wieder. Erna scheint meine Verwirrung richtig zu deuten und flüstert mir zu, dass das Mädchen meine Urenkelin sei.
»Wir möchten dir gern unser Geschenk überreichen. Schau, das ist ein Fotoalbum mit Fotos von jedem Einzelnen von uns.« Das Mädchen reicht mir das geöffnete Buch, das ich langsam an mich nehme und mit großem Interesse begutachte.
»Wenn du einen schlechten Tag hast und die Erinnerungen an deine Familie verblassen, kannst du in dieses Album schauen. Neben unseren Fotos haben wir für dich unsere Namen und persönliche Daten notiert. Du kannst jederzeit darin lesen und wirst immer wissen, wer wir sind.«
Ich blättere die Seiten mit zitternden Händen um und betrachte die einzelnen Fotos. Leider kann ich den dazugehörigen Text nicht lesen. Ich bin bis heute des Schreibens und Lesens der modernen deutschen Schrift nicht mächtig. Das Einzige, was ich beherrsche, sind die alten deutschen Buchstaben, in meiner betagten Bibel und meinem Gesangbuch. Das sind die einzigen Bücher, die ich je gelesen habe. Ich werde Erna wohl bitten müssen, mir vorzulesen.
»Gefällt dir das Geschenk, Motter?« Das Mädchen lächelt mich freundlich an.
»Des is der scheenste G‘schenk, was ich gekriecht hun.« Dankbar lächelnd drücke ich die Hand meiner Urenkelin. »Des kimmt uf den Platz gleich nebst der Bibel.«
»Deine uralte Bibel?«
»Iver hunnert Jahr ältst.«
»Die hat einmal deiner Ururgroßmutter gehört«, erklärt Erna ihrer Enkelin, »deren Vorfahren einst Deutschland verließen, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Meine Großmutter fand Trost im geschriebenen Gotteswort und deine Großmutter ebenso.«
»Kannst du dich an früher erinnern?« Olga mustert mich neugierig, aber ich bin gedanklich abgetaucht, nehme nichts um mich herum wahr. Selbst die fragenden Gesichter meiner Tochter und Urenkelin stören mich nicht. Stattdessen ist mein Blick in eine unbekannte Ferne gerichtet. Niemand weiß, warum ich das manchmal tue, denn sowohl Erna als auch meine anderen Kinder haben es längst aufgegeben, Zugang zu der Welt zu bekommen, in der ich seit nunmehr zwei Jahren lebe.
Sie können nichts ahnen, doch was auch immer das ist, das mein Gehirn auffrisst, es verzehrt nur die jüngeren Erinnerungen. Die Momente, die weiter zurückliegen, sind gut erhalten, sehr gut sogar. Momente, die sich vor über achtzig Jahren ereigneten, sind noch so frisch, so lebendig und so duftend, wie sie es damals waren.
In der Ferne der vergangenen Jahre sehe ich die Bilder vor meinem inneren Auge glasklar: Ein junges Mädchen, das sonntags ihr olivgrünes Kleid mit einer bunt gestreiften Rüschenschürze in der Kirche trägt, das barfuß im Sommer durch die Felder und Wiesen läuft und mit ihren dunklen Augen jungfräulich auf die Welt um sie herum schaut, das Echo ihres schalkhaften Lachens im Dickicht des gepflanzten Waldes hört und dem Gesang der fröhlich zwitschernden Vögel lauscht.
Ich sehe mich in meiner Heimat, in Blumental. Die Einwohner der Siedlung sind deutsche Umsiedler aus dem europäischen Teil Russlands, vor allem von der Wolga.
Das Dorf, das meine Heimat und die meiner Kinder wurde, liegt hier im flachen, leeren Land der Altai-Region, mitten in der Kulunda-Steppe, die wiederum Teil der westsibirischen Tiefebene ist. Die Kolonisten behaupten: Wer sich auf die Zehenspitzen stellt, der kann den Kanton von einem Ende bis zum anderen überblicken, so flach liegt er da, unweit der Grenze zu Kasachstan.
Der Steppenwind weht heiß, wild und ungebärdig und trägt eine Menge feinen Flugsamen der Steppenblumen und -gräser in das Dorf, das am Ufer der Zolotucha klebt, in dem viele Fische und Flusskrebse zu sehen sind.
Die Erde ist von Zieselmäusen durchwühlt, die Sümpfe von Fröschen, die Wälder von singenden Vögeln. Die Natur blüht und gedeiht in all ihrer Pracht. Das Gras wächst dicht und hoch, Obstbäume sind hier nicht selten. Von einem erhöhten Standpunkt sieht man die vielen farbenprächtigen Blumen-, Sonnenblumen-, Mohnblumen- sowie Getreide- und Melonenfelder. Bis zum Horizont. Diesem malerischen Umland hat Blumental seinen Namen zu verdanken. Den süßlichen Duft des Holunders rieche ich immer noch.
Plötzlich sehe ich mich direkt auf dem zentralen Platz von Blumental vor der evangelischen Holzkirche mit dem weitläufigen Innenraum, den von Klappläden umrankten Fenstern und dem Glockenturm, mit seiner kegelförmigen Spitze. Eine große Hauptstraße mit mehreren Nebengassen, einer Grundschule und einem Kirchplatz, der das Dorf in zwei Hälften teilt – das Oberdorf und das Unterdorf.
Einen kurzen Moment verweile ich an diesem Platz, bevor ich die Hauptstraße zum Oberdorf entlang schreite, die breit und gerade wie ein ausgerollter Teppich des Zaren vor mir liegt und sich in rechten Winkeln mit anderen Gassen kreuzt. Vorbei an den gepflegten Vorgärten und an Zäunen aus gehobelten Holzbrettern, mit breiten Klapptoren für Schlitten und Fuhrwerke und einem kleineren Eingang für die Menschen. Vorüber an den akkuraten Häusern mit reich verzierten Fensterläden, die mit ihrem frischen Anstrich in Blau, Weiß und Rot besonders schmuck wirken. Jedes Haus versinkt in Baumpflanzungen, zwischen denen sich prächtige Obstgärten ausgebreitet haben. Vor den Häusern erfreuen wunderschöne Beete mit vielen unterschiedlichen Blumensorten das Auge. Insgesamt ist es in Blumental sehr sauber und viel ordentlicher, als anderswo in russischen Siedlungen.
Mein gedanklicher Gang beschleunigt sich, als ich den Marktplatz mit den drei großgewachsenen Birken und dem großen Brunnen überquere, an dem sich Frauen täglich mit ihren Tragejochen sammelten, als hätte ich es besonders eilig. So ist es auch. Ich kann es kaum erwarten, endlich am Haus, in dem ich einst gewohnt hatte, anzukommen.
Bald stehe ich davor. Zur rechten Seite des Hofes befindet sich das Wohnhaus mit einer Seitenlänge von zehn Metern und wird von einem langgestreckten Wirtschaftsgebäude mit Pferdestall verlängert. Nebenan Kuhstall, Scheune, Hühner- und Schweinestall und ein offener Raum für Torf und Kohle. Gegenüber von der Scheune befindet sich eine Remise für Erntewagen, Karren und andere Gerätschaften.
Vorn in der Einfahrt steht eine Lärche, die der Torbank im Sommer ausgiebigen Schatten spendet und hinter dem Wohnhaus sind ein Gemüsegarten und ein kleiner Garten mit einer Laube angelegt. Durch ein Tor kann ich in den Obstgarten mit Äpfel-, Birnen- und Zwetschgenbäumen hineinsehen. Ich schließe die Augen und nehme den Duft der blühenden Bäume in mich auf, höre das aufdringliche Läuten der Kirchenglocke in der Ferne, das Bellen der Hunde und spüre die Wärme der Sonne auf meiner Haut.
Das ist mein Reich und hier habe ich meine Kindheit und Jugend mit meinen sechs Geschwistern verbracht. Eine von schwerer Arbeit gezeichnete Kindheit, aber auch eine glückliche, in der Weite der Ländereien, in Freiheit und Ruhe eines friedlichen Lebens.
1
Sommer 1924, Blumental
Der Tag in Blumental beginnt am frühen Morgen, noch bevor der erste Hahn gekräht hat und die Sterne am Himmel leuchten. Wie jeden Tag weckt mich Anneliese gegen vier Uhr morgens, damit ich die Kühe zur Herde bringe, die zuvor von ihr und Mutter gemolken wurden. So früh aufzustehen, ist für mich eine Qual, denn vor dem Morgengrauen ist der Schlaf bekanntlich am tiefsten.
»Lass mich schlafen, Annelischka, ich bin noch müde«, sage ich verdrießlich und will erneut die Augen unter meinem Federbett aus Gänsedaunen schließen, aber sie lässt sich nicht so leicht abweisen.
»Steh auf, der Hirte wird nicht auf dich warten«, brummt sie. »Und trödle nicht!«
Von Müdigkeit überwältigt, zwinge ich mich mit außerordentlicher Anstrengung aus dem Bett, das ich mit meiner zwei Jahre jüngeren Schwester teile. Marischka schläft seelenruhig weiter. Bald wird Anneliese auch sie aus dem Bett jagen.
Mir rasch etwas übergezogen, folge ich den Kühen im Halbschlaf über die Straßen von Blumental, die eigentlich wissen, wo sie lang müssen, ohne, dass ich sie führe. Aber ich beklage mich nicht. Was bringt es, mich zu beklagen! Alle müssen im Haus und Hof, Keller und Stall, auf dem Felde und auf der Weide mithelfen. Mutter sagt, sie kann eben alles, was Löffel lecken kann, bei ihrer Arbeit gebrauchen.
Mein Vater, Egor Iwanowitsch, und Mutter, Maria Dawidowna haben insgesamt vier Kinder: Egor – der Erstgeborene. Wie im alten Israel bekommt der erstgeborene Sohn den Namen seines Vaters. Und weil es in der Kolonie üblich ist, dass die ganze Familie mit verheirateten und unverheirateten Gliedern bis zum Tode des Hausvaters zusammenbleibt, und so mehrere Generationen miteinander unter einem Dach wohnen, entsteht manchmal eine Verwechslung. Um den ehrwürdigen Hausherrn, Vetter Egor und seinen Sohn Egor namentlich zu unterscheiden, hilft man sich mit Verkleinerungssilben, und so heißt es im Volksmund: »Dem Egor sei'm Egoraschka.« So wird mein Bruder von unserer Familie genannt.
Sollte Egoraschka irgendwann auch einen Sohn bekommen und der Schlingel verbricht mal etwas, wird Vater lachen, schelten und hin und her raten: Wer kann’s wohl gewesen sein? Schmunzelnd wird er feststellen: »Dies war mei'm Egoraschka sei' Egorkelche«, und alle werden mit ihm lachen.
Vater ist stolz auf seinen ältesten Sohn, der als tapferer und verschlagener Offizier zur Revolutionszeiten in der Armee gedient hatte, als ich ungefähr drei Jahre alt war. Um ihn zu verabschieden, waren Vater und Mutter damals gemeinsam mit mir und meinem Cousin Andre in die benachbarte Großstadt gefahren. In einem Fotoatelier wurden wir, den Erzählungen meiner Angehörigen nach, von einem seltsamen Apparat abgelichtet. Ich selbst kann mich nicht mehr daran erinnern, aber das Foto, das damals entstanden war, steht seitdem in einem Rahmen auf Mutters Kommode.
Annelischka ist das zweite Kind und gleichzeitig älteste Tochter von dreien, der, den Regeln des ländlichen Lebens zufolge, die wenigste elterliche Liebe zuteilwird. Sie tröstet sich mit dem Gedanken, dass sie anfangs, als sie geboren wurde, womöglich verwöhnt und verhätschelt wurde, aber, ob es tatsächlich so gewesen ist, das kann sie nicht mehr wissen.
Zumindest hat sie Altmotter erlebt, die sich, nach Aussage Annelischkas, liebevoll um meine älteren Geschwister gekümmert hatte, als die Familie noch in Hussenbach an der Wolga lebte. Die Großmutter war es, die Olgas ältere Geschwister lehrte, die Händchen für ein Gebet zu falten, ihnen beim Spinnrad und Strickstrumpf die Gebotter beibrachte und die schönsten Märchen und die hübschesten biblischen Geschichten erzählte.
Großmutter lebt nicht mehr, aber das Andenken an sie ist geblieben. Und so sitzt Anneliese an so manchem Abend Geschichten erzählend an unserem Bettrand und wir lauschen mit gespannter Aufmerksamkeit ihren Erzählungen.
Seit sie sechs ist, hilft Anneliese der Mutter im Haushalt. Bis heute ist sie ihre hauptsächliche Unterstützung im Haus, Hof und auf dem Feld. In der Kinderstube ist sie die Haupterzieherin. Um Maria und mich kümmert sie sich von Geburt an, umsorgt und pflegt uns.
Sie ist die Härten des Lebens gewohnt, genauso wie Mutter. Als der kleine Jakob, das drittgeborene Geschwisterkind an Durchfall, Scharlach oder gar einer anderen Krankheit gestorben war, hatte Mutter, Annelieses Aussage nach, lediglich ein wenig geweint und tröstete sich schnell damit, dass er bei dem lieben Gott gut aufgehoben sei.
Mutter kann manchmal schroff wirken, besonders wenn es in der Kinderstube zu laut hergeht. Dann hält sie es mit der Weisheit Salomons und trägt zu, dass kein Hieb verloren ist, höchstens der, der aus Versehen danebengeht. Wenn David, der viertgeborene Sohn, sich über Mutters Ausschweifungen lustig macht, kriegt er oft ein Geschirrtuch quer über den Rücken übergebraten.
Mutter ist streng. Hohe Wangenknochen und die Leidensmiene einer Märtyrerin lassen ihr schönes Gesicht drohender erscheinen als es tatsächlich ist. Denn nach all den Drohungen beschränkt sich ihre erzieherische Tätigkeit am Ende doch nur auf das Verbieten des Unerlaubten und auf das Schelten. Überspannen wir es einmal, müssen wir zur Strafe in die Ecke oder für eine Stunde in der Stube eingesperrt bleiben.
Außer der Schererei mit uns, den jüngeren Schwestern, hat Annelischka viele andere Aufgaben. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit muss sie Vater deutlich mehr auf dem Acker helfen, was Mutters Beschwerden zur Folge hat. Mutter stöhnt und klagt, schürzt wütend die Lippen. Beim Frühstück oder Abendessen beginnt sie immerzu dasselbe Gespräch: »Ich habe keine Kraft mehr, Vater.« Sie richtet sich an ihren Gatten, doch ich weiß, dass die Worte uns, ihren jüngeren Töchtern gelten. »Die Arbeit wächst allmählich über meine Kräfte hinaus. Ihr habt Unterstützung auf den Feldern, wie lange muss ich mich um alles alleine kümmern?«
Und so legte sich mit sieben Jahren ein Tragejoch mit zwei Eimern auf meine robusten Schultern – ein Brett, das in der Mitte zur Schulterform ausgeschnitzt ist, sodass es gut und fest auf den Schultern aufliegt. Die Enden des Tragejochs gehen in zwei Stangen links und rechts aus, die mit einer Kette und mit einem Haken jeweils einen Eimer befördern können. Zwar habe ich den Auftrag, die Eimer nur halb zu füllen, doch dann hätte ich mich mehrmals am Tag auf den Weg zum Brunnen machen müssen. So gehe ich bald täglich mit zwei 10-Liter-Emailleeimern los. Während ich die schwere Last trage, schlägt mein Herz hastig und bang, und der Rücken biegt sich, dass ich glaube, er bricht bald.
Mutter schlägt ächzend die Hände zusammen und tadelt mich: »Etwa voll die Eimer? Bist du verrückt, Kind!« Doch insgeheim ist sie zufrieden, weil sie sich selbst den Gang zum Brunnen sparen kann.
Die Freude in Mutters Stimme ist unverkennbar, und so eile ich zum großen Holztrog, über dem der stinkende Dampf billiger Waschseife wallt. Ein Berg an Hemden, Kleidern und Laken türmt sich. Mutter hat nur Zeit gehabt, sie einzuweichen, ich muss sie zu Ende waschen.
Das Waschen ist bei der Menge eine Ganztagsarbeit und wird deshalb nur alle drei bis vier Wochen erledigt. Auch die kleine Marischka hilft mit. Das Wasser aus dem Brunnen ist überaus kalkreich und zum Waschen nicht geeignet. Auf Mutters Anordnung muss es deshalb aus der Zolotucha geholt werden, was ich gemeinsam mit Marischka erledige. Der Fluss liegt etwa vierhundert Meter vom Hof entfernt und bei einer großen Wäsche wird einiges an Wasser benötigt.
Ich strenge mich an, schrubbe und keuche über dem Waschbrett aus Zinkblech in einem Holzrahmen, bemühe mich, die mir aufgetragene Aufgabe möglichst gut zu erledigen. Das macht meine Fingerknöchel wund und meine Kleidung trotz Gummischürze nass.
Bei der Arbeit verlassen mich die Gedanken, ziehen sich an einen Ort zurück, an dem es keine dampfenden Kübel und keine schmutzige Wäsche gibt und ich grüble darüber nach, wie schön es doch jetzt in der Schule wäre, dürfte ich nur hin. Für den ganzen Vormittag der Arbeit entfliehen, weg vom stinkenden Holztrog, den Wäsche- und Kartoffelbergen, die es erst zu entkeimen und dann zu schälen gilt. Ich träume, während mein Körper die Arbeit automatisch ausführt, stumm, mit gleichmäßigen Bewegungen.
»Das Hemd wird nicht sauberer, auch wenn du es bis Altjahrestag tauchst«, merkt Mutter an und zeigt mit einer müden Bewegung ihrer Hand hinaus auf den Hof. »In die Sonne damit.«
»Mach‘ ich schon, Mutter.« Ich hole ein Kleidungsstück nach dem anderen, rolle sie zu tropfenden Ballen zusammen und wringe sie mit großer Kraftanstrengung aus – eine der unangenehmsten Arbeiten.
»Halte dich nicht so lange mit der Wäsche auf. Es gibt noch reichlich im Garten zu tun.«
Ich wandere, den schweren Wäscheberg in einem Korb tragend, auf den Hof hinaus. Die Leinen, auf denen die Wäsche zum Trocknen aufgehängt werden soll, sind in unterschiedlichen Höhen gespannt. Manche von ihnen kann ich nur mit einer Trittleiter erreichen, und manchmal geschieht mir das Missgeschick, dass ein sauberes Wäschestück von der Leine fällt und im Dreck landet. In diesem Fall ist Mutters Brummen unausweichlich. Die zusätzliche Zeit über dem dampfenden Holztrog lehrt mich, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein.
Sorgfältig klemme ich den Stoff mit groben Holzklammern fest, wische mir den Schweiß von der Stirn und strecke mich erschöpft. Die Schultern zurückgezogen, verweile ich im Schatten der Wäsche und genieße die leichte Brise, die um mein Gesicht streicht.
»Wunderbar, nicht wahr?« Ich blicke zu Marischka hinüber. Meine jüngere Schwester lächelt mich breit an.
Ich nicke, nehme den Korb auf und schlendere zurück in die Waschküche. Sobald ich mit einer Aufgabe fertig bin, wartet in der Regel der Garten und es geht weiter mit Unkrautzupfen, Gießen der Kartoffelpflanzen, Gurken, Tomaten und der Roten Bete. Ich schleppe Eimer um Eimer aus dem Fluss die steilen Stufen auf und ab, bis ich vor Erschöpfung zusammenbreche und Mutter, sobald sie mich in diesem Zustand erblickt, fürsorglich sagt: »Geh, mein Mädchen, ruh dich aus, meine wertgeschätzte Helferin! Ich mach das zu Ende.«
An solchen Abenden habe ich nicht einmal Kraft, um mich zum Fluss hinauszuschleichen und den anderen Kindern und Jugendlichen beim Baden und Spielen zuzusehen. Ich verkrieche mich in den Heuschuppen, um dort alleine zu sein und schlafe direkt auf dem Stroh ein. Am nächsten Morgen werde ich erneut um vier Uhr von Annelischka geweckt, muss abermals die Kühe zur Herde begleiten und all die anderen tausend Dinge erledigen, die mir jeden Tag von Mutter aufgetragen werden.
Umso mehr freue ich mich auf das Frühstück, wenn ich von der Weide zurück bin und die Hühner und Schweine gefüttert sind. Als die Kirchenglocke um sechs Uhr am Morgen läutet, erscheint die Familie pflichtgemäß am Tisch und sobald Mutter ihr morgendliches Gebet gesprochen hat, gibt es für alle Essen. Vor jedem Platz steht an diesem Morgen eine Schüssel mit Schnitzsuppe. Alle lassen es sich sogleich wohl schmecken.
»Im Dorf munkeln sie an jeder Ecke über den neuen Schulmeister, der ab Oktober in der Dorfschule unterrichten soll«, erzählt Anneliese und ich spitze sofort die Ohren.
Es heißt, aufgrund einer anspruchsvollen und langjährigen Ausbildung, sucht sich ein fertiger Schulmeister am liebsten eine Arbeit in großen Gemeinden, wo ihm zusätzlich ein oder zwei junge Leute als Gehilfen zur Seite gestellt werden. In dem kleinen, abgelegenen Dorf in Sibirien möchte sich niemand niederlassen. Es gleicht einem Wunder, dass doch jemand bereit ist, diese Stelle anzunehmen.
»Noch so ein Betchla«, schnaubt Vater. Er ist ein großer, aristokratisch wirkender Mann mit dunkler Kurzhaarfrisur und einem Schnurrbart, der sich an seine Oberlippe wie angeklebt schmiegt. Als Hausherr kann er auf andere mürrisch oder sogar herrisch wirken. Aber so ist er nicht. Er hatte es nie leicht und musste sein Leben lang schwer arbeiten. Zu uns Kindern ist er aber fast immer nachsichtig.
»Wie sein Vorgänger wird er den Kindern nichts Gescheites beibringen. Bloß, wie man Löcher in die Luft starrt. Und dafür bekommt der auch noch Geld«, kommentiert Vater, während er die Suppe eifrig löffelt.
Mir ist in der Tat zu Ohren gekommen, dass die Tätigkeit eines Schulmeisters sehr anstrengend sei, gleichzeitig aber nicht besonders gut entlohnt werde, weshalb der letzte Schulmeister als verhältnismäßig arm im Dorf galt. Die vierzig Rubel im Jahr, die er verdiente, brauchte er von allen am meisten, erzählten die Leute. »Der ist an der Überarbeitung zugrunde gegangen«, war ihr Fazit, als er letzten Winter einer langwierigen Krankheit erlegen war.
»Da pflichte ich Vater bei.« Egor nickt eifrig. Mit Mitte zwanzig ist er wie Vater, groß und schlank, ganz sein Ebenbild, nur dass er im Gegensatz zu ihm weniger mürrisch ist und keinen Schnurrbart trägt, weil die jungen Burschen dieser Mode nicht mehr nacheifern und ihr Gesicht lieber glatt rasieren. »Zu meiner Schulzeit saß der Lehrer nur da und zeichnete Bilder mit einem Stock auf den Boden.«
»Seht ihr? Das meine ich«, fühlt sich der Hausherr verstanden.
»Ich würde gern zur Schule gehen.« Ich werfe einen unvermittelten Blick auf Vater, dessen voller Löffel auf halbem Weg zum Mund gefriert.
»Lüschna, du willst wohl zur Schule gehen? Aber was soll dir das bringen?« Er mustert mich skeptisch.
»Ich würde gern die Buchstaben der Deutschen Fibel lernen, um die Geschichten in der Bibel zu lesen und das Gesangbuch zu buchstabieren.«
»Woher der plötzliche Drang?« Mutter starrt mich mit weit geöffneten Augen an. Sie ist eine außergewöhnlich schöne Frau, sonst hätte Vater sich ja nicht im Vorbeifahren vom Kutschbock aus in sie verguckt. Das erzählt er selbst bei jeder Gelegenheit.
»Sobald du das Lesen beherrschst, wirst du mir dann aus der Bibel vorlesen?«, frohlockt die kleine Maria.
»Aber sicher, wenn ich zur Schule gehen darf, lerne ich Buchstaben und werde dir vorlesen, Schwester.«
»Egor und David haben die Schule besucht, das reicht.« Mutters Löffel landet geräuschvoll im Suppenteller. »Die Jungen brauchen das dringender.«
»Warum, Mutter? Warum brauchen die Mädchen es nicht so dringend wie die Jungen?«
»Iss und frach net so viel!«, ermahnt mich Mutter und ich ärgere mich tierisch, dass sie noch nie Verständnis für meine schönen Buchstaben und Zahlen hatte, wie sie es nennt. Mutter findet, dass es für ihre Töchter vorteilhafter sei, wenn wir uns im Haus und Hof einbringen, anstatt die Schulbank zu drücken.
Mutters Alltag besteht nur aus Haus, Feld und Stall und etwas anderes kann sie sich für ihre Mädchen nicht vorstellen. Gut und vermögend zu heiraten sowie arbeitsam zu sein, sind die Bestimmungen, die wir, ihrer Meinung nach, haben sollten.
»Die Schulzeit war echt eine Plackerei«, versucht mich David zu ermuntern. Mit seinen achtzehn Jahren ist er mitten in seiner Blütezeit, gutaussehend – dunkle Haare und grüne Augen, was die Aufmerksamkeit zahlreicher junger Damen im Dorf auf sich zieht und was Bruder redlich auszunutzen weiß.
Ich werfe einen flehenden Blick zu Vater, in der Hoffnung, dass er sich schlussendlich für mich einsetzt und seine Tochter in Schutz nimmt, doch er zuckt lediglich mit den Schultern, krächzt und schnäuzt sich geräuschvoll, so wie er das immer tut, wenn ihn etwas nervt. Streicht sich über das zottige Barthaar und erhebt sich gemächlich vom Tisch.
»Weißt du, drei Kopeken Strafgeld für jeden versäumten Schultag zu zahlen, erscheint mir als recht viel«, sagt er nach kurzem Überlegen. Er denkt immer aus wirtschaftlicher Sicht. Nicht umsonst führt der Hausherr einen gewinnbringenden Betrieb.
Aus Erzählungen habe ich nach und nach erfahren, dass die Familie meines Vaters reich war. Doch die Ahnen von Mutters Seite waren nicht weniger rechtschaffende Menschen. Sie zeichneten sich durch zahlreichen Nachwuchs aus und ihr Glück wussten sie auch beim Schopfe zu packen. Zuerst als sie hundertfünfzig Jahre zuvor auf Einladung von Zarin Katharina per Schiff in Kronstadt vor St. Petersburg eingetroffen waren, um so als Bauern ihrer Abgabenlast in Deutschland zu entkommen, und später, als meine Eltern, aufgrund der Agrarreform des letzten Zaren, die Gelegenheit wahrgenommen hatten, Hussenbach zu verlassen und günstiges Ackerland in der sibirischen Kulunda-Steppe zu kaufen.
»Ich habe vor, in die Schule zu gehen, nicht sie zu versäumen!«, entgegne ich nachdrücklich.
»Mutter ist hochschwanger! Wer hilft ihr bei den Hausarbeiten?«, knurrt Vater. »Und bei der Ernte, die bald ansteht? Annelischka muss jetzt viel mehr auf den Feldern helfen. Du und Marischka auch. Ihr werdet immer größer.«
Das höre ich dauernd von meinen Eltern. Es heißt, weil ich stetig größer werde, kann ich dies und das machen, den Tisch abwischen, Geschirr abtrocknen, Tisch decken, Kartoffeln schälen.
Im Allgemeinen gilt es in der Gemeinde, die Kinder so früh wie möglich in den Beruf der Bauern einzuführen, damit sie mit Vollzug der Konfirmation fertige Bauersleute sind. Mutter wird nicht müde, uns dies täglich vorzutragen und uns mit Arbeit zu beladen. Die Mädchen lernen die Frauenarbeiten bei der Mutter und die Knechtche bei dem Vater. So müssen Egor und David alles können – Reiten, Fahren, Aus- und Einspannen, Viehfüttern, Ackern, Säen, Mähen, rundum alles, was das bäuerliche Leben an Arbeit bereithält.
»Wir reden nicht erneut über das Thema. Keine Schule, ihr müsst bei der Haus- und Feldarbeit mithelfen.« Vater lässt seinen leeren Teller unaufgeräumt auf dem Tisch stehen und stampft durch das Hinterhaus auf den Hof. Ich blicke ihm kurz nach. Gleich wird er die Pfeife rauchen, wie er es jeden Morgen nach dem Frühstück tut und anschließend mit seinen Söhnen und Anneliese auf die Felder aufbrechen.
Ich wage keine weitere Widerrede und beeile mich niedergedrückt und schweigend auch meinen Teller zu leeren. Dieses Gespräch endet doch immer auf dieselbe Art.
Sobald alle den Tisch verlassen, kümmere ich mich zusammen mit Marischka um den Abwasch, während Mutter uns weitere Aufgaben für den Vormittag überträgt und sich selbst an die Arbeit macht.
Kartoffeln zu pellen, ist eine halbwegs humane Tätigkeit, doch Kartoffeln abzukeimen, das ist wahrlich eine Qual. Um dieser Aufgabe zu entfliehen, verstecke ich mich oben auf dem Dachboden, wo Kisten, Körbe und allerlei hölzernes Gerät herumstehen und Hausmäuse herumhüpfen. Auf dem Dachboden riecht es intensiv nach Holz und Staub und trockenen Kräutern. Lieber bei den Mäusen sein, als Kartoffeln abzukeimen, denke ich in meinem Versteck und riskiere, dass Mutter mit einem Bettklopfer auf mich losgeht, wenn sie mich entdeckt. Denn eines, was Mutter nicht leiden kann, ist, wenn man sich vor der Arbeit drückt.
An meinem Versteck liebe ich die alten Kisten mit Zeitungen, in denen ich herumblättern und mir ein paar Bilder anschauen kann. Den Text lesen kann ich nicht, obwohl ich es gern möchte.
Ich könnte heulen vor Wut und Enttäuschung! Ich habe es so leid, meine Eltern immerzu darum anflehen zu müssen, die Schule besuchen zu dürfen und kann doch nichts ändern. Meine Eltern halten an den Gewohnheiten des Alltags fest, nichts kann sie zum Umdenken bewegen. Auch nicht die Tatsache, dass ich nur ein paar Stunden am Unterricht teilnehmen würde. Am Nachmittag hätte ich immer noch Zeit, Mutter zu helfen.
Je mehr ich über diese Ungerechtigkeit nachdenke, desto weniger kann ich die hervortretenden Tränen unterdrücken.
»Olga! Olga! Oooooolga!«, höre ich die Rufe meiner Mutter von unten.
Rasch wische ich mir die Tränen mit den Handballen aus dem Gesicht und schaue durch das winzige Bodenfenster. Mutter läuft im Hof umher, auf der Suche nach mir. Wenn sie mich hier oben auf dem Dachboden in Gesellschaft von alten Zeitungen erwischt, wird sie mich erst recht mit einem Bettklopfer verprügeln.
Ich schnaube und beginne langsam, die Treppe hinabzusteigen. Ich kann mich hier nicht ewig verstecken, denn irgendwann kommt Mutter dahinter, dass immer noch Kartoffeln vom letzten Jahr im großen kalten Keller abgekeimt werden müssen. Also mache ich mich widerwillig an die unangenehme Arbeit. Marischka hat zu helfen.
Das wohl Schlimmste am Keime abbrechen ist, dass ich davon ganz schmutzige Hände bekomme. Einige Knollen sind matschig, schrumpelig und schleimig, aber man merkt es erst, wenn man bereits in den stinkenden Matsch hineingegriffen hat.
»Bähhh!« Marischka wischt sich den Dreck an ihrer Kleidung ab und zeigt mir die Hände. »Meine Hände stinken. Das ist so widerlich.«
»Mach weiter.« Ich würge einen Klumpen dicken Speichels die trockene Kehle hinunter und greife nach einer weiteren Kartoffel.
Wenn wir Steine zwischen den Kartoffeln finden, werfen wir diese auf einen Extrahaufen. Das verursacht ein klackerndes Geräusch, das wir beide sehr schön finden. Deshalb veranstalten wir ein Spiel daraus und werfen die Steine mehrfach auf den Haufen, weil es dann nochmal so schöne klackernde Geräusche von sich gibt.
Das einzig Gute an dieser stinkigen Angelegenheit ist, dass Mutter uns anschließend zum Baden schickt. Sobald ich die Kühe am späten Nachmittag von der Weide geholt habe und meine beiden Brüder vom Feld zurück sind, dürfen Marischka und ich in Begleitung von Egor und David zum Fluss.
Annelischka hat kein Interesse, sich uns anzuschließen. Sie hat seit neuestem einen Borsch und unternimmt einen Spaziergang mit ihrem Verehrer, der ihr seit einigen Tagen den Hof macht. In der Regel holt ihr Bewunderer sie an den Abenden ab und sie spazieren gemeinsam zum abgelegenen Flussufer oder in den Wald. Mit der Privatsphäre, die Eltern ihnen gewähren, haben sie hier auf dem Land zwar ihre Freiheiten, aber alles hat seine Grenzen, und diese Grenze weiß Anneliese und auch jedes andere christlich erzogene Mädel der Kolonie streng einzuhalten.
Der Weg zum Fluss führt meine Geschwister und mich über die Felder und Wiesen, auf denen Bauern ackern und manche von ihnen langsame, getragene Lieder einstimmen, um sich die Arbeit zu verschönern oder einfach, um sich bei Laune zu halten. Noch stehen die Felder voller Weizen und Sonnenblumen. Doch schon bald beginnt die Erntezeit und der Sommer mit seinen milden Nächten wird dem Frühherbst weichen.
Am Fluss angekommen, lasse ich meine Augen über die Flussauen streifen. Zolotucha, die alljährlich im April um mehrere Meter steigt, bis sie ihre Ufer überschwemmt und die Talsohle mit Wasser bedeckt, wird in den warmen Sommermonaten an den Abenden zum Tummelplatz der Leddigen.
Am Ufer brennt ein Lagerfeuer, Mädchen und Burschen aus dem Dorf springen um das Feuer herum. Ihr schalkhaftes Lachen und fröhlicher Gesang sind weit zu hören.
Die Burschen stimmen ein Lied an:
Hätt‘ ich dich nicht gesehen,
Wie glücklich könnt‘ ich sein!
Allein, es ist geschehen,
Mein Herz ist nicht mehr mein.
Ich trage schwere Ketten,
Die du mir aufgelegt,
Ums Leben möcht ich wetten,
Dass keiner schwerer trägt …
Die Mädchen fahren fort:
Wie schwänzelt doch mein Röckelchen,
Wie schwänzelt doch mein Rock?
Ich hatt‘ noch nie so’n Röckelchen,
Wo so geschwänzelt hat.
Und schließlich, wie überall in allen deutschen Kolonien, das altbekannte Schön ist die Jugendzeit.
Ich stürme sofort zum Fluss an eine seichte, ungefährliche Stelle, die zum Baden und Schwimmen gut geeignet ist. Es ist bloß das Oberkleid, das ich ablegen muss. Schuhe trage ich keine, nur sonntags zum Gottesdienst in der Kirche. Damit bin ich keineswegs eine Außenseiterin. Denn die meisten Kinder im Dorf laufen von April bis zum ersten Frost barfuß, auch Marischka. Was mich angeht, so passen mir meine Schuhe nie. Zu groß, zu klein, zu schwer, keine Schnürsenkel, kaputt oder mit einem Loch in der Sohle. Nie gibt es den richtigen Schuh.
Ohne lange zu zögern, hüpfe ich sofort in das kühle Nass. Das Wasser ist klar und erfrischend, trotz der von der Sonne aufgeheizten Oberfläche. Marischka hat ebenfalls ihr Oberkleid ausgezogen und läuft mir nach. Im Fluss zu baden, ist herrlich.
Egor beginnt, sich das Hemd aufzuknöpfen. David hingegen hat nicht vor, zu baden. Stattdessen hat er sich den Kartus unternehmungslustig tief in den Nacken gezogen und einen Grashalm zwischen die Zähne gesteckt.
»Hey, Bruder? Willst du nicht baden?«
»Nein, ich glaube, ich geselle mich zu den Mädchen am Lagerfeuer.« Er deutet mit einem Wink in die Richtung der singenden Mädchenschar. Bei diesem Anblick muss ich lauthals lachen.
»Hast du gehört, Marischka, unser Davidkelche ist ein Frauenheld. Was wird wohl Vater sagen, wenn er noch vor Egoraschka heiratet?«
»Kümmere dich nicht darum, Lüschna. Sonst überlege ich es mir gleich anders und komme doch hinein, um dich zu ertränken!«
»Versuch’s doch! Ich kann mich über Wasser halten, du weißt doch, ich bin eine gute Schwimmerin.« Eine gute Schwimmerin und auch eine gute Taucherin bin ich tatsächlich. Kein Wunder, denn ich bin praktisch an diesem Fluss groß geworden. Ich mag zwar zierlich wirken, aber ich bin stark und ausdauernd und werde nicht untergehen.
»Na warte, Mädel!«, droht mir der Bruder lachend. »Gleich komme ich rein!«
»Also, Marischka, unser Davidkelche ist schrecklich verliebt. Wir haben es alle mitbekommen«, lasse ich nicht locker.
»Unsinn«, widerspricht David. »Mein Herz gehört keinem bestimmten Mädel, wie denn auch! Es würde bedeuten, dass ich mich auf eine von vielen festlegen müsste. Das ist wahrlich nicht einfach, wenn man so ein prachtvoller Bursch ist, wie ich einer bin! Da müsste ich wählen, und zum Wählen habe ich genug, das kann ich euch sagen!«
»Du Prahlhahn!«, lacht Egor, der inzwischen das Hemd abgelegt hat und dabei ist, auch die Hose auszuziehen. »Gestern hast du mir die Ohren voll geheult. Mina dies, und Mina jenes. Ich konnte kein Auge zu tun!«
»Stimmt, erst letzte Woche habe ich ihn erwischt, wie er zuerst an Katharinas Fenster stand und ihr Liebesbekundungen zuflüsterte und anschließend dasselbe am Fenster der Anna tat!«, verkünde ich.
»Du Schuft!«, entfährt es Egor überrascht. »Gleich drei Mädels?«
David zuckt mit den Schultern. »Nicht meine Schuld. Die Sache mit der Liebe ist nicht so einfach.«
»Nimm die Katharina!«, rufe ich aus dem Wasser.
»Nein, nimm die Mina!«, widerspricht Marischka. »Die finde ich netter.«
David kaut am Grashalm und überlegt einen Moment. »Ja, Mina habe ich gern, aber bei Katharina habe ich wohl mehr Chancen.«
»Warte doch ab! Vielleicht kriegst du ja beide oder gar gleich alle drei? Wer weiß das schon?«, fügt Egor hinzu.
»Leute, ihr benehmt euch wie die Wilden!« David verdreht die Augen und alle müssen bei diesem Anblick lachen. Dann macht er eine wegwerfende Handbewegung, so als wollte er eine Fliege erschlagen und geht in Richtung des Lagerfeuers zu den Mädchen.
»Und was ist mit dir, Bruderherz?«, wende ich mich an Egor.
»Was ist mit mir?«
»Kommst du nun ins Wasser?«
Egor schneidet eine Grimasse, die Marischka und mir erneut lautes Gelächter entlockt, nimmt kurzen Anlauf und springt in hohem Bogen, fast über unsere Köpfe hinweg, ins blaue Wasser.
2
Die Sonne brennt heiß. Man könnte denken, das sei ungewöhnlich für die sibirische Steppe, aber so ist es nicht. Erzählungen nach ist es hier im Sommer so mild wie in Südfrankreich, und Temperaturen von über dreißig Grad sind nichts Ungewöhnliches. Im Winter dagegen herrscht bittere Kälte. Die durchschnittliche Temperatur liegt dann bei minus 15°–20° Grad, der Frost häufig bei minus 40, mit viel Schnee, überall.
Mutter bleibt erschöpft stehen, wischt sich den Schweiß mit dem Handrücken von der Stirn. Mit der anderen Hand stützt sie sich den Rücken. Zusätzlich zu ihrem kugelrunden Bauch trägt sie einen schweren Korb, den sogenannten Brüggenkorf, aus wilden Weiden geflochten. Hochschwanger und kaum in der Lage zu gehen, ist sie gemeinsam mit Marischka und mir unterwegs zum Getreidefeld, um den Arbeitern das Essen zu bringen.
Auch Marischka und ich haben die Körbe auf unseren Rücken und schnauben unter der schweren Last. Wäre nicht die sengende Hitze, wäre es nur halb so schlimm. So macht uns der Durst zusätzlich zu schaffen.
»Es ist so heiß, Mutter. Ein Regenschauer wäre jetzt genau richtig«, überlegt Marischka laut. Sie hat sich auf die Erde gesetzt und lädt mich mit einer Handbewegung ein, mich zum Ausruhen neben sie hinzusetzen.
Mutter legt den Kopf in den Nacken und blickt hinauf zum Himmel, während sie eine Hand vor die Augen hält, damit die Sonne sie nicht blendet. »Gut, dass es nicht regnet. So kann der Weizen schneller trocknen. Obwohl, die Natur schon dringend Regen braucht«, sagt sie und lässt ihren Blick über das Land wandern.
Zu ihrer Rechten befindet sich ein von Siedlern gepflanzter Mischwald, links sind Weizenfelder, soweit das Auge reicht. Der Weizen ist inzwischen hochgewachsen und die Getreideernte hat gerade Hochsaison.
»Ich habe Durst«, stöhnt Marischka.
Mutter stellt ihren Korb auf der Erde ab, holt eine Kanne mit Malzgetränk heraus und reicht sie Marischka. Das süßlich schmeckende, braune Getränk ist ein guter Durstlöscher während der heißen Tage.
Meine Schwester trinkt hastig.
»Wir müssen weiter«, sagt Mutter bestimmt, nachdem auch ich getrunken habe und sie die Kanne zurück in den Korb stellt. »Ihr wisst, Vater ist über jede helfende Hand dankbar.«
Mutter setzt den Weg ohne weitere Worte fort, während Marischka und ich uns unwillig von der Erde erheben und unseren Fußmarsch fortsetzen.
Jedes Jahr ist die Getreideernte eine Plackerei. Wenn der Weizen reif ist und geerntet werden soll, müssen alle mit anpacken, denn gemacht wird alles mit der Hand. Bei der Größe des Ackerlandes gibt es jede Menge zu tun.
Die Ländereien meiner Eltern umfassen 30 Desjatinen. Nicht, dass ich mich gut mit den Zahlen auskennen würde, aber Vater sagt, das entspreche einer Größe von etwa 33 Hektar, auf denen er vorrangig Getreide produziert. Der Anbau von Hafer, Kartoffeln, Gerste und Erbsen macht ebenfalls einen großen Teil der Ernte aus. Mit jedem Jahr wächst der Anteil an Ertrag, den Vater nicht nur auf dem Marktplatz verkauft, sondern auch außerhalb des Dorfes.
Vater ist ein gelehrter, gerissener Geschäftsmann und das macht uns zu einer mehr oder minder wohlhabenden Familie, die in der Lage ist, anderen Menschen Arbeit anzubieten.
Knechte und Heuerleute helfen das gesamte Jahr im landwirtschaftlichen Betrieb mit und liefern wichtige Hand- und Spanndienste. Vater achtet darauf, wen er einstellt. Am liebsten nimmt er ordentliche Leute mit guten Manieren, die ihre Arbeit exakt verrichten, auf dem Feld ackern und sich selbst gut und sauber halten.
Seit acht Uhr morgens, nachdem das Getreide auf dem Feld vom Morgentau getrocknet ist, ist die Arbeit in vollem Gange. Allen voran geht Vater selbst mit einer Sense. Ihm folgen Heuerlinge und Knechte sowie Egor und David. Sechs Mäher, die mit ihren Sensen den Weizen schneiden. Jeder Mäher hat seine eigene Reihe und alles geschieht flott und geschickt.
Vater ist ein starker Mann. Unermüdlich setzt er einen Schlag nach dem anderen an, sodass ungefähr nach sechs Schlägen die Garbe dick genug ist und er sie hinter sich in seiner Reihe ablegen kann.
Das Binden der Garben ist eine knochenharte Arbeit, die viel Geschick und Fingerfertigkeit erfordert und überwiegend von uns Frauen und Mädchen erledigt wird. Jede Binderin muss zwei Mähern nachbinden und das so schnell, dass man den Mäher bis auf zwei oder drei Garben vor sich hat. Wer das nicht fertigbringt, den erwartet elterlicher Unmut. Dabei spielt das Alter kaum eine Rolle. Nicht nur Mutter und Anneliese, sondern auch Marischka und ich müssen auf dem Getreidefeld mithelfen.
Um die Mittagszeit, sobald die Sonne am höchsten steht und das Läuten der Kirchenglocke im Echo um das umliegende Land hallt, wird die Arbeit unterbrochen.
»Mittagessen!«, ruft Mutter und damit sie auch alle hören, schlägt sie mit einer Kelle kräftig gegen ein Emailleeimer.
Es dauert einen Augenblick, bis sie alle Speisen ausgebreitet hat und die Arbeiter sich um die Körbe mit belegten Broten und Riwwelkuchen, die von Mutter und Anneliese am Tag zuvor gebacken worden waren, versammeln.
»Gerade recht. Ich habe solchen Hunger.« David reibt sich die Hände und späht auf die dargebotenen Speisen. Er wagt es jedoch nicht, nach einem Brot zu greifen, sondern wartet geduldig, bis Mutter das Tischgebet gesprochen hat. Erst dann fangen alle an mit großem Appetit zu essen.
Beim Essen sprechen und trinken alle, bis Heinrich Lipps‘ kräftige Stimme alles übertönt. Der Mann ist seit einem Jahr bei Vater beschäftigt und ist ein schrulliger Mensch, ein Märchenerzähler des sondergleichen. Man könnte meinen, dass er die halbe Welt bereist hat und sogar dem englischen King höchstpersönlich begegnet sei. Aber im Grunde ist er ein Dummschwätzer, der jedoch seine Arbeit gut verrichtet und den Vater deshalb als gute Hilfskraft zu schätzen weiß.
»Einmal hatte ich in Saratow zu tun«, beginnt Heinrich Lipps, nachdem er sich den Mund vollgestopft hat und alle hören ihm sofort gebannt zu. Das tun sie immer, wenn Heinrich Lipps zu erzählen beginnt. Wie viel Wahrheit in seinen Erzählungen steckt, das weiß niemand, doch interessant sind seine Geschichten allemal.
Als Heinrich Lipps vor vielen Jahren auf Anordnung seines damaligen Herrn auf dem Saratower Marktplatz alle Besorgungen erledigt hatte, bekam er Durst und Hunger, besaß jedoch kein Geld mehr, um sich etwas zu kaufen. Zunächst hielt er Ausschau nach einem bekannten Gesicht in der Menge, dann aber, nach einer Weile, wurde ihm klar, dass er hier weit und breit keine Bekannten antreffen würde. Seine Chance auf einen Klaren waren gleich null, und so begab er sich selbstbewusst in ein Wirtshaus, nahm an einem Tisch Platz, winkte die Bedienung zu sich heran und bestellte ein Schnitzel und Schnaps. Nachdem er alles ziemlich eilig vertilgt hatte, orderte er Nachschlag. Sobald er auch mit der zweiten Portion fertig war, stand er seelenruhig auf, und mit einem Gesichtsausdruck, als hätte er gerade etwas sehr Heldenhaftes vollbracht, begab sich Heinrich Lipps zum Ausgang.
Der Gastwirt sah ihm vom Tresen aus nach, und als ihm bewusst wurde, dass Heinrich Lipps nicht vorhatte, für Speis und Trank zu bezahlen, rief er ihm laut hinterher: »He! Der Herr! Bezahlen Sie gefälligst!« Die Worte erreichten Heinrich Lipps, als er bereits den Fuß in der Schwelle hatte. Er blieb abrupt, mit einer verdatterten Miene, stehen.
»Was ist los? Ach ja. Ich muss bezahlen … Das machen wir gleich. Moment.«
Heinrich Lipps kam zurück, stellte sich an den Tresen und begann, pantomimisch eine Telefonscheibe zu drehen – ein technisches Wunderwerk, das ich nur vom Hörensagen kenne. Nachdem er mehrere Umdrehungen vollzogen hatte, sprach er heiser: »Spreche ich mit London? W… wunderbar! Madame, geben Sie mir bitte den König! … Gut, ich warte … Sind Sie es, Herr König? Guten Tag! … Ja, ja, das bin ich, Heinrich Lipps, wie schön, dass Sie sich an Ihren alten Freund erinnern! Hier gibt es ein kleines Problem, Hoheit. Ich, also Heinrich Lipps, benötige dringend Geld. Seien Sie so freundlich, schicken Sie mir bitte einen Zehner … Nein, nein, in Rubel! … Ein Zehner, nicht mehr, das genügt völlig. Ich bedanke mich ergeben.« Heinrich Lipps legte die fiktive Hörmuschel auf und wandte sich anschließend an den Gastwirt, der ihn verblüfft anstarrte. Alle Gäste lachten sich ins Fäustchen.





























