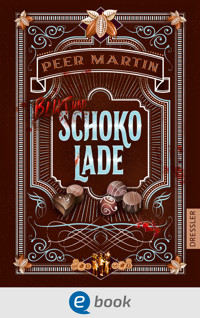
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als die 18-jährige Manal auf der Suche nach ihren Wurzeln an die Elfenbeinküste reist, ändert sich ihr Leben auf einen Schlag: Hinter einem von Hunden bewachten Zaun steht Issa, mitten im Urwald. Und braucht ihre Hilfe. Er will seinen kleinen Bruder nach Hause holen, der, wie viele andere Kinder, zum Arbeiten auf die Kakaoplantage verschleppt wurde. Doch so einfach ist das nicht, denn in der Welt hinter dem Zaun herrschen eigene Regeln, und viele der Kinder haben Angst vor der Freiheit. Schließlich gelingt ihnen jedoch mit Manals Hilfe die Flucht. Und eine gnadenlose Verfolgungsjagd durch ein ausgetrocknetes Land beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Und wenn sie kein Geistermädchen ist?, fragte eine Stimme zwischen den Schmerzen in meinem Körper. Wenn da draußen, ganz in der Nähe, Menschen sind? Die uns sehen können? Die – theoretisch – helfen könnten? Uns helfen, hier rauszukommen?
Manal liebt Schokolade. Und sie liebt Issa. Issa arbeitet auf einer Kakaoplantage, und er tut es freiwillige – im Gegensatz zu allen anderen Kindern, die dort wie Sklaven leben. Denn Issa hat ein Ziel: Er möchte seinen kleinen Bruder befreien, der dorthin verschleppt wurde. Dazu brauchter Manal. Doch was kann ein Mädchen aus Berlin schon gegen die alltägliche Brutalität auf einer Plantage am Rande des ivorischen Urwalds tun? Mehr, als Manal jemals für möglich gehalten hätte.
Für Hannah-Marie,
die Homeschooling nicht ohne Schokolade erträgt
Für Jacob und Aron,
die sagen, Schokolade sei für Frauen, und sie heimlich essen
Für Catherine,
die ihre Schokolade in Arbeitspausen in den Kaffee tunkt
Für Lola,
die eigentlich keine Schokolade essen darf, weil sie ein Hund ist
Für den Schokoladen in Berlin, wo seit Langem statt Schokolade Kultur gemacht wird, und für all die Kinder da draußen, die nie Schokolade essen werden und nur ihre bittere Seite kennen
Mit einem Dank an Paul Ouinso für die Übersetzung der Kakaobohnen ins Malinké, seine Koch-Tipps und die Richtigstellung einiger anderer Dinge
Vorwort
Schokolade.
Das ist ein Wort, das Assoziationen auslöst: Süße, Trost, Kindheit, Weihnachten, Ostern, Kalorien.
Meine Kinder lieben Schokolade. Ich liebe Schokolade. Selbst meine Hündin Lola liebt Schokolade. Sie stiehlt sie manchmal.
Schokolade ist nicht gesund für Hunde. Schokolade ist auch nicht gesund für Menschen – für die Menschen, die den Kakao dafür ernten.
Das ist die eine Sache. Doch es gibt eine zweite.
Wie viele Luxusgüter hat das, was in den Kakaoländern heute geschieht, eine Vorgeschichte, die weiter reicht. Eine Geschichte, die im Bewusstsein Europas wenig verankert ist, obwohl gerade dieses Europa Dreh- und Angelpunkt für sie war: die Geschichte des transatlantischen Dreieckshandels, der die heutige politische Entwicklung Afrikas mitbegründet.
Und deshalb gibt es in diesem Roman zwei Geschichten.
Ihr werdet dieser zweiten Geschichte, der Geschichte in der Geschichte, begegnen, und Euch möglicherweise über sie ärgern, da sie unterbricht, was Ihr lesen möchtet. Vergebt mir.
Ihr dürft die Geschichte überblättern. Vielleicht ist sie nur mir wichtig, mir, dem alternden Schriftsteller, der hier in seinem Arbeitszimmer sitzt und die Welt da draußen vorbeiziehen sieht, wie auch der Schriftsteller Pieter Sonnentau. Vielleicht ist sie nur mir wichtig und meinen Protagonisten, die für mich so real geworden sind.
Aber sie begründet vieles.
Peer Martin, Québec, Juni 2021
Pieter
Er saß an seinem Schreibtisch, den aufgeklappten Laptop vor sich, und sah aus dem Fenster.
Trank einen Schluck Kaffee. Starrte den Bildschirm an. Die Kopien alter Kupferstiche, die an die Wände gepinnt waren: Menschen in Reihen, dicht an dicht. Menschen in Ketten. Schiffe voller Menschen, Felder voller Menschen, gebeugte dunkle Rücken.
Er hob die Hände über die Tastatur – und ließ sie wieder sinken.
Trank noch einen Schluck Kaffee. Seufzte. Checkte Mails. Fluchte leise.
Hier saß er, Pieter Sonnentau, Mitte fünfzig, Schriftsteller, unfähig, einen Anfang zu finden.
Aber da war eine Geschichte, die er schreiben musste. Endlich, nach all den Romanen, deren Realität er hatte beugen können, wie er wollte.
Die Realität dieser Geschichte konnte er nicht beugen.
Denn sie war geschehen.
Nicht hier, in Berlin. Weit fort, unter der erbarmungslosen Sonne eines anderen Kontinents. Zweien, eigentlich. Und auf einem endlosen Ozean. Zwischen Blut und Dunkelheit, Feuer und Träumen.
Es war die Geschichte seiner Familie, aber es würde wehtun, sie zu schreiben. Er schob es seit Jahren vor sich her.
Er stand auf, um mehr Kaffee zu kochen.
Issa
Hier. Hier ist er in den Bus gestiegen.
Der Platz ist staubig und heiß. Ein kleiner, tapferer Baum steht neben der Straße, auch auf seinen Blättern liegt Staub, wie auf den Hütten und auf den Menschen, roter Staub wie Farbpulver.
Mädchen mit Körben auf den Köpfen warten auf den nächsten Bus, um Früchte und Erdnüsse zu verkaufen, Zahnbürsten, Rasierklingen, Kabel und bunte Handyhüllen.
Hat er diese Mädchen gesehen, als er hier war? Damals? Haben sie ihn gesehen?
Ich habe sie gefragt, sie erinnern sich nicht, er war einer von vielen. Die Namen und Erinnerungen wehen mit dem Staub davon, lösen sich auf in der Hitze. Aber er war da, ich kann es spüren, seine Angst, seine Hoffnung.
Ich werde seinen Namen nicht dem Staub überlassen.
Yaya. Damals sieben Jahre alt. Verschwunden. Mein Bruder.
Heute wäre er neun.
Bei Allah. Zwei Jahre lang habe ich nicht gewusst, wo er ist.
Ich werde nie vergessen, wie ich ihn immer auf meinen Schultern getragen habe. Wie wir gelacht haben, zusammen.
Fast zehn Jahre trennen uns, und er hat damals zu mir aufgesehen wie zu einem Vater. Es war auch kein anderer Vater da. Väter verschwinden, so ist das, Allah fragt nicht.
Ich liebe auch meine vier Schwestern, aber mit Yaya war es immer anders. Echt.
Und ich bin schuld, dass er fort ist.
Sie hätten mich sterben lassen sollen.
Aber sie haben mich gerettet, und das war ein Fehler. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich unsere Mutter, unsere wunderbare Mutter, und ich höre sie sagen: Schweig, Issa. Ich sehe sie lächeln. In meinem Tagtraum sage ich ihr: Wenn ihr mich hättet sterben lassen, hätten wir das Land nicht verkaufen müssen. Dann hätten wir keine Schulden. Und sie legt ihre schlanken Hände auf meine Schultern und lächelt und legt ihre Stirn an meine. Es ist ein schöner Tagtraum.
Ich bin alleine hier. Ich sehe meinen Schatten im Staub des Busparkplatzes, ein langer Schatten, die Sonne sinkt: ein Schatten auf Krücken.
Der Schatten hat nur ein Bein.
Ich kann die Familie nicht ernähren.
Damals, als ich im Fieber auf meiner Matte lag, als die Infektion das Bein schon halb aufgefressen hatte, hat Yaya meine Hand genommen. »Issa«, hat er geflüstert. »Du wirst gesund, und alles wird gut.«
Und ich bin gesund geworden, wir haben ein Vermögen bezahlt, und nichts ist gut.
Ich bin ein Krüppel.
Er ist meinetwegen gegangen. Yaya. Er ist gegangen, um Arbeit zu suchen. Er ist in einen Bus gestiegen. Der alte Abou, der am Busbahnhof Wasser verkauft, hat sich schließlich erinnert. Sie haben Yaya Geld versprochen. Sie haben ihm versprochen, dass er zurückkommen wird.
Das versprechen sie allen. All den Kindern, die in Busse zur Grenze steigen.
Er war nicht allein. Sie waren zu dritt, hat Abou gesagt, drei kleine Jungen.
Côte d’Ivoire.
Ein Land mit einem so schönen Namen! Es hat meinen Bruder verschluckt.
Zwei Jahre lang habe ich nicht nach ihm gesucht, habe ich weiter Baumwolle geerntet wie früher, auch mit einem Bein kannst du Baumwolle ernten. Seht es euch an, das Spiegelbild in der schmutzigen Scheibe des Busses, seht euch den jungen Mann mit den hölzernen Krücken und den traurigen Augen an. Sein Körper ist achtzehn Jahre alt. Sein Geist ist hundert.
Ich denke an meine Schwestern, meine vier schönen Schwestern, jetzt ist die letzte von ihnen verheiratet, sie sind alle versorgt. Und ich gehe. Ich werde Yaya finden.
Vielleicht denkt er an mich, in diesem Moment. Vielleicht sehnt er sich nach Hause.
»Komm zurück«, werde ich zu ihm sagen. »Mali wartet auf dich. Erinnerst du dich, wie schön es ist in der letzten Stunde des Sonnenlichts, wenn die Dunkelheit blau und golden herabsinkt?«
Denn das ist es. In dieser Stunde ist es ein Land für Verliebte. Ich hatte nie Zeit für die Liebe, und vermutlich hat die Liebe keine Zeit für einen Krüppel. Ich betrachte meine Hände: Arbeitshände, dunkel, rau und schwielig wie die rissige Rinde der trockenen Bäume. Sie halten eine Fahrkarte. Und ich steige, wie Yaya, in einen Bus.
Manal
Sie betrachtete ihre Hände.
Schmale Hände, dunkel, feingliedrig, an der linken silberne Ringe, einer mit einem schlichten blauen Stein, der andere ein Muster verschlungener Ornamente auf der dunklen Haut.
Er nahm sie in seine, die so viel heller waren, flocht ihre Finger ineinander, lachte, dort auf dem Sofa zwischen den bunten Decken und Kissen. »Weiße Schokolade und dunkle Vollmilch«, wisperte er. »Wenn man das mischt, gibt es marmorierte Pralinen, das wäre doch hübsch.« Und er ließ ihre Hand los und drehte stattdessen eine ihrer Locken um seinen Finger. Korkenzieherlocken.
»Und obendrauf Kringel aus schwarzer Bitterschokolade …«
Manal rollte mit den Augen. »Gib mir noch ein paar mehr Klischees«, flüsterte sie, lachte aber ebenfalls und zerzauste sein helles Haar.
Er: Joscha Hainmüller, 24, Student der Betriebswirtschaft und Teilzeitverkäufer mit kundenbindendem Charisma.
Sie: Manal Sophie Sonnentau, 18, Abiturientin, Aushilfe im Laden.
Und das Sofa: ein Sofa in einem Hinterzimmer voller Pappkartons und Geschenkpapierrollen. Wegebrecht und Söhne, Berlin stand auf dem Papier, in Gold eingeprägt. Chocolatiers mit Tradition, seit 1880. Der alte Wegebrecht musste ein Urenkel des ersten Wegebrechts sein, er selbst hatte keine Söhne. Oder Töchter. Weshalb er Joscha und Manal brauchte, um die Kunden ins Geschäft zu locken.
Sie waren schön, vor allem zusammen, schön, wenn sie zwischen den Pralinen standen und lächelten und abwogen, sie hatten eine so positive Ausstrahlung, alle sagten das.
Manchmal hasste Manal es, schön zu sein. Sie sagten ihr zu oft, dass sie schön war. Und es schien alles zu sein, was sie ausmachte; auch der alte Wegebrecht hatte nicht gefragt, welchen Abschluss sie hatte oder was sie mit ihrem Leben tun wollte, er hatte gesagt: Sie sind eine schöne junge Frau, und sie eingestellt. Und sie wusste, auch er hatte dunkle Vollmilch gedacht.
»Pssst!«, machte Joscha. Da waren Schritte im Verkaufsraum, Manal hörte sie jetzt auch. Der alte Herr Wegebrecht. Das Geschäft war geschlossen, sie sollten eigentlich damit beschäftigt sein, hier hinten Pralinen in Geschenkpäckchen abzupacken. Dies war nur eine Pause.
Sie lauschten gemeinsam, erstickten fast an ihrem Lachen. Natürlich wäre es peinlich, wenn der alte Wegebrecht sie nackt auf dem Sofa finden würde, andererseits taten sie nichts ausdrücklich Verbotenes.
Die Schritte näherten sich der Tür.
»Lass ihn doch reinkommen«, wisperte Joscha. »Kann er noch was lernen über Pralinen.« Er legte die Hände um ihre Brüste, als wären sie etwas, das er präsentierte: »Voilà, ein Traum von Mokka, mittig mit einem Hauch Nugatcreme.«
Manal hasste all diese dummen Vergleiche. Und eigentlich hasste sie Joschas Worte. Aber sie schlug seine Hände nur spielerisch weg, und dann stand sie neben dem Sofa und schlang mit einer blitzschnellen Bewegung eine der Decken um sich: goldgelbes Webmuster. Sie steckte sie seitlich über ihrer Brust fest, die Türklinke wurde heruntergedrückt – Joscha hechtete hinter das Sofa, wo er sich duckte, um sich in seine Jeans zu winden. In diesem Moment ging die Tür auf. Da stand er, der alte Herr Wegebrecht, klein und hager, im Anzug, korrekt wie immer. Er hielt ein Päckchen in der Hand und musterte Manal in ihrer Decke.
»Wir haben gerade etwas ausprobiert«, sagte sie. »Für eine neue Kampagne.«
»Afrika«, sagte Herr Wegebrecht und nickte. »Hübsch. Vielleicht noch ein Tuch ins Haar, im selben Farbton … vielleicht hat Ihre Mutter so was?«
Manal strich die etwas durcheinandergeratenen Locken zurück, die ihr bis fast auf die Schultern reichten, und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Hat sie nicht. Aber kriegt man im Eine-Welt-Laden.«
»Wir brauchen was Besonderes für die Adventszeit«, sagte Joscha und tauchte hinter dem Sofa auf, in Jeans, aber mit bloßem Oberkörper, vermutlich hatte er sein T-Shirt nicht gefunden. Manal musste sich auf die Lippen beißen, um nicht zu lachen. »Wir könnten heiße Schokolade ausschenken, im Ethnolook.«
Herr Wegebrecht nickte steif. »Afrika, der schwarze Kontinent der Schokolade.« Er sah zu Joscha und hob eine Augenbraue. »Und Sie sind … auf einer Wüstentour?«
»So in etwa«, murmelte Joscha und grinste.
»Wir müssen ohnehin über das Adventsgeschäft sprechen. Dienstpläne, Überstunden, Zusatzkräfte. Und da ist ein Paket für Sie.« Herr Wegebrecht sah Manal an. »Eigentlich bin ich deshalb gekommen. Ich war vorn im Laden, um die letzte Lieferung zu kontrollieren, da habe ich es gefunden.«
Manal nahm das Paket und las den Absender. Mamadou Didier Touré. Côte d’Ivoire. Und ein Bezirk. Irgendwelche Zahlen.
»Mein Onkel«, murmelte sie. »Warum schickt er mir ein Paket ans Geschäft?«
Herr Wegebrecht zuckte die Schultern. »Ich überlasse Sie dem Pralinenabpacken, werden Sie mit den fünfzig Stück noch heute fertig?«
»Natürlich«, sagten Manal und Joscha gleichzeitig. Und dann schloss sich die Tür hinter Herrn Wegebrecht. Sie atmeten beide auf und ließen sich aufs Sofa fallen.
»Afrika-Kampagne«, flüsterte Joscha und grinste. Er fuhr mit dem Finger die Linie nach, die die Decke bildete, oberhalb ihrer Brüste. »Das will ich sehen, wie du im Advent so im Laden stehst.«
Manal schnappte sich eine Schere und öffnete das Paket. Darin lag, geschützt von alten Zeitungen, eine große rötlich gelbe Frucht mit breiten dunkelbraunen Streifen.
»Eine Kakaoschote«, sagte Joscha.
Manal nickte. Sie überflog den Brief, der bei der Schote lag, die winzige, ordentliche französische Schrift ihres Onkels.
Schneide sie auf, mein Kind, aber sei vorsichtig, ihre Schale ist hart, nur ihr Inneres ist weich. So ist es auch mit unserem Land. Côte d’Ivoire.
Deine Mutter sagt mir, Du bist fertig mit der Schule und spielst mit dem Gedanken, Dir ein wenig die Welt anzusehen. Sie sagt, Du jobbst im Moment noch, und Du zögerst. Meine liebe Manal! Zuletzt haben wir uns gesehen, als Du ein kleines Mädchen warst und ich Euch in Berlin besucht habe. Nun haben Fatouma und ich überlegt, ob Du nicht zu uns kommen möchtest. Deine Wurzeln kennenlernen. Unsere Söhne sind inzwischen alle in den Staaten und studieren, und es ist wunderbar, das weißt Du ja, denn deine Familie hat es möglich gemacht. Aber es ist ein wenig still im Haus. Im Moment beginnt bei uns die Kakaoernte, vielleicht möchtest Du das einmal sehen. Schneide die Kakaofrucht auf und frage ihr Inneres nach Deiner Zukunft.
Mamadou
Manal schüttelte den Kopf. »Er war schon immer ein Spinner, mein Onkel«, sagte sie und lachte.
Joscha fand ein Messer im Laden, und er blieb hinter ihr stehen, während sie die harte Frucht in zwei Hälften schnitt, sie spürte seinen Atem auf ihren bloßen Schultern.
Dann klappte die Frucht auf, das Fruchtfleisch und die Samen lagen vor ihnen.
»Sie sind weiß!«, sagte Joscha erstaunt. Manal lachte. »Ja, sie sind weiß.«
Sie griff tief ins Innere der Frucht, holte mit zwei Fingern etwas von der glitschigen Masse heraus und steckte es Joscha in den Mund.
»Hm«, sagte er. »Süß. Aber nicht schokoladig.«
»Man macht die Schokolade aus denen hier«, sagte Manal und nahm einen der großen Samen. Steckte ihn in den Mund. Schüttelte sich. Er schmeckte bitter.
»Du kannst hinfahren. Alles darüber rausfinden, wie man sie macht«, sagte Joscha. »Du warst noch nie bei deinem Onkel, oder?«
»Nein. Er ist nicht mal wirklich mein Onkel. Er ist um tausend Ecken verwandt mit meiner Mutter.«
»Ich dachte, deine Mutter kommt aus den USA.«
»Tut sie. Lange Geschichte.« Manal seufzte. »Und eigentlich hat sie nichts mit mir zu tun.«
»Fahr hin. Sieh es dir an. Das Land, aus dem deine Vorfahren kommen.«
Sie legte den Kopf schief. »Kommst du mit?«
Er küsste sie und schüttelte den Kopf. »Das Weihnachtsgeschäft ruft. Und das Studium. Das ist dein Abenteuer.«
Sie zog einen Flunsch. »Ich dachte, jetzt, wo wir miteinander geschlafen haben, sind wir fest zusammen?«
»Ich …« Joscha machte einen Schritt zurück. »Ich meine, du bist das schönste Mädchen, das ich kenne, und ich würde das durchaus wiederholen, aber … ich bin nicht so der Typ für monogame Beziehungen …«
Sie beobachtete, wie er hilflos dastand, und das Lachen platzte aus ihr heraus. »Hast du gedacht, ich mein das ernst? Joscha. Wer ist schon der Typ für monogame Beziehungen?«
Und dann nahm sie eine Praline von einem der Kühlgitter, eine noch unverpackte Praline, steckte sie in den Mund und leckte sich die Finger ab.
»Das Leben ist ein Spiel«, wisperte sie. »Ein Spiel und Schokolade.«
Aber als sie sich anzog, fragte sie sich, ob das eigentlich alles war. Und eine seltsame Sorte Melancholie zog an ihr.
Als ihr Vater ihr an diesem Abend Gute Nacht sagte, wie er es tat, seit sie klein war, saß Manal im Bett und sah den Mond an, der durchs Fenster schien.
»Du wirfst dich nicht mehr ins wilde Leben heute Abend?«, fragte er. »Ich meine, es ist elf Uhr, und du hast das Licht aus?«
»Ich habe den Mond an«, flüsterte Manal. »Ich denke nach.«
Er setzte sich auf den Stuhl an ihrem Schreibtisch. »Darüber, was du tun wirst?«, fragte er leise. Er sagte nicht: Du solltest dich endlich entscheiden, du hängst zu lange rum, es war Mai, als du das Abi gemacht hast, jetzt haben wir November.
»Warst du mal in Côte d’Ivoire?«
Er nickte. »Zwei Mal. Lange her. Zwischen dem letzten Mal und heute liegen zwei Putsche.«
»Mit Mama?«
»Das erste Mal ja. Das zweite Mal allein. Ich wollte immer darüber schreiben.« Er seufzte. »Über die Geschichte unserer Familie. Eurer Familie.«
»Meine ist es nicht«, sagte Manal. »Meine Familie seid ihr, du und Mama.«
»Die anderen auch«, sagte er. »Du hast sie nur nicht gekannt.«
»Wurzeln«, murmelte sie und dachte an den Brief. »Aber es sind nicht deine.«
Er schüttelte den Kopf. Sah seine Hände an. Weiße Hände. Nein. Niemand war weiß, weiße Menschen waren rosa wie Himbeerbonbons, ehe man sie in den Mund steckt. Oder rosa wie Krabben. Oder blass wie Fischfilet. Sie waren alle anders, genau wie dunkle Menschen alle auf andere Weise dunkel sind. Und der Schriftsteller Pieter Sonnentau, Manals Vater, war ein erdbeerjoghurtfarbener Mann mit dünner werdendem rotem Haar und Sommersprossen. Früher hatte sie sich gewünscht, so auszusehen wie er.
»Mamadou hat dir geschrieben«, sagte ihre Mutter, die in den Türrahmen getreten war. Ihr Gesicht war dunkel wie die Nacht im Flur hinter ihr. Manal nickte.
»Und? Besuchst du ihn?«
»Ich denke darüber nach. Eigentlich war der Plan ja eher, eine Art Weltreise zu machen … Aber es könnte die erste Station sein. Irgendwo muss man anfangen.«
»Muriel und ich würden den Flug sponsern«, sagte Manals Vater.
»Weil ihr glaubt, es wäre gut für mich, meine Wurzeln zu finden?«
»Weil wir glauben, es wäre gut für dich, irgendwo damit anzufangen, irgendetwas zu finden«, sagte Muriel und lachte, wie sie immer lachte. Ernst.
1
Issa
Es war Nacht, als ich ankam.
Ich war elf Tage lang unterwegs gewesen, hatte Busse gewechselt, mit Leuten geredet, mich an meinen Fragen entlanggehangelt. Manche Leute wollen nicht reden. Manche sind blind. Sie sehen die Kinder nicht. Die Nichtblinden sagten, an der Grenze bringen sie sie mit Mopeds rüber, einzeln, damit es nicht auffällt.
Wenn da einer ist, dem es auffällt, hält er die Hand auf für ein paar Scheine und sieht hinterher weg.
Es sind nicht viele Kinder, sagten sie, mal eins, mal zwei oder drei. Aber ein ständiger Strom.
Und Yaya ist Teil dieses Stroms gewesen.
Am Nachmittag stieg ich im letzten Ort aus, zu dem der Bus fuhr.
Und ich fand Menschen, die mir die Richtung wiesen, sie sprachen Malinké wie ich, es klang nur ein wenig anders als in Mali. Jenseits des Ortes begann der Wald.
Ein Nationalpark, ich las es auf einem verwitterten Schild für Touristen. Aber es sah nicht aus, als kämen eine Menge Touristen hierher. Dieser Park, sagten die Leute mit einem Achselzucken, ist verbraucht. Nicht mehr viel da für die Touristen. Ein paar Reste. Die meisten Bäume sind zu Brennholz geworden und zu Brettern, die Fläche zu Feldern, wer braucht Bäume? Wir brauchen Felder.
So begann ich meine Wanderung zu Fuß, an den Überresten des Nationalparks entlang. Ich wünschte, es wären mehr Bäume gewesen. Mehr Schatten.
Nach drei Stunden sank die Sonne, und dann war es dunkel, und dann führte der Weg, der kaum mehr war als eine Fahrspur, in den Wald. Der Mond malte meinen Schatten auf die trockene Erde, einen schwankenden Schatten auf Krücken, der sich mühsam vorwärtsschleppte, den Schatten eines Clowns, über den niemand lacht.
Und dann gab es eine Abbiegung, und an ihrem Ende, endlich, ein Tor in einem hohen Drahtzaun. Ich wusste, was auf dem Schild stand, ohne dass ich Licht brauchte, um es zu lesen.
Plantation de cacao, M.A. Youssouf Kalou.
Den genauen Namen der Plantage kannte ich erst seit dem letzten Ort. Es hätte auch jeder andere sein können, es gibt Dutzende, Hunderte solcher Plantagen in diesem Land.
»Cacao«, flüsterte ich in die Nacht. Es war ein Zauberwort. Oder ein Fluch.
Das war der Grund, aus dem sie die Kinder einsammelten. Yaya, mit seinen sieben Jahren, war losgezogen, um Geld zu verdienen. Er hatte nicht gewusst, was ich wusste: dass sie nicht zurückkehren, niemals, die Kakaokinder.
Aber ich war hier, und ich würde ihn nach Hause holen.
Ich trat näher an den Zaun. Dahinter führte der Weg ein Stück weiter, bis zu einem Platz aus festgestampfter Erde. Daneben stand ein gemauertes Haus mit zwei Stockwerken, ein gutes Haus. Weiter hinten zwei niedrige, palmstrohgedeckte Hütten und dahinter die Bäume: Bäume in Reih und Glied, niedrige Bäume mit breiten, dunklen Blättern, ihr Geruch schwer und feucht.
Kakaobäume, Träger von schwarzem Gold in der samtenen Nacht. Zwischen den Bäumen sah ich Geister umherstreichen, leise Schatten, ich hörte ihr Wispern in den Zweigen.
Und dann schlugen die Hunde an. Es waren drei, sie kamen mit gefletschten Zähnen und geifernden Mäulern angerast und sprangen am Zaun hoch. Ich machte auf meinen Krücken einen Schritt zurück.
Ich gebe es nicht gerne zu – aber ich habe Angst vor Hunden. Ich, Issa, achtzehn Jahre alt, unfreiwilliger Clown auf Krücken, habe Angst vor ihnen wie ein Kind. Denn es war ein Hund, der mich zum Clown gemacht hat. Die Infektion hat sich nach oben gefressen, hat das Bein verfaulen lassen, aber es begann mit dem Biss des Hundes, und manche sagen, auch er war von einem Geist besessen.
Einer der Hunde warf sich gegen den Draht, um an mich heranzukommen, und ich sah seine Augen, sah seine Mordlust. Und dann war da ein Mädchen, ganz plötzlich, als hätte die Nacht selbst sie ausgespuckt; ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid wie eine Erscheinung.
Sie legte ihre Hände auf die Rücken von zwei Hunden, da wurden sie alle still, sie setzten sich hin und sahen zu ihr auf.
»Wer … wer bist du?«, hörte ich mich flüstern.
»Ich heiße Colombe«, sagte das Mädchen, und ich dachte, natürlich, Colombe, die Taube, wie hätte sie anders heißen können.
»Aber wer bist du?«, fragte sie. »Was machst du hier, so spät am Abend?«
»Ich suche meinen Bruder«, sagte ich. »Yaya. Er ist aus Mali hierhergekommen, vor zwei Jahren.«
Sie nickte langsam und streichelte einen der Hunde. Da tauchten hinter ihr zwei Jungen in der Dunkelheit auf, zwei Jungen, der eine so alt wie sie, vielleicht acht, der andere jünger, fünf oder sechs. Sie kamen nicht näher, hielten Abstand zu den Hunden. Ihre Hosen und Hemden waren zerrissen, sie waren ganz anders als das Mädchen in seinem weißen Mondlichtkleid.
»Wir hatten einen hier, der Yaya hieß«, sagte der eine und sah zu mir herüber. »Aber der ist tot.«
»Seit wann?«, fragte ich, zu perplex, um irgendetwas zu fühlen.
»Seit vorgestern«, sagte der eine Junge. Aber der andere sagte im selben Moment: »Seit letztem Jahr«, und da wusste ich, dass sie logen.
»Er ist also hier«, sagte ich. »Ich werde morgen wiederkommen. Und ich werde ihn mitnehmen …«
Das Mädchen trat ganz nah an den Zaun und sah zu mir auf. »Das kannst du nicht«, sagte sie leise.
»Oh doch«, sagte ich. »Ich werde ihnen sagen, dass wir auf seinen Lohn verzichten. Ich will nur, dass er mit mir kommt.«
Sie legte den Kopf schief und musterte mich eine Weile.
»Du kannst deinen Bruder nicht mitnehmen« flüsterte sie dann, »weil mein Vater ihn gekauft hat. Genau wie Momo und Boubou. Und die anderen. Er hat viel Geld für sie bezahlt. Und ihr beide solltet zurückgehen.« Sie drehte sich halb zu den beiden Jungen um. »Klettert wieder in die Hütte, durchs Fenster. Ihr wisst, was passiert, wenn sie euch nachts draußen erwischen.«
»Dein Vater … ist Monsieur Youssouf?«, fragte ich, verwundert. Es erklärte die Sauberkeit des weißen Kleides. Es erklärte, warum die Hunde auf sie hörten. Es erklärte nicht das Lächeln, das sie lächelte. »Streite nicht mit ihm«, sagte sie. »Und streite nicht mit Yves. Er ist mein Bruder. Yves ist gefährlich.« Sie flüsterte jetzt, und die beiden kleinen Jungen nickten.
»Er ist ein Teufel«, flüsterte einer von ihnen.
»Dann werde ich mit dem Teufel kämpfen«, sagte ich.
Colombe und die Jungen sahen mich an, und ich sah mich durch ihre Augen. Ich hatte mein bestes Hemd angezogen, ein Erbstück von unserem Vater, aber elf Tage Reise hatten Spuren darauf hinterlassen, der Kragen löste sich, es hatte einen Riss über der Brust, und dann waren da die Krücken, ich war ein jämmerlicher Anblick, wie sollte ich mit einem Teufel kämpfen?
»Es gibt nur eine Möglichkeit für dich, ihn zu sehen«, flüsterte Colombe. »Deinen Bruder, meine ich. Aber es ist keine gute Möglichkeit.«
»Ich bin zu allem bereit«, sagte ich, stützte mich nur noch auf eine Krücke, drückte meinen Rücken durch und richtete mich auf, als müsste ich einen Test bestehen vor diesem kleinen Mädchen.
»Komm morgen früh und bitte Monsieur Youssouf um Arbeit. Er braucht Leute, jetzt in der Ernte. Die Krücken sind dein Glück. Einen ganzen Mann könnte er nicht bezahlen, einen halben vielleicht. Wenn du zu den gleichen Bedingungen arbeitest wie die Kinder, dann wird er dich aufnehmen, und dann kannst du Yaya sehen.«
Sie sah zu den beiden Jungen hinüber. »Aber ihr, ihr müsst den Mund halten«, sagte sie. »Ist das klar? Ihr habt heute Nacht niemanden hier gesehen. Keinen Jungen, der seinen Bruder sucht.«
»Warum nicht?«, fragte der Kleinere, und der Größere sagte: »Darum.«
»Aber wenn du durch das Tor auf die Plantage kommst«, wisperte die Taube, »wirst du sie nicht wieder verlassen.«
»Warum?«, fragte ich. »Die Kinder sind gekauft worden, aber ich? Ich komme selbst.«
»Und du wirst dich selbst verkaufen«, sagte sie. »So wird es sein.«
Und dann kam der Morgen, ein grüner Morgen, der über grünen Bäumen heraufdämmerte, und die Sonne begann ihre Reise über den Himmel und trocknete den Tau der Nacht. So sah ich sie zum ersten Mal wirklich: die Bäume. Kinderbäume, verglichen mit den Riesen des Urwaldes. Sie waren niedrig, ihre Stämme dünn, grau und dunkelgrün gefleckt vom Moos, grazil geneigt über einen weichen braunen Teppich aus herabgefallenem Laub. Und ich sah ihre Früchte: gelb, rötlich, leuchtend, wie Klumpen von Gold. Sie saßen direkt an den Stämmen, und es ging ein Zauber von ihnen aus, der vielleicht gefährlich war, wie alles, was zu schön ist.
Und dann sah ich, wie ein älteres Mädchen die Türen der beiden Hütten aufschloss, und ich sah die Jungen aus den Hütten kommen, verschlafen noch taumelten sie ins Freie. Es gab ein Feuer, an dem sie gemeinsam in der Morgendämmerung standen und Tee aus kleinen Blechtassen tranken, im Stehen. Da sah ich ihn.
Yaya. Mein Bruder. Mein Herz setzte für einen Schlag aus. Er war älter geworden, mehr als zwei Jahre, er war kein Kind mehr, und in seinen Augen lag der gleiche müde Schatten wie in denen der anderen. Er sah mich nicht. Jetzt bildeten die Jungen eine Schlange, bewacht von den Hunden, holten sich bei einem jungen Mann jeder eine Machete ab, auch Yaya. Er hielt die Augen gesenkt wie die anderen. Und die Jungen verschwanden zwischen den Bäumen, waren fort, verschluckt vom Spiel aus Licht und Schatten. Der junge Mann sah ihnen nach und verschränkte die Arme, lehnte sich für einen Moment an die Hauswand, entspannt.
Dann spuckte das Haus einen älteren Mann aus, klein und untersetzt und mit einem traurigen Gesicht wie ein Elefant. Er sah sich um, entdeckte mich und kniff die Augen zusammen.
Kam auf den Zaun zu, begleitet von einem der Hunde. Blieb vor mir stehen und musterte mich. »Was willst du?«
»Mein Name ist Issa«, sagte ich, »und ich suche Arbeit.«
»Du?«
»Ich habe zwei gesunde Arme. Ich habe gehört, Sie brauchen Erntehelfer. Ich bin nicht schnell, aber ich bin stark.«
»Soso«, sagte der Mann. Monsieur Youssouf, dachte ich.
»Ich arbeite für den Preis, den Sie den Kindern zahlen«, sagte ich.
Er nickte langsam. »Den Lohn gibt es am Ende der Ernte. Jetzt … kannst du für deine Arbeit hier schlafen und essen.«
»Gut«, sagte ich. Und er öffnete das Tor, und ich ging hindurch.
Wenn du die Plantage betrittst, wirst du sie nicht wieder verlassen.
Und dann fand ich das Mädchen von letzter Nacht wieder, die weiße Taube, sie saß mit ihrer Mutter neben der Feuerstelle und scheuerte einen Topf aus, und ihr Kleid war gar nicht weiß. Es war gelb und hellbraun kariert, sauber, aber zerschlissen. Nur das Mondlicht hatte es in der Nacht verwandelt.
»Du kannst deinen Namen hier auf die Liste setzen«, sagte Monsieur Youssouf und hielt mir einen uralten Ordner hin, in dem eine Menge Namen standen. Ich nahm den Füller und schrieb. ISSA.
Und ich dachte daran, wie ich damals zwei Jahre lang Buchstaben und Zahlen gelernt hatte, zusammen mit den anderen Schülern. Wenn ich die Augen schloss, sah ich sie vor mir: eine wunderbare Zeit, als wir mehr Felder hatten, meine schönen Schwestern alle zu Hause waren und unser Vater noch lebte. Damals hatte ich gedacht, ich könnte etwas Erstaunliches und Bedeutendes werden. Ein Astronaut, der die Sterne erforscht. Ein Taucher in den tiefen Meeren. Ein Lehrer, der Kindern Worte erklärt. Ich öffnete die Augen, und eine Hand legte sich auf das Papier vor mir. Eine schöne, schlanke Hand mit einem goldenen Ring. Sie verdeckte meinen Namen und die der anderen, löschte sie aus.
»Aufwachen! Nicht träumen!«
Vor mir stand der junge Mann von vorhin. Es war seine Hand, und so, wie er aussah, gehörte ihm auch alles andere. Die Welt. Er war ein wenig kleiner als ich, aber er hielt sich sehr gerade, sein Körper feingliedrig, elegant und doch muskulös. Ein schöner Mensch. Ein Prinz.
Ich mochte ihn nicht.
»Issa«, sagte er. »Issa, der Traumwandler. Was ist mit deinem Bein passiert?«
»Ich … habe es nicht bei mir«, sagte ich und weigerte mich, seinem Blick auszuweichen.
Er lachte leise. »So, hast du nicht«, sagte er. »Aber deine Arme hast du bei dir, und wenn du hier arbeiten willst, solltest du anfangen, sie zu benutzen. Silvester, gib ihm eine Machete.« Er sah hinüber zu den Hütten, wo ein weiterer älterer Junge lehnte und mit einem Stein eine der geschwungenen Macheten schliff. Er war lang und hager. Und dann löste er sich von der Hütte und kam herüber. Eine Schlange. Dieser Junge bewegte sich wie eine Schlange, geschmeidig und lautlos.
Der Blick seiner ungewöhnlich hellen Augen, Schlangenaugen, saugte sich für einen Moment an mir fest. Dann hob er die Machete. »Vorsicht«, sagte er. »Scharf.« Und er ließ die glänzende Schneide vor meinem Gesicht durch die Luft wirbeln, sodass ich zurücktaumelte.
»Nimm sie. Das ist ab jetzt deine Freundin.« Er schulterte seine eigene Machete. »Komm.«
»Silvester, du zeigst ihm, was zu tun ist«, sagte der Prinz. »Wir haben keine Zeit zum Trödeln, verstanden? Mach das allen klar. Die Ernte ist gut, aber wenn wir sie nicht reinkriegen, nützt das niemandem etwas. Und heute Nachmittag fangen wir mit der Vorbereitung des neuen Feldes im Süden an.«
Silvester nickte, und wir gingen los, zwischen die Bäume, es war erleichternd, in ihren Schatten zu treten, in ihren Duft nach Grün und nach Leben. Aber Silvester ging schnell, ich kam nicht hinterher. Er wartete, ungeduldig. »Ich verstehe nicht«, sagte er kopfschüttelnd, »weshalb sie dich angestellt haben. Du wirst dreimal so lange brauchen wie die anderen.«
Ich nickte. »Sie zahlen mir weniger.«
»Zahlen. Hm«, sagte er. Und dann ging er weiter. Die Krücken sanken im federnden Laubteppich ein, armer Clown.
»Verdammt, und dann auch noch das neue Feld, das soll mir mal einer sagen, warum wir die Bäume jetzt abbrennen müssen, während der Ernte«, hörte ich ihn murmeln. »Er ist ein Verrückter, dieser Yves, merk dir das.«
»Warum … ernten wir nicht die Früchte ganz vorn? Nahe bei … den Hütten?«, keuchte ich.
Er schnaubte. »Das sind Vorzeigebäume. Für den Pisteur. Der die Ernte für die Großkunden aufkauft«, sagte Silvester kurz angebunden. »Du musst eine Menge lernen.«
Und endlich blieb er stehen. »Hier«, sagte er. »Unser Gebiet für den Tag. Du nimmst die Reihe da drüben, ich die Bäume hier. Guck zu.« Er setzte die Machete direkt über der ersten Kakaofrucht an, markierte eine Linie und trennte die Frucht dann mit einem einzigen gezielten Schlag ab, ohne die Rinde des Baumes zu verletzten. Dann bückte er sich und warf sie ein paar Meter weit weg. »Der Haufen der Früchte darf nicht unter dem Baum entstehen, sonst beschädigen sie sich gegenseitig beim Fallen.«
Es war eine einzige fließende Bewegung: zielen, hacken, aufheben, werfen, zielen.
Ich versuchte, es Silvester nachzumachen, doch ich musste eine Krücke loslassen, um die Machete zu schwingen, sie war schwer, und mit einer Krücke ist es nicht leicht, sich nach der gefallenen Frucht zu bücken. Ich kämpfte verbissen, es Silvester gleichzutun, doch es war unmöglich. Er arbeitete sich Baum um Baum voran, er war schnell wie der Wind.
Zu Hause auf dem Feld hatte mir niemand das Tempo vorgegeben.
»Wie lange machst du das schon?«, fragte ich.
Er wog eine Kakaofrucht in der Hand. »Seit ich acht bin. Zehn Jahre.«
»Und … wolltest du nie hier raus? Etwas anderes tun?«
»Schlag die Schoten ab und quatsch nicht«, sagte Silvester.
Als wir endlich eine Pause machten, tat mir alles weh, und ich verfluchte meinen Körper, verfluchte jede einzelne Faser. Silvester wartete nicht. »Komm essen, Traumwandler«, sagte er, und dann war er fort.
Ich erreichte die Hütten erst, als die anderen schon dort versammelt waren, sie waren aus allen Ecken der Plantage zusammengekommen und saßen in einem Kreis auf dem Boden, hielten Blechtassen in der Hand und Teller mit gelbem Kabato, Maismehlbrei. Ich ließ mich ebenfalls auf den Boden fallen. Es war anders gewesen in der Baumwolle, die Baumwolle hatte ihre eigene Poesie gehabt, sie hatte uns gehört, sie war schwerelos gewesen, als könnte ich auf ihr fliegen, sie hatte mir Zeit gelassen.
Kakao lässt dir keine Zeit. Er erschlägt dich. Bäume voller Goldbarren, schwer, unbarmherzig.
Die Gesichter der Arbeiter waren jung. Ich fand die beiden aus der Nacht wieder, Momo und Boubou, Boubou schien der Jüngste von allen zu sein, er hielt sich immer nahe bei Momo, der auf ihn aufpasste. Und ich fand andere, lauter kleine Jungen, Kakaokinder. Sie lachten miteinander, scherzten, aber hinter den Scherzen war eine Müdigkeit in ihren Augen.
Yaya war nicht bei ihnen.
Und dann tippte mir jemand auf die Schulter: Colombe. Sie lächelte mich an und gab mir ebenfalls eine Tasse Tee und einen Teller. Das ältere Mädchen, vielleicht fünfzehn Jahre alt, saß mit der Mutter ein wenig abseits, sie waren dabei, Maismehl für mehr Kabato in einem großen Topf in heißes Wasser einzurühren. Ich spürte ihren Blick. Die Blicke aller. Sie sahen sich den Krüppel an und fragten sich, was er hier wollte.
»Tja, sieht aus, als hätten wir einen neuen Arbeiter«, sagte Silvester und hob seine Blechtasse. »Auf den Neuen! Aber nehmt euch kein Beispiel an seiner entspannten Geschwindigkeit.« Die anderen lachten.
»Ich, ich bin schnell!«, sagte Boubou. »Ich kletter in die Bäume wie ein Affe, Silvester, ich komm jetzt bis ganz nach oben!«
»Aber dann klammert er sich fest und kann die Machete nicht mehr halten«, sagte ein anderer, alle lachten, und Boubou sagte: »Gar nicht wahr, Moussa kann das selber nicht besser, der hat doch Schiss, der würde lieber Kabato kochen mit den Frauen.« Da lachten alle schon wieder.
»Vielleicht leiht Desirée dir ein Kleid«, sagte irgendwer, und sie sahen zu dem älteren Mädchen hinüber. Sie errötete und rührte weiter in ihrem Topf. »Kommt nur her, ihr mit euren dummen Sprüchen!«, rief sie. »Dann mach ich hier Mus aus euch.«
Mitten im Lachen, das darauf folgte, trat noch jemand in den Kreis.
Yaya.
Mein Herz machte einen Satz.
Er ließ den Blick über die Runde wandern, dann blieb der Blick an mir hängen, und etwas breitete sich ganz langsam über sein Gesicht, etwas wie ein Licht. Ich hob die Hand und legte ganz langsam, wie zufällig, einen Finger an die Lippen. Und Yaya, mein kluger kleiner Bruder, verstand.
»Wer ist das?«, fragte er und setzte sich.
»Ich bin Issa«, sagte ich.
Und er nickte. »Hallo, Issa«, sagte er. Als er sich vorbeugte, um seinen Tee entgegenzunehmen, sah ich, dass eine Träne in seinem Auge glänzte.
Und dann das Aufschlagen der Früchte. Ein Berg aus Gold. Die Krücken neben mir auf der Erde, die Machete in meiner Hand. Und neben mir mein Bruder.
Ich sah seinen Händen zu, wie sie arbeiteten, flink, geübt, sah, wie er die zu große Machete ansetzte und die Schoten spaltete, auseinandernahm, das weiße Innere herauskratzte.
»Später legen wir es zum Trocknen aus«, sagte er und meinte: Wie hast du mich gefunden?
»Es wird dauern, bis die Kerne trocken sind«, sagte ich und meinte: Ich habe zwei Jahre lang nach dir gefragt und gesucht.
Wir sagten die wirklichen Sätze nur mit unseren Augen, und ich hätte ihn so gerne in die Arme gezogen, diesen tapferen kleinen Bruder neben mir, aber da waren die anderen, sie saßen alle um den Goldberg herum, und da war Silvester. Er kontrollierte sie alle, sagte hier etwas Ermunterndes, übte dort Kritik, aber mich kontrollierte er mit anderem Blick. »Zu langsam«, sagte er, »zu langsam.«
Und dann begriff ich, dass auch er mit den Augen etwas anderes sagte.
Wir waren gleich alt. Achtzehn. Alle anderen waren jünger. Kleiner. Kinder. Was Silvester eigentlich sagte, war: Du bist ein Krüppel, vergiss das nicht. Kein Mann. Ich bin es, der diese Bande befehligt, und du wirst mir meinen Platz nicht streitig machen.
»Ich werde schneller werden«, sagte ich und meinte: Hast du Angst?
Ich lächelte, als ich das sagte. Er nahm mein Lächeln und zertrat es mit seinem Blick.
»Schneller. Ja. Das musst du«, sagte er und meinte: Ich habe keine Angst. Vor nichts und niemandem.
Aber er log.
Die Dämmerung des ersten Tages fraß bereits den Himmel auf, als wir endlich allein waren. Für zwei Minuten: gestohlene Zeit unter dem grünen Dach der Blätter, abseits von den anderen. Ich war dabei, einen letzten Sack mit Schoten zu füllen, und da stand er im Abendlicht – mein Bruder, neun Jahre alt, in einem karierten Hemd, das vor allem aus Löchern bestand, die knielang abgeschnittene Hose mit einem Stück Schnur zusammengehalten, gebückt unter dem Gewicht eines Sacks. Ich sah die Schweißtropfen auf seinem Gesicht.
Doch er lächelte.
»Issa«, flüsterte er. »Ich … dachte erst, du wärst ein Geist. Aber du bist echt. Oder?«
Ich grinste, lehnte mich halb an einen Stamm, hievte meinen eigenen Sack auf meinen Rücken, strauchelte unter dem Gewicht, schnappte die Krücken. Ein Gleichgewichtskunststück.
»Hast du schon mal einen Geist auf Krücken gesehen?«
»Es sieht furchtbar aus«, sagte Yaya, und sein ganzes Gesicht war voller Sorge. »Als ich gegangen bin, hattest du sie noch nicht. Du lagst da und schliefst, im Fieber, der Verband war ganz frisch, und irgendwie dachte ich, alles wird wieder gut.«
»Beine wachsen selten nach«, sagte ich und grinste. Er nickte.
»Issa.« Er verlagerte den Sack auf seinem Rücken, verzog das Gesicht. Aber er setzte ihn nicht ab, und ich wusste, warum – es war zu schwer, ihn wieder auf den Rücken zu bekommen. »Bist du … meinetwegen da?«
»Nein, Dummkopf«, sagte ich. »Ich bin nur zufällig hier, in diesem Land, das nicht das meine ist, und habe mich für einen Hungerlohn auf einer Kakaoplantage anstellen lassen.«
»Wie viel Geld geben sie dir?«
»Was du auch bekommst. Krüppel kriegen, was Kinder kriegen.«
Yaya lachte. »Also nichts.«
»Es hieß, das Geld kommt mit der Ernte.«
»Das heißt es immer«, sagte Yaya. »Ich dachte das auch. Ich dachte, ich kann dir Geld schicken. Aber es gibt kein Geld. Es gibt etwas zu essen und einen Schlafplatz, das war’s.«
»Oh nein«, sagte ich. »Ich bin freiwillig gekommen, und sie werden mich bezahlen müssen. Niemand hat mich verkauft. Yaya. Hast du versucht, wegzulaufen?«
Er musterte mich einen Moment lang, dann nickte er. »Am Anfang.«
»Was ist passiert?«
»Wir müssen die Säcke zum Sammelplatz bringen, gleich sieht man zwischen den Bäumen nichts mehr«, sagte Yaya.
»Du musst es mir … erklären«, keuchte ich, als wir nebeneinander hergingen. Es war beinahe unmöglich, ich konnte nur eine Krücke nutzen, weil ich den Sack festhalten musste. »Alles. Und wenn ich alles gelernt habe, wenn ich irgendwann ausgezahlt werde und wir genug Geld für die Reise haben …«
»Dann geht ihr nach Hause«, sagte jemand hinter mir, und ich wandte den Kopf, mühsam. Es war einer der älteren Jungen, der dort stand, fast schon nicht mehr zu erkennen in der Dunkelheit. Er war dreizehn oder vierzehn, gedrungen und muskulös, und trug ebenfalls einen Sack. »Aber das tut ihr nicht«, sagte er. »Niemand geht nach Hause.«
»Adama!«, sagte Yaya. Und, leiser: »Du sagst niemandem, was du gehört hast, klar?«
Adama war stehen geblieben, und ich spürte, wie er uns musterte.
»Er ist dein Bruder«, sagte er schließlich. »Richtig? Er ist gekommen, um dich zu holen. Hast du vergessen, was Yves getan hat, als das letzte Mal einer versucht hat, jemanden rauszuholen?«
»Still, Adama!«, flüsterte Yaya. »Still.«
Adama schnaubte. »Ich wollte auch weg«, sagte er. »Da raus, in die Städte, herumziehen und trommeln und singen. Eines Tages ein großer Musiker werden.« Er lachte. »Aber eins hab ich gelernt, trommeln und singen kann man auch zwischen Kakaobäumen. Und zum Trommeln brauch ich meine zehn Finger. Ich riskier nichts. Wer will schon berühmt sein? Hat auch Nachteile. Lästige Fans und all das.«
»Wenn du jemandem sagst, wer Issa ist … was wir planen … der Teufel bringt ihn um.«
»Nee, da mach dir mal keine Sorgen«, sagte Adama. »Das erledigt Silvester vorher. Ich hab seine Blicke gesehen. Und da ist er.«
Hätte er nichts gesagt, ich hätte den Schatten nicht gesehen, der sich in der Dunkelheit zwischen den Bäumen näherte mit seinem eigenen Sack.
»Was steht ihr hier rum und tratscht?«, fauchte Silvester. »Müsst ihr dem Krüppel helfen?« Er schüttelte den Kopf. »Das wird so nichts mit dir«, sagte er zu mir, »gib schon her.«
Und dann setzte er seinen Sack ab und griff nach meinem, wollte uns zeigen, dass er zwei Säcke schleppen konnte. Er erwartete, dass mein Sack leicht wäre. Aber als er versuchte, ihn anzuheben, merkte er, wie sehr er sich verschätzt hatte. Und er nahm wieder seinen eigenen. »Das Gewicht kriegst du nie bis zum Sammelplatz«, murmelte er. »Du versuchst, etwas zu beweisen, aber das geht schief.«
Yaya hielt meine Krücken, damit ich den Sack wieder aufheben konnte, und tatsächlich half Adama mir, ihn auf den Rücken zu hieven. Ich trug den Sack bis zum Sammelplatz neben den Hütten, ohne ein einziges Mal anzuhalten. Langsam. Aber stetig. Silvester schnaubte nur, als ich ankam und meinen neben den anderen Säcken absetzte. Er war voller als die übrigen.
Ich wischte mir den Schweiß aus den Augen. Und spürte, dass jemand mich ansah, im Licht des kleinen Feuers: Monsieur Youssouf. Er nickte langsam. Anerkennend.
Aber Silvesters Schlangenblick brannte auf mir.
Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen – einen Sack tragen, der schwerer war als Silvesters Sack, und ankommen. Vielleicht war es ein Fehler gewesen.
Manal
Und dann nach dreizehn Stunden im Flieger wieder eine dieser Aluschalen, zu heiß, mit Pappdeckel: Reis mit Hühnchen. Der Mann neben Manal trank Weißwein. »Ich werde ihn vermissen, in Côte d’Ivoire«, sagte er mit einem Seufzen. »Ein guter Franzose hat was.«
Manal lächelte und prostete ihm mit ihrem Plastikbecher zu. Er hatte weißes, krauses Haar, das einen schönen Kontrast zur dunklen Haut bildete, und erinnerte Manal an ihren Großvater, der auch gerne Weißwein trank. Dr. John Strongman, pensionierter Unfallchirurg in Chicago.
Und auf einmal hatte sie das Gefühl, sie müsste sich an diesen Herrn mit dem weißen Haar klammern, diesen korrekten Herrn in seinem Anzug, weil er war wie ihr Großvater.
Da draußen wartete ein Land, das sie nicht kannte. Eine Kultur, die ihr fremd war. Wurzeln.
Sie nickte ein, und im Traum sah sie die Wurzeln. Sie stand auf trockener, rissiger roter Erde, in unaushaltbarer Hitze, und dann brach die Erde auf, und die Wurzeln quollen hervor und griffen nach ihr. Sie wickelten sich um ihre Füße, ihre Beine, ihren ganzen Körper – und sie schrie.
Und dann war sie wach, das Gesicht des freundlichen alten Herrn mit dem weißen Haar beugte sich über sie.
»Mademoiselle«, sagte er mit einem Stirnrunzeln. »Wir sind da. Im Landeanflug auf Abidjan.«
Onkel Mamadou stand mit einem Schild im Gedränge vor dem Flughafen. Sie war nie so dankbar für ein Schild gewesen. Das Warten in den endlosen Schlangen im Flughafengebäude hatte sie erschöpft: Passkontrolle, Visakontrolle, Gepäckkontrolle, an der Decke das ständige Summen von Ventilatoren. Um sie herum nur dunkle Gesichter. In Deutschland war sie aufgefallen, weil sie dunkler war als die anderen. Hier war sie heller.
»Da bist du, mein Kind, endlich!«, sagte Mamadou und schloss sie in seine Bärenarme. »Wir haben den ganzen Morgen auf dich gewartet! Diese Flugzeuge, sie fressen da oben in der Luft die Wolken, grasen wie die Ziegen, kommen an, wann sie wollen, was?«
Er lachte, ein tiefes, volltönendes Lachen, und Manal dachte, dass sie nicht einmal mitbekommen hatte, dass der Flug verspätet war.
»Mamadou, mach mir das Mädchen nicht verrückt«, sagte die Frau, die neben ihm stand. Sie war ein wenig kleiner als er und auf eine zierliche Art pummelig, wie ein kleiner Marzipanengel mit dunklem Schokoladenüberzug.
Mein Gott, dachte Manal, ich denke wie Joscha. Aber Gedanken kommen von selbst. Fatouma hatte ihre Locken auf dem Kopf zu einer Art Krone aufgetürmt. Sie trug ein blassrosa Kleid mit altmodischer Spitze am Saum und im Ausschnitt, und in der Hand hielt sie einen weißen Sonnenschirm wie einen Zauberstab. Das Wort Zuckerfee tauchte in Manals Kopf auf. Die Zuckerfee aus dem Nussknacker.
»Oh, du kennst Fatouma noch nicht, meine wunderbare Gattin«, sagte Mamadou und warf sich Manals Trekkingrucksack über die Schulter wie einen Kartoffelsack. Nein, dachte Manal. Yams. Keine Kartoffeln.
Sie ließ sich von Fatouma umarmen und folgte den beiden durchs Gedränge; die Luft schmeckte nach Flughafenansagen und Abgasen, und dann standen sie vor Mamadous Wagen, einem Pick-up mit offener Ladefläche, und Mamadou zurrte den Rucksack hinten fest, neben echten Säcken.
»Es gibt nur einen Beifahrersitz«, sagte Manal. »Wo …?«
Mamadou lachte. »Oh, europäische Mädchen mögen Sport, hat man mir gesagt, schau dich an, kein Kleid, kein Rock, Jeans wie ein Kerl. Also dachten wir, du verschaffst dir ein bisschen Bewegung nach dem langen Flug und läufst.«
Manal schluckte. »O…kay. Wie weit ist es denn?«
»Oh, heute Abend sollten wir da sein, ich hoffe, wir schaffen es noch im Hellen, die Straßen haben Löcher, sie sind zerfressen von all den hungrigen Autos, fressen den Asphalt und die Erde weg wie nichts, pass auf, meine Kleine, man sollte nicht in so ein Loch fallen, manche sind unendlich tief, du fällst und fällst, und man weiß nicht, wo die Leute rauskommen, viele wurden nie wieder gesehen«, sagte Mamadou und öffnete die Beifahrertür.
Die Zuckerfee kletterte auf den Sitz und verstaute ihren Zauberstab. Zu ihren Füßen standen mehrere verklebte und verschnürte Päckchen und Plastiktüten, offenbar hatten die beiden den Besuch in der Stadt genutzt, um einzukaufen. Für die Farm.
Sie besaßen eine Farm, Muriel hatte gesagt, sie sei winzig, und Pieter hatte gesagt, so winzig nun auch nicht, am Ende hatten sie sich fast gestritten. Manal dachte an ihre Eltern. Irgendwo, weit, weit weg, saß in diesem Moment ihr Vater an seinem Schreibtisch und brütete über einem neuen Roman. Irgendwo stand ihre Mutter an einem Patientenbett und schrieb Dinge in Akten.
»Jetzt steig schon ein«, sagte Fatouma. »Wir passen beide auf diesen Sitz. Das mit dem Laufen war wieder so ein dummer Witz von deinem Onkel.«
Manal kam sich neben der Zuckerfee vor wie eine Riesin. Ihre Hände, die auf ihren Knien lagen, wirkten neben Fatoumas Händen seltsam groß und zu hell. Wie etwas, das noch nicht fertig angemalt ist.
In ihrem Kopf summten all die französischen Wörter umeinander in ihrer vollmundigeren afrikanischen Aussprache, sie musste sich erst daran gewöhnen, dies hier war etwas anderes als das Französisch, das sie noch vor ein paar Monaten im Leistungskurs gesprochen und geschrieben hatte.
Der Pick-up sprang stotternd an und rollte zwischen gepflegten Palmen vom Flughafenparkplatz, tauchte ein in eine Stadt voller Wolkenkratzer und moderner breiter Straßen, aber nach einer Weile änderte sich das Bild: niedrige Hütten, in- und umeinandergebaut, viele Menschen, Wäscheleinen, offene Abwasserkanäle. Hunde, Hühner, Staub, Dreck, Hitze. Diesel, verbranntes Plastik.
»Vor ein paar Wochen«, sagte Mamadou, »ist ein Hund vor uns über die Straße gerannt, und vor Schreck hat das Auto die Klimaanlage verschluckt.«
Fatouma verdrehte die Augen.
Aber Manal grinste. Sie begann, ihren Onkel und sein Auto zu mögen, das Dinge verschluckte.
Und sie war schon eine Dreiviertelstunde mit ihm und Fatouma zusammen, ohne dass einer von ihnen gesagt hatte, was für eine schöne junge Frau sie geworden war. Ein Pluspunkt.
Dann verließen sie die Stadt, dann kam das Land. Rote Erde, wenige Bäume, Felder. Kein Elfenbein, keine Elefanten. Irgendwo warteten die Wurzeln aus ihrem Traum.
Zehn Stunden später waren sie da.
Der Pick-up hielt unter einem Firmament voller Sterne.
Die Farm lag im Nichts, weit weg von allem, der nächste Ort war eine Stunde Autofahrt entfernt. Die letzten Kilometer waren sie durch tiefe Schlaglöcher und Wald gefahren: Nachtwald, unsichtbar, schemenhaft. Mamadou hatte gesagt, dass man nachts besser nicht fahren sollte, und Manal begriff es jetzt. Sie war froh, dass es nur das letzte Stück war, auf dem die Schwärze sie einholte. Und zuerst sah Manal auch von der Farm nichts. Einzelne große Blätter ragten ins Licht der Scheinwerfer, ehe Mamadou den Motor abwürgte, den man nicht mehr anständig ausmachen konnte, weil das Auto, so sagte er, Angst habe, man würde es dann nicht mehr anmachen, sondern verschrotten.
Mamadou ging voraus und machte Licht: Es gab eine Außenlampe am Haus, eine Glühlampe, die an ihrem Kabel über einer kleinen Veranda hing; Moskitos taumelten durchs Licht, Motten tanzten vorüber wie Schattengeister.
Fatouma führte Manal die Stufen hinauf zur Veranda und ins Haus. Der Flur, in dem eine weitere kahle Glühbirne brannte, war winzig, alles war winzig, gezimmert aus rohen Brettern.
»Das ist dein Zimmer«, sagte Fatouma und wies mit ihrem Zauberstab in einen ebenfalls winzigen, aber sauberen Raum. Es gab ein Bett mit einer rot und braun gemusterten Tagesdecke und einem riesigen Kopfkissen, ein paar verblichene Kalenderbilder von Großstadtansichten an der Wand, eine Plastikflasche mit Wasser auf einem wackeligen Tisch. Und einen Stuhl.
»Es war das Zimmer der Jungs, ehe sie ausgezogen sind«, sagte Fatouma, und da war ein kleiner blauer Schatten in ihrer Stimme.
»Sie haben … zu mehreren hier gewohnt?«
»Zu viert. Inzwischen haben sie alle ihr eigenes Leben, die große weite Welt hat sie zu sich gerufen.« Sie seufzte. Lehnte den Schirm an die Wand und legte Manal die zierlichen Hände auf die Schultern. »Deshalb ist es schön, dass du für ein Weilchen bei uns bist. Komm. Setzen wir uns noch einen Moment draußen hin, ehe es zu dunkel wird.«
»Aber es ist … dunkel?«
»Oh, es wird dunkler«, sagte Fatouma mit einem leisen Lachen. Gab es da draußen, jenseits der Nacht, noch eine zweite, größere Nacht, die sie, die Weitgereiste, die Fremde, nicht begriff?
Manal wickelte sich in den Seidenschal, den Muriel ihr zum Abschied geschenkt hatte, blaue Seide mit handgemalten grünen Kringeln. Die Glühbirne im Zimmer flackerte und ging aus.
»Verflixt, der Strom«, sagte Fatouma.
Kurz darauf flackerte ein Streichholz auf, und Manal merkte, wie erleichtert sie über das Licht war. Fatouma entzündete eine kleine Öllampe, die auf dem Tisch gestanden hatte.
»Der Strom ist häufiger mal weg«, sagte sie. »Obwohl er von der Solaranlage kommt. Mamadou hat ganz sicher eine Erklärung dafür.«
»Lass mich raten«, sagte Manal. »Die Pflanzen auf eurer Farm haben den Strom ausgetrunken?«
Fatouma lachte. »Ihr beide werdet euch verstehen.«
Und dann saßen sie auf der Veranda, im Licht der Öllampe, jeder mit einem Glas frischem Wasser aus dem Wasserfilter, und das Wasser war besser als Wein. Mamadou und Fatouma saßen auf der Bank am Tisch, Manal in dem alten Schaukelstuhl, der ein wenig knarzte und in dem man versank.
Vergiss alles, sitz einfach hier und schaukle, flüsterte er. Du brauchst dich nicht zu fragen, wie es weitergeht. Ja, ich weiß, du willst nur eine Weile bleiben und dann um die Welt reisen, eine Menge Länder sehen, um endlich herauszufinden, was du anstellen willst mit deinem Leben … aber heute Nacht ist das alles gleichgültig.
Manal lehnte sich zurück und lauschte in die Nacht. Irgendwo ganz nah quakten Frösche. Grillen zirpten. Der Urwald schwieg nicht.
»Was pflanzt ihr hier?«, fragte sie.
»Träume«, sagte Mamadou. »Aber es ist zu trocken, Träume brauchen Wasser. Wir kämpfen. Jeden Tag, seit vierzig Jahren. Gegen die Austrocknung der Träume.«
»Ach, Unsinn«, sagte Fatouma. »Wir haben Yams, ein bisschen Kaffee, Tomaten, Karotten, Zwiebeln, Lauch, Cashewbäume, Orangen, Zitronen, Bananen und ein paar Hektar Kakao im Dschungel. Aber du weißt, wir leben nicht von der Farm. Dein Onkel hat seine Bücher. Biologie für Schulen. Die Farm ist Liebhaberei. Und die Kakaobäume sind ein Spleen von ihm.«
»Ein Experiment«, sagte Mamadou und trank einen Schluck. »Aber ich sage dir eins, Akissi …«
»Akissi?«, fragte Manal.
»Du bist an einem Sonntag geboren, und an einem Sonntag Geborene sind Akissi.« Mamadou nickte ernst. »Heutzutage gehen die alten Namen verloren, aber ich mag sie. Akissi, ich sage dir eins, es sind nicht die Kakaobäume, die den Strom getrunken haben. Das waren andere. Keine Bäume. Menschen. Es ist schwarze Magie. Die da drüben …«
»Oh, schweig, Dummkopf«, sagte Fatouma. »Da drüben ist weit weg, niemand kriecht durch den Wald, um deinen Strom zu klauen.« Sie schüttelte den Kopf.
Manal räusperte sich. Sie wollte nicht, dass sie stritten.
»Ich habe euch etwas mitgebracht«, sagte sie. »Aus dem Geschäft, wo ich gejobbt habe die letzte Zeit.«
Sie griff unter den Schaukelstuhl und zog eine runde Metalldose aus einer Kühltasche. Hielt sie Fatouma hin, die sie nahm und ehrfürchtig über die Oberfläche mit der goldenen Prägung strich: Wegebrecht und Söhne, Berlin. Chocolatiers mit Tradition, seit 1890.
Dann löste sie die ebenfalls goldene Schleife und öffnete die Dose. Mamadou beugte sich darüber, schloss die Augen, atmete den Duft ein.
Manal lächelte. Roch es ebenfalls. Ein Geruch nach zu Hause füllte die Luft. Noch vor drei Tagen hatte sie im Laden von Wegebrecht und Söhne zwischen Pralinen und Schokoladenkunstwerken gestanden, über die verschiedenen Sorten von Gianduja-Nugat und die Verarbeitung von Edelbitterschokolade referiert, gelächelt, Geschenke mit goldenen Schleifen verpackt.
»Das also machen sie aus unserem Kakao«, sagte Mamadou und lachte leise. »Würden sich die Bäume nie träumen lassen, wetten? Ich kaufe nie Schokolade in einem Laden. Komisch eigentlich.«
»Dies hier ist besondere Schokolade«, sagte Manal. »Und es ist fast ein Wunder, dass sie die Reise heil überstanden hat.«
Mamadou nickte. Er nahm einen kleinen Würfel, dessen helle Schokoladencreme mit feinen Nusssplittern durchsetzt war, und steckte ihn in den Mund. »Daran …«, sagte er nach einer Weile, »könnte man sich gewöhnen.«
Die Zuckerfee wählte eine rosafarbene Praline in Form einer kleinen Rose, bestäubt mit glitzerndem Zucker. »Da drin sind echte Rosenblätter«, sagte Manal. »Ich habe die Paste angerührt. Die Blätter dürfen nicht zu Matsch gekocht werden, man muss sie noch erkennen können.«
Fatouma hielt die Praline ins Licht der Öllampe. »Ein Kunstwerk«, flüsterte sie. Dann biss sie ein winziges Stück von der Praline ab, ließ es auf der Zunge zergehen. »Wir werden jeden Tag jeder eine davon essen«, sagte sie. »Wir sollten sie aufbewahren, solange es geht. Sie sind wie ein Märchen, das sehr weit weg spielt.« Sie lächelte. »Und das gut ausgeht. Immerhin ist sie rosa.« Sie hielt Manal die offene Metalldose hin.
»Oh, danke, nein«, sagte Manal lachend. »Die sind für euch. Ich kann wieder Pralinen von Wegebrecht essen, wenn ich nach Hause komme.«
»Aber du bist zu Hause«, sagte Mamadou. »Deine Vorfahren stammen von hier.«
»Ich denke, ich werde jetzt schlafen gehen«, sagte Manal und stemmte sich aus dem Schaukelstuhl hoch. »Der Flug war lang.«
Als Manal in ihrem Nachthemd auf der schweren Bettdecke lag und die Frösche draußen noch immer nicht schliefen, streckte Mamadou noch einmal den Kopf herein. »Hast du alles, was du brauchst?«
»Ja, danke«, sagte Manal. »Morgen möchte ich den Wald sehen. Ich werde meine Wanderschuhe anziehen und all das Grün kennenlernen …«
»Fangen wir mit der Farm an«, sagte Mamadou. Und dann beugte er sich über sie und wisperte: »Sei gewarnt, Akissi. Im Wald gibt es einen Teufel. Die Geister, die unter dem Mond tanzen und die Fatouma fürchtet, sind harmlos. Aber der Teufel, mein Kind, ist ein Mensch.«
2
Issa
Ich lernte, schneller zu werden.
Es war nicht leicht.
Aber in den Nächten schlief ich Seite an Seite mit meinem Bruder, und dieser kleine atmende Körper neben meinem gab mir Kraft. Ich weiß nicht, wie er es machte. Er war einfach da.
Ich erzählte den anderen von den Baumwollfeldern zu Hause, ehe sie einschliefen, von der Freiheit, die dort wohnte, von dem kleinen Dorf und dem hohen Himmel. Und sie lauschten gebannt.
In unseren Träumen wanderten Yaya und ich gemeinsam über dieses Feld, wir hatten Baumwolle in den Händen, leicht wie Luft. Neu geborene Zicklein drängten sich an unsere Beine, und unsere Mutter rief von weit her, rief uns nach Hause zum Essen.
In den Träumen brauchte ich keine Krücken.
Und wenn der Morgen kam, wenn Monsieur Youssouf die Tür zur Hütte aufschloss, dann erschien mir die Realität unwirklich, der Traum war wirklicher gewesen.
Aber ich lernte, schneller zu werden.
Ich arbeitete nicht mehr mit Silvester. Wir entwickelten ein System, ich schlug die Früchte ab, und Yaya, Momo und Boubou hoben sie auf und warfen sie auf einen Haufen, es sparte Zeit, wenn ich mich nicht bückte.
»Wir sind eine Maschine«, sagte ich zu den Jungen. »Wie die großen glänzenden Maschinen, die sie in Europa haben, um zu ernten. Ich habe sie gesehen, auf einem Fernsehbildschirm im Schaufenster eines Elektroladens.«
Und die Jungen lachten und waren gern eine Maschine. Sie halfen mir, die Säcke auf meinen Rücken zu laden, ich hatte mein Hemd ausgezogen, damit banden wir sie fest, sodass ich beide Krücken benutzen konnte. Dafür trug ich ihre Säcke. Solange ich mich nicht bücken musste, war alles in Ordnung.
Aber Silvester beobachtete uns. Es gefiel ihm nicht, dass unser System funktionierte.
In der dritten Nacht versuchte ich, die Tür der Hütte zu öffnen – nur, um zu sehen, ob es ging. Aber das Schloss war stark. Es gab ein Fenster, sonst wären wir wohl erstickt in der Hitze. Das Fenster war klein und hoch. Und draußen hörte ich die Hunde.
Am nächsten Tag fragte ich Monsieur Youssouf während der Mittagspause, wann wir das Gelände verlassen könnten: ich, Clown mit Unschuldsmiene.
»Gar nicht während der Ernte«, antwortete er ernst. »Wir brauchen jeden Mann.«
»Sie gehen auch hinaus«, sagte ich. »Sie waren fort, gestern den ganzen Nachmittag.«
»Du passt genau auf, was«, sagte Monsieur Youssouf. Aber er sagte es freundlich. »Irgendwer muss Vorräte kaufen. Ihr alle wollt essen.«
»Ich möchte am Freitag in den Ort«, sagte ich. »Ich habe gesehen, dass es eine Moschee gibt. Der Freitag ist ein heiliger Tag.«
»Das ist wahr.« Er nickte. »Aber es ist zu weit zu Fuß. Na, wir werden sehen. Heute ist erst Dienstag.«
Als ich mich umdrehte, lehnten die älteren Jungs an einer der Hütten und beobachteten uns: Adama und der zart gebaute, ebenfalls dreizehnjährige Moussa, der aussah wie ein Mädchen, und die Zwillinge Prince und Solomon, die als Einzige Christen waren.
Und als wir uns an diesem Abend an der Pumpe wuschen, stand neben mir auf einmal Yves.
Youssoufs Sohn. Der Prinz.
Er stand da und spielte mit einem Stock, den er sonst zum Abschlagen nicht ganz abgetrennter Früchte benutzte. Er ließ seinen Blick über meinen bloßen Oberkörper wandern wie jemand, der ein Rind beschaut, und ich merkte, dass ich allein an der Pumpe stand. Dass alle anderen plötzlich fort waren. Nur Yaya wartete auf mich, ein wenig abseits, er sah angespannt aus.
»Du«, sagte Yves. Und er hob den Stock und stieß mich damit an.
»Was soll das?«, fragte ich und richtete mich auf.
»Du hast mit meinem Vater gesprochen«, sagte Yves und lächelte. »Du möchtest zur Moschee gehen, ja? Am Freitag?«
»Ja«, sagte ich, und als er mich noch einmal mit dem Stock stieß, packte ich das Ende mit einer Hand. Ich hörte, wie Yaya scharf die Luft einsog.


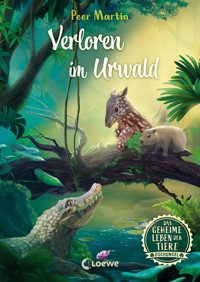


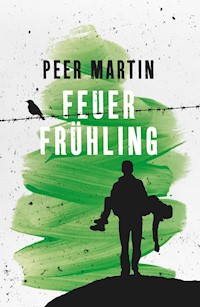













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









