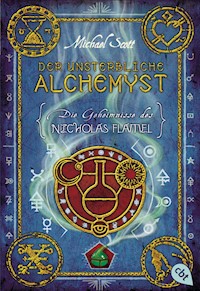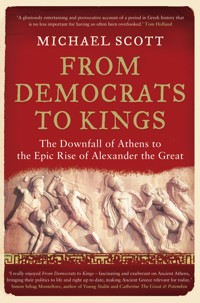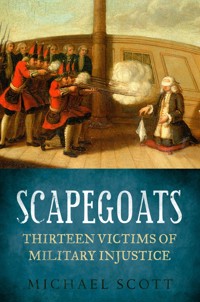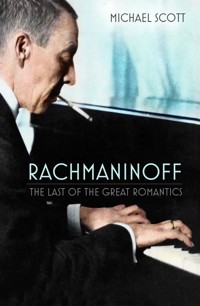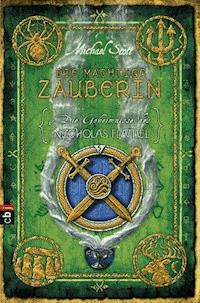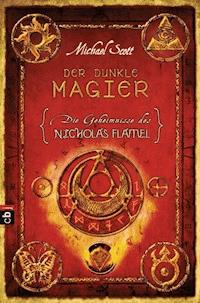3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Spiegel ist groß und sehr alt. Er ist der wertvollste Fund, den der Antiquitätenhändler Jonathan Frazer in seinem ganzen Leben gemacht hat. Und er kann seinen Tod bedeuten … Im Schein des Mondes formen sich merkwürdige Bilder im Spiegelglas. Sie zeigen nicht das Hier und Jetzt, sondern gewaltsame Ereignisse, die sich vor Hunderten von Jahren zugetragen haben – und immer wieder das Antlitz der verführerischsten Frau, die Jonathan je gesehen hat. Um ihr quälend schönes Abbild weiter sehen zu dürfen, wird er alles tun. Er wird den Spiegel sogar mit Blut füttern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Der Spiegel ist groß, sehr alt, und auf seiner Oberfläche scheint ein Schleier zu liegen. Er ist der bedeutendste Fund, den der Antiquitätenhändler Jonathan Frazer in seinem ganzen Leben gemacht hat. Und er kann seinen Tod bedeuten … In Jonathans Lagerräumen häufen sich unerklärliche Unfälle, ein grausam entstellter Fremder bedroht seine Familie, und im Schein des Mondes erscheinen verzerrte Bilder im Spiegelglas. Sie zeigen nicht das Hier und Jetzt, sondern eine Reihe tödlicher Ereignisse, die sich vor Hunderten von Jahren zugetragen haben – sowie die verführerischste Frau, die Jonathan je gesehen hat. Er fühlt sich unwiderstehlich zu ihr hingezogen. Um weiterhin die quälend verführerischen Bilder des Spiegels sehen zu können, wird er alles tun. Er wird ihn sogar mit Blut füttern …
Autoren
Michael Scott ist einer der erfolgreichsten und profiliertesten Autoren Irlands und ein international anerkannter Fachmann für mythen- und kulturgeschichtliche Themen. Seine zahlreichen Fantasy- und Science-Fiction-Romane für Jugendliche wie für Erwachsene sind in mehr als zwanzig Ländern veröffentlicht. Seine Reihe um die »Geheimnisse des Nicholas Flamel« ist ein internationaler Bestseller. Michael Scott lebt und schreibt in Dublin.
M.R. Rose arbeitete für die BBC und weitere Fernsehsender und wirkte bei der Umsetzung großer Theaterproduktionen mit. Heute arbeitet sie als Drehbuchautorin in Los Angeles und schreibt gemeinsam mit Michael Scott am nächsten Thriller.
Von Michael Scott & M.R. Rose bei Blanvalet erschienen:Die 13 Heiligtümer, Blutbann
MICHAEL SCOTT& M.R. ROSE
BLUTBANN
Thriller
Aus dem Englischenvon Hans Link
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel»Mirror Image« bei Tor Books, New York.
1. AuflageOktober 2015 bei Blanvalet,einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.Copyright © 2015 by Michael ScottDieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.deRedaktion: Gerhard Seidl/text in formHK · Herstellung: samSatz: DTP Service Apel, HannoverISBN: 978-3-641-16057-9www.blanvalet.de
Prolog
Der Spiegel fühlte sich kalt an auf ihrer nackten Haut.
Sie drehte das Gesicht leicht zur Seite und drückte die Wange gegen die kühle Oberfläche, spürte die sinnliche Berührung an Brüsten, Bauch und Schenkeln. Mit einem Schaudern breitete sie die Arme aus, um den Rand des schlichten Holzrahmens zu packen, öffnete die Beine und drückte ihre Lenden gegen die feuchte Fläche.
Ihre Brustwarzen wurden hart, ihre Atmung beschleunigte sich, als die Hitze in ihrem Bauch aufwallte.
»Für immer und ewig?«, flüsterte sie.
Die schattenhafte Gestalt hinter ihr – kaum zu erkennen auf der stumpfen Oberfläche des Spiegels – kam näher. »Für immer und ewig, unveränderlich, unverändert. Ich schwöre es.«
»Jaaaa«, hauchte sie. Sie schloss die Augen und stellte sich ihr Bild vor – mit gespreizten Gliedern an den Spiegel gepresst, Gesicht an Gesicht, Brust an Brust, Bauch an Bauch mit ihrem Spiegelbild. Ihr Herz begann immer schneller zu hämmern. Es pochte gegen das Glas, und die Hitze zog hinunter in ihre Lenden, setzte sich wellenartig durch alle Fasern ihrer Muskeln fort.
Genau in dem Augenblick, in dem ihr Orgasmus sie erfasste und sie ihren Rücken durchbog, zerriss der scharfe Steinsplitter ihre Kehle.
Aus ultimativer Wonne wurde absoluter Schmerz.
Blut zischte und dampfte auf dem Glas. Sie öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei, und als der Schatten näher kam und den Kopf über ihr Gesicht beugte, seine Lippen an ihrer Wange, flüsterte er: »Ich liebe dich.«
Ihre Lippen bewegten sich, und Worte formten blutigen Schaum auf dem Glas darunter. »Ich danke dir.«
Kapitel 1
Der riesige Spiegel war zwei Meter zehn hoch und einen Meter zwanzig breit, schmutzig und voll blinder Flecken, das Glas deformiert, sodass alles in ihm leicht verzerrt und verschwommen wirkte. Er war ziemlich grotesk.
Und Jonathan Frazer wusste, dass er ihn haben musste! Er hatte ein Dutzend Kunden, die sich für Düsteres und Überspanntes interessierten, und wenn von denen keiner anbiss, würde ihn eine der Firmen für Spezialeffekte nehmen.
Frazer stand hinten in einer kleinen Menschenmenge in einem miefigen Auktionssaal und wartete ungeduldig, während der gelangweilte Auktionator den Auktionskatalog des »Besitzes eines Gentlemans« abarbeitete.
»Los sechsundsechzig, das Sägeschwert eines französischen Gendarmen, mit zweischneidiger Stahlklinge, Griff und Parierstangen aus Bronze, komplett mit lederner Scheide. Die Klinge zeigt einige Abnutzungsspuren …«
Jonathan Frazer schaute jedes Mal bei diesem skurrilen Auktionshaus in der Lot’s Road in Chelsea vorbei, wenn er auf Einkaufstour in London war. Obwohl es erst kurz nach ein Uhr mittags war, fühlte er sich müde. Er stellte eine schnelle Berechnung an – L. A. lag acht Stunden zurück, dort war es fünf Uhr morgens. Diese Reise hatte er als besonders anstrengend empfunden. Die meisten seiner üblichen Anlaufstellen hatte er bereits abgeklappert und auch ein paar neue Läden entdeckt, aber er hatte nichts Brauchbares gefunden. Die Feiertage standen vor der Tür, und er musste für sein Geschäft unbedingt noch ein paar einzigartige Stücke auftreiben.
Frazer trat ins Halbdunkel des Auktionsraums und blinzelte, bis seine Augen sich an das fahle Licht gewöhnt hatten, dann streifte er zwischen den größeren Objekten umher, die dicht gedrängt im hinteren Teil des Saals herumstanden. Es war fast alles uninteressant. Der Singsang des Auktionators hallte durch den Raum. Frazer schüttelte leicht den Kopf. Er hatte nicht erwartet, etwas zu finden: Die wirklich guten Sachen wurden im Allgemeinen von den Händlern und Sammlern untereinander verkauft und kamen selten vor ein breites Publikum. Ein Großteil des hiesigen Sortiments war Schrott oder befand sich in solch schlechtem Zustand, dass es dadurch wertlos wurde.
»Los achtundsechzig, die Halbsavonnette-Taschenuhr eines Gentlemans … reparaturbedürftig …«
Ein silberner Lichtstreifen ganz hinten im Raum erregte Frazers Aufmerksamkeit. Er drehte sich um und blinzelte in die Dunkelheit. Es dauerte einen Moment, bis er die Form erkannte: Hinter einem wurmstichigen Kleiderschrank und einer frühen Jugendstilkommode stand ein Spiegel.
Er zwängte sich zwischen dem Kleiderschrank und der Kommode hindurch, zuerst angezogen von der schieren Größe des Stücks. Frazer war einen Meter achtzig groß, und der Spiegel überragte ihn mindestens um dreißig Zentimeter. Er breitete die Arme aus und schätzte geübt die Breite: mindestens ein Meter zwanzig. Das Glas war von einem überraschend schlichten Holzrahmen eingefasst, komplett mit Spiegelhaltern aus Messing, um ihn an einer Wand zu befestigen, obwohl er jetzt auf einen kunstvollen Ständer montiert war, wodurch man ihn drehen konnte. Der Ständer war eine spätere Beigabe, entschied er.
Jonathan Frazer fuhr mit der Hand über den Spiegel und zeichnete lange Streifen auf das Glas; es war verdreckt, mit einer schmierigen Schmutzschicht überzogen. Er rieb ungefähr auf Augenhöhe kreisförmig mit einem Papiertaschentuch darüber und spähte hinein, aber in der Dunkelheit des Auktionssaals und durch den verkrusteten Dreck auf dem Glas konnte er kaum sein eigenes Spiegelbild ausmachen. Er leckte sich den Finger und rieb damit über den Spiegel, mit stockendem Atem, als er dessen Kälte auf seiner Haut spürte, aber selbst das nützte nichts gegen den Dreck.
Ohne die Rückseite des Spiegels zu untersuchen, konnte er ihn unmöglich genau datieren, aber wenn man die leicht bläuliche Färbung des Glases berücksichtigte, die wahrnehmbare Verzerrung um den Rand und die seltsame Unebenheit zur Mitte hin, war er gewiss alt, siebzehntes Jahrhundert, vielleicht früher.
Er musste ihn haben.
»Nummer neunundsechzig, ein großer, antiker Spiegel mit Holzrahmen, schätzungsweise zwei Meter zehn hoch und einen Meter zwanzig breit. Ein imposantes Stück …«
Jonathan Frazer holte tief Luft und war plötzlich dankbar, dass er Jeans und ein langärmliges Sweatshirt trug statt seines üblichen Anzugs. Er warf einen erfahrenen Blick auf die kleine Menge: Er konnte keine der typischen Händler entdecken. Er hoffte, dass man ihn einfach für einen x-beliebigen Typ hielt, der hier auf der Suche nach einem Schnäppchen zufällig vorbeigekommen war.
»Also, wer bietet als Erster achthundert Pfund?«
Frazer traute seinen Ohren kaum. Der Spiegel war mindestens das Zehnfache wert. Aber er hielt den Kopf gesenkt und sah den Auktionator nicht an, zeigte kein Interesse.
»Dann siebenhundertfünfzig, kommen Sie, meine Damen und Herren; er ist hier, um verkauft zu werden. Siebenhundertfünfzig für ein so schönes Stück Glas. Ein ansehnliches Objekt in jedem Haus.«
»Dafür würde man ein verdammt großes Haus brauchen, Kumpel«, witzelte jemand mit Cockney-Akzent.
Der Auktionator lächelte. »Sechshundert Pfund, meine Damen und Herren. Sechshundert Pfund, oder ich muss das Los zurückziehen.«
Frazer schaute auf und stellte Blickkontakt mit dem Auktionator her. Er hob die linke Hand und spreizte die Finger.
Der Auktionator runzelte die Stirn, dann nickte er schwach. »Fünfhundert Pfund sind geboten. Bietet jemand mehr als fünfhundert Pfund, kommen Sie, meine Damen und Herren, dies ist ein echtes Schnäppchen. Bietet jemand mehr als fünfhundert Pfund?«
Niemand rührte sich.
»Fünfhundert Pfund zum Ersten. Zum Zweiten … und zum Dritten …« Der Auktionator schlug mit seinem Hämmerchen auf das Pult. »Verkauft!« Er schaute in Frazers Richtung und nickte. »Nun weiter zu Los Nummer siebzig …«
Ein junger Mann in einem blauen Overall bahnte sich einen Weg durch die Menge und reichte Frazer einen Kaufbeleg, den er ausfüllen sollte.
»Können Sie ihn liefern?«
»Das können wir natürlich, Sir, die Lieferung kostet extra.«
»Natürlich.« Frazer reichte ihm seine Visitenkarte. »An diese Adresse.«
Der junge Mann drehte die Karte um. »Frazer Interiors. In Los Angeles. Ich erinnere mich an Sie, Sir. Wir haben Ihnen vor ein paar Jahren diese geschnitzten chinesischen Löwenköpfe geliefert.«
»Sie haben ein gutes Gedächtnis.«
»Das war meine zweite Woche im Job. Ich musste alle sechs Köpfe einpacken, sie versichern und dann den Transport nach Hollywood organisieren … das war eine ziemlich lehrreiche Erfahrung. Ich habe es nie vergessen. Wir haben Sie hier lange nicht gesehen.«
»Ich weiß; ich komme nicht so oft rüber, wie ich sollte, und natürlich ist London mehr oder weniger abgegrast. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal einen kleinen Schatz gefunden hätte.«
Der junge Mann lächelte. »Nun, diesmal haben Sie ein echtes Schnäppchen gemacht, Mr. Frazer. Heute ist Ihr Glückstag.«
Frazer warf einen letzten Blick auf den Spiegel und wandte sich ab. »Sie haben recht, dies ist mein Glückstag.«
Kapitel 2
»Der macht was her.« Tony Farren strich anerkennend über das Glas. »Der Rahmen ist scheußlich. Mal sehen, was sich da machen lässt.«
Jonathan Frazer hockte sich vor den riesigen Spiegel und zeigte auf die schwarzen Flecken am Rand. »Kümmerst du dich auch um diese Schwärzungen?«
Tony nickte. »Das wird kein Problem sein.«
Jonathan stand auf und wischte sich die Hände ab. »Was hältst du davon?«
Tony Farren schob sich die Hände in die Jeanstaschen. Er arbeitete für die Familie Frazer, seit James Frazer, Jonathans Vater, Mitte der Sechzigerjahre in Hollywood seinen Antiquitätenladen eröffnet hatte. Jonathan hatte das Geschäft geerbt – es hieß inzwischen Frazer Interiors und widmete sich dem Verkauf von Möbeln der Fünfzigerjahre und sorgfältig ausgewählten antiken Stücken – und Tony gern mit übernommen. Tony war klein, stämmig, vollkommen kahl und beinahe allwissend, was Antiquitäten betraf. Er hatte die meisten seiner Sommer in der umgebauten Garage im Haus seiner Eltern in Los Feliz verbracht und Tony bei der Arbeit fasziniert zugesehen und -gehört. So gut wie alles, was er über Antiquitäten wusste, hatte er von Tony Farren gelernt.
»Es ist ein erlesenes Stück«, sagte Tony schließlich. »Sehr erlesen.«
»Kannst du mir einen Preis nennen?« Jonathan lächelte. »Sehr erlesen« war in der Tat ein großes Lob.
Farren strich mit den Händen über das Glas, spähte über seine Hornbrille und untersuchte den Spiegel dann mithilfe einer kleinen Taschenlampe genauer. Er wiederholte die Prozedur mit dem hölzernen Rahmen, dann trat er hinter den hohen Spiegel, um sich der Rückseite zu widmen. »Es ist ein interessantes Stück, da gibt es keinen Zweifel. Das Glas ist möglicherweise venezianisch, spätes vierzehntes, frühes fünfzehntes Jahrhundert, obwohl das sehr schwer zu sagen ist. Könnte auch noch älter sein, wenn du mich fragst. Der Rahmen sieht nach frühem sechzehnten Jahrhundert aus, er ist jedenfalls im entsprechenden Stil gearbeitet, obwohl das Holz älter zu sein scheint … und es ist auch ein besonderes Holz, Eibe oder Walnuss.« Er trat zurück, ließ die Hände erneut in die Taschen gleiten und legte den Kopf schief. »Wenn ich es allerdings noch mal genauer reflektiere …«
Jonathan stöhnte über den Kalauer.
Tony grinste. »Tut mir leid. Es wäre eine Schande, den Spiegel aus dem Rahmen zu nehmen, es sei denn, wir fänden einen kunstvolleren Rahmen dafür – aber das ist bei der Größe unmöglich. Er müsste schon maßgefertigt werden. Lassen wir den Spiegel so, wie er ist.«
»Der Preis, Tony«, erinnerte Jonathan ihn sanft.
»Ich würde sagen, ungefähr zwanzigtausend Dollar …«
»Was!?«
Farren grinste angesichts Jonathans Überraschung. »Wieso, was wolltest du denn dafür nehmen?«
»Ungefähr sieben Riesen, siebentausendachthundert vielleicht …«
»Für mehr als zweieinhalb Quadratmeter wahrscheinlich venezianischen Glases mit einem, wie es aussieht, elisabethanischen Rahmen drum herum! Das wäre ja geschenkt.«
»Könnte eine Fälschung sein«, überlegte Jonathan.
Tony Farren schnaubte rüde. »Vertrau mir, das ist keine Fälschung.« Er klopfte mit den Knöcheln gegen das Glas. »Und bei diesem Stück wird der Preis auch nicht runtergehen. Wenn wir es ein paar Jahre einlagern, verdoppelt er sich.«
Jonathan Frazer trat von dem riesigen Spiegel zurück und schlängelte sich zwischen Stapeln von Möbeln hindurch. Die beiden Männer befanden sich in der zum Gästehaus umgebauten, jetzt wiederum zweckentfremdeten Garage hinter Frazers Haus. Sie war zuerst genutzt worden, damit Tony dort an den wertvollsten Stücken ungestört arbeiten konnte, wurde aber bald auch gebraucht, um den überquellenden Laden zu entlasten und die kostbareren der empfindlichen Stücke zu lagern. Frazer ließ sich auf die schlecht gemachte Kopie eines Chippendale-Stuhls sinken und lachte leise. »Ich habe fünfhundert Pfund dafür bezahlt, und mit Wechselgebühren und Frachtkosten sind es ungefähr zweitausendfünfhundert Dollar gewesen.«
Tony schüttelte den Kopf. »Das ist ein Schnäppchen, wie man es nur einmal im Leben macht.«
»Ein Glücksfall, mein Freund?«
Der ältere Mann lächelte. »Jeder Händler – ob er nun mit Büchern handelt, mit Briefmarken, Münzen, Möbeln, Bildern oder Silber – spürt irgendwann in seinem Leben einen ganz besonderen Gegenstand auf.« Er legte die Hand auf das Glas, und ein feuchter Handabdruck bildete sich auf der Scheibe, nur um fast sofort wieder zu verschwinden. »Dies könnte sehr gut dein ganz besonderes Teil sein.«
Frazer warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Dann betrachtete er ein letztes Mal den Spiegel. Vielleicht würde er ihn nicht verkaufen. Jedenfalls noch nicht. Angesichts der gerade einbrechenden Konjunktur könnte es sich lohnen, an dem Spiegel festzuhalten. »Ich bin im Laden, falls du mich brauchst.« Er sah Tony an. »Gib dir besonders viel Mühe damit.«
»Mache ich. Ich fange gleich an, ihn aufzuarbeiten. Ich freue mich direkt darauf«, fügte er hinzu und rieb mit der rechten Hand noch einmal über das Glas. »Stell dir nur vor: Wenn dieses Glas reden könnte. Was hat es alles gesehen?«, fragte er sich laut.
»Das sagst du bei jedem einzelnen Stück, das ich herbringe.«
»Alles hat eine Geschichte«, erwiderte Tony, während Jonathan sich bereits zum Gehen gewandt hatte. »Vergiss nicht, was dein Vater gesagt hat: Du verkaufst keine Antiquitäten …«
»… du verkaufst Geschichten«, ergänzte Jonathan.
Tony Farren stammte aus dem Sunset District von San Francisco. Seine Eltern hatten sich als junges Paar nach dem Zweiten Weltkrieg dort niedergelassen. Mit achtzehn Jahren wurde Farren eingezogen und nach Vietnam geschickt. Er diente ein Jahr lang, bevor er in die USA zurückkehrte; bis dahin hatte er nichts weiter gelernt, als ein M60-Maschinengewehr zu warten und zu bedienen. In der Hoffnung, sich ein neues Leben aufzubauen, zog er nach Los Angeles, erprobte sich dort in einem Gewerbe nach dem anderen – als Maler, Glaser, Klempner und Elektriker – und lernte überall genug, um als tüchtig zu gelten, fand aber jede Tätigkeit irgendwann bemerkenswert langweilig.
James Frazer machte in Hollywood einen Antiquitätenladen auf und brauchte einen Alleskönner, jemanden, der ein Stuhlbein reparieren, eine Tischplatte überarbeiten oder ein Gemälde retuschieren konnte.
Bei seinem Vorstellungsgespräch log Tony Farren; er erzählte, dass er all dies und noch mehr könne. Und niemand war überraschter als er selbst, als er herausfand, dass dies tatsächlich zutraf. Durch Fleiß verbesserte er seine Fähigkeiten ständig; seine Lösungen der Probleme, die sich ihm alltäglich boten, waren zwar unorthodox, funktionierten aber meistens. James Frazer behauptete, er sei ein Genie; Tony schob es auf die Tatsache, dass er endlich etwas tat, das ihm Spaß machte. Jeder Tag war anders: An einem Tag arbeitete er vielleicht an Stühlen oder Tischen, am nächsten verkabelte er einen Kristallkronleuchter neu oder reparierte das Scharnier an einem antiken Schrank, während er am darauf folgenden Tag einen Nachttisch im Faux Finish bearbeitete.
Tony Farren hatte mehr als fünfundvierzig Jahre für James Frazer gearbeitet, mitgeholfen, die Firma zu vergrößern, und war inzwischen ein anerkannter Experte für Möbel des achtzehnten Jahrhunderts. Er hatte so ziemlich jede Art von Antiquität und Artefakt schon gesehen … aber noch nie so etwas wie diesen Spiegel.
Langsam untersuchte Tony das Teil – es war gewiss der größte antike Spiegel, den er je gesehen hatte. Es war ein massives Stück. Ein schlichter Holzrahmen mit einfacher, hölzerner Rückseite fasste die riesige, einteilige Spiegelfläche ein. Offensichtlich würde er die Rückseite entfernen müssen, bevor er mit der eigentlichen Arbeit beginnen konnte.
Tony zog eine Lupe aus der Hosentasche und beugte sich vor, um eine der Klammern zu untersuchen, welche die Rückwand mit dem Rahmen verbanden. Unwillkürlich stieß er ein verärgertes Zischen aus: Die Köpfe der zwei Schrauben darin waren restlos abgedreht, die Schlitze unbrauchbar. Er wandte sich der nächsten Klammer zu und runzelte die Stirn; auch dort waren die Schraubenköpfe ruiniert. Seine Inspektion – es gab insgesamt zwölf Klammern mit je zwei Schrauben – ergab, dass die Köpfe aller vierundzwanzig Schrauben vollkommen abgenutzt waren. Er rieb mit einer schwieligen Hand über die hölzerne Rückseite. Es war durchaus möglich, mal eine Schraube zu ruinieren – er hatte es selbst oft genug getan –, aber alle vierundzwanzig? Das sah nach Vorsatz aus.
Wer immer die Rückwand befestigt hatte, hatte nicht gewollt, dass sie je wieder entfernt wurde.
Das Problem war jedoch nicht unlösbar. Tony konnte die Schrauben mit neuen Schlitzen versehen – tief genug, um einem Schraubenzieher Halt zu geben. Es bestand zwar immer noch die Gefahr, die Schraube dann abzudrehen – aber dann hätte er wenigstens die Klammer schon einmal gelöst.
Tony ging zu der langen Werkbank hinüber. Übersät mit halb fertiggestellten Projekten, war sie ein Chaos von Werkzeugen und hatte im Lauf der Jahre zahlreiche Assistenten zur Verzweiflung gebracht. Während sie jedes Teil lange suchen mussten, wusste er immer genau, wo er das entsprechende Werkzeug zuletzt benutzt hatte. Jetzt wählte er eine kleine Black & Decker und befestigte daran einen runden Schleifsteinaufsatz. Dann schob er sich eine gefärbte Schutzbrille über die Brille und zog Handschuhe an. Anschließend entfernte er mit unendlicher Geduld vorsichtig das ausgefranste Metall von den Köpfen der groben Schrauben. Es kostete ihn fast eine Stunde, zuerst diejenigen, die er leicht erreichen konnte, bevor er sich eine Trittleiter holte, um die Sache zu vollenden. Als er fertig war, glänzten die Köpfe silbern und funkelten im Licht. Er kehrte zur Werkbank zurück und tauschte die Black & Decker gegen einen Dremel mit Diamant-Trennscheibe. Dann nahm er sich einige Augenblicke Zeit, um im Geiste noch einmal durchzugehen, was er tun würde, bevor er sich zufrieden neben dem Spiegel auf den Boden kniete. Jetzt kam der heikle Teil.
»Macht so was nicht zu Hause, Kinder«, murmelte er, während er die Trennscheibe quer über die Mitte der ersten Schraube führte. Funken stoben, und die flaue, modrige Luft wurde vom scharfen Geruch versengten Metalls durchdrungen. Er brauchte drei angespannte Minuten, um die Rille zu fräsen, und als er sie mit dem Schraubendreher ausprobierte, passte er sauber hinein. Tony stöhnte in stiller Zufriedenheit.
Kein Problem.
Tony Farren hatte zweiundzwanzig der vierundzwanzig Schraubenschlitze gefräst, als der Unfall passierte. Er war müde; er hatte über eine Stunde lang nur darauf verwandt, die Rillen zu schneiden, die Muskeln in seinem Hals und seinen Schultern verkrampften sich, und seine Augen fühlten sich trocken an; nervös zuckten seine Lider. »Gott, ich bin einfach zu alt für so was«, murmelte er vor sich hin. Er hätte vor über einer Stunde Mittagspause machen sollen, aber es war viel besser, diese Sache erst zu Ende zu bringen und sich dann einen Happen zu essen zu besorgen. Er schob die Leiter zur letzten Klammer hinüber und stieg mit dem Dremel in der rechten Hand hinauf. Als er fast oben war, wackelte die Trittleiter. Farren jaulte vor Schreck, ließ den Dremel fallen und mühte sich, das Werkzeug wieder aufzufangen. Es gelang ihm nicht, und er hörte es auf den Betonboden krachen. Er fiel vornüber und hielt sich instinktiv am oberen Rand des Spiegels fest. Ihm wurde sofort klar, was er da tat, und er versuchte, sich abzustoßen, entsetzt, dass er womöglich den Spiegel umwerfen würde. Die Trittleiter schwankte unter seinen heftigen Bewegungen und kratzte über den Boden, bevor sie nachgab. Tony schlug mit dem Kopf auf dem harten Boden auf, seine rechte Hüfte knackte widerwärtig, und Reste des zertrümmerten Dremels gruben sich in sein Fleisch.
Tony lag volle zwanzig Minuten bewusstlos da. Als er zu sich kam, widerstand er trotzig dem Drang, sich zu übergeben. Die Schutzbrille hatte er jetzt quer auf dem Gesicht sitzen. Er nahm sie ab und warf sie zur Seite, erleichtert, dass seine richtige Brille noch intakt war. Er betastete seinen Hinterkopf und zuckte zusammen, als seine Finger warme, klebrige Flüssigkeit berührten, die aus einer offenen Wunde sickerte. Platzwunde am Kopf, vermutlich eine leichte Gehirnerschütterung, vielleicht eine gebrochene Hüfte und ein paar angebrochene Rippen, schätzte er, aber er hatte Glück gehabt. Es hätte schlimmer sein können, viel schlimmer. Er hätte sich bei seinem Sturz das Genick brechen können.
Jede Bewegung war eine Qual, und sein ganzer Körper schien nur aus Schmerz zu bestehen. Paradoxerweise – trotz des Schmerzes, wegen des Schmerzes? – verlor er das Gefühl in den Beinen, aber er vermutete, dass das nur der Schock war. Vielleicht hatte er aber auch innere Blutungen.
»Mistmistmist.« Seine Stimme war ein ersticktes Zischen vor Schmerz. Als er schließlich entschied, dass er sich mit den Schmerzen arrangiert hatte, machte er sich auf den quälenden Weg zum Telefon. Es hing an der Wand über der Werkbank. All die Jahre hatte er sich dagegen gesträubt, sich ein Handy anzuschaffen, und jetzt wünschte er, er hätte das nicht getan. Wie er an das Wandtelefon kommen sollte, war eine andere Frage, aber immer eins nach dem anderen. Er wusste, dass Jonathan im Laden war; er wusste, dass Celia – Mrs. Frazer – noch immer beim Surfen auf Hawaii war und erst in einigen Tagen zurückerwartet wurde. Manny war mit Freunden einkaufen gegangen. Wenn er das Telefon erreichen konnte, würde er Jonathan im Laden anrufen. Scheiß drauf! Zuerst würde er den Krankenwagen rufen.
Er stemmte sich auf den rauen Betonboden und zog sich unbeholfen vorwärts, weg von dem Spiegel, der direkt hinter ihm stand. Das Blut hämmerte ihm im Kopf, brüllte in seinem Schädel, und er spürte, wie es ihm warm die Wange hinunterlief. Seine Atmung war ein lautes Röcheln. Wenn er die Werkbank erreichte, würde er …
Sich konzentrieren … eins nach dem anderen …
Das würde er sich auf seinen Grabstein meißeln lassen: Immer eins nach dem anderen.
Jetzt konzentrierte er sich darauf, die Werkbank zu erreichen. Wenn er das geschafft hatte, würde er sich ausruhen.
Er stemmte sich wieder hoch … aber es ging nicht voran. Seine Beine spürte er gar nicht mehr. Ihm brannten die Schultermuskeln; das durchgedrückte Rückgrat schmerzte, als er seine Reserven anzapfte und versuchte, sich über den Boden zu ziehen. Mit beinahe übermenschlicher Anstrengung streckte er die Hand aus und erreichte mit den Fingerspitzen die Werkbank. Mit letzter Kraft schaffte er es, sich festzuhalten.
Etwas bewegte sich.
Tony Farren drehte sich um. Sein linker Fuß hatte sich in dem kunstvollen Sockel des Spiegels verfangen. Er hatte den Spiegel bei jeder Bewegung mit sich gezogen, und die Haut seines Knöchels war wund gescheuert. Er hatte es wegen des Dröhnens in seinem Kopf nicht gehört, hatte es nicht gespürt wegen der Taubheit in seinen Beinen. Er richtete sich auf und versuchte, das Bein mithilfe beider Hände zu befreien, indem er es zu sich heranzog.
Der zwei Meter zehn hohe Spiegel bewegte sich auf dem Ständer, seine Oberfläche neigte sich nach unten.
Tony Farren öffnete den Mund, um zu schreien, aber kein Laut kam heraus. Er wusste instinktiv, was geschehen würde. Gefangen und außerstande, sich zu bewegen, konnte er nur voll Entsetzen zuschauen, wie sich der Spiegel weiter neigte. Mit einer langsamen, beinahe schwerfälligen Bewegung kippte das mächtige Teil vornüber.
Farren stieß einen einzigen Schrei aus, bevor der Spiegel ihn traf, seine ausgestreckten Hände brach, die Knochen tief in seinen Körper trieb, ihm den Schädel zertrümmerte und dann zerquetschte, die Rippen tief in die inneren Organe drückte. Blut und Hirn wurden kurz verspritzt, dann bedeckte der Spiegel ihn ganz und presste ihn auf den Betonboden.
Es waren vier Feuerwehrmänner nötig, um den Spiegel von den zerschmetterten Überresten von Tony Farren zu heben. Auf die Männer warteten zwei Überraschungen: Der Spiegel war trotz des Sturzes unversehrt; und obwohl der Leichnam eine beinahe unkenntliche Masse von zerquetschtem Fleisch und gebrochenen Knochen war, gab es kein Blut. Keinen einzigen Tropfen.
Kapitel 3
Für immer und ewig. Unverändert und unveränderlich.
Und so war es.
Die Traumlandschaft: ein Schattenland, grau und verdorrt, schwarz und weiß.
Nicht ganz lautlos. Ein Wispern des Windes, die Andeutung von Stimmen, eine Totenklage schräger Musik.
Für immer und ewig. Unverändert und unveränderlich.
Bis jetzt.
Farbe floss durch die Traumlandschaft. Ein Aufblitzen von Blutrot, das Erinnerungen brachte, Begierden weckte.
Es erfuhr eine Beschleunigung.
Kapitel 4
Dieser Mann, dachte Dave Watts, war einer der größten und hässlichsten Mistkerle, die er je gesehen hatte. Er hatte einige Sekunden lang durch eins der großen Fenster des Auktionssaals hereingespäht und die Augen mit den Händen beschattet, um drinnen etwas erkennen zu können. Schließlich war er an die Tür gekommen, hatte sie geradezu blockiert. Er war kein Mann, den man auch nur in einer hell erleuchteten Gasse treffen mochte, befand Dave, geschweige denn in einer dunklen.
Dave Watts schritt an den Möbeln entlang, die er gerade in Vorbereitung auf die übliche wöchentliche Auktion in einer Liste erfasste, und blieb in sicherer Entfernung vor der großen, schattenhaften Gestalt stehen. »Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Die Auktion ist erst am Mittwoch, und vor Dienstagmorgen sind keine Besichtigungen vorgesehen.«
Der große Mann trat in den riesigen, runden Raum und zog leicht den Kopf ein, als er näher kam. Er war ganz in Schwarz gekleidet. Das wirkte entfernt priesterlich, nur dass er statt eines Priesterkragens einen schwarzen Rollkragenpullover trug.
Dave, der selbst einen Meter achtzig groß war und hundert Kilo wog, schaute zu einem Mann auf, der ihn – mit der Statur eines Profiringers – um einen halben Kopf überragte. In der Mitte des Raums blieb der Hüne stehen und sah sich gemächlich um. Der Mann hatte schneeweißes Haar, obwohl seine Augenbrauen schwarz waren; den größten Teil seines Gesichts bedeckte ein Geflecht von Narben, die besonders entlang der Wangenknochen und der Stirn sehr auffielen. Seine Nase war einst gebrochen und schlecht gerichtet worden, und er hatte eine tiefe Kerbe im Kinn. Endlich wandte er sich Dave zu und starrte ihn mit kohlschwarzen, steinharten Augen ohne einen Wimpernschlag an.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte Dave noch einmal, jetzt mit größerem Nachdruck. So unauffällig wie möglich versuchte er, sich einem Elefantenfußständer zu nähern, in dem einige Regenschirme und Spazierstöcke standen. In einem davon war ein Schwert verborgen, obwohl Gott allein wusste, in welchem. Die Auktionssäle waren einmal überfallen worden, und bei zwei vergangenen Auktionen war man an sie herangetreten und hatte sie gebeten – nein, ihnen befohlen –, Schutzgeld zu zahlen. Trotz wiederholter Drohungen, das Gebäude niederzubrennen, hatten sie sich geweigert zu zahlen und hatten dann nichts mehr davon gehört.
Aber dieses große, hässliche Arschloch war ein Geldeintreiber, wie er im Buche stand.
»Sie versteigern einen Spiegel«, sagte der Riese endlich, seine Stimme überraschend mild und kultiviert.
Dave erkannte den Anflug eines distinguierten Oxforder Akzents. »Nein … nein … Sir, das tun wir nicht. Jedenfalls nicht diese Woche.«
Der Riese runzelte die Stirn. »Man hat mir gesagt, dass in diesen Räumen bald ein großer Spiegel versteigert würde. Ich bin weit gereist, um diesen Spiegel zu erwerben. Also, wird ein Spiegel versteigert?« Seine Stimme war ein kratziges Flüstern, als sei seine Kehle irgendwann einmal beschädigt worden.
»Nun, nein, Sir«, antwortete Dave nervös, vollkommen verunsichert durch die schiere Präsenz des Mannes. »Wir hatten letzte Woche in der Auktion einen großen Spiegel, vielleicht haben Sie die Termine verwechselt.«
»Haben Sie den Katalog der letzten Woche?«
»Ja, Sir, aber ich kann Ihnen den Spiegel auch gern beschreiben. Tatsächlich habe ich ihn selbst katalogisiert.«
»Beschreiben Sie ihn.«
Dave sah sich nervös um: Wo waren die Assistenten? Gewiss hätten sie inzwischen vom Mittagessen zurück sein sollen? »Es war ein großer Spiegel, ungefähr zwei Meter zehn mal einen Meter zwanzig, in einem schlichten Holzrahmen und kippbar auf einen Sockel montiert. Er war unvorstellbar schwer«, fügte er mit einem Grinsen hinzu, das bei dem Ausdruck auf dem Gesicht seines Gegenübers verblasste.
»Das ist der Spiegel, nach dem ich gesucht habe.« Er machte einen Schritt nach vorn. »Ich nehme an, er ist verkauft worden.«
»Ja, Sir.«
»An wen?«, fragte er scharf.
»Ich … ich fürchte, dass wir derartige Informationen nicht weitergeben können.«
»Geben Sie sie weiter!«
»Jetzt warten Sie mal …!«
»Wer hat diesen Spiegel gekauft?« Obwohl seine Stimme immer noch kaum mehr als ein Flüstern war, lag jetzt definitiv ein bedrohlicher Unterton darin.
»Sir, wie ich sagte, wir garantieren unseren Kunden Vertraulichkeit. Ich fürchte, ich kann Ihnen den Käufer des Spiegels nicht nennen.« Dave spürte, wie sich auf seiner Stirn Schweißperlen bildeten, als der Mann näher trat. Die Narben auf seinem Gesicht stachen weiß gegen die dunklere Bräune seiner Haut ab. Er sah aus, als sei er geradewegs durch eine Windschutzscheibe geflogen. Dave betrachtete sehnsüchtig einen der Gehstöcke in der Nähe; er war sich nicht sicher, ob er in der Lage sein würde, einen herauszubekommen, bevor der Fremde ihn angriff.
»Warum wollen Sie sich in Schwierigkeiten bringen?«, fragte der Mann freundlich. »Ich kann dafür sorgen, dass es sich für Sie lohnt.« Er zog eine Rolle Geldscheine hervor und begann, die größeren roten Scheine, die Fünfziger, hinzublättern.
Dave Watts starrte ihn an, bis der Mann vier Fünfziger abgezählt hatte.
»Frazer Interiors«, platzte er plötzlich heraus. »In Los Angeles, Jonathan Frazer, gekauft für fünfhundert Pfund und mit AGP International Shipping versandt, was ihn noch einmal neunhundert Pfund gekostet hat.«
Der Fremde lächelte dünn und steckte das Geld wieder in seinen Mantel. »Vielen Dank.«
»Hey«, sagte Dave gekränkt, als er seine Zweihundert zusammen mit dem Rest verschwinden sah. »Was ist mit meinem Geld?«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich Ihnen Geld geben würde.« Der Mann wandte sich ab.
»Wir hatten einen Deal; Sie haben gesagt, Sie würden dafür sorgen, dass es sich für mich lohnt.« Er vergaß seine früheren Ängste und hielt den größeren Mann am Arm fest.
Der Riese drehte sich um, packte Dave an der Kehle und stieß ihn rückwärts gegen die Wand. Er starrte ihn mindestens eine Minute lang an, bevor er den Griff um seine Kehle lockerte und lächelte.
Dave rieb sich den Hals und fragte sich, ob er jetzt rote Abdrücke hatte: Dieses Lächeln war das furchterregendste gewesen, das er je gesehen hatte. Er trat vor und stolperte über den Elefantenfuß, verstreute Regenschirme, Gehstöcke und Wanderstäbe überall auf dem Boden. Unwillkürlich schaute er hinab, und als er den Blick wieder hob, war der Mann verschwunden.
Dave Watts wischte sich mit dem Ärmel seines Arbeitskittels übers Gesicht. Ihm war eiskalt, obwohl er in Schweiß gebadet war: Er begriff, dass er zum ersten Mal in seinem Leben richtige Angst erlebt hatte.
Kapitel 5
Der Raum würde ohne ihn nie mehr derselbe sein.
Jonathan Frazer ging langsam durch den stillen Werkraum. Er trug noch immer den schwarzen Anzug, den er bei der Beerdigung getragen hatte. Er war das erste Mal seit der vergangenen Woche wieder in der Werkstatt im Gästehaus, und der längliche Raum – obwohl er mit Möbeln und Antiquitäten vollgestopft war – fühlte sich immer noch leer an. Er setzte sich in Tonys ramponierten Sessel und schaute sich um. Staubflöckchen schwebten in der Nachmittagsstille. Er hatte einen Freund verloren. Er hatte Tony Farren nicht als Vater gesehen, sondern eher als eine Art Onkel betrachtet. Oh, er hatte seine Fehler gehabt – hatte kleinlich und gehässig sein können, streitsüchtig, und er hatte es gehasst, wenn man bewies, dass er im Unrecht war. In den letzten Jahren hatte er eine viel zu große Schwäche für alten Wein und junge Männer entwickelt – aber er war ein guter Freund gewesen.
Frazers Blicke wurden von dem hohen, imposanten Spiegel und dem dunklen, rotbraunen Fleck auf dem Boden davor angezogen. Himmel, was für ein unheimlicher Unfall! Es hatte natürlich eine Autopsie gegeben und den Bericht eines Gerichtsmediziners: Unfalltod war das berechenbare Urteil gewesen.
Die Abfolge der Ereignisse war leicht zu rekonstruieren. Jonathans Blick wanderte den Spiegel hinauf, und er stellte sich vor, wie Tony an den Schrauben arbeitete, wie er sie alle säuberte und dann mühsam neue Rillen hineinschnitt. Er hatte sich zu weit vorgelehnt und war gefallen, und er hatte sich den Kopf angeschlagen, die Hüfte gebrochen und sich einen Schaden am Rückgrat zugezogen. Der Spiegel war gekippt und dann nach vorn auf ihn gefallen. Die Polizisten hatten das Gewicht des Spiegels auf über zweihundert Kilo geschätzt, aber er glaubte, dass er vielleicht noch schwerer war. Es war nur ein schwacher Trost, dass Tony sofort tot gewesen war.
Jonathan lächelte bitter. Tony hatte immer gesagt, dass er gern sterben würde, während er an etwas Besonderem arbeitete. Dieser Wunsch war ihm erfüllt worden.
Möge Gott seiner Seele gnädig sein.
Die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet. Das Scharnier quietschte und erschreckte ihn.
»Tut mir leid, Jonathan, ich habe nicht damit gerechnet, dich hier zu finden.« Diane Williams, Tony Farrens Assistentin, trat ein und ließ die Tür hinter sich zufallen. »Es ist nicht dasselbe ohne ihn«, sagte sie leise. Sie trug einen schwarzen Wildlederrock und eine frisch gebügelte weiße Bluse – das erste Mal, dass Frazer sich erinnern konnte, sie jemals in einem Rock gesehen zu haben –, und ihr zotteliges, blondes Haar war ordentlich an ihrem Hinterkopf zusammengesteckt. Ihre roten, verquollenen Augen verbarg sie hinter einer dunklen Brille. Obwohl sie oft lange und erbittert mit Tony hatte streiten können, waren sie einander sehr zugetan gewesen. »Es waren viele Leute da«, murmelte sie benommen. Das Schweigen im Raum war bedrückend.
»Er wäre stolz darauf gewesen.« Frazer nickte. So ziemlich jeder Antiquitätenladen, der etwas auf sich hielt, und jedes Auktionshaus in Los Angeles hatte einen Mitarbeiter geschickt; außerdem waren Innenarchitekten, Kollegen und sonstige Kontakte, die Tony im Lauf der Jahre aufgebaut hatte, zahlreich erschienen. Frazer bedauerte lediglich, dass seine Frau sich kategorisch geweigert hatte, ihren Surfurlaub abzukürzen, um an der Beerdigung teilzunehmen.
»Jonathan …«, begann Diane zaghaft. Sie löste ihre Haarspangen und ließ sich ihr langes, struppiges Haar über die Schultern fallen. »Ich weiß, dies ist nicht die Zeit und wahrscheinlich auch nicht der Ort …«
»Was ist denn, Diane?«, fragte Frazer sanft.
»Es ist dieser Spiegel, Jonathan, dieser … dieser beschissene Spiegel! Ich arbeite daran nicht. Das kann ich nicht!« Dann begann sie zu weinen, die Tränen, die sie an Tonys Grab so reichlich vergossen hatte, bis sie dachte, sie habe sich leer geweint, kehrten wieder zurück. Sie nahm ihre Brille ab und wischte sich mit einer Hand die Tränen weg.
Jonathan nahm sie in die Arme, drückte ihren Kopf an seine Brust, streichelte ihr das Haar und summte ihr sanft ins Ohr. Er hatte nie gefragt, aber er schätzte, dass sie ungefähr im selben Alter war wie seine Tochter Emmanuelle, Manny – achtzehn, und er hatte in seiner zwanzigjährigen Ehe genug Tränen gestillt und gelindert, um als ein Experte zu dem Thema gelten zu können. »Ich wollte dich auch gar nicht darum bitten«, log er. Er hatte über die Frage noch nicht einmal nachgedacht. »Hör mir zu. Ich will, dass du dir ein paar Tage Urlaub nimmst – wir nennen es Sonderurlaub wegen Trauerfall. Komm am Montag zurück, und wir überlegen uns etwas. Ich brauche dich jetzt, Diane, und du musst in Topform sein. Nur du kennst alle Tricks von Tony. Denk gar nicht an den Spiegel. Ich werde ihn mir wahrscheinlich vom Hals schaffen.«
»Ich bin nicht abergläubisch, Jonathan, das weißt du. Aber dieser Spiegel bringt Unglück …«
»Diane …«, begann er.
»Schau mal …« Sie nahm seine Hand und drehte ihn so, dass er vor dem Spiegel zu stehen kam. »Was siehst du?«
»Hinter einer Schicht Dreck sehe ich zwei unglückliche Menschen«, sagte er sanft.
»Ich habe diesen Spiegel seit seinem Eintreffen hier viermal poliert. Am ersten Tag habe ich fast zwei Stunden damit verbracht, jedes Fleckchen Dreck und Schmiere davon zu entfernen. Tony bestand darauf.«
»Er ist wahrscheinlich schmutzig geworden, als er … als er gefallen ist«, argumentierte er logisch.
Diane fasste Jonathan am Arm und drehte ihn zu sich um. »Bitte, Jonathan, sieh zu, dass du den Spiegel loswirst, zerbrich ihn, wirf ihn weg, verbrenne ihn, aber bitte, behalte ihn nicht hier.«
Frazer ergriff ihre Arme und drückte sie fest. »Du bist überreizt, Diane. Jetzt geh bitte nach Hause und ruh dich ein wenig aus. Wir werden am Montag alles klären, versprochen.«
»Danke«, sagte sie kleinlaut.
»Und jetzt ab mit dir.«
Als sie gegangen war, trat Jonathan Frazer vor den Spiegel und fuhr mit einer Fingerspitze einmal längs über das Glas. Sie war anschließend schwarz von Dreck.
Er nahm an, dass der Spiegel bei seinem Sturz schmutzig geworden war … Aber war es nicht erstaunlich, dass er nicht zersplittert war, als er auf den armen Tony gefallen war? Er hatte den Unfall vollkommen unversehrt überstanden … selbst der Rahmen …
Ein plötzlicher Gedanke kam ihm. Er kniete sich auf den Boden und trat unbewusst genau an dieselbe Stelle, an der Tony getötet worden war. Er untersuchte die Kanten des Holzrahmens. Sie waren mit Blut bespritzt worden, sie hätten Flecken davontragen müssen, das Holz müsste zerkratzt sein, wo es auf den Betonboden geschlagen war. Da waren keinerlei Spuren am Rahmen, keine rostigen Blutflecken, kein zersplittertes Holz. Da war gar nichts.
Und dann bemerkte er noch etwas: Die schwarzen Flecken um die Kanten am unteren Teil des Glases waren verschwunden. Das Glas fühlte sich kühl unter seinen Fingern an, als er es berührte: Es fühlte sich so an – und sah auch so aus –, als wäre es neu.
Kapitel 6
Als Jonathan Frazer mit seinem Volvo Kombi in die Einfahrt einbog, fand er den neuen Mercedes Cabrio seiner Frau achtlos quer vor der Doppelgarage geparkt, sodass beide Tore blockiert waren. Er stieß ein verärgertes Zischen aus und fuhr den Volvo auf den Pfad, der zum Haus führte, dann marschierte er über die Kieseinfahrt und nahm den Zweitschlüssel für den Mercedes von seinem eigenen Schlüsselring.
Es hätte sie zwei Minuten gekostet, den Wagen richtig zu parken.
Jonathan setzte sich ins Cabrio und nahm den kräftigen Geruch der neuen Lederpolster wahr, ein Geruch, der jetzt überlagert war von dem neuesten Parfüm seiner Frau: Opium. Sie wechselte ihre Parfüms mit erstaunlicher Regelmäßigkeit. Bevor er den Wagen anließ, holte er tief Luft, um sich zu beruhigen. Sie hätte den Wagen parken oder zumindest nicht die Einfahrt blockieren sollen … Es war reine Gedankenlosigkeit. Oder vielleicht steckte mehr dahinter.
Er grinste plötzlich in den Spiegel und stellte fest, dass sein Magen sich umzudrehen begann. Er hatte keinen Streit gehabt, hatte sich seit einem Monat nicht mehr so gefühlt … und genauso lange war Celia fort gewesen.
Den letzten Streit mit Celia hatte er kurz vor ihrer Abreise nach Hawaii gehabt, oder wo zum Teufel sie diesmal gewesen war. Er war aus dem Haus gestürmt, in den Volvo gesprungen und hatte beim Rückwärtsfahren eine der freistehenden dekorativen Wasserspiele auf dem Rasen gerammt. Die große Keramikschüssel war von ihrem Podest gekippt und hatte den hinteren Blinker zerschmettert. Auf irgendeine verworrene Art hatte er das Gefühl gehabt, dass dies ein ziemlich treffendes Sinnbild ihrer Beziehung war.
Aber das Miststück hätte den Wagen richtig parken können!
Als seine Atmung wieder normal war und sein Herz das zornige Hämmern eingestellt hatte, ließ er den Mercedes an, setzte sorgfältig rückwärts die Einfahrt hinunter und öffnete dann mit der Fernbedienung das Garagentor. Mit einer Reihe von keuchenden und zischenden Lauten hob sich das Tor reibungslos. Als es in seiner Halterung gelandet war, fuhr er mit dem Wagen langsam vorwärts. Celia hatte mit dem vorangegangenen Auto – einem alten BMW – den Tick gehabt, die Fernbedienung schon zu betätigen, wenn sie gerade in die Einfahrt einbog, und dann schnurstracks in die Garage zu schießen, noch ehe das Wagendach sich fertig geschlossen hatte. Jonathan hatte auf den Tag gewartet, da sie entweder gegen das Garagentor fahren würde, das sich geweigert hatte, sich zu öffnen, oder vom Tor, das auf halbem Wege nach oben stehen geblieben war, geköpft wurde.
Nachdem ihr Wagen sicher geparkt war, schlenderte er zu seinem eigenen Auto zurück. Er hatte einen besonders frustrierenden Tag hinter sich. Eine Kundin hatte einen teuren, maßgefertigten Esstisch zurückgegeben, weil ihr die Farbe nicht gefiel, die sie selbst ausgesucht hatte, und dann war eine Lieferung teurer Kristalllampen eingetroffen, die vollkommen falsch gewesen waren. Ihm wurde klar, dass er sich den Tag hätte freinehmen sollen. Tonys tragischer Tod und die Beerdigung gestern hatten ihn vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht, und natürlich hatte er nicht wirklich Gelegenheit gehabt, sich seit seiner Rückkehr aus London wieder in seinen normalen Arbeitstrott einzufinden.
Unglücklicherweise war morgen Samstag, einer der hektischsten Tage im Laden, und er konnte es sich nicht leisten, ihn sich freizunehmen. Nächste Woche vielleicht.
Er parkte vorsichtig seinen eigenen Wagen ein – die Doppelgarage hatte genau die richtige Größe für beide Autos, vorausgesetzt, Celia parkte ihren Wagen nicht schief ein. Er schloss das Garagentor ab und schlenderte zur Haustür, und dort loderte sein Ärger erneut auf, als er den Schlüssel in die Tür steckte und sie sich sofort leise nach innen öffnete. Sie war offen gewesen. Er stand auf der Schwelle und drückte die Tür ganz auf.
Der Marmorboden des Flurs war mit Celias Gepäck und zahlreichen Taschen zugemüllt. Ein Surfbrett lehnte an einem italienischen Rokoko-Beistelltisch. Jonathan schritt durch das Chaos, zog das Brett sanft vom Tisch weg, leckte sich den Finger und rieb damit über die Stelle, an der es den Lack beschädigt hatte.
In dem Bewusstsein, dass ein Streit jetzt nahezu unvermeidbar war – er erkannte die Vorzeichen, spürte, wie seine Schulter- und Bauchmuskeln sich verkrampften –, ging er langsam die Treppe hinauf.
Das Schlafzimmer war übersät mit Kleidern, und durch die geschlossene Tür des Badezimmers hörte er das stetige Trommeln der Dusche. Frazer drückte die Tür ein wenig auf, spähte hinein und zuckte zurück, als Dampf um ihn herum aufstieg. Er konnte gerade eben die Gestalt seiner Frau durch das beschlagene Glas erkennen.
»Hey …«, rief er. Das Zischen des Wassers ließ nach. »Hey, ich bin es …«
»Oh, du bist zu Hause. Ich bin in einer Minute draußen.«
Als Celia Frazer nackt und tropfend ins Schlafzimmer geschlendert kam, hatte Jonathan den Großteil der verstreuten Kleidung aufgeräumt, das meiste davon in den Wäschekorb geknüllt und den Rest auf Bügel in den begehbaren Kleiderschrank gehängt. Sie küsste ihn nur flüchtig auf die Wange, obwohl sie ihn seit einem Monat nicht gesehen hatte, dann schob sie sich vorbei, um schnurstracks in den Schrank zu gehen. Sie zog ein Nachthemd aus elfenbeinfarbener Seide heraus. Als sie es überstreifte, klebte es sofort an ihrem nackten Körper, zeichnete ihre Brüste, ihren Bauch und ihre Schenkel nach.
Jonathan Frazer stellte fest, dass er seine Frau ansehen konnte, ohne irgendetwas zu empfinden. Obwohl sie seit einem Monat nicht miteinander geschlafen und sich doppelt so lange nicht geliebt hatten, erregte ihn der Anblick ihres nackten Körpers nicht im mindesten. Eine allgegenwärtige Diät hatte viel von ihrem Körper weggestohlen, und ständiger Sport hatte es durch Muskeln ersetzt, was ihrer Gestalt ein leicht hubbeliges Aussehen gab. Ihre Brüste, die immer klein gewesen waren, schienen beinahe verschwunden zu sein, während sie ihre Oberkörper- und Schultermuskeln aufgebaut hatte. Und obwohl sie nur ein Meter achtundsechzig groß war – und selbst er wusste nicht, was sie wog –, schätzte er, dass sie stärker war als er.
»Willst du mich gar nicht fragen, wie mein Urlaub war?«, fragte sie schließlich, ohne ihn anzusehen, während sie den Rest ihrer Kleider auspackte und sie in einem Haufen auf den Boden neben dem Wäschekorb fallen ließ.
»Du hast die Haustür offen gelassen«, sagte er knapp.
»Oh. Ich dachte, ich hätte sie geschlossen.«
»Es hat wenig Sinn, ein Alarmsystem für zwanzigtausend Dollar zu besitzen, wenn du die Tür offen lässt.«
»Es waren keine zwanzigtausend Dollar, Schätzchen …«
»Das ist nicht der Punkt«, blaffte er. »Du hast die verdammte Tür offen gelassen.«
»Ich hab’s vergessen.«
»Warum hängst du nicht einfach einen Zettel an die Tür: Bitte, kommen Sie herein und rauben Sie uns aus, oh, und lassen Sie sich ruhig Zeit.«
»Das mache ich beim nächsten Mal.«
»Herrgott, Celia!«
Celia ließ eine Tasche aufs Bett fallen und schnippte die Schließen auf. »Ich habe es vergessen, okay. Ich musste eine Menge hineintragen. Ich hatte es eilig. Ich hatte etwas über fünfeinhalb Stunden im Flugzeug gesessen, und dann hab ich noch mal eine Stunde auf der Autobahn verbracht. Ich war müde. Ich habe mich schmutzig gefühlt. Ich wollte eine Dusche, also.« Sie funkelten einander über das Doppelbett hinweg an.
Schließlich zuckte Jonathan die Achseln. »Okay«, sagte er müde. »Du hättest für die Beerdigung nach Hause kommen können«, fügte er leise hinzu und begriff, dass das der Kernpunkt seines Zorns war.
»Es wäre unpassend gewesen.«
»Er war ein Angestellter … ein Freund.«
»Mein Freund war er eindeutig nicht!«, gab Celia aufgebracht zurück. Tony Farren hatte wenig für Celia und ihre Gepflogenheiten und Launen übriggehabt und hatte sich nicht die Mühe gemacht, seinen Widerwillen zu verbergen. Ihre Abneigung hatte auf Gegenseitigkeit beruht. Sie hatte ihn nicht gemocht und den bloßen Gedanken daran verabscheut, dass er auf ihrem Besitz und in ihrem Gästehaus arbeitete. »Er war ein Angestellter, im Grunde war er nichts als ein besserer Handlanger!«
Frazer ließ seinem Zorn freien Lauf und genoss seltsamerweise seinen Ärger. »Lass dir eins sagen«, entgegnete er eisig. »Tony Farren ist der Grund, warum Frazer Interiors heute überhaupt so erfolgreich ist. Als mein Vater den Antiquitätenladen eröffnete, hat Tony Farren mitgeholfen, das Geschäft aufzubauen, er wurde für seine Expertise bekannt, und als ich dann das Geschäft geerbt und es in einen Designladen verwandelt habe, sind die Kunden Tony gefolgt. Nicht mir. Tony. Ich bin sehr dankbar, dass er bei mir geblieben ist, dass er die billigen Artefakte, die ich gekauft habe, in Antiquitäten von Wert verwandelt hat, damit du … damit ich … damit wir … unsere Tochter auf die denkbar besten Schulen schicken konnten, damit wir uns den luxuriösen Lebensstil leisten konnten, den wir haben … und damit du dir deine verdammten Urlaube nehmen konntest, wann immer dir danach zumute war. Er ist der einzige Grund, warum wir überlebt haben!«
Er eilte aus dem Zimmer, bevor sie die Tränen in seinen Augen sah. Diese Dinge hätte er Tony sagen sollen, über diese Dinge hätten sie reden sollen.
Was er gesagt hatte, entsprach alles der Wahrheit.
Vielleicht hatte er die Sache um Celias willen übertrieben dargestellt, aber es war trotzdem die Wahrheit. Frazer Interiors hatte wegen Tony Farrens gutem Ruf überlebt, wegen seiner Fähigkeiten und Kenntnisse; es würde nicht morgen schließen müssen, weil er tot war, aber es würde ein Unterschied sein. Er hatte die Gabe besessen, alten Schrott in Antiquitäten zu verwandeln – und was eine Antiquität war, lag im Auge des Betrachters.
Und jetzt war er tot.
Getötet von einem beschissenen Spiegel.
Während der Zorn noch immer in ihm schäumte und ihn kalt und leer machte, stürmte er durchs Haus, hinaus durch die Küche und hinüber zum Gästehaus. Als er die Tür aufdrückte, fand er den Spiegel in der Mitte des Raums, als Silhouette vor dem spätnachmittäglichen Licht, das Glas eine milchig bleiche, stumpfe Fläche.
Frazer schnappte sich einen Hammer von der Werkbank und stellte sich mit bebender Brust davor.
Getötet von einem beschissenen Spiegel. Er hob den Hammer und näherte sich dem Glas.
Der Spiegel war zwanzigtausend Dollar wert. Mindestens.
Der Gedanke ließ ihn erstarren.
Ihn zu zerstören würde ihn enorm befriedigen; ihm helfen, etwas von dem Zorn über Tonys unnötigen Tod abzuarbeiten. Und der Drang war da, zu schlagen, etwas zu treffen, etwas zu verwunden. Okay. Er hatte vielleicht einen triftigen Grund, mit Celia zu streiten; sie war im Unrecht gewesen. Sie hätte zur Beerdigung nach Hause kommen sollen, drei verflixte Tage hätten für ihren Urlaub keinen allzu großen Unterschied bedeutet. Sie hätte ihren Wagen vernünftig parken sollen; sie hätte die Haustür hinter sich schließen sollen.
Aber dadurch war er auch nicht mehr im Recht.
Sie waren jetzt seit zwanzig Jahren verheiratet; er hätte sich inzwischen längst an ihre Art gewöhnen sollen.
Er hob den Hammer abermals; um überrascht festzustellen, dass er sich kaum im Spiegel erkennen konnte. Er rieb mit dem Finger einmal über den ganzen Spiegel; als er ihn wegnahm, war er mit einer dicken, rußigen Schmutzschicht bedeckt.
Jonathan betrachtete den Hammer in seiner Hand. Und dann ließ er ihn auf den Boden fallen.
Den Spiegel zerschlagen – und was würde er damit erreichen? Es würde ihm vorübergehende Befriedigung verschaffen … und er würde zwanzigtausend Dollar oder mehr verlieren. Und der Erste, der ihn dafür einen Volltrottel genannt hätte, wäre Tony Farren gewesen.
Er wandte sich ab, blieb an der Tür stehen und schaute wieder zum Spiegel hinüber. Er würde ihn säubern und ihn verkaufen – sogar billig, nur, um ihn loszuwerden.
Als er die Tür schloss, flossen Farben über die Oberfläche des Glases wie Öl auf schmutzigem Wasser.
Kapitel 7
Das beharrliche, schrille Piepen weckte ihn kurz vor drei Uhr morgens.
Jonathan Frazer rollte sich blindlings herum und tastete nach dem Wecker … und dann war er plötzlich hellwach.
Die Alarmanlage!
Er richtete sich schnell auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen, glitt dann nackt aus dem Bett und zitterte in der frühmorgendlichen Kälte. Schläfrig blinzelnd, starrte er auf den weißen, rechteckigen Kunststoffkasten neben der Schlafzimmertür, dessen durchdringendes Piepen ihm in den Ohren klingelte. Der Apparat steuerte die raffinierte Alarmanlage für das Haus und das Gästehaus. Auf dem kleinen LCD-Bildschirm blitzte das Wort »Gästehaus« in hellgrünen Buchstaben auf. Etwas hatte den Alarm ausgelöst. Der Alarm war stumm, es schrillten keine lauten Glocken draußen los – Celia wollte das nicht –, aber das Piepen der Alarmkonsole klang unnatürlich laut in dem stillen Schlafzimmer.
Jonathan gab den Notfallcode ein, um das nervige Geräusch abzuschalten. Er wusste, dass die hiesige Polizeiwache bereits verständigt wäre. Er schlüpfte in eine dunkle Jogginghose und einen schwarzen Sweater und schob die Füße in seine Pantoffeln. Den Rat der Sicherheitsfirma ignorierend – »falls der Alarm ausgelöst wird, gehen Sie unter gar keinen Umständen selbst der Sache nach« –, rannte er mit klopfendem Herz die Treppe hinunter. In der Küche hielt er inne. Dann duckte er sich unterhalb der Fenster entlang, bewegte sich vorsichtig zu der gläsernen Hintertür und spähte auf die gepflasterte Terrasse hinaus. Das Gästehaus war zwischen den Bäumen kaum zu sehen. Es lag im Dunkeln … und dann blitzte dort ein milchig weißes Licht hinter den Fenstern auf, flackerte und erstarb wieder.
ENDE DER LESEPROBE