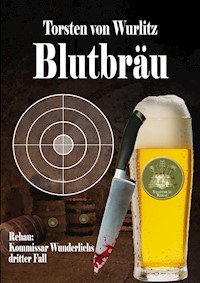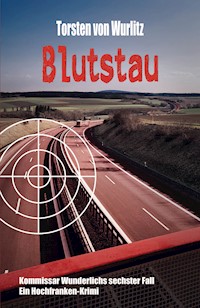Torsten von Wurlitz
Blutbräu
Rehau:
Kommissar Wunderlichs dritter Fall
Prolog
Fünf Tage, nachdem man Ulrich Wolks Überreste aus dem Beton ausgegraben hatte, war endlich Zeit, um zu trauern.
REH-AU 1 parkte nicht oft vor dem Friedhofsgelände an der Jobststraße, aber wenn, dann kündete des Bürgermeisters Dienstwagen davon, dass ein ganz Großer gegangen war.
„Er hat dieser Stadt unschätzbare Dienste erwiesen“, versuchte Angermann zu trösten. „Er hat sie den Fängen der Mafia wieder entrissen.“
„Es wird trotzdem schwer werden.“ Ulrike Wunderlich sprach mit gebrochener Stimme. „Er hat so vielen das Leben gerettet, und jetzt muss ich so früh auf ihn verzichten.“
„Ich weiß“, entgegnete er mitfühlend. „Es gibt keine Worte dafür, wie schwer es ist. Ich habe so etwas ja auch noch nie erlebt. Ein solches
Verbrechen, eine solche Niedertracht. Und er hat sich geopfert.“
Sie machten beide eine lange Pause, um zur Besinnung zu kommen nach all dem, was
passiert war.
„Aber trotzdem, glaub mir. Der Tag wird kommen, an dem du wieder lächeln kannst.“
So standen sie gemeinsam schweigend da und sahen dem schwarzen Wagen der
Bestattungsanstalt „Pietät“ bis zum Schluss nach, wie er würdevoll den endlosen Hauptweg entlang zu Kommissar Wunderlichs Grab schlich.
Kapitel 1
Die letzten zwei Wochen in Wunderlichs Leben begannen mit Strömen von Blut.
Gerade hatten sie noch Radio gehört, in Wortfetzen durch die sperrangelweit geöffnete Tür des Cafés am Maxplatz, das abends ein Tapas-Restaurant war und jetzt am Nachmittag die
zahlreichen Gäste draußen in der Sonne bewirtete. „Wetter in Bayern heute, Samstag, 1. Oktober 2016 … Alpenrand Wärmegewitter … unwetterartige Regenfälle … Oberfranken Fortdauer des ruhigen, spätsommerlichen … weiterhin zwanzig bis dreiundzwanzig Grad …“
Es war Altweibersommer. Wie immer in Hochfranken um diese Zeit. In der nördlichsten Stadt Italiens hatte er bis vor knapp fünf Jahren Dienst getan, der schönsten Stadt der Welt und was sie dem Millionendorf im Süden nicht alles für Attribute nachwarfen. Dort, in der mediterranen bayerischen Landeshauptstadt,
stand für die Schwabinger Bussi-Gesellschaft ein weiterer Tag mit schwüler Föhnluft und anschließendem Temperatursturz mit Blitz und Donner an. Derweil waren
Kriminalhauptkommissar Wunderlich und seine Frau in T-Shirts und Bermudas durch
das eiskalte Rehau spaziert, im Zentrum von Bayerisch-Sibirien, und hatten sich
in der warmen Herbstsonne inmitten eines freundlichen, geerdeten
Menschenschlages ein riesiges Eis schmecken lassen.
„Du bist wirklich wesentlich ausgeglichener, seitdem du wieder hier bist.“
Das Feedback war ihm nicht neu, aber er hörte es von ihr immer gern aufs Neue. Genüsslich blickte er auf die Platzmitte, auf der vor wenigen Tagen der neue
Springbrunnen eingeweiht worden war, feierlich und im Beisein von dreihundert
Menschen. Es war wieder die nahezu allseits beliebte Version, die schon in
seiner Kindheit dort gestanden hatte, abends traumhaft und verspielt in
wechselnden Farben angestrahlt.
„Ja mei … no scho. Aber mit sechsavierzge werd mer hald aa ruicher.“ Es war sein Markenzeichen, Altbairisch und Hochfränkisch zu mischen, er achtete mit Blick auf das unmittelbar benachbarte, nicht
von allen seiner Rehauer Mitbürger heiß geliebte Ausland südlich des Fichtelgebirges lediglich darauf, dass ihm zwischen „obi“ und „nunder“ kein „oichi“ entfleuchte.
Er machte eine Kunstpause, während er den Blick zwischen der Perlenbach-Promenade, dem prächtigen Alten Rathaus und dem Einkaufsgewusel in der Ludwigstraße schweifen ließ. Dann äffte er, typisch sein Humor, einen regionalen Fernseh-Slogan nach.
„Iech bie der Wunderlich, und do bie iech dahaam.“
Sie hatten gelacht, gescherzt und soeben noch das unbeschwerte Glück in Bayerns grünem Nordosten genossen.
Und nun das jähe Ende.
Es war 15 Uhr. Die Wunderlichs waren dabei, den Maxplatz wieder zu verlassen,
nicht ohne in Erinnerungen zu schwelgen an das Konzert von Gery and the Johnboys, das vor drei Wochen während der Kulturtage hier stattgefunden hatte. Die Rehauer Band, die seit dreißig Jahren in wechselnder Besetzung, aber mit demselben Chef am Start war, weckte
mit ihrem Rock-Pop-Mix von den Sechzigern bis zur Jahr-tausendwende immer
wieder Erinnerungen an die jeweilige Jugendzeit, so auch bei Familie
Wunderlich.
„Schon verrückt, oder?“, lächelte er. „Wir sind hier draußen auf dem Rasen gesessen, haben Brotzeit gemacht und keinen Cent für die Show bezahlen müssen.“
„Und dann hat er auch noch dreieinhalb Stunden gespielt. Kannst du dir
vorstellen, was das in der Olympiahalle gekostet hätte?“
„Unnötig, sich das vorzustellen“, entgegnete er. „Du hättest sowieso keine Karten mehr bekommen, es sei denn, du hättest es schon letztes Jahr zu Ostern gewusst.“
Sie schlenderten weiter zum Perlenbach, der das Ensemble des Rehauer
Stadtplatzes im Westen begrenzte. Ulrike versuchte, mit einem nachgemachten
Quaken die Stockenten anzulocken, die zu Dutzenden gemächlich im Fluss herumkreuzten.
„Tja – vorbei“, seufzte Rehaus einziger Kriminaler erleichtert. „Ich finde, dass die bayerische Regierung endlich mal einer göttlichen Eingebung gefolgt ist“, schmunzelte er mit Blick auf den berühmten Münchner im Himmel. „Der Aloisius Hingerl scheint nun doch herabgestiegen zu sein. Von selber wären sie sicherlich nie auf diese Aktion gekommen, in jeder ehemaligen Kreisstadt
eine Kripo-Außenstelle einzurichten.“
„Na ja, nach deinen inzwischen zwei Mordfällen vielleicht schon.“ Ulrike drehte den Kopf zuerst nach links zum Denkmal für die Flussperlmuschel, welche 2013 im Zentrum einer tödlichen Verschwörung gestanden hatte. Dann hob sie ihn in Richtung Pilgramsreuth, wo keine zwei
Jahre später rund um das Kartoffeldenkmal Mord und Totschlag wegen eines Radsport-Events
ausgebrochen waren. Sie begann die Semmeln zu zerkleinern, während sie die Perlenbach-Promenade flussaufwärts in Richtung des Gässchens „Am Graben“ flanierten. Fröhlich ging sie ihrem Mann ein Stück voraus, den ersten Enten entgegen.
„Das war schon mehr als ungewöhnlich“, sinnierte Wunderlich. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas noch einmal …“
Ein gellender, markerschütternder Schrei war das Nächste, was er hörte.
„Oh Gott! Nein! Was …? Hilfe!!“, kreischte sie.
Jetzt konnte, jetzt musste er es sich sehr plötzlich vorstellen.
Es hatte Ulrike heimtückisch und völlig lautlos getroffen. Mit blankem Entsetzen und wie gelähmt starrte Wunderlich seine Frau an. Doch die konnte gerade noch mit zitternden
Fingern nach unten aufs Wasser zeigen, bevor sie selbst zu Boden sank. Er
erfasste in keiner Weise, was hier vor sich ging. Wurde hektisch, wusste gar
nicht, wo er zuerst hinsehen sollte. Aus irgendeinem Grund entschied er sich für die Ente. Die war bereits ganz rot. Das Federkleid hatte sich über und über verfärbt durch das Blut. Es war so viel Blut, dass von der weißen Farbe an dem Erpel überhaupt nichts mehr übrig geblieben war. Noch ehe Wunderlich Luft holen oder gar nachdenken konnte,
entdeckte er schockiert, dass die anderen Enten genauso aussahen. Und auch,
warum. Er beobachtete, wie sich die Blutspur ihren Weg durchs Wasser zu ihnen
bahnte, wie sie die Vögel immer mehr in diese grauenhafte Farbe tauchte. Es war eigentlich gar keine
Spur. Der Perlenbach war mindestens auf der Hälfte seiner Breite dunkelrot eingefärbt. Total in Panik blickte er weiter flussaufwärts, wo seine Frau zu liegen gekommen war. Dann endlich sprintete er los, der
Quelle des Aderlasses entgegen. Er sah Ulrike dort liegen. Er sah an ihr
hinunter, an ihr vorbei ins Flussbett. Er sah, wie direkt unter ihm das Blut in
den Perlenbach strömte.
Das Nächste, was er tat, war, die Kavallerie zu rufen.
Aber es war zu spät.
Kapitel 2
Zur selben Zeit an einem Ort im Ausland.
„Mezzomaiore hat angerufen. Die Sache ist erledigt.“ Der Kleine, etwas Untersetzte mit dem schwarzen Haar lächelte breit. Seine helle, fast heiser wirkende Stimme klang zufrieden.
Der schlaksige Blonde lächelte ebenfalls, nur um einiges zurückhaltender.
„Damit sind wir also wieder im Rennen, Signore?“
Der Schwarzhaarige Anfang fünfzig, der durch seine nicht so stark ausgeprägte Körpergröße jünger wirkte, machte eine ausladende Handbewegung, die etwas von einem imaginären Tisch wischte.
„Sì. Wenn wir den Schlüssel zu diesem Geheimnis nicht haben konnten, dann, bei Gott, soll ihn niemand
bekommen.“
Beide blickten sie nun entspannt, ja geradezu andächtig, auf den hellockerfarbenen barocken Rathausbau. Die große Uhr zeigte halb vier Uhr nachmittags.
„Die italienische Reise geht weiter“, schmunzelte der Lange mit Blick auf das Denkmal, neben dem sie unten auf dem
Platz standen.
„Weißt du, Katschenbacher hat einen Fehler gemacht“, antwortete der Schwarzhaarige maliziös. Er sprach das Wort wie „Fäller“ aus, schulterzuckend und mit den Handflächen nach oben. Jemand, der mit Bedauern, aber ohne Mitleid ein nicht in Zweifel
zu ziehendes Urteil fällte. Dann wechselte er in einen ziemlich drohenden, herablassenden Tonfall. „Non è buono. Das ist nicht gut. Ich bin Geschäftsmann. Ich mag es nicht, wenn jemand einen Fehler macht.“
„Tja, jetzt ist es vorbei mit ihm.“
„Alles war friedlich bisher, oder etwa nicht? La famiglia. Sind wir nicht alle eine große Familie? Hat die Familie nicht den Markt gerecht unter sich aufgeteilt? Die
Nachfrage nach dem Stoff ist hoch genug für alle, nicht wahr? Und dann hat Signor Katschenbacher plötzlich diese haarsträubende Idee.“
„Können Sie sich erklären, warum er das angezettelt hat?“
„Er will Krieg, Paolo. Krieg. Aber warum nur? Habe ich ihm etwas getan? Bin ich
nicht immer fair zu ihm gewesen? Peccato! Schade, sehr schade um ihn. Aber wenn Katschenbacher diesen Krieg will – den kann er haben.“
„Was haben Sie nun weiter vor, Signore?“
„Sagen wir so: Sein Unternehmen wird nach dem äußerst bedauernswerten Vorfall schon bald zum Verkauf stehen. Molto bene! Und dann werden wir ja sehen, ob das Ganze seine eigene hirnrissige Idee war
oder die der Person hinter ihm.“
„Und wenn es die Person hinter Katschenbacher gewesen ist?“
„Wenn es der Pate war, dann steht in der Familie kein Stein mehr auf dem anderen,
sehr bald schon. Glaube mir.“
Der Blonde, Jüngere blieb daraufhin ebenso ruhig, wie es der Schwarze, Ältere geblieben war. Nur klangen seine Worte weniger drohend.
„Wie gut, dass Sie Ihren Sohn zum Studium ausgerechnet dorthin geschickt hatten.
Mezzomaiore ist ein Glücksfall für uns.“
„Das kannst du laut sagen, Paolo“, bestätigte der Kleine, Heisere. „Ach ja“, seufzte er genüsslich, „schön ist es hier bei euch in dieser Stadt. Fiumefreddo ist ja auch nicht weit.“ Er deutete auf den Wegweiser. „Sizilien …“
„Wissen Sie, wann dieses Rathaus neu erbaut wurde, Signore?“, fragte der Blonde nicht ohne Stolz. „1816, nach Originalplänen, nachdem es zuvor niedergebrannt war. Und es wird noch immer benutzt. Dies
ist eine Stadt mit langer Tradition. Und Sie leiten ein Unternehmen mit langer
Tradition. Ich finde nicht, dass ein Laden wie der von Katschenbacher, der erst
vor ein paar Jahren angefangen hat, besser sein sollte als unsere altehrwürdige Firma. Ich bin sehr froh, dass Sie hier inzwischen Geschäftsführer sind.“
„Und ich bin froh, dass der Herr Zweite Bürgermeister dieser Stadt sich entschlossen hat, mein Stellvertreter zu sein“, kam das Lob zurück. „Unsere Firma arbeitet hart, sehr hart“, säuselte er fast beiläufig in den Raum. „Da geht es nicht an, dass uns irgendeiner eine solche Konkurrenz vor die Nase
setzt. Noch dazu aus genau jener Stadt. Madre di Dio, wer bin ich, dass ich mir so etwas bieten lassen sollte.“
„Von Wolfgang Katschenbacher jedenfalls nicht mehr“, lächelte der blonde Schlacks. Es sah fast bescheiden aus.
Dabei war soeben ein Mord geschehen.
Kapitel 3
„Großer Gott, was ist denn hier passiert?!“ Angermann konnte kaum mehr als flüstern. Beim ersten Mord vor drei Jahren, ein paar Meter weiter in der
Schwesnitz, war er nur leichenblass gewesen, und das war bereits außergewöhnlich. Beim zweiten Toten letzten Sommer am Schneeberg war er im Wesentlichen
außer Atem. Aber das Blutbad, dessen Zeuge der Bürgermeister der Stadt Rehau hier in diesem Augenblick wurde, versetzte ihn in
einen noch schlimmeren Zustand. Einen, den man vom Chef des Rehauer Rathauses
niemals erlebt und auch nie für möglich gehalten hätte. Er wirkte nicht wie eine staatstragende Persönlichkeit, die sonst in pathetischen Ansprachen und völlig zu Recht von der „Industriestadt im Grünen mit Herz und Kultur“ referierte. Wie ein sportlicher Mittvierziger, der von morgens um fünf bis abends um neun am Schreibtisch saß und dazwischen noch seine drei Sprösslinge zur Schule und zum Kindergarten brachte. Wie jemand, der seine
Mitarbeiter bis zum Anschlag pushte, zugleich aber der Staatsregierung jeden Förder-Euro und dem Wettergott alljährlich ein sonniges Stadt- oder Wiesenfest rausleierte.
Nein, Edmund Angermann schwieg. Er flüsterte seine Frage dahin, dann stand er einfach nur regungslos da und brachte
keinen Ton mehr heraus. Er blickte seinen alten Freund Wunderlich bloß tröstend an.
Es war 16 Uhr, und Angermann schwieg noch immer, als zwei Minuten später das Dröhnen der Polizeihubschrauber näher kam und schließlich über ihren Köpfen in ohrenbetäubenden Lärm mündete. Er sah abwechselnd auf die Blutströme, die Polizei-BMWs und auf die am Boden liegende Ulrike Wunderlich.
„Just Pink“, rief er deren Ehemann schließlich zu, als er sich wieder gefangen hatte. Der Kommissar gab ihm nur einen
verwirrten Blick zurück.
„Na, das rote Blut und das Meer aus Blaulicht, das ergibt so ziemlich die Farbe
unserer Star-Band vom Stadtfest vor zwei Monaten. Oder?“
„Ich bin jetzt wirklich nicht in der Stimmung für Witze!“, blaffte Wunderlich zurück, die Augen nicht von seiner Frau abwendend, die sich allmählich anschickte, wieder aufzustehen.
„Ulrike kann einfach kein Blut mehr sehen, seitdem sie eine Zeitlang die Veterinärkontrollen am Schlachthof gemacht hat. Gruselig, sage ich dir. Mache es zum
Pflichtbesuch für Schulklassen und du reduzierst den deutschen Fleischkonsum auf die Hälfte. Ihr ist seither mehr als einmal schlecht geworden, wenn mal ein größerer Blutfleck auf meiner Dienstkleidung war. Aber dass sie derart umkippt wie
heute, habe ich noch nie erlebt.“
„Na ja, bei der unfassbaren Menge Blut ist das dann aber doch kein Wunder“, folgerte der Bürgermeister. „Hauptsache, das Blut stammt nicht von ihr. Also, ihnen nach!“
Sie passierten die Absperrung, die quer stehende Polizeifahrzeuge links und
rechts der Perlenbach-Promenade gebildet hatten, und klemmten sich am östlichen Ufer hinter die Einsatzhundertschaft, die flussaufwärts durch das Wasser watete. Wunderlich wechselte noch einige liebevolle Worte
mit seiner Frau, die er eine halbe Stunde zuvor versorgt hatte, während alles Uniformierte auf dem Weg gewesen war, das er im Landkreis Hof hatte
auftreiben können. „Bleib liegen“, hatte er zu ihr gesagt und ihr seine Jacke als Kissen untergelegt. „Lass deinen Kreislauf erst mal in Ruhe wieder Fahrt aufnehmen.“ Jetzt nahm er die Wiedergenesene in den Arm und ließ sie von zwei Kollegen nach Hause fahren.
Dann folgten sie weiter der Blutspur. „Ich finde es nicht lustig, dass jemand meine Stadt ausgerechnet rot anstreicht,
schwarzer Teer wäre viel hilfreicher gewesen“, witzelte Angermann noch, aber die Lage war ernst. Wunderlich hatte den Mann,
mit dem er schon vor vierzig Jahren als Dreikäse-hoch Räuber und Gendarm gespielt hatte, nicht nur in dessen Eigenschaft als Bürgermeister angerufen. Angermann hatte vielmehr einen Hang zu Verbrechen. Was
erfreulicherweise nichts damit zu tun hatte, dass er Politiker war. Sondern
seinem Hobby geschuldet. Dem, das sein Freund Wunderlich zum Beruf gemacht
hatte: Knifflige Kriminalfälle lösen. Und dass sie einen solchen vor sich hatten, schon wieder, das stand außer Zweifel.
„Es geht immer noch weiter!“, rief ihnen der Zugführer zu, als er mit seinen Leuten unter der Fußgängerbrücke mit dem gusseisernen Geländer angekommen war. „Das Blut kommt von da hinten um die Flussbiegung!“
„Es beginnt weit hinter der Flussbiegung“, bestätigte einer der Hubschrauberpiloten knarzend über den Knopf, den Wunderlich inzwischen im Ohr hatte. „Da ist überhaupt kein Ende abzusehen.“
„Dann müssen wir ja wohl auch da rein, und zwar schnell“, kommandierte Wunderlich Angermann ins Wasser. „Um die Biegung führt kein Weg mehr. Und ich schicke zwei Fahrzeuge zur nächsten Brücke flussaufwärts!“ Er bellte die Order in sein Mikro.
„Das ist doch nicht das Blut von einem einzelnen Menschen“, hechelte Angermann, der nach Wunderlichs Anruf geistesgegenwärtig einen Neoprenanzug mitgebracht und nun angezogen hatte. Sie waren schon
jetzt beide bis zur Hüfte rot getränkt, und es stank wie in einem Schlachthaus.
„Nein, und meine Hoffnung ist, dass es gar kein Menschenblut ist. Aber wenn doch,
dann wage ich mir nicht vorzustellen …“ Wunderlich beendete den Satz nicht. Sie waren um die Flussbiegung herum, und es
wurde nicht weniger.
Nach Bourgoin-Jallieu, der französischen Partnerstadt Rehaus, war die Brücke benannt, welche die B289 ringförmig um den Ort führte und dabei den Wiesengrund kreuzte. Von dort funkte nun die Streife das Erlösende und Unheimliche zugleich. „Zwischen Mühlgraben und Perlenbach!“ Fast zeitgleich meldete sich der Hubschrauber: „Zirka hundert Meter nach der Biegung verzweigt sich der Fluss. Dazwischen liegt
eine Senke mit einer weitläufigen Wiesenfläche. Die Blutlache beginnt in der Mitte der Senke. Da müsst ihr hin. Dahinter in Richtung der großen Brücke ist wieder alles grün.“
Der Mühlgraben, dessen historischer Zweck sich im Namen wiederfand, war ein 1500 Meter
langer Kanal. Er begradigte den Perlenbach, der hier wie in einem Bilderbuch
seine Mäander durch die Auenlandschaft zog. Der Kanal zweigte am östlich gelegenen Ortsteil Heinersberg ab und mündete am Burgplatz nahe der Stadtmitte wieder ein. Als Wunderlich und Angermann
gegen 17 Uhr zusammen mit dem Einsatzzug die Senke zwischen beiden Gewässern erreichten und das Flussbett des Perlenbachs verließen, standen sie immer noch fast knietief in einer Blutlache von gut zehn Metern
Durchmesser.
Angermann starrte auf den Mittelpunkt des Blutbades. Er musste sich zwingen,
sich zu konzentrieren, während er vom hektischen Waten durchs Wasser noch schnaufte wie ein Walross und
der Blutgeruch ihm speiübel werden ließ. Dann wanderten seine Augen weit aufgerissen hinauf zu der Straße, die parallel zum Mühlgraben verlief. Anschließend starrte er Wunderlich an, schlug die Hände vors Gesicht und schüttelte fassungslos den Kopf.
„Ich lebe jetzt seit über vierzig Jahren in dieser Stadt, aber dass das, worauf wir hier stehen, noch
existieren würde, hätte ich nie im Leben geglaubt.“ Mit der düsteren Miene eines Propheten, der soeben den Weltuntergang verkündet hatte, deutete er nach unten auf die durchtränkte Wiese.
„Wovon sprichst du? Wir stehen auf einer Wiese, oder etwa nicht?“ Wunderlich hatte keine Ahnung.
„Nein, wir stehen eben nicht nur auf einer Wiese. Du wirst mir nicht glauben,
worauf du dich hier wirklich befindest. Und ich spreche davon, dass dort unter
der Ascher Straße offenbar Leichen im Keller liegen. Und das meine ich wörtlich.“
„Leichen? Keller? Unter der Straße? Was zum Teufel ist denn da, unter uns? Ich verstehe kein Wort. Und wieso
tritt das Blut dieser Leichen hier an die Oberfläche? Mitten in der Wiese? Eddi, bitte red Klartext, wir haben es verdammt eilig.
Hier geht es offenbar dutzendfach um Leben und Tod!“
„Das erkläre ich dir sofort in dem Keller, den ich meine. Los, schnapp dir deine Leute und
komm hoch, über die Ascher Straße!“
Kapitel 4
Auch das zweite Opfer hatte keine Chance. An diesem frühen Samstagabend schlug der Tod erbarmungslos zu. Es war dunkel und es war
feucht. Man konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Hin und wieder flatterte
eine Fledermaus über seinem Kopf entlang.
Vielleicht hätte er wissen müssen, was ihm in diesem finsteren Sumpf blühen würde. Vielleicht hätte er nicht so leichtsinnig hierherkommen sollen, in diese Dunkelheit, nach
allem, was er getan hatte. Aber das war ihm überhaupt nicht bewusst gewesen. Er war sich insgesamt keiner Schuld für irgendetwas bewusst gewesen, bevor er unausweichlich damit konfrontiert wurde.
Er war so von sich selbst überzeugt, dass er sich für unantastbar hielt.
Bis zu dem Moment, in dem er das Letzte im Leben spürte. Zuerst schien es nur ein Piksen zu sein. Er ärgerte sich. Er war groß gewachsen, aber recht empfindlich. Ein Mückenstich könnte schon wieder einen Tag Krankheit bedeuten. Nur halt! Das hier konnte ja unmöglich ein Mückenstich sein! Er spürte viel zu viel Blut an seinem Rücken, und ein seltsam tief reichender, sehr stechender Schmerz setzte ein.
All diese Gedanken und Wahrnehmungen hatten sich binnen dreier Sekunden
abgespielt. Instinktiv drehte er sich um. Nur die Umrisse der anderen Person
waren zu erkennen, selbst jetzt, wo sich seine Augen etwas an die Dunkelheit
gewöhnt hatten. Noch bevor er überrascht sein konnte, raste das Messer schon ein zweites Mal auf ihn zu.
„Du sollst nicht stehlen!“, knurrte die Stimme, als sich die Klinge in die Schulter des Opfers rammte. Er
kannte diese Stimme genau. Furchtbar genau.
Jetzt schrie er vor Schmerzen. Er schrie, so wie man ihn noch nie hatte schreien
hören. Er war ein jovialer Typ, dessen Ruhe ein Statussymbol dafür war, welch übermäßig hohe Meinung er von sich selbst besaß. Damit war es nun schlagartig vorbei, in der letzten Minute seines Daseins.
Nicht stehlen? Oh ja, er war ein Dieb! Was er fast ein Jahr zuvor gestohlen
hatte, war für den rechtmäßigen Besitzer unbezahlbar und unersetzlich, und es hätte auch keinen Weg gegeben, es zurückzugeben. Noch dazu war es mit dem einen großen Diebstahl ja nicht getan gewesen. Seine Gier hatte doch noch viel mehr
angerichtet. Kaum einen Monat war es nun her, dass er demselben Opfer weiteres,
völlig andersartiges Diebesgut entrissen und damit die Existenz von gut einem
halben Dutzend Menschen auf des Messers Schneide geschoben hatte. Er hatte
ihnen das Besondere, das er ihnen schon zum Greifen nahe in Aussicht gestellt,
ja zur Hälfte bereits übergeben hatte, wieder abgenommen und es anderen angeboten. Einfach so, weil er
mehr wollte und weil er es ihnen nicht gönnte.
Wieder waren nur Augenblicke vergangen, während ihm all das gedämmert war. Jetzt, jetzt auf einmal, viel zu spät, bereute er. Wie ein Herrscher, der lange Jahre nur im Bösen regiert hatte und sich auf dem Sterbebett, im plötzlichen Aufflackern der Erkenntnis und aus Angst vor dem Tod, zum Christentum
bekannte. Aber was half es noch?
„Du sollst auch die anderen neun Gebote nicht brechen!“ Damit traf der dritte Stich frontal den überraschten, wehrlosen großen Mann. Es war nicht einfach für die Person mit dem Messer, zu zielen, hier, wo kein Tageslicht ihr zu Hilfe
kam. Aber die kleine Taschenlampe, die sie benutzte, reichte aus. Dieser dritte
Stich war ein Volltreffer. Das Opfer sackte stöhnend zusammen. Das Blut entwich nun in Strömen aus seinem leblosen Körper. Rot, rot, rot, der ganze Boden färbte sich so tief, dass er mit der goldgelben Farbe des Getränkes, für das er da war, nichts mehr zu tun hatte.
Von ferne läuteten mit einem Mal die Kirchenglocken ihr Totengeläut, dumpf nur wahrzunehmen hier unten und doch übermächtig in der Stille, die ansonsten über diesem gespenstischen Ort lag. Mit seinem letzten Atemzug schien der
Sterbende noch einmal unmerklich den Kopf zu schütteln, bevor sich ungläubiges Staunen für immer in seinen toten Augen widerspiegelte.
Der Mensch, der soeben gemordet hatte, ließ schwer schnaufend, zutiefst erregt und doch endlich erleichtert die Klinge
sinken. Er hatte die Rache, die er wollte. Der große, von sich selbst so überzeugte Mann hatte ihm einfach viel zu viel genommen. Er musste dieses in Rot
getauchte Fanal setzen. Die Polizei würde die Blutspur natürlich schnell finden. Und all diejenigen, die es betraf, würden das schreckliche Signal auch gut verstehen. Nur zu ihm würde keine Spur führen. Das war auch äußerst wichtig. Nicht nur, um nicht den Rest des Lebens in einem bayerischen Gefängnis verbringen zu müssen. Sondern vor allem deshalb, weil der Mann mit dem Messer in der Brust, der,
der mindestens drei der zehn Gebote gebrochen hatte, ja nicht das letzte Opfer
auf diesem grausamen Rachefeldzug bleiben sollte. Das nächste Opfer, es würde noch viel blutiger sterben.
Kapitel 5
Schnell wie der Wind und leise wie Katzen schlichen sie sich auf das Gelände des Feilenhauer-Kellers. So heftig, wie den Beamten unten aus dem
Perlenbachgrund das Blut entgegengeflossen war, musste die Tat ganz frisch
sein. Der Täter war also vermutlich noch zu Gange.
„Das Gemäuer vor euch steht in direkter Verbindung mit der anderen Straßenseite, wo wir gerade herkommen“, flüsterte Angermann, dessen Eigenschaft, ein wandelndes Stadtarchiv zu sein, hier
von größtem Nutzen war. „Es gibt einen Entwässerungsgraben, du wirst es verstehen, wenn ihr drin seid.“
„Wenn wir mal drin sind“, entgegnete Wunderlich. „Wir haben kein SEK dabei und der Verbrecher ist vermutlich schwer bewaffnet. Wir
laufen die Treppe hinunter ins Dunkel, er dagegen sieht uns kommen.“
„Da habe ich eine bessere Idee. Kommt mit.“ Angermann führte die gut zwanzig Polizisten ein paar Meter weiter bergauf, dorthin, wo sie
fast schon an den Bahngleisen standen.
„Seht ihr das Loch im Boden? Der Bierkeller hat einen Luftschacht. Unten ist ein
Brunnen, aus dem das Brauwasser gefördert wurde, direkt bis an die Oberfläche.“
„Brillant, Herr Bürgermeister. Dann lassen wir erst einmal die Kamera runter.“
Als Polizeiobermeister Peter Dittrich, Urgestein der Rehauer Polizei und
sozusagen Wunderlichs langjähriger Assistent, eiligst das nötige Equipment aus dem Streifenwagen geholt hatte, baute sich in der Luft eine
Spannung auf, die allen den Puls auf weit über hundert schob. Zentimeter um Zentimeter ließen sie die kleine Kamera in den Schacht gleiten, mit äußerster Vorsicht, um nur ja kein Geräusch zu verursachen. Gebannt starrten alle gleichzeitig auf den Laptop, der das
Videobild übertrug. Für quälend lange anderthalb Minuten zeigte es erst einmal nur Stein.
Dann erschien das Entsetzliche.
„Da haben wir die erste Leiche, fürchte ich.“ Wunderlich konnte kurz angebunden sein. Aber der Anblick sprach für sich. Auf dem kalten Felsboden war klar der leblose Mensch in einer Blutlache
zu erkennen.
Es war ein Bild des absoluten Grauens. Der Körper schien bereits von oben auf brutalste Weise zerschlitzt. Acht Messer-stiche
zählten die fassungslosen Beamten, während sie sich mühsam auf dem flackernden Videobild orientierten. Jeder einzelne dieser Stiche
war nicht etwa nur ein Schnitt. Der Täter hatte mit seiner Waffe regelrecht im Gewebe des Opfers gesuhlt wie ein
Wildschwein im Schlamm. Hautfetzen hingen herab, Fleischstücke lagen losgelöst vom Körper in jeder der kleinen Blutlachen auf der Leiche, so als wären es Fonduestücke.
„Ich … ich fasse es nicht. Dagegen war der Typ unter dem Viehhändler-Denkmal damals ja regelrecht harmlos. Aber trotzdem: Diese eine Person
kann nicht diesen Blutstrom da unten am Mühlgraben verursachen.“ Der schockierte Dittrich sprach aus, was alle mit größter Unruhe dachten: „Wo sind die anderen Opfer?“
Selbst die Kamera schien vor Angst wie gelähmt. Zögerlich schwenkte sie durch den Raum, in dem sich der Brauwasser-Brunnen befand.
Doch sie erfasste nirgendwo weitere Menschen. Auch durch das Mikrofon drang
kein Laut an die Oberfläche. Hier hatte nicht das massenhafte Schlachten stattgefunden, das sie mit größter Angst befürchtet hatten. Wenigstens nicht in diesem Raum. Wenigstens das nicht.
„Mir ist überhaupt nicht klar, was hier vorgeht“, stellte Wunderlich schließlich entschieden fest. „Wir gehen jetzt da rein!“
Man brauchte nicht immer ein Spezialeinsatzkommando, um so richtig auf den Putz
zu hauen. Mit einem Ruck rissen sie die hölzerne Tür zur Kellertreppe auf. „Polizei, Hände hoch! Stehen bleiben, Polizei!“, dröhnte es durch das gespenstische, stockfinstere Gemäuer, als sie in Vierergruppen hinab-stürmten, zwei mit gezogener Waffe, zwei mit Taschenlampen. In weniger als zwanzig
Sekunden hatten sie den langen Fässergang am unteren Ende der Treppe gesichert und waren gebückt durch den niedrigen Querstollen nach links in den zweiten großen Gang vorgedrungen. Bis hierhin war ihnen kein Angreifer entgegengekommen. Nun
wurde es allerdings noch wesentlich gefährlicher, denn sie mussten sich verteilen. Die eine Gruppe stürmte den Nebenraum mit dem Brunnen, aus dem sie ebenfalls nichts als ihre eigene
Kamera anstarrte; die anderen liefen weiter geradeaus, sicherten linker Hand
die zweite Treppe, deren Ausgang oben ohnehin zugemauert war, und bogen schließlich rechts um die Kurve, um bis zum Ende des Stollens zu gelangen, an dem ein
Schild „6 Meter“ die scheinbar geringe, aber niemals überwundene Distanz zu den Eisenbahngeleisen von Rehau nach Selb anzeigte.
„Gesichert!“, brüllte es schließlich aus allen Ecken und Winkeln des unheimlichen Höhlensystems, und dann erst entdeckten und verstanden sie, was in diesem
ehemaligen Bierkeller vorgefallen war.
Der Besitzer des Feilenhauer-Kellers hatte ihnen nach der Erstürmung Licht gemacht. Das Gewölbe war ja mit Beleuchtung verkabelt, nachdem es immer wieder Führungen dort unten gab. Damit war die Lage klar. Und von einem Angreifer weit
und breit nichts zu sehen.
„Es gibt also nur diese eine Leiche, was schlimm genug ist“, konstatierte Hauptkommissar Wunderlich. „Und das restliche Blut kommt aus den Fässern da.“
Der Fässergang diente, wie der Name schon sagte, früher dazu, um hier den edlen Gerstensaft kühl zu lagern. Entlang der Lagerfläche verlief dabei ein Graben, in dem das Wasser abfloss, mit dem die Fässer gereinigt wurden.
„Und wo fließt das nun hin?“, fragte Wunderlich den Bürgermeister.
„Das ist ja der Gag“, begann Angermann zu referieren. „Wir haben hier unten zwei Fässergänge. Beim einen, dem neben der Eingangstreppe, befindet sich am Ende eine
Spalte, in der das Wasser einfach versickert. Niemand weiß genau, wo. Das haben die Bergleute, die den Keller vor über hundert Jahren in den Fels getrieben haben, dankend angenommen. Beim zweiten
Gang, der, in dem wir hier stehen, ist das anders. Da läuft das Wasser durch diese Höhle hier ab.“
Der Rathauschef wies auf einen etwa einen Meter hohen und 50 Zentimeter breiten
Spalt, in den hinein der Weg nur kurz geradeaus führte und dann sogleich hinter einer Rechtskurve verschwand.
„Der Chef vom Autohaus ist da mal in seinen Jugendtagen durchgekrochen und unten
am Mühlgraben wieder raus-gekommen. Damals hatte er seine Werkstatt noch hier in der
Ascher Straße und nicht am Hofer Berg. Das Wasser fließt hier rein, unter der Ascher Straße durch und dann in der Senke zwischen Mühlgraben und Perlenbach wieder an die Oberfläche.“
„Das Blut, meinst du.“
„Ähm, ja, in diesem Fall natürlich das Blut“, korrigierte sich Angermann beschämt.
Die Einsatzhundertschaft der Polizei hatte inzwischen alle Fässer, die in dem Gang standen, geöffnet. Sie waren noch immer halb voll mit Blut. Es rann durch die geöffneten Zapfhähne ohne Unterlass in den Wassergraben und von dort durch die Höhle zum Perlenbach. Endlich drehten sie die Hähne zu.
„Bei diesen Mengen kann das nur Schweineblut sein, oder?“, erkundigte sich ein zutiefst verunsicherter Angermann mit bebender Stimme.
„Lass es uns hoffen. Ich werde Professor Birnbaum anrufen und ihm einen Kurier
mit Proben aus den Fässern schicken. Er soll sich gleich morgen früh auf den Weg hierher machen und die Leiche begutachten. Er wird uns dann
hoffentlich in kürzester Zeit sagen können, wessen Blut wir da vor uns haben.“
Es war kurz nach neunzehn Uhr. Draußen war es dunkel geworden. Wenn die Spurensicherung ihre Arbeit getan haben würde, wäre es bestimmt Mitternacht.
„Wir werden die Leiche zunächst ins Kühlhaus des städtischen Friedhofs bringen, dann kann Birnbaum morgen seine Arbeit gleich in
einem Aufwasch erledigen.“
„Aufwasch kannst du hier jetzt wirklich nicht sagen“, ermahnte ihn Angermann, und selbst Wunderlich, der fanatische Wortspieler, sah
ein, dass das angesichts dieses brutalen Verbrechens zu viel des, wenn auch
unfreiwilligen, Wortspiels war. Er räusperte sich entschuldigend.
„Lass uns auf die Version mit dem Schweineblut hoffen. Aber das beantwortet nur
eine von sehr, sehr vielen Fragen.“
„Wer wor des, wie kumma die Fässla do nunder, wieso hodd der a sedda Sauerei mit so vill Blut g’macht, wenn er bluaß aan massagriert hodd, wieso dudd er erschd a Versteck suung und lässt’s nocherd so huechgeh’ …“ Dittrichs Fragezeichen hörten gar nicht auf zu sprudeln.
„Und vor allem“, stoppte ihn sein Chef, „wer ist die Tote?“
Davon hatten sie keine Ahnung. Ebenso wenig wie von dem zweiten Opfer, das sie
erst in Tagen auffinden würden.
Kapitel 6
Wolfgang Katschenbacher und Giuseppe Mezzomaiore begegneten sich zufällig an diesem Sonntagvormittag, wobei der Anlass einen solchen Zufall
nahelegte. Sie befanden sich beide am Rande des Pulkes von Schaulustigen, der
sich rund um die Polizeiabsperrung am Felsenkeller breitgemacht hatte. Das
Blutbad im Perlenbach und der Einsatz einer Polizei-hundertschaft hatten sich
seit gestern Abend natürlich in der Stadt wie ein Lauffeuer herumgesprochen.
Katschenbacher, Ur-Rehauer Ende vierzig, hohe Stirn und Schnauzbart, war Geschäftsführer der Rehauer Stadtbräu GmbH und normalerweise vollkommen tiefenentspannt. Aber wenn er Mezzomaiore
traf, war alles anders.
„Eine Frau, wie?!“, knurrte er mit seiner tiefen Stimme dem Italiener entgegen. Mezzomaiore, fünf Jahre jünger, schlank, sportlich und trotzdem ein Kerl wie ein Schrank, blickte ihn
unter seinem militärisch kurz geschnittenen schwarzen Haar unverwandt an.
„Wen meinen Sie, Signor Katschenbacher? Wissen Sie etwa mehr über den Leichenfund als ich?“
Katschenbacher war schon jetzt kurz vor der Weißglut. Er arbeitete auch als Unternehmensberater, hauptberuflich eigentlich. Er
war es also gewohnt, auf Probleme sachlich und kreativ zu reagieren. Aber
Mezzomaiore war kein Klient. Die beiden waren Feinde.
„Jetzt tun Sie nicht so, Mezzomaiore. Sie wissen ganz genau, wer da unten liegt.“ Trotz seiner herausfordernden Wortwahl flüsterte der Brauereichef beinahe. Die gesperrte Ascher Straße rund um den Bierkeller war ja voll von Augen und Ohren, die nichts von dem
mitbekommen sollten, was die beiden Kontrahenten sich zu sagen hatten.
Der Italiener war einer der wenigen Menschen auf der Welt, der noch größere Ruhe ausstrahlen konnte als Katschenbacher. Er war von jeder noch so
brenzligen Situation unbeeindruckt und schien jederzeit einen Überblick behalten zu können wie ein Rot-Kreuz-Sanitäter. So auch hier.
„Sie klingen mir fast so, als wollten Sie mir etwas in die Schuhe schieben,
Signore. Worum geht es hier?“
„Darum, dass Petra ermordet wurde.“
„Petra? Die Petra?“ Der Italiener riss überrascht die Augen auf, starrte erst Katschenbacher an und dann über ihn hinweg in Richtung katholischer Kindergarten. „Das ist … mir fehlen die Worte! Warum?“
„Warum ich auf Petra komme? Weil sie gestern früh nicht dort erschienen ist, wo sie hätte sein sollen. Und dann macht plötzlich der Fund einer Frauenleiche die Runde in Rehau. Da kann man doch eins und
eins zusammenzählen.“
„Das meine ich nicht.“ Mezzomaiores Stimme blieb ruhig, aber seine Miene verfinsterte sich. „Ich meine, warum Sie sie umgebracht haben?“
„Ich habe niemanden umgebracht. Sie sind das ja wohl gewesen.“ Auch Katschenbachers Stimme wurde nun ruhiger, zugleich jedoch drohender. „Ich habe keinerlei Motiv, diese Frau umzubringen. Sie hingegen schon.“
„Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt, Signor Katschenbacher. Bei Ihnen ist ja wohl
weitaus weniger Gras über die Sache gewachsen.“
„Ich gehe zur Polizei, Mezzomaiore. Was für eine Dreistigkeit das ist, dass Sie sich überhaupt noch in der Stadt aufhalten.“
„Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Wie Sie richtig bemerkt haben, halte ich mich
noch immer hier auf, obwohl ich Ausländer bin. Ich bin also einigermaßen auffällig. Das spricht wohl gegen mich als Täter. Für Sie als Täter hingegen spricht der schwere Verlust, den Petra Ihnen zugefügt hat. Im doppelten Sinn. Die Polizei wird Sie nicht lange frei herumlaufen
lassen, sobald ihr das klar wird. Je früher Sie sie also aufsuchen, desto früher sitzen Sie im Kittchen.“
„Damit kommen Sie niemals durch!“
„Ich schon. Sie nicht. Ich bin unschuldig. Madonna! Die arme Petra! Ich selbst
werde zur Polizei gehen, wenn sie es wirklich ist. Es war keine einfache Zeit,
aber es war alles gut, bevor Sie kamen, Katschenbacher.“
„Ich werde dich …“ Katschenbacher war mit einem Mal aufbrausend, wütend, außer sich.
„Umbringen? So wie Sie Petra ermordet haben?“ Auch Mezzomaiore wurde nun laut.
Die ersten Schaulustigen drehten sich um, und beide schwiegen umgehend und
verhielten sich wieder unauffällig.
Derweil ging Wunderlich ein paar Meter weiter an der Treppe zum Felsenkeller
seiner Ermittlungsarbeit nach. Dass er Zeuge einer düsteren Männerfeindschaft wurde, die ihn selbst das Leben kosten sollte, war weder ihm
noch irgendjemandem sonst bewusst.
Mezzomaiore wandte sich von Katschenbacher ab, als sein Handy klingelte, und
ging die Ascher Straße hinab, während er den Anruf annahm.
„Ciao, Giuseppe! Ich melde mich, um Ihnen zu danken.“
„Signor Buongustaio. Sehr erfreut, dass Sie es von mir persönlich auch erfahren können.“
„Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite“, erwiderte die heisere Stimme. „Mein Sohn hat mir nicht zu viel versprochen, dass Sie solche Dinge erledigen können. Ich hoffe, es geht ihm gut in Siena? Paolo und ich, wir kommen ja gar
nicht mehr weg hier vom alten Goethe. Ein kleiner Spaziergang vielleicht hier
und da, diese wunderbare alte Allee entlang. Mehr nicht. Es ist viel Arbeit, so
ein Traditionsunternehmen an der Weltspitze zu halten. Madre di Dio, viel Arbeit.“
Mezzomaiore war inzwischen unten in der Schützenstraße angekommen, die wegen der Sensation oben am Feilenhauer-Keller wie
ausgestorben war. Er konnte das Telefonat mit dem Ausland völlig unbefangen und laut und deutlich führen. „Ihr Sohn fühlt sich sehr wohl in der Toskana, seien Sie unbesorgt, Signor Buongustaio. Die
Kunst ist eine sehr schöne, altehrwürdige Wissenschaft. Ich freue mich, dass ich ihm begegnet bin und ihn auf diesem
Weg ein Stück begleiten kann.“
„Ich freue mich meinerseits, dass er einen so verlässlichen Freund gefunden hat, und einen so talentierten obendrein. Sie haben
unserer Firma große Dienste erwiesen, indem Sie Katschenbacher das Geheimnis für immer entrissen haben.“
„Er hat in der Tat keinen Zugriff mehr darauf, er wird sie nie wiedersehen, seine
Wunderwaffe. Und soweit ich das beurteilen kann, wird er obendrein auch noch
ins Gefängnis wandern.“
„Ins Gefängnis? Sie sind ja ein Pfundskerl. Ihm wird man diese, nun sagen wir,
Angelegenheit zur Last legen? Wie haben Sie das denn fertiggebracht?“
„Es ist besser, wenn Sie das erst aus der Zeitung erfahren, Signore.
Katschenbacher hat wirklich einen großen Fehler gemacht.“
„Bene. Ich habe das gleich gespürt an Ihnen: Wir Italiener verstehen uns. Wir wissen, was zu tun ist. Aber
denken Sie dran: Keine Spuren zu unserer Firma. Die Familie ist sehr daran
interessiert, dass das, was sich unglücklicherweise ereignet hat, nie passiert ist. Sie verstehen? Und man ist bei uns
hier bekanntlich nicht zimperlich, wenn etwas schiefgeht.“
„Es ist in diesem Land in der Tat nicht immer einfach, die Ehre der großen Familie hochzuhalten, Signor Buongustaio. Als ich noch ein Kind war, da war
das Umfeld, in dem Sie gerade tätig sind, noch sehr geheimnisvoll. Ich meine, noch vor wenigen Jahrzehnten haben
wir es gar nicht gekannt. Niemand von uns war jemals dort. Eigentlich hat es
gar nicht existiert.“
„Jetzt übertreiben Sie, Giuseppe. Dieses Umfeld war doch immer da. Sie hatten als Kind
nur noch keine Berührung damit. Es war nur wie eine fremde Familie für Sie. Und heute ist es la famiglia – für uns alle.“
„Ein wenig geheimnisvoll bleibt es trotzdem bis heute.“
„Da mögen Sie recht haben. Aber wir sind nun ein Teil davon, ein ganz normaler Teil,
untrennbar. Deshalb: Keine Spuren. Wir telefonieren wieder. Alles Gute,
Giuseppe. Und grüßen Sie meinen Sohn von mir!“
Mezzomaiore würde Buongustaios Sohn zunächst nur telefonisch grüßen können. Er musste und wollte noch einige Tage in Rehau bleiben, denn die Sache war
noch nicht abgeschlossen.
Kapitel 7
„Jetzt lassen Sie mich doch mal durch, junger Mann!“, schnauzte Professor Dr. Hans-Otto Birnbaum den etwa zwanzigjährigen Beamten an, der ihm den Weg zum Feilenhauer-Keller versperrte. „Wissen Sie denn nicht, wer ich bin?“ Der junge Polizist sah den leitenden Gerichtsmediziner der Universität Erlangen unverwandt an, was ein unzweifelhaftes „Nein“ bedeutete. Wunderlich hatte schließlich ein Einsehen und winkte seinen Forensiker mit dem Spitzbart und der
Nickelbrille durch.
„Hier in Rehau – kennt dich keine Sau! Hier in Rehau – kennt dich keine Sau!“, klingelte Sibylles Handy nach der Melodie von „Einer geht noch rein“. Wunderlich warf ihr einen empörten Blick zu.
„Kann ich doch nichts dafür, dass ich gerade jetzt angerufen werde. Es gibt nun mal zu viele Menschen, die
meinen, sie seien wichtig, nur weil sie aus der Großstadt kommen. Da habe ich mir das eben zugelegt“, entgegnete die kleine blonde Polizeipsychologin verschmitzt und spitzte listig
und vergnügt die Lippen.
Birnbaum war viel zu sehr mit der Majestätsbeleidigung durch die Polizeiabsperrung beschäftigt, als dass er das Klingeln überhaupt mitbekommen hätte. Hoch erhobenen Hauptes und mit dem siegessicheren Blick des Allwissenden
schritt der spitzbärtige, bebrillte und gegelte Pathologie-Papst auf Wunderlich zu, der direkt vor
dem ins Halbdunkel führenden Treppenabgang herumstand.
„Aaalso, lieber Herr Hauptkommissar, da hast du mir ja wieder mutwillig einiges
abverlangt. Mitten in der Nacht ein halbes Dutzend Blutproben zu analysieren – Blut vom Fass sozusagen. Aber was tut die Wissenschaft nicht alles für die mit endlichem Wissen gesegnete Kriminalpolizei. Wenn du mich nicht hättest …“
„Ist ja gut, Eure Majestät“, unterbrach ihn Wunderlich mit gespielter Unterwürfigkeit und echtem Flehen, während Birnbaum selbstverliebt in den sonntäglichen Rehauer Himmel blickte. „Was ist nun mit dem Blut?“
„Gehe dieser Spur nicht weiter nach. Sie sieht aus, als ob sie aus dem Weltraum käme. Dieses Blut ist nicht von dieser Welt.“
„Hä???“
„Späßla. Schweineblut, wie du vermutet hast. In sämtlichen Fässern. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass auch nur eines davon im Geringsten
mit menschlicher DNA in Berührung gekommen ist.“
Alle Anwesenden atmeten erleichtert auf.
„Aber die Leiche, die ich gerade in eurem provisorischen Kühlhaus begutachten durfte, die sieht ja wirklich übel aus. Ich habe, wie Sie alle wissen, unendlich viele Jahre Erfahrung in
meiner Disziplin und damit doppelt so lange wie jeder andere Kollege. Doch ich
habe noch nie einen so konsequent durchgeführten Mord gesehen. Sechzehn Messerstiche, mindestens acht davon wären jeder für sich tödlich gewesen. Sie wurden offenbar mit ungeheurer Gewalt ausgeführt. Einige der Stichkanäle deuten ganz klar auf einen großen, kräftigen Täter hin, sie gehen mit Wucht von oben nach unten. Jedes Organ, das man treffen
kann, wurde auch getroffen. Ein Wunder, dass der Körper überhaupt noch in einem Stück ist. Und dann hat er der Toten sämtliche Adern aufgeschnitten, um sie auszubluten. Das hat sich dann, vermute
ich, mit dem Schweineblut vermischt und in euren Bach ergossen.“ Birnbaum blickte, mit einem völlig ungewohnten Anflug von Erschütterung im Gesicht, hinüber zur Bourgoin-Jallieu-Brücke, unter der der Perlenbachgrund verlief. „Haben Sie die Tote auch gesehen, Frau Augsburger?“
Sibylle nickte stumm und ernst.
„Und, was sagen Sie aus Sicht Ihres Fachs dazu?“
„Übertötung ist der Begriff dafür.“
Birnbaum nickte zustimmend und – natürlich – all-wissend.
„Der Täter tut mehr, als er muss“, fuhr sie fort. „Die Tötung wird sozusagen mehrfach ausgeführt. Sie vermischt sich mit rasender Wut, mit unkontrollierbaren Rachegefühlen oder Ähnlichem. Nur …“
„Nur: Rasende Wut passt nicht zu Fässern mit Schweineblut“, ergänzte Wunderlich, der gleichzeitig denselben Gedanken hatte.
Sibylle zuckte bestätigend mit den Schultern. „Diese Frau hier ist mit einem eiskalten Plan umgebracht worden.“
„Mit einem kaltblütigen, im wahrsten Sinn.“ Wunderlich, der größte Kalauer-Erfinder, den Rehau je gesehen hatte, konnte es sich nicht
verkneifen. Seine beste Freundin senkte ironisch den Daumen.
„Die Herren dürfen mich nun gerne ausreden lassen, oder sind Frauen bei der Polizei nur zum
Kaffeekochen da? Also: Einerseits wird dieser Mord mit großer Brutalität und wilder Gewalt ausgeführt. Andererseits ist der Täter planvoll vorgegangen.“
„Aber warum dann das Schweineblut, ich meine …“
„Hallo, Herr Wunderlich! Was an den Ohren? Ich war dran!“
Die zierliche, wortkarge, manchmal zu Unrecht schüchtern wirkende Psychologin konnte sehr streitlustig werden, wenn es ums Prinzip
ging.
„Wiederum andererseits“, fuhr sie fort, „stellt sich doch die Frage: Wenn jemand geplant einen Mord begeht, warum stellt
er es dann so an, dass die Tat auf jeden Fall schnell entdeckt wird?“
„An Ihrer, nun ja, nachdrücklichen Mimik meine ich erkennen zu dürfen, dass Sie uns die Antwort hierauf auch präsentieren“, unterbrach Birnbaum süffisant höflich. Aber Sibylle entgegnete nichts, sondern warf ihm einen herausfordernden
Blick zu.
„La famiglia!“,ließ er sich nicht lange bitten. Sie lächelte ihn sarkastisch breit an.
„Das war nicht schwer.“
„Ein Mafiamord?!“ Wunderlich schnappte nach Luft.
„Sieht leider eindeutig so aus.“ Sie deutete hinab in den fahl beleuchteten Schlund. „Was du da in dem Keller siehst, ist ein Fanal. Eine Botschaft an alle, die es
angeht: Seht her, diese Frau hat einen Fehler gemacht. Sie hat gegen
irgendeinen Codex verstoßen, und dafür muss sie büßen. Das droht jedem von euch, der denselben Fehler begeht.“
„Ein Fanal mit Schweineblut?“
„Ja, sicher. Die Botschaft benutzt häufig genau dasjenige als Mittel, was der Delinquent verbrochen haben soll. Das
ist typisch für die Mafia.“
„Das heißt, die Tote hat etwas mit Blut zu tun gehabt?“
„Oder allgemein mit etwas Flüssigem, ja. Die kriminalpsychologische Fachliteratur hat sich damit schon
mehrfach befasst.“
„Na prost Mahlzeit! Dann können wir jetzt also überlegen, was die Leiche angestellt hat, bevor wir auf die Spur ihres Mörders kommen, der vermutlich sowieso schon über alle Berge in Italien ist.“ Wunderlich wirkte leicht resigniert.
„Nicht notwendigerweise. Das organisierte Verbrechen ist sich seiner Sache meist
sehr sicher. Die bleiben auch gerne, wo sie sind.“
„Dann sollten wir nun wirklich als Erstes herausfinden, wer die Frau überhaupt ist. Es ist jetzt schon achtzehn Stunden her, dass wir sie gefunden
haben. Wir brauchen Ergebnisse! Verfluchter Dreck!“
Birnbaum blickte Sibylle leicht verdattert an. „Was ist denn mit dem los? Seit wann flucht er so?“
„Er ist seit Dienstag auf Entzug.“
„Oh. Entzug von der Sache?“
Sie nickte nachdenklich.
„Das ist ja furchtbar.“ Der Pathologe hatte seine Arroganz schlagartig verloren und gab sich mit einem
Mal sehr mitfühlend.
Wunderlich, der Mann mit den Entzugserscheinungen, hatte sich abgewandt. Er rief
den Bürgermeister an, um ihn auf dem Laufenden zu halten. Angermann, so hoffte er, würde wie so oft bestimmt eine zündende Idee haben.
Die hatte der Rathauschef tatsächlich, aber anders, als der Hauptkommissar sich das vorgestellt hatte.
Denn beim Stichwort „Mafia“ wurde es am anderen Ende für eine ganze Weile totenstill. Dann sagte Angermann etwas äußerst Erstaunliches.
„Wir müssen reden. Ich habe dir einiges zu erzählen. Treffen wir uns zum Mittagessen im Sicilia? In einer Stunde?“
Ergebnisse hatte Wunderlich verlangt. Das sollte sehr schnell Erfolg haben. Er
ließ Birnbaum stehen, noch ehe der sich mit den Worten „Na dann bis zu meiner nächsten großartigen Unterstützung“ von ihm und Sibylle verabschieden konnte.
Kapitel 8
Lisa Leimitzer war das blühende Leben. Die quirlige Dreißigjährige mit dem zu ihrem Temperament passenden feuerroten Lockenkopf war immer gut
drauf und pflegte fröhlich zu plaudern, was das Zeug hielt. Sie hatte eine richtig glückliche Kindheit und Jugend verleben können, in einem dieser wunderbar dörflichen Flecken im südlichen Landkreis Hof. Kauten die Großstadtkinder auf dem Schicksal zu knapper Krippenplätze und zubetonierter Straßen herum, so war man hier umgeben von Kühen, Feldern, Traktoren und grünen Hügeln, soweit das Auge reichte. Es war wirklich kein Wunder, dass sich daraus so
große Optimisten-Seelen wie Lisa ent-wickelten. Ihre tiefenentspannten, leutseligen
Auftritte als Musik-Duo mit ihrer Schwester Lea waren legendär. Lisa, das hieß impulsiv, nahbar, fränkisch. Man musste sie einfach gernhaben.
Gelähmt, stumm, zu Tode betrübt. Das war Lisa Leimitzer heute. Heute an diesem Sonntagmittag, als man ihr die
Todesnachricht überbrachte. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass man sie in einem solchen
Zustand vorfand. Aber die Ursache dafür war ja auch abgrundtief entsetzlich.
Sie hatten ihn gefunden, grausam zugerichtet. In jener dunklen, vom Moos überzogenen Hölle, in der es vermutlich geschehen war. Erstochen, sowohl hinterrücks als auch von vorne, mit sechzehn Stichen, von denen mehr als einer tödlich war.
„Hatte Ihr Mann Feinde?“, hatte der Kripo-Beamte sie gefragt. Lisa hatte die Frage nur wie durch einen
langen Tunnel wahrgenommen, aber die Antwort war so einfach, dass sie sie auch
so geben konnte.
„Natürlich hatte er Feinde. Das, was er anzubieten hatte, hätte die gesamte Familie aufgemischt. Das würde ein noch nie da gewesenes Ungleichgewicht zur Folge haben. Egal, wem er es
angeboten hätte, es hätte bei denen, die das Nachsehen haben, einen Erdrutsch ausgelöst. Er musste seine Entscheidung aber früher oder später mitteilen, und ich vermute stark, dass er das vor Kurzem wohl getan hat.“
Was daran so besonders sei, wenn man als Lieferant neue Kunden betreue, hatte
die Polizei sie verwundert gefragt. Lisa lachte kurz ihr gewohnt herzhaftes
Lachen, bevor sie in die Trauer zurückfiel. „Der sogenannte Lieferant war für seinen Kunden absolut unersetzlich“, hatte sie angehoben und den Ermittlern dann erklärt, um welches Produkt es hier genau ging. Das hatte umgehend hochgezogene
Augenbrauen bei ihren Gegenübern zur Folge gehabt.
Als sie ihnen dann noch erläutert hatte, welch düstere Gestalten hinter den Kunden standen, die sich um das Produkt bewarben,
kamen leicht entgleiste Gesichtszüge hinzu.
„Südeuropa? Dann gibt es hier einiges zu entflechten“, hatte die Polizei im Gehen zu ihr gesagt und ihr gedankt.
Nun war sie alleine und starrte mit leerem Blick aus dem Fenster auf die grünen Hügel.
Mezzomaiores Handy klingelte schon wieder. Das Telefonat mit seinem Auftraggeber
war gerade eine Stunde her, als Buongustaio nun ein weiteres Mal im Display
erschien.
„Entschuldigen Sie bitte, Giuseppe, dass ich Sie noch einmal belästige“, schnarrte die hohe Stimme wieder wie über ein Reibeisen. „Aber ich habe eine ganz wichtige Sache vollkommen vergessen. Ach, ich glaube,
ich werde alt. Alt, seehr alt …“
„Kein Problem, Signore, dafür bin ich ja da.“
„Um es kurz zu machen: Es gibt doch hoffentlich keine Zeugen für das, was Sie so elegant für uns zu erledigen die Freundlichkeit hatten?“
Angesichts der Gründlichkeit, mit der der athletische junge Italiener seinen Auftrag abgearbeitet
hatte, war die Frage eigentlich eine Beleidigung. Aber Mezzomaiore hatte
dennoch Verständnis dafür. Er wusste genau, dass ein solcher Fehler Buongustaios Kopf hätte kosten können.
„Haben Sie keine Sorge“, antwortete er mit der festen, beruhigenden Stimme eines Mediziners am
Unfallort. „Das Ergebnis meines Auftrages wird zwar zweifellos auffallen.“
„So ist es ja auch gedacht gewesen …“
„Eben. Aber es gibt niemanden, der diese Auffälligkeit mit uns in Verbindung bringen kann. Darum habe ich mich gekümmert. Sie kommen nie darauf, wo ich den stummen Zeugen meiner Aktivität gelagert habe – bombensicher, wirklich.“
Mezzomaiore nannte Buongustaio den Ort ganz in der Nähe, und der Mann im Ausland begann herzhaft zu lachen.
„Molto bene, Giuseppe. Dann habe ich nur noch eine Bitte, eine winzige Bitte: Sorgen Sie
dafür, dass dies im Fall des Falles auch so bleibt.“
Mezzomaiore hatte verstanden. Er legte zufrieden lächelnd den Kopf in den Nacken und blickte souverän in die Herbstsonne und den blauen Himmel.
Nein, es würde auch in Zukunft keine Zeugen für die Aktion geben.
Aber das war noch nicht alles auf seiner Agenda. Er hatte erst eine Schlacht
gegen Katschenbacher gewonnen und noch nicht den Krieg.
Kapitel 9
„Die Mafia! Hier in unserer schönen Stadt Rehau!“ Angermann klang zutiefst bedrückt. „Wenn wir das dem Frankenblatt berichten, erklären sie uns für komplett übergeschnappt.“