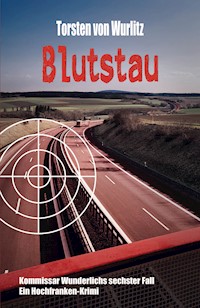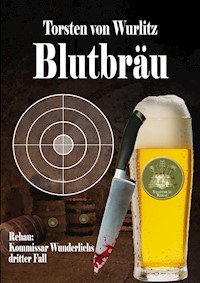Torsten von Wurlitz
Blutstau
Prolog
Es war praktisch ein Staatsakt. Die Autobahnmeisterei in Rehau zeigte sich am
Dienstag nach den Pfingstferien 2021 üppig beflaggt. Die Regierungspräsidentin von Oberfranken war anwesend, die beiden Landräte von Hof und Wunsiedel und alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte entlang der A93, die es getroffen hatte. Der Trauerflor an den Fahnen
Deutschlands und Bayerns schien beinahe überbordend und konnte doch nicht das Unbegreifliche ausdrücken, das binnen weniger als einer Woche geschehen war.
„All die Beamten, die nun ihr Leben verloren haben, sind Helden“, begann der Polizeipräsident aus Bayreuth seine Trauerrede. „Nicht nur wegen ihres unglaublichen Mutes vor dreißig Jahren. Sondern auch wegen ihres Dienstes an der Gesellschaft seitdem. Die
Autobahn ist sicherer geworden durch sie.“
„Ich kann nur bestätigen, was der Herr Polizeipräsident über meinen besten Freund und seine Kollegen gesagt hat“, fuhr ein sichtlich betroffener Rehauer Bürgermeister danach fort. „Und wie tragisch ist es daher“, ergänzte Edmund Angermann mit brechender Stimme, „dass ausgerechnet die Autobahn ihrer aller Tod war.“
„Wir wollen jedoch auch des anderen Lebens gedenken, das ausgelöscht wurde und wodurch diese Tragödie begann“, gab der evangelische Pfarrer Löw zu bedenken. „Die Dreiundneunzig war ihr Schicksal.“
Angermann nickte ergriffen. Die Dreiundneunzig, sie schwebte dunkel und wuchtig über allem. Eine Zahl, die nun weit Größeres bedeutete als nur eine Straße im Hofer Land.
1
Nichts deutete auf eine blutrote Sonne hin.
Das Zentralgestirn tauchte den Fronleichnamstag 2021 in ein goldenes Licht und wärmte die Luft Oberfrankens, wie es sich für die wundervolle Zeit Anfang Juni in Bayern ganz oben gehörte. Die Sommersonnenwende stand bevor, die längsten Tage, das Leben voller Genuss. Kriminalhauptkommissar Wunderlich hielt
die Nase in den milden Frühsommerwind, den linken Ellenbogen lässig aufs geöffnete Autofenster gelegt und den Geschmack von Kochkees und Presssack noch auf
der Zunge, während sie über die A93 durch diesen lieblichen Landstrich rollten. Er war auf Ferientour.
Das heißt, der Leiter der Kriminalpolizei in Rehau befand sich durchaus in einem
Streifenwagen. Aber mehr zum Zeitvertreib. Es war weit und breit kein Mordfall
aufzuklären. Nachdem er Ende 2020 die größenwahnsinnigen Sieben vom Kornberggipfel dingfest gemacht hatte, war es endlich
einmal eine Zeitlang etwas ruhiger geworden. Über den Winter hatte er die Notizen zu seinen fünf aufgeklärten großen Morden seit 2013 digitalisiert, hier und da in einem Cold Case gestöbert, in der Asservatenkammer ein wenig Ordnung geschaffen und dazwischen das
Tagesgeschäft der Kleinkriminalität erledigt. So wie heute.
Achim Dittrich saß unaufgeregt wie immer neben ihm auf dem Beifahrersitz. Der Streifenbeamte
Anfang fünfzig war einer von Wunderlichs guten Kumpels, was auch daran lag, dass es sich
um Peter Dittrichs Bruder handelte. Der wiederum fungierte seit vielen Jahren
als Wunderlichs engster Assistent in Rehau. Die beiden Dittrichs waren zwei
Urgesteine der Polizei im Hofer Land. Pflichtbewusst, hilfsbereit und mit breitem Kreuz ausgestattet, körperlich wie mental. Zuverlässig immer zur Stelle, wenn es draußen auf der Straße Streit zu schlichten gab. So auch jetzt. Wunderlich und Achim hatten soeben im
Landgasthof in Grünhaid eine herzhafte fränkische Brotzeit zu Mittag genossen, nachdem sie in Schönwald am Brunnen gegenüber dem Rathaus zwei Quartalssäufer aufgelesen hatten, die mit gut drei Promille vom Mittwochabend übriggeblieben und von der Polizei daher ins Selber Klinikum verfrachtet worden
waren. Die beiden Beamten hatten gerade fertig gegessen, als sie der nächste Funkspruch ereilte.
„In Regnitzlosau gibt’s Ärger“, hatte Claudia durchgegeben. „Da verprügelt wohl ein alter weißer Mann gerade seine Angetraute.“
„Ist gut, wir fahren rüber“, hatte Wunderlich der Obermeisterin in der Hofer Einsatzzentrale geantwortet,
das Blaulicht angeknipst und den Fahrersitz eingenommen, was Achim mit einem
anerkennenden Schmunzeln quittierte.
„Heute ist Feiertag, da bekommst du das geschenkt“, meinte der Kommissar nur, als sie in die Anschlussstelle Schönwald einbogen. Er fuhr normalerweise nicht selbst, wenn er mit einer Streife
unterwegs war. Wunderlich war passionierter Rennradler, und wenn er mit seinen
einundfünfzig Jahren zu einem Einsatz in Regnitzlosau musste und es nicht allzu eilig
schien, dann rollte er über die Hügel am Waldschlösschen und an der Raitschin vorbei üblicherweise auf einem kleinen Ritzel und nicht mit einem Fünfganggetriebe. Insofern war das Auto ein bisschen ein Fremdkörper für ihn und er zog das Beifahrer-Dasein vor.
„Womit habe ich denn das nun verdient?“, brummte Achim gutmütig vor sich hin.
„Münchberg“, war Wunderlichs knappe Antwort.
Sie erzählte in einem Wort ein ganzes Leben. Er fuhr seinen Freund Achim auch deswegen,
weil es ihm eine Ehre war. Neben ihm saß einer, der die Bürgermedaille der Stadt Rehau trug und die Ehrenbürger-Würde der Städte Leipzig und Hof innehatte.
Und das Bundesverdienstkreuz.
„Münchberg – die Katastrophe ist da.“ So hatte nämlich der vollständige Satz gelautet. In der Titelschlagzeile des Frankenblattes vom 20. Oktober vor einunddreißig Jahren.
Der 19. Oktober 1990 war ein milder, sonniger Herbsttag gewesen, wie so oft in
dieser Region. Auf das ganze östliche Oberfranken strahlte morgens um 8:30 Uhr ein wunderbar blauer Himmel
herab. Nur nicht auf die Münchberger Senke.
Tief tauchte damals die Autobahn A9 ab, um das Tal der Pulschnitz zu queren. So
tief, dass sie eine leichte Beute war für die Nebelbank. Die Autofahrer hatten bei ihrem viel zu hohen Tempo keine
Chance. Sie donnerten aus der Sonne in das wabernde Grau wie in eine massive
Bergwand. Es krachte unaufhörlich. Mehr als hundert Fahrzeuge wurden in den Massencrash gezogen. Über hundertzwanzig Verletzte forderte die irrsinnige Karambolage. Allerdings hätten wohl alle überlebt. Wenn nicht der Vierzigtonner gekommen wäre.
Wie ein Geschoss raste der riesige Milchlaster, ungebremst und mit einem völlig übermüdeten Fahrer, in das vernebelte Blechwirrwarr und drückte es zusammen wie in einer Schrottpresse. Zehn Menschen fanden in der
entsetzlichen Katastrophe den Tod, während es an der Unfallstelle auch noch zu brennen begann. Es war das bis dahin
schwerste Verkehrsunglück in der Geschichte der Bundesrepublik. „Auf der Autobahn sieht es aus wie im Krieg.“ Das schrieb nicht die Boulevardpresse. Es waren die Worte eines erfahrenen und
abgeklärten Feuerwehrkommandanten.
Der Fahrer des Milchlasters wurde festgenommen und später zu drei Jahren Haft verurteilt. Ein Detail der Tragödie, welches in der Öffentlichkeit hingegen lange nicht bekannt wurde, war die Sache mit dem
vollbesetzten Bus.
Achim Dittrich aus Regnitzlosau hatte Dienst an diesem Oktobertag, gegen Ende
seines ersten Jahres beim Polizeipräsidium Oberfranken. Während er in einem Streifenwagen saß, fuhren weitere Kollegen routinemäßig Motorradstreife. Alle Fahrzeuge befanden sich in etwa auf gleicher Höhe auf der A9 zwischen Rudolphstein und Münchberg-Nord, als die Nachricht von dem Crash über den Polizeifunk kam. Die Beamten hatten keine fünf Sekunden gebraucht, um die Situation zu erfassen. Es musste derart schnell
gehen, dass sie entschieden, auf ihr eigenes Risiko keinerlei Rücksicht zu nehmen. Sie verteilten sich sofort über die gesamte Breite der Autobahn und bremsten, während hinter ihnen bei schönstem Sonnenschein der Verkehr heranraste, hupend, verständnislos und unkonzentriert. Die jungen Polizisten setzten ihr Leben aufs Spiel.
Aber das Fahrzeug, das sie an vorderster Stelle zum Stehen brachten, war ein
Reisebus aus Sachsen, der mit dreiundneunzig Menschen an Bord auf dem Weg nach
Italien war – mit hundertzwanzig Sachen. Er war in Leipzig gestartet und hatte in Hof weitere
Passagiere aufgenommen. Als die nach der Notbremsung schließlich aussteigen wollten, stellte sich heraus, dass die Türhydraulik eine Fehlfunktion hatte. Also brachen Achim Dittrich und seine
Kollegen die Türen von außen auf und brachten auf diese Weise alle Insassen in Sicherheit. Die
Kriminaltechniker der Polizei ermittelten später, dass das Reise-Schlachtschiff ohne das Eingreifen der jungen Beamten mit
hoher Wahrscheinlichkeit in das brennende Blechknäuel gedonnert und augenblicklich in Flammen aufgegangen wäre.
Dittrich und seine Kollegen hatten dreiundneunzig Menschen das Leben gerettet.
Sechs Monate später wurden sie nach Berlin ins Schloss Bellevue eingeladen, um die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik entgegenzunehmen. Was Achim nicht daran
hinderte, seinen Job dreißig Jahre lang unbefangen und bodenständig weiterzumachen. Er wurde zu einem der bekanntesten und beliebtesten
Polizisten Oberfrankens. Und damit – was er nicht hören wollte, aber hinnehmen musste – zum Volkshelden. Er war mehr als ein guter Beamter. Er war ein guter Mensch.
„Münchberg“, hatte Wunderlich nur gesagt, und jeder in seinem Umfeld wusste, was das
bedeutete: Es war ihm ein Privileg, mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen, hier und heute im Jahr 2021. Und mit diesem Hochgefühl kutschierte er seinen Freund Achim Dittrich über die Autobahn.
Das Bauwerk Nr. 35a stand friedlich da, hoch über dem Regnitzgrund. Die Aussicht von der Brücke nach Süden war gigantisch. Die Autobahn kam von Rehau her in einer endlos lang
gezogenen Rechtskurve den Neukühschwitzer Hügel herab, und man konnte gut anderthalb Kilometer weit das graue Band der Straße verfolgen, wie es Fahrzeug um Fahrzeug aus dem Wald auszuspucken und auf die
Reise zu senden schien. Zweck der kleinen Brücke war es, die beiden Dörfer Vierschau und Klötzlamühle zu verbinden. Eigentlich.
„Und?“, fragte er Achim, während sie den Perlenbach bei Eulenhammer überquerten und an der Ausfahrt Rehau-Süd vorbeischossen. Heute hieß das so viel wie „Wie habt ihr die Pfingstferien verbracht? Hat den Kindern der übliche Ausflug in den Hofer Zoo gefallen? War deine Schwiegermutter wieder
eingeladen und hast du sie ertragen, wo es doch bestimmt wieder Hirschbraten
mit Klößen als Belohnung gegeben hat?“
Achim wusste, dass es das heißen sollte. Die oberfränkische Kommunikation war ebenso unveränderlich wie kontext-sensitiv. Die Frage „Und?“ stand für alles Mögliche und meinte immer genau das, was gerade wichtig war.
Wenn man die Arme auf das rote Brückengeländer von Bauwerk 35a stützte, konnte man ebenfalls alles Mögliche erkennen. Nicht nur die große Regnitzbrücke, unter der hindurch man von Regnitzlosau nach Draisendorf fuhr. Eintausendfünfhundert Autobahnmeter waren vor allem eine lange Sichtachse. Der Abstand
zwischen den Leitpfosten betrug fünfzig Meter. Die weißen Mittelstreifen waren unglaubliche sechs Meter lang und damit so, dass ein
Einfamilienhaus der Breite nach darauf gepasst hätte. Die Lücken zwischen den Streifen maßen zwölf Meter. Man konnte auf einer Straße eine Menge Entfernungen abschätzen.
„No scho“, antwortete Achim auf Wunderlichs „Und?“. Was wiederum bedeutete: „Ja, genau so waren meine Pfingsten, und ich habe das Familienleben und das
leckere Essen wie immer genossen.“
Man verstand sich. Aber da beide an diesem leuchtend gelben Sonnentag regelrecht
zum Plaudern aufgelegt waren, setzten sie dann doch noch ein Übermaß an Worten hinzu.
„Die Gruaßa kimmt im Herbst nei die Schull, gell?“
„Ner ho“, bestätigte Achim. „Schule. Schon verrückt. Sie ist doch erst gestern in den Kindergarten gekommen.“
„Das Leben rast halt dahin.“ Wunderlich deutete mit dem Kopf die lange Gerade entlang, auf der die Autobahn östlich an Rehau vorbei eine kleine Senke durchzog. „Aber ich finde, du erziehst sie großartig. Die gerät mal nicht an so einen Prügelknaben wie den, den wir gleich verhaften werden.“
Das Brückengeländer von Bauwerk 35a besaß auf der Oberseite eine gut fünf Zentimeter breite und einen Zentimeter tiefe Einkerbung, genau an der Stelle,
wo sich die senkrechte Halterung zweier aneinanderstoßender Schutzgitter befand. Praktisch. Unheimlich praktisch.
Sie passierten Hof-Süd und bogen in die Rechtskurve, die die A93 über das weite Tal der Regnitz führte.
„Ich find’s super, dass du manchmal zu so einem Kleinkram mitfährst“, lobte Achim seinen Chef. „Ich meine, als Hauptkommissar könntest du genauso gut spazieren gehen heute.“
„Nicht mein Ding, die hohe Nase. Wie auch, mit einem Meter dreiundsiebzig?“ Wunderlich grinste. „Und außerdem, mit guten Kumpels macht das einfach Spaß.“
Die drei Autobahnbrücken bei Vierschau kamen in Sicht, sie würden sie gleich unterqueren und dann abfahren nach Regnitzlosau. Achim schwieg.
Wunderlich spürte Dankbarkeit dafür, in seinem Beruf ein paar gute Freunde gewonnen zu haben, so wie Achim. Wie
oft waren der Kommissar und seine Frau bei den Dittrichs zum Grillen gesessen.
Und dann die Aktion, als Achim ihn nach einem Defekt am Rennrad vom Schneeberg
abgeholt hatte – in einem zivilen Dienstfahrzeug.
Achim schwieg noch immer, und Wunderlichs wärmende Gedanken hatten nur Zehntelsekunden gedauert. Dann realisierte er, dass
er ein kurzes, dumpfes Pfeifen gehört hatte.
In der Frontscheibe klaffte rechts von ihm auf einmal ein Loch. Das Sonnenlicht
hatte sich verfärbt. Es strahlte nicht mehr leuchtend gelb. Blutrot sickerte es in Wunderlichs
Auge, unerbittlich, gefärbt vom getränkten Scheibenglas.
Er riss entsetzt seinen Kopf herum und starrte Achim an. Den toten Achim
Dittrich, blutüberströmt und mit kaputter Stirn. Die Beifahrerseite glich einem Schlachthof. Die
Blutspritzer waren über den ganzen Sitz verteilt, über das Armaturenbrett, die Seitenscheibe, einfach alles in vierzig Zentimetern
Umkreis von Achims durchlöchertem Schädel.
Der Kommissar stieg voll in die Eisen, bei hundertfünfzig auf der Autobahn. Er bremste so panisch, dass der Streifenwagen anfing,
sich mit quietschenden Reifen querzustellen. Wunderlich hatte verdammtes Glück, dass er selbst überlebte: Der Feiertagsverkehr auf der A93 war gering, und die paar Autos hinter
ihm hatten wegen seines Blaulichts sowieso schon Abstand gehalten. Am äußersten Rand der Fahrbahn kam er zum Stehen, vielleicht einen halben Meter bevor
sein Fahrzeug die Leitplanke durchbrochen und sich beim Sturz hinab auf die Äcker zigmal überschlagen hätte.
Seine berufliche Gewöhnung an das Grauen war das Einzige, das ihn davor bewahrte, in hemmungslose
Schreie auszubrechen, Achims Leiche zu schütteln in der Hoffnung, er könne ihn dadurch wieder ins Leben zurückholen. Seinen langjährigen Freund Achim, den er soeben binnen eines Wimpernschlags verloren hatte,
ohne jede Vorwarnung.
Dreißig Sekunden lang konnte er sich überhaupt nicht rühren. Dann hielten die ersten Autos an, die, deren Fahrer lange genug Zeit
hatten, um zu begreifen, dass mit dem Streifenwagen vor ihnen etwas ernsthaft
nicht stimmte. Erst jetzt kam er wieder zu sich.
„Gehen Sie sofort zurück in Ihre Fahrzeuge und bleiben Sie unten!“, herrschte er alle an, die Erste Hilfe leisten wollten, in einem Ton, der
keinen Zweifel daran zuließ, dass sie sich gemeinsam in einer Situation auf Leben und Tod befanden. Dann
robbte er an sein Funkgerät heran, den Blick nicht von der Umgebung wendend, rundherum auf jeden Baum,
jeden Strauch und jeden anderen Hinterhalt starrend, aus dem ein Schütze erneut hätte feuern können.
Zehn Minuten später war unter dem Getöse von Martinshörnern und dem Knattern von Hubschraubern die Verstärkung aus Hof da. Und der Bürgermeister von Rehau ebenfalls. Edmund Angermann konnte als Kommunalpolitiker
einiges ab. Der schlanke Endvierziger, der schon mit Mitte dreißig ins höchste Amt von Wunderlichs Heimatstadt gewählt worden war, galt als belastbar, agil und redegewandt. Und er war ein
Jugendfreund Wunderlichs, seitdem sie beide in Wurlitz aufgewachsen waren.
Weshalb der eine den anderen nun hierher an den Ort des Grauens gebeten hatte.
Der Bürgermeister blickte vorsichtig durchs Seitenfenster in den havarierten
Streifenwagen, in der Erwartung, den Toten dort so vorzufinden, wie er es aus
Fernsehkrimis kannte – ein kleines Einschussloch in der Stirn, ein leerer Blick, fertig. Stattdessen
schaute Angermann direkt in die Hölle. Achims Kopf war fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Körper lag in einer Blutlache so groß wie der Untreusee. Angermann riss sich selbst zurück an die frische Luft, ging in die Knie und musste sich fünf Minuten lang übergeben. Der Monsterstau, der sich hinter ihnen nun aufbaute, und das viele
Blut vor ihren Augen im Auto vermischten sich in Wunderlichs Hirn zu einem
ekelerregenden Knäuel.
„Die Straße ist ein graues Band, weiße Streifen, grüner Rand“, zitierte er geistesabwesend und leichenblass einen Spruch, den er mal irgendwo
aufgeschnappt hatte. Dann fing er sich, packte Edmund Angermann plötzlich am Kragen und schüttelte den aschfahlen Rehauer Rathauschef, dass der nicht wusste, wie ihm
geschah.
„Ist dir klar, was hier passiert?“
„Ein feiger und brutaler Mord“, konnte Angermann nur entgegnen, geschwächt, geschockt und wütend.
„Ja, das ist das eine. Aber es ist womöglich noch nicht alles. Niemand wusste, dass wir kommen würden. Verstehst du?“ Wunderlichs Empörung über das Geschehene wandelte sich in größte Besorgnis. „Hier geht es nicht um Achim. Es hätte jeden treffen können. Ein Amokläufer ist unterwegs. Und deshalb ist es mit dem einen Mord vielleicht nicht zu
Ende. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Etwas Furchtbares. Wir müssen sofort handeln!“
Sein Instinkt trog ihn nicht.
2
Sieben Jahre und neun Monate Jahre zuvor.
„An seddan Schmarrn.“ – „A dritta Fohrspuur, dena homm sa wull ins Hiern g’schissn.“ – „Nuch mehra Strooß, dermied sich nuch mehra Leid derrenna.“ – „Ho, der Goddsagger werd nuch vuller wern.“
Das war grob zusammengefasst die Ausgangslage an Feedback, welches auf Schorsch
und Gerch in Regnitzlosau einströmte.
„Sie sagen, sie haben noch vereinzelt Bedenken zur Vertrauenswürdigkeit der Planung und zur Verkehrssicherheit“, übersetzte Gerch Mackert so zurückhaltend wie möglich. Er hoffte, dass sein Gegenüber zumindest das Wort „Friedhof“ nicht verstanden hatte.
„Es san Hinterwäldler, deine Oberfranken“, raunte Schorsch Anderl angefressen zurück. Er hatte uneingeschränkten Jubel erwartet. Doch taten die Menschen auf dem Regnitzlosauer Festplatz
das, was die Einwohner Hochfrankens immer taten, wenn sie jemand mit überschwänglicher Begeisterung überrumpeln wollte: Anstatt sich sinnlos mitreißen zu lassen, murmelten sie erst einmal skeptisch vor sich hin. Gleichwohl laut
und vernehmlich, denn es waren nicht wenige hergekommen an diesem 24. August
2013, einem spätsommerlichen Samstag, nachmittags um dreizehn Uhr. Die scheinbar kleine Fläche oben am Hang im ruhigen Regnitzlosauer Norden, zwischen einer Wohnsiedlung
und dem Feuerwehrhaus, hatte es in sich. Sie bot jeden zweiten Sommer einem
gestandenen Wiesenfest Platz, mit Hunderten von Besuchern und Livemusik in
einem Festzelt. Was bei solchen Anlässen als Stärke des lebendigen kulturellen Lebens im Hofer Land zutage trat, das gesellige
Beisammensein Vieler auf einem kleinen Dorfplatz, es entpuppte sich für Anderl und Mackert gerade als Problem, denn sie konnten sich vor der Kritik
nicht verstecken. Hinzu kam, dass sie und ihre Zuhörer außer dem Festplatz nur noch eine Marslandschaft umgab.
Unten im Ortskern war die Regnitz ausgetrocknet. Entlang des einst lieblich mäandernden Baches säumten bis hinaus zur Klötzlamühle die Schädel verendeter Rinder das Ufer und die verödeten Felder ringsherum. Eine giftige, dampfende, rötliche Schlacke waberte im Flussbett. Verdurstete Hunde und Katzen lagen tot auf
den Straßen rund um die alte Filiale der Stadtbank. Die Bank selbst war schon lange keine
mehr, und auch von der billigen Fastfood-Bude und von dem drittklassigen Handyladen, die stattdessen eingezogen waren, existierten nur noch die verdreckten
und maroden Firmenschilder, deren erbärmliche Restbeleuchtung flackerte wie Kerzenlicht im Wind. Einzig ein
Waffengeschäft gab es noch in dem öden Komplex. Wüstensand bedeckte den gesamten Ort. Plünderer schafften aus der Sankt-Aegidien-Kirche alles heraus, was sie an Barock
aus den Wänden brechen konnten. Schwer bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei sicherten
mit Panzerwagen und Wasserwerfern das gelbe Rathaus, um es als einzige Grüne Zone vor den kriminellen Banden zu beschützen, die auf der Suche nach Nahrung sengend und mordend durch Regnitzlosau
zogen. Während die wenigen Bewohner, die die Apokalypse überlebt hatten, unter der Staatsstraßen-Brücke kauerten und über dem offenen Feuer selbstgefangene Ratten rösteten, solange es noch ging. Denn die Flammen hielten sie nur noch mit den hölzernen Geländern und Bodenplanken des Regnitzauen-Spazierwegs am Leben, die sie Stück für Stück von den Betonsockeln brachen. Beim Versuch, von dem alten Fabrikgelände hinter ihnen das unter dem Silo gelagerte Holz zu stehlen, waren bereits
mehrere von ihnen umgekommen. Nun krochen die Mutigsten im Schutze der Dämmerung auf das Freigelände des verlassenen Autohauses am anderen Brückenende und saugten aus den verrottenden Fahrzeugen die letzten Tropfen Benzin
ab, um für die eisige Nacht alles, was nur irgendwie brennen konnte, zu Wärme zu machen.
So nämlich sah es aus auf dem computeranimierten Drohnenflug durch den Zweitausendfünfhundert-Einwohner-Ort, als Mackert und Anderl ihre Großbildleinwand angeschmissen hatten.
„Das ist die Zukunft eurer Gemeinde, wenn wir die A93 nicht ausbauen. Rückschritt! Exodus! Untergang! Wenn ihr nicht wachst, wird es keine Arbeitsplätze mehr geben, keine Geschäfte, keinerlei Infrastruktur. Mit anderen Worten: Ihr seid alle tot. Oiso, pack
mer’s!“ Anderl, schlank, groß gewachsen und mit entsprechend herablassendem Blick durch die teure Brille
unter seinem silbergrauen Mittelscheitel, wirkte genau so, wie man sich einen Münchner Baulöwen vorstellte. Sein Äußeres hatte Stil, goldene Uhr, hellgrauer Maßanzug. Aber jedes Wort aus seinem Mund geriet zum altklugen, selbstverliebten
oberbayerischen Mia-san-mia-Statement. Anderl war also genau die Sorte Mensch,
die sie rund um Hof ganz besonders gut leiden konnten. Der Rehauer Großindustrielle Georg Mackert, genannt Gerch, bildete da nur deshalb eine Ausnahme,
weil er einer von hier war. Ansonsten stand er Anderl nämlich in nichts nach. Gerch thronte stolz wie immer in seinem fränkischen Trachtenjanker auf der Bühne, die sie extra für die Kundgebung aufgebaut hatten. Neben ihm ebenjener Mann, den er als neuesten
Fang an Land gezogen hatte. Schorsch Anderl sollte die Autobahn aufmotzen. Und
Gerch, der untersetzte schnauzbärtige Gerch, der bauernschlaue Pionier der grünen Energie in Nordbayern, der seine Millionen mit dem Bau von Windparks gemacht
hatte, tat das, was er immer tat: Er verkaufte das Ganze als seine Idee und
sonnte sich im Glanz von Leuten, die noch wichtiger waren als er selbst. Was in
seinem Weltbild natürlich nur äußerst selten vorkam.
„Etzerd sedd hald amol ruich“, tönte er jovial über die Wiese des Regnitzlosauer Festplatzes, nachdem die vom vorhergesagten
Untergang des Hofer Landes schockierten Besucher nur verwirrt vor sich hin
grummeln konnten. „Hört euch unsere bahnbrechende Vision erst einmal bis zum Ende an.“ Er packte Anderl kumpelhaft an dessen linker Schulter und schwenkte den
Zeigefinger seiner anderen Hand weit durch die Luft, hinweg über das Feuerwehrhaus und den Regnitzgrund, hinweg sogar über die grünen Hügel Richtung Schwesendorf, wie einer, der unendlich in die Welt und in die
Zukunft zu blicken vermochte.
Es ging um eine große Straße. Und es ging schief.
„Also, liabe Leit“, begann Anderl nämlich mit seiner sonoren Stimme, „wir sind uns doch alle einig, dass dieser Landstrich, dem weiterer Bevölkerungsschwund droht …“
„Was heißt hier droht?“, brüllte Rick unten auf der Wiese und die Regnitzlosauer brachen in schallendes Gelächter aus.
„… dass also diese provinzielle Gegend dringend weiteren wirtschaftlichen Schub
braucht!“ Mit diesen Worten drückte er einen Knopf, und hinter ihnen fing eine Girlande aus bunten Glühbirnen an zu leuchten, eins dieser Dinger, die man auch bei Losbuden und
Zuckerwatte-Ständen auf Volksfesten verwendete. Abwechselnd blau und weiß blinkten sie – es waren die Farben von Autobahnschildern. Und sie bildeten ein Wort, nur ein
einziges:
„WACHSTUM!“
Die beiden Georgs hatten extra den kleinen Festplatz für die erste Kundgebung auf ihrer Werbetour gewählt und nicht den Doppel-Parkplatz links und rechts der Regnitzbrücke im Ortskern, den ihnen Bürgermeister Vogel angeboten hatte, verbunden mit einer Straßensperrung. Anderl und Mackert wollten sich eigentlich vor allem mit den überzeugtesten Befürwortern ihres Projekts umgeben, die sie zielgruppengerecht eingeladen hatten,
und nicht mit vielen Menschen, unter denen womöglich auch unbelehrbare Gegner waren. Schließlich war die Show vor allem für die Presse gedacht, um Publicity zu erzeugen. Aber all das ging angesichts von
Anderls bemerkenswert tollpatschiger Wortwahl ein bisschen arg nach hinten los.
Schon bei dem Wort „provinziell“ packten die ersten ihre Trillerpfeifen aus. Und als das Wort „Wachstum“ zu blinken begann, folgte brüllendes Gelächter, was Anderl mit völliger Verständnislosigkeit quittierte.
„Gerch, kunnst du mir verrotn, wos mir do solln, wenn diese … diese Waldmenschen so unkooperativ sind?“ Anderl bewegte sich kurz vor dem Niederbayrischen, wenn er stinkig war. „Die miassadn uns doch auf Knien danken, dass wir sie retten. Dass wir dafür sorgen, dass sie größer und glücklicher werden. Mehr Verkehr, mehr Wohlstand.“
„Bassd scho.“ Gerch klopfte ihm tröstend und abwiegelnd auf die Schulter und schmunzelte unter seinem schwarzen
Schnurrbart vor sich hin. „Was du hier siehst, ist nur eine vorsichtige, zurückhaltende Äußerung von leichten Bedenken. Der Oberfranke ist ein stoischer Mensch, weißt du. Wenn der Einheimische wirklich unkooperativ wird, das möchtest du nicht erleben, deswegen bleib bittschön freundlich.“
„Also, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“, gab sich Anderl daraufhin deutlich mehr Mühe, „wir würden Sie gerne umfassend informieren und auch für alle Sorgen, Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Wir planen hier ein Projekt für und nicht gegen die Region.“
Die Menge wurde ruhiger. „Ner ho, nocherd horn’g mer hald erschd amol hie.“ – „Es kennerd ja derweecher aa wos Gscheids derbei saa.“ – „Iech glaab’s fei nedd, ober ner guud.“ Nur noch Gegrummel wie dieses war zu vernehmen, was im Hofer Land die
Definition äußersten Wohlwollens erfüllte.
Die Ostbayern-Autobahn A93 war im Jahr 2001 fertig gestellt worden. Viele Jahre
hatte der Abschnitt nördlich von Weiden zuvor im Dornröschenschlaf einer einbahnigen Fernstraße gelegen. Bis nach Falkenberg war sie immerhin breit genug gewesen, damit Tempo
hundertzwanzig erlaubt war und man hin und wieder einigermaßen überholen konnte. Aber von da aus nach Norden, mitten durch Wiesau und durch
Mitterteich, vorbei an Marktredwitz und Selb, hatte man sich auf der schmalen
Bundesstraße 15 quälen müssen. Schon zu jener Zeit war längst klar, dass der Wirtschaftsraum Hochfranken, die Landkreise Hof und
Wunsiedel, bedeutend attraktiver und leistungsfähiger war als die Verkehrswege, die man ihm zugestand. 1990 brachte schließlich den Durchbruch – die Wende an der deutsch-deutschen Grenze hatte es möglich gemacht. Zuerst war Ende jenes Jahres die vierspurige Umgehung von Wiesau
und 1993 dann die von Mitterteich fertig gestellt worden. In den acht Jahren
danach arbeitete sich der Neubau nach Norden bis Hof und der Ausbau nach Süden bis Weiden voran. Von dort Richtung Regensburg war die Autobahn schon seit
1987 fertig gewesen und hatte dazu geführt, dass sich Gewerbeansiedlungen wie an einer Schnur aufgereiht und Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in die nördliche Oberpfalz gebracht hatten. Die Eröffnung des Dreiecks Hochfranken im Dezember 2000 und die Freigabe des letzten Stückchens an zweiter Fahrbahn zwischen Selb und Thiersheim im August 2001 erfüllten das gleiche Versprechen für das östliche Oberfranken. Sie waren daher nicht nur Schlusspunkt, sondern auch
Festakt für alle Pendler, Unternehmer und Touristen im Hofer Land gewesen.
So weit war der Nutzen der A93 weitgehend unbestritten. Nur begann sie genau
deshalb, allmählich das Schicksal vieler Fernstraßen zu teilen: Sie schien zu klein zu werden. Ausbaupläne wurden geschmiedet und heiß diskutiert. Diverse Bau-Konsortien bewarben sich beim Freistaat Bayern um die
Realisierung des Projekts. Das alles wurde medial intensiv begleitet. Die
Menschen im Hofer Land wussten also, was in etwa auf sie zukam, und als Gerch
Mackert, nach eigenen ständig wiederholten Angaben zweitgrößter Steuerzahler der Stadt Rehau, in das Millionenspiel mit dem Asphalt
einstieg, war die öffentliche Aufmerksamkeit ebenso groß wie die Meinungen geteilt. So weit, so üblich.
„Also, dann klären Sie uns jetzt mal auf“, rief Sabrina von unten aus der Menge. „Sie glauben, dass das Hofer Land ohne noch mehr Verkehr vor dem Untergang steht,
und wollen deshalb die A93 auf sechs Fahrspuren verbreitern – richtig?“
„Nein“, gab Anderl zurück und blickte in lauter überraschte Gesichter. Er genoss den Anblick etliche Sekunden lang. „Der zweite Teil stimmt nicht. Aber das lasse ich am besten meinen Projektleiter
erklären“, fuhr er dann fort. Er bat ein kleines Männlein auf die Bühne, das alleine schon durch seinen gedrungenen Körperbau den Eindruck eines autoritären Oberlehrers machte. Das nur noch vom seitlichen Haaransatz bedeckte Haupt,
die allzu strenge Brille und der weiße Spitzbart, vor allem aber der unnachgiebig stechende Blick machten den Zuhörern klar, dass hier kein netter Kumpel zu ihnen sprechen würde. Dabei war er beinahe von hier.
„Ich verstehe Ihre Frage so“, begann das Männlein sächselnd, „dass es in Regnitzlosau Menschen gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Anderl Bau dazu mobilisieren, auf der A93
einen dritten Fahrstreifen zu asphaltieren, ja?“
Die Menge war mucksmäuschenstill, in einer Mischung aus Verblüffung und Neugier. Das Männlein fuhr fort.
„Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiter
von Anderl Bau hauptsächlich mit nachhaltigen Verkehrskonzepten beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt, voll eingesetzt wird.“
Die Leute hatten die Sätze noch gar nicht erfasst, als der alles entscheidende folgte.
„Niemand hat die Absicht, die bestehende A93 um eine Fahrspur zu erweitern.“
Die Mitglieder der Bürgerinitiative K.O.R.E.A., der Klugen Oberfranken gegen die Rücksichtslose Erweiterung der Autobahn, wussten nicht, ob sie wachten oder träumten, ob sie in Freudentaumel ausbrechen sollten oder ob gleich der Wecker
klingeln würde. Allen voran Joe, der Sprecher des Bündnisses, und Rick und Sabrina als Vorstandsmitglieder.
„Der ganze Straßenausbau ist also abgeblasen?“, fragte Joe mit unüberhörbarer Erleichterung.
„Das wäre ja tragisch“, ergänzte Rick mit maximaler Ironie. „Wo man doch in München sieht, wie all die Autobahnkreuze den Verkehr verflüssigt, die Lebensqualität erhöht und eine vorbildliche Boomtown erschaffen haben!“
„Naa, do hobt’s jetzad unseren Herrn Ulrich falsch verstanden“, dozierte Schorsch Anderl humorlos. Mit bedeutungsschwerem Schwung enthüllten er und Gerch die riesigen, mit weißblauem Tuch abgedeckten Holztafeln hinter sich. Zum Vorschein kamen zwei vergrößerte Straßenkarten.
„93“ stand über der fetten roten Doppel-Linie, die sich von Nord nach Süd schwang, von Regnitzlosau bis Marktredwitz. Nur einen winzigen Haken gab es:
Die Linie befand sich nicht dort, wo im Moment die Autobahn verlief.
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis die Ersten unten auf der Festwiese
reagierten und fragend mit dem Finger auf die Karte zeigten.
„Schauts amol“, begann Gerch die unausgesprochene Frage zu beantworten. „Als zweitgrößter Steuerzahler der Stadt Rehau ist es mir eine Verpflichtung und Ehre, zum
Wohl unserer Region nicht unerhebliche Mittel in die Hand …“
„Ja, schon gut!“, rief Sabrina von unten aus der Menge, und Rick, direkt neben ihr, ergänzte: „Wir wissen schon, dass du der Messias bist.“
„Sehr schön. Es freut mich, dass das endlich einmal verstanden wurde“, antwortete Gerch ernst und feierlich und blickte zufrieden über die Leute.
„Wie ich schon sagte“, sprach das sächselnde Männlein, „nachhaltige Verkehrskonzepte. Neubau statt Ausbau. Vorwärts immer, rückwärts nimmer! Die A93 in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf!“
„Ja, also einerseits hat unsere Anderl Bau sich über die optimale Trassenführung der sechsspurigen A93 verantwortungsvolle Gedanken gemacht“, hob der Münchner Schorsch selbstbewusst und zugleich vorsichtig an. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einen Teil der heutigen Trasse
auflassen und weiter östlich bauen werden, wo mehr Platz ist.“
Sabrina, Rick und Joe studierten den Verlauf der dicken roten Linie. Anderl zog
sie mit einem Laserpointer nach, Gerch hob begeistert den Daumen dazu. Je mehr
die beiden oben auf der Bühne strahlten, desto blasser wurden die anderen drei unten, umringt von einer
schockiert schweigenden Menge.
„Nur über meine Leiche, du Fettbemme!“, plärrte Sabrina Gerch an, als sie die neue Trasse begriffen hatte.
„Über meine auch“, knurrte Rick.
„Über meine auch“, nickte Joe mit breiter Brust, die seinem breiten Kreuz und seiner robusten
Erscheinung in nichts nachstand.
„Aber … aber das ist doch eure Chance!“, rief Anderl verwirrt. „Wir retten euch das Leben! Wir machen aus diesem todgeweihten Landstrich eine blühende Landschaft!“
Joe war mit seinen vierundvierzig Jahren mit allen Wassern gewaschen, und
praktisch nichts konnte ihn je aus der Ruhe bringen. Aber jetzt, als er Mackert
und Anderl mit stechendem Blick fixierte, wurde er doch laut.
„Eine betonierte Landschaft macht ihr daraus! Aber das werdet ihr niemals schaffen. Eher lasse
ich mich von euch über den Haufen fahren!“
Anderl und Mackert hatten alle drei Wortmeldungen sehr gut hören können. Sie tauschten in Ruhe einen Blick, aus dem standfeste Einigkeit sprach.
Dann zuckten sie mit den Achseln.
„Von mir aus“, sagte der eine zum anderen.
3
Sie wussten ja nicht, was sich vor ihnen zugetragen hatte. Die, die es noch bei
Hof-Süd geschafft hatten rauszufahren, überfüllten schon die B15, um mitten durch die Stadt Hof ihren Ausweg zu suchen. Die
Ernst-Reuter-Straße glich einem riesigen Parkplatz. Die anderen, die Autofahrer im ganz großen Stau auf der A93 vor Regnitzlosau, ließen derweil genervt und ratlos ihre Hupen sprechen, eine Weile zumindest, dann
gaben sie auf und warteten, sich in ihr Schicksal fügend.
Edmund Angermann schwieg, in das Hupen wie in die Ruhe hinein. Der Bürgermeister der Stadt Rehau hätte ohnehin weder Kraft noch Motivation gehabt zu sprechen, und das war heute,
am 3. Juni 2021, wohl das erste Mal in seiner bislang vierzehnjährigen Amtszeit so. Angermann hatte mehrfach den Bayerischen Staatspreis für kommunalpolitische Rhetorik gewonnen, und wenn man über ihn in der Stadt als ‚den Eddi‘ sprach, dann schwang das Staunen über seine Satz-Ungetüme darin mit. Aber zu tief war diesmal der Abgrund, in den er auf der
blaulicht-durchfluteten A93 bei Regnitzlosau blickte. Ruhig legte er Wunderlich
den Arm um die Schulter, und so starrten sie minutenlang auf den
blutverschmierten Autositz, auf dem der Streifenbeamte Achim Dittrich kurz
zuvor von einer Sekunde auf die andere sein Leben ausgehaucht hatte.
Ulrike hasste es, wenn er ein Spezialeinsatzkommando auflaufen ließ, und Wunderlich hörte durchaus oft auf den Rat seiner Frau. Bei ihr und mit ihr konnte er aus
seinem Berufsalltag vieles abladen und aufarbeiten; diese Stütze ließ ihn die ständige Konfrontation mit dem Verbrechen überhaupt erst durchstehen. Bürgermeister Angermann pflegte sie als wichtigste ehrenamtliche Mitarbeiterin der
Kripo zu bezeichnen. Und er meinte das voller Respekt, denn Ulrike war durch
ihren tatsächlichen Beruf längst, auch unabhängig von ihrem Mann, ein unverzichtbarer Teil von Rehau geworden. Aber heute
hatte Wunderlich keine Zweifel, dass sie seiner Entscheidung für den SEK-Einsatz zustimmen würde, wenn sie am Abend davon erführe. Denn die gepanzerte Limousine gab ihm und Angermann jetzt Deckung in die
Richtung, aus der der Schuss gekommen war, und die Scharfschützen der Polizei taten das ebenfalls. Zwei Hubschrauber und Dutzende Beamte
durchkämmten das Gelände rund um die Autobahn. Der Attentäter hätte verrückt sein müssen, wäre er vor Ort geblieben. Und wenn eines feststand, dann, dass diese eiskalte Tat
nicht das Werk eines Verrückten war.
„Dass du das tust für jemanden, der das Neue Deutschland gelesen hat“, brach Wunderlich schließlich das Schweigen.
„Und vor allem Fähnchen mit Hammer und Zirkel geschwenkt“, ergänzte Angermann. Endlich konnten beide wieder ein wenig schmunzeln.
Es war einer dieser Momente, in denen eine Männerfreundschaft über das Kumpelhafte hinausging und ins Beistehen eintrat. Und das war in diesem
Fall bemerkenswert, bedachte man, dass der Rehauer Rathauschef die konservative
Mehrheitsfraktion der Bürgerlichen Mitte anführte, während der Kriminalhauptkommissar in seiner Jugendzeit bei den Bürgern für Rehau einer der obersten Linken in der Stadt gewesen war. Er las zum Spaß Propagandazeitungen der DDR, kaufte bei Verwandtschaftsbesuchen in Ost-Berlin
von den fünfundzwanzig Mark Mindestumtausch stets ein paar alberne Devotionalien ein und
forderte Angermanns Amtsvorgänger zum Rücktritt auf. Jener dankte es ihm mit der Ansage, Wunderlichs sprichwörtliche Frechheit sei stadtbekannt. So vergingen in den Achtzigern und
Neunzigern viele Jahre der Belustigung für die Rehauer Zivilgesellschaft, und dann vergingen noch mehr Jahre, in denen
die Wunden heilten und die Rollen wechselten. Nun also standen Schwarz und Rot
einträchtig vor einem feigen Verbrechen.
„Ich muss es ihr sagen“, flüsterte Wunderlich, schon wieder kraftloser.
„Nicht du. Wir.“ Angermanns Tonfall duldete keinen Zweifel daran, dass sie beide gemeinsam zu
Achim Dittrichs Frau fahren würden. Aber noch bevor sie aufbrechen konnten, klingelte Wunderlichs Handy.
„Egerländer, was gibt’s?“
„Du missersd aaf die Briggn Nummer fimferdreißich oo kumma. Vo der Kletzlamill aaf Vierschau nauf. Des is nedd ganz
uninderessand!“
Markus Egerländer war am Telefon. Der Chef der Spurensicherung bei der Hofer Kripo hatte ein
Händchen dafür, Details aus einem Tatort zu kitzeln, auf die kein normaler Mensch je gestoßen wäre. Mit „nicht ganz uninteressant“ kommentierte er in seinem breiten Fürther Mittelfränkisch üblicherweise Dinge, die seine Kollegen als sensationelle Entdeckung empfanden.
Es hieß also übersetzt: „Das ist so krass, das musst du dir sofort ansehen.“
Wunderlich tat wie ihm geheißen und fuhr mit Angermann die paar hundert Meter zu der Autobahnbrücke, um die es ging. Das Bauwerk 35a tat sich vor ihm auf, als wäre nichts gewesen. Kaum oben angekommen nahm der Spurensicherer im weißen Overall den Hauptkommissar in Empfang.
„Hier stehen wir auf der Brücke, von der aus der Schütze deinen Beifahrer tödlich getroffen hat“, erklärte Egerländer.
„Hier?? Aber die Stelle, wo Achim … ich meine, wo es passiert ist, befindet sich doch mindestens einen Kilometer
entfernt?“ Wunderlich deutete nach unten in die Ferne, dort wo das Meer der Blaulichter am
grellsten funkelte und sein schwer beschädigter Streifenwagen quer auf dem Asphalt stand.
„Scho. Aber des is kaa Brobleem.“ Der Fürther Spurenleser war oft so lakonisch, dass es auf Fränkisch fast schon prollig wirkte. Mit seiner etwas untersetzten Statur und
seinem von langen Koteletten gesäumten, schütteren schwarzen Haar hätte man ihn ebenso gut für einen Metzgermeister halten können. Ein Beruf, in dem man ebenfalls nicht allzu behutsam um den heißen Brei herumredete. Wunderlich starrte ihn vorwurfsvoll an und Egerländer runzelte entschuldigend die Stirn.
„Ich meine“, fuhr er dann fort, „das Gewehr, mit dem Achim Dittrich erschossen wurde, war ein Präzisionsgewehr mit deutlich über tausend Metern Reichweite.“
„Woher weißt du das?“, staunte Wunderlich und erschauderte im nächsten Moment, als Egerländer lässig die Patronenhülse aus der Tasche seines weißen Overalls zog.
„Kaliber 5,56. Das ist keine Spielzeugpistole, sondern eine Scharfschützen-Waffe.“
„Um Himmels willen. Ein Soldat? Oder Terroristen?“
„Nein, das muss beides nicht zutreffen. Die bekommt bei uns in Deutschland jeder
Sportschütze mit Waffenbesitzkarte. Was es für uns nicht besser macht. Außerdem hat unser Mann eine Auflage benutzt. Siehst du die Einkerbung im Geländer?“
Wunderlich folgte Egerländers Zeigefinger in Richtung des Schildes, auf dem der Brückenname stand: „5739771 – BW35a.“ Gleich daneben die Vertiefung auf der Oberseite.