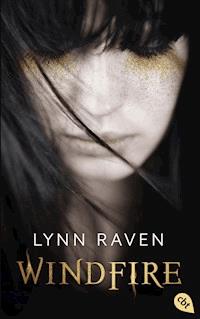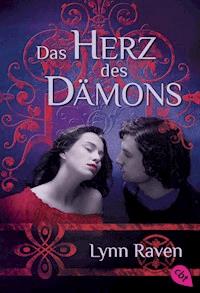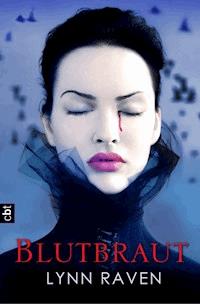
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Magie macht ihn stark, Liebe verletzlich
Seit sie denken kann, ist Lucinda Moreira auf der Flucht vor Joaquín de Alvaro, denn sie ist eine »Blutbraut«, und nur sie kann den mächtigen Magier davor bewahren, zum Nosferatu zu werden. Dazu aber müsste sie ihm ihr Blut geben und sich auf ewig an den Mann binden, der für sie die Verkörperung alles Bösen scheint.
Doch dann tritt genau das ein, wovor sie sich fürchtet: Gerade als Lucinda sich erstmals verliebt hat, und zwar in den charmanten Cris, wird sie entführt und auf das Anwesen Joaquíns gebracht. Lucinda ist in eine Falle gelaufen, denn Cris ist kein anderer als Joaquín de Alvaros Bruder, und auch er sucht eine Blutbraut …
Doch die beiden Brüder sind nicht die Einzigen. Auch andere Mitglieder ihres Konsortiums begehren Lucindas Blut. Als Lucinda in die Gewalt eines von ihnen gerät und Joaquín sie unter Einsatz seines Lebens befreit, beginnt Lucinda sich zu fragen, was die wahren Motive für sein Handeln sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
cbt ist der Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
für Dusty
1
Boston, Massachusetts, USA
Die Kondome knisterten in meiner Gesäßtasche. Eines hatte ich haben wollen. EINES! Josh hatte mir gleich mehrere in die Hand gedrückt und grinsend ein »Nur zur Sicherheit!« nachgeschoben. Mein reizender Kollege Josh, der die genialsten Cocktails der Ostküste mixte, das heißeste Lächeln des ganzen Kontinents hatte und gewöhnlich nichts anbrennen ließ. Was hatte mich geritten, ausgerechnet ihn zu fragen? Ach ja. Der Umstand, dass er so gnadenlos schwul war, dass sich vermutlich schon ganze Legionen weiblicher Wesen die Augen wegen so viel Verschwendung ausgeheult hatten – und ich deshalb angenommen hatte, er würde mir keinen dummen Spruch drücken. Hatte er genau betrachtet auch nicht, aber irgendwie hatte ich wohl erwartet, er wäre bei der Übergabe etwas … diskreter. Nun – falsch gedacht, Lucinda.
Ich starrte in den fleckigen Spiegel über den Waschbecken. Beinah erwartete ich, dass fremde, glitzernde Augen zurückstarren würden …
Warum hatte auch ausgerechnet heute der Kondomautomat vor den Toiletten leer sein müssen? – Warum war ich ausgerechnet heute zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht Nein sagen würde, sollte Cris mich heute Nacht fragen, ob ich mit ihm schlafen wollte? – Vielleicht weil Bratt mich zu Beginn meiner Schicht in sein Büro gerufen hatte, um mir nicht nur meinen Lohn für den letzten Monat zu geben, sondern auch um mir zu sagen, dass ich ihm noch mal meine Papiere vorbeibringen sollte, da mit den Daten in seinen Unterlagen etwas nicht stimmte? Vielleicht weil mir in dem Moment klar geworden war, dass meine Zeit mal wieder abgelaufen war? Wobei: Genau genommen war sie das schon eine ganze Weile. Tick-tack-tick-tacktick. Ich hatte nur den Wecker nicht gehört. – Nein, ich hatte ihn nicht hören wollen.
Jetzt hatte ich jedenfalls eindeutig ein Problem: Meine Papiere waren so falsch wie der Name, unter dem mich alle im Forty-two kannten. Wenn Bratt – oder irgendjemand anders – sie genauer unter die Lupe nahm, war ich geliefert. Wenigstens hatte er mir meinen Lohn trotzdem vollständig ausbezahlt. Zum Glück. Das Bündel Geldscheine war ein beruhigender Druck in meiner Hosentasche. Ich würde also einmal mehr einfach verschwinden. Ohne ein Wort zu sagen, schlicht nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Meine Sachen packen und weiterziehen. Wie immer. Nur dass ich dieses Mal nicht weiterziehen wollte. Noch nicht. Wegen Cris. Cris, mit seinen blonden Locken, deren Ansatz mir verraten hatte, dass sie von Natur aus deutlich dunkler waren, und den sanften, hellbraunen Augen. Cris, dessen Anblick mein Herz schneller schlagen ließ und der mich behandelte, als sei ich etwas unendlich Kostbares. Er war das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert war. Ich war selbstsüchtig genug, ihn nicht aufgeben zu wollen. Manchmal brauchte auch ich einen Traum, an dem ich mich festhalten konnte. Und wenn es nur für kurze Zeit war.
Vielleicht konnte ich ja doch noch in der Stadt bleiben und mir einfach nur einen anderen Job suchen? Boston war groß – und anonym genug. Ich könnte weiter im Boston Animal Shelter helfen, jeden Tag Jasper sehen, seine Wuschelohren kraulen, mein Gesicht in seinem Fell vergraben – zumindest bis er eine nette Familie gefunden hatte …
Ich war es Leid davonzulaufen. Nie irgendwo länger bleiben zu können als ein paar Wochen oder höchstens Monate, wenn ich Glück hatte; kein wirkliches Zuhause, keine richtigen Freunde zu haben … Aber letztlich hatte ich keine andere Wahl. Weil ich war, was ich war: eine Blutbraut. Sie werden dich jagen, solange du lebst, Lucinda. Du darfst niemals zu lang an einem Ort bleiben, sonst werden dich die Hexer der Hermandad finden. Wieder und wieder hatte Tante María es mir eingehämmert. Und dann hatte einer von ihnen sie umgebracht. Es ist nicht fair! Beinah hätte ich aufgelacht. Nichts in meinem Leben war fair. Und das alles hatte ich ihm zu verdanken. Joaquín de Alvaro. Der mein Blut zum Überleben brauchte. Egal ob ich wollte oder nicht. Monster!
»Ach, hier bist …«
Mit einem hohen Laut schreckte ich zu der Stimme herum. Meine Tasche schlug gegen meine Hüfte.
In der Tür des Waschraumes hob Pam abwehrend die Hände. »Shit, bist du heute schreckhaft, Mia.«
»Tut mir leid …« Ich zwang mich, die Hand von dem Springmesser in meiner Hosentasche zu lösen und sie möglichst unauffällig zurückzuziehen. »Ich …«
»He, vor mir musst du dich nicht rechtfertigen, Prinzessin.« Pam zuckte in geheuchelter Unschuld die Schultern. »Ich wäre vermutlich auch nervös, wenn ich dasselbe vorhätte wie du.« Herr im Himmel, wem hatte Josh noch von der Sache mit den Kondomen erzählt? Ich drehte mich wieder um, zerrte Papierhandtücher aus dem Spender, trocknete mir scheinbar gelassen die Hände ab. »Ich meine … zum ersten Mal einen Typen flachzulegen, ist schon ein Höhepunkt im Leben einer Frau …« Zack! Mein Blick zuckte hoch, begegnete ihrem im Spiegel. Nur weil ich mich nicht jedem Kerl im Forty-two an den Hals warf, bedeutete das nicht, dass ich noch nie … Auch wenn Cris der Erste war, bei dem ich mir wünschte, ich könnte mehr haben als nur eine oder vielleicht zwei Nächte in seinen Armen. Ich quetschte die Papiertücher zu einem feuchten Ball zusammen. Jetzt konnte sie sich ein Grinsen offenbar doch nicht mehr verbeißen. »Dein Freund ist ja auch Zucker. Ich an deiner Stelle hätte ihn gleich beim ersten Mal rangelassen.« Ich wandte mich erneut zu ihr um. Es war kein Geheimnis, dass Pam nach ihrer Schicht eigentlich nie allein ins Bett ging. Und dass sie einen Typen gewöhnlich auch nie zwei Mal mit nach Hause nahm. Ihr Grinsen wurde noch breiter. »Er steht übrigens an der Bar und wartet auf dich.«
Cris war da! Mit einem Schlag war alles andere vergessen. Plötzlich hatte ich Herzklopfen wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Nicht, dass es für Tante María und mich so etwas wie ein Weihnachtsfest gegeben hätte. Bäume kosteten Geld und wo hätten wir auch nur das kleinste Bisschen Schmuck unterbringen sollen, wenn wir eigentlich nur aus dem Koffer lebten? Und trotzdem: Da war eine Erinnerung – eine, die aus meinem irgendwie nicht existenten Leben vor meiner Zeit mit Tante María stammen musste: eine riesige Tanne; unzählige Lichter tanzten in ihrem Grün; Eiskristalle glitzerten neben in allen Regenbogenfarben schimmernden Kugeln; die Spitzen ihrer Zweige waren mit kaltem Schnee bestäubt. Da waren Strohsterne. Und ein Hund. Groß; dunkles, seidig langes Fell; eine weiße Halskrause wie eine Löwenmähne; eine schmale, lange Schnauze, die heimlich Wurststückchen aus meinen Händen nahm. Quichotte. Der Name war manchmal wie ein Flüstern in meinen Gedanken.
Direkt vor meinem Gesicht schnippten Finger. Ich fuhr zurück, blinzelte. »Erde an Mia!« Pam. »Hallo? Jemand zu Hause? – Oder möchtest du meine Schicht übernehmen und ich verbringe den Abend mit deinem Freund?« Anscheinend hatte sie mir diese Frage schon einmal gestellt.
»Danke, nicht nötig!« Ich erwiderte ihr Grinsen mit einem möglichst lockeren Schulterzucken, beförderte den Papierhandtuchball in den gefährlich überquellenden Mülleimer unter den Waschbecken und schob mich an ihr vorbei in den schmalen Gang, der den Club mit den Waschräumen verband. »Wir sehen uns morgen.« Nur dass es für mich im Forty-two kein ›morgen‹ mehr gab.
»Viel Spaß, Prinzessin!«
Ohne mich noch einmal umzudrehen, winkte ich ihr über die Schulter zu und zog die schwere Feuerschutztür auf – und musste zwei jungen Frauen ausweichen, die mir auf Absätzen entgegenstöckelten, auf denen ich mir spätestens beim zweiten Schritt den Hals gebrochen hätte, bevor ich selbst hindurchgehen konnte.
Obwohl es gerade erst auf zehn Uhr zuging, war das Forty-two schon gut besucht. In den Nischen hatte es sich die übliche Klientel bequem gemacht: junge Männer und Frauen zwischen zwanzig und dreißig, allerhöchstens fünfunddreißig – die vor allem im hinteren Bereich mehr Mommys und Daddys Geld ausgaben als ihr eigenes. Die Tanzfläche war eine lose Masse dunkler Schatten, über die immer wieder dünne Spotlichtfinger und Stroboskopblitze zuckten. Eine halbe Stunde mehr und es gab nur noch Stehplätze. An der Bar war das jetzt schon der Fall. Heute Nacht durfte es mir ausnahmsweise egal sein, wie viel Arbeit ins Haus stand. Eigentlich hätte meine Schicht auch bis halb drei Uhr gedauert, aber Bratt hatte mir erlaubt, dieses Mal früher zu gehen und meine Überstunden abzubummeln.
Verglichen mit dem Licht draußen im Gang, das die Glühbirne in ihrem Drahtkäfig unter der Decke verbreitet hatte, war es auf dieser Seite der Feuerschutztür mehr als dämmrig. Trotzdem sah ich Cris sofort. Er lehnte an der Ecke der Bar, direkt neben den Schwingtüren, die in den für Gäste verbotenen Bereich dahinter führten, und unterhielt sich mit Josh – na klasse! –, der in genau diesem Moment an ihm vorbei in meine Richtung nickte. Cris wandte sich um. Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht, das mir das Gefühl gab, außer ihm das einzige lebende Wesen auf diesem Planeten zu sein. Er ließ Josh stehen und kam mir entgegen. Sein Haaransatz war wieder blond nachgefärbt. Im Nacken reichten die Spitzen bis auf das dunkle Sweatshirt mit Kapuze, das er um die Schultern gelegt hatte. Wahrscheinlich würde er sie demnächst wieder auf eine ›gepflegtere‹ Länge stutzen lassen. Schade. Eine langbeinige Schönheit unterbrach ihren Weg zu den Nischen im hinteren Bereich und drehte sich nach ihm um. Ihr Begleiter wäre beinah gegen sie geprallt. Cris schien es gar nicht zu bemerken.
»Wow!« Er ergriff meine Hände und hob sie von meinem Körper weg, um mich besser betrachten zu können.
Mein Gesicht wurde heiß. Die Ärmel der schwarzen Spitzenbluse rutschten ein Stück in die Höhe. Ich hatte sie nicht zugeknöpft. Darunter trug ich nur noch ein sandfarbenes Spaghettiträger-Top. Auffällig hell verglichen mit den dunklen Grautönen, die sonst mein Stil waren. Hoffentlich sah man auch bei anderen Lichtverhältnissen nicht, dass die beiden Oberteile secondhand waren. Cris zuliebe hatte ich zugunsten einer ausgeblichenen Jeans auf meine schwarze Lederhose verzichtet. Dass sie ihre besten Tage schon hinter sich hatte, ließ sich nicht mehr verbergen. Dabei gehörte sie eindeutig zu den guten Sachen in meinem Kleiderschrank. – Welcher Kleiderschrank, Lucinda?
Ich befreite meine Hände aus seinem Griff und zog die Ärmel hastig an ihren Platz zurück, um die Narbe an meinem Handgelenk zu verbergen. – Warum hatte ich das Lederband nur abgelegt, das ich normalerweise mehrfach darumgeschlungen trug?
Mein Lächeln war alles andere als sicher. »Selber ›wow‹.« Wie immer. In seinen schwarzen Hosen, die ganz aus aufgesetzten Taschen zu bestehen schien, und dem einfachen weißen Hemd, das lässig über den Bund hing, hätte er mühelos bei jedem Vergleich mit den Von-Beruf-Sohn-Jungs unter den Gästen mithalten können. Dabei finanzierte er sich sein Studium selbst.
»Nicht neben dir.« Er bedachte mich mit diesem Lächeln, das mir jedes Mal das Herz schneller schlagen ließ. Was hatte ich getan, dass sich das Schicksal endlich meiner erinnerte und mir ein kleines bisschen Glück gönnte? Nein. Ich konnte Boston nicht verlassen. Egal was passierte. Ich wollte nicht mehr ohne Cris sein. Nie wieder.
»Wie war die Uni?« Er studierte etwas, das sich International Management nannte. Vielleicht hörte mein Gesicht auf zu brennen, wenn ich mich fürs Erste unverfänglicheren Themen zuwandte. Solche, bei denen er mir keine Komplimente machen konnte.
»Frag nicht.« Er stieß ein Stöhnen aus. »Die Hälfte meiner Dozenten muss heute Zahnschmerzen gehabt haben.« Sein Blick strich noch einmal über mich. Eine blonde Strähne war ihm in die Stirn gefallen. Warum zum Teufel färbte er sich die Haare hell? Wenn sie von demselben dunklen Braun wie seine Brauen waren, musste es in Kombination mit seinen hellbraunen Augen noch umwerfender aussehen. Er hätte ebenso gut auf einem Laufsteg sein Geld verdienen können, statt in einer Werbeagentur zu jobben. Der Hauch eines Zögerns, dann beugte Cris sich zu mir und küsste mich ganz leicht auf die Wange. Und zog sich hastig wieder zurück. Beinah wie jemand, der fürchtet, bei etwas Verbotenem ertappt zu werden. So war es von Anfang an gewesen. »Was möchtest du heute Abend machen?«
»Ich weiß nicht.« Aber du könntest mich im Laufe des Abends fragen, ob ich mit dir schlafen will, und mich mit zu dir nehmen. Nicht, dass ich seine Wohnung schon einmal gesehen hatte. Ich wusste nur, dass es kein Zimmer in einem Studentenwohnheim oder einem Verbindungshaus war, wo ab einer gewissen Uhrzeit kein Besuch mehr erlaubt war. Ich schloss die Finger um den Riemen meiner Tasche. Meine Handfläche fühlte sich klamm an. Cris nahm meine freie Hand in seine.
»In der Tremont Street hat ein neues arabisches Restaurant aufgemacht. Hast du Lust, es auszuprobieren? – Ich zahle.« Hundeblick. Etwas anderes traf es nicht, um den Ausdruck zu beschreiben, mit dem er mich ansah. Cris aß für sein Leben gern. Wobei ich mich fragte, wo er die ganzen Kalorien hinsteckte. Vor allem arabisch – und spanisch. Und er zahlte eigentlich immer. Was mir schon mehrfach ein schlechtes Gewissen beschert hatte. Allerdings war die Tremont Street nicht mal nur eben so zwei Blocks entfernt. Dass sich meine Begeisterung über seinen Vorschlag in Grenzen hielt, entging ihm nicht. »Oder sollen wir lieber zum Fish Pier und dort etwas essen?« Er wusste, dass ich das Wasser – und vor allem das Meer – liebte. Wenn sich die Wellen vor mir bis zum Horizont erstreckten, hatte das für mich etwas von schierer Unendlichkeit. Und Freiheit. Damit hatte er mich am Haken – weitestgehend zumindest.
»Das ist aber auch nicht gerade um die Ecke.« Zum Fish Pier war es zu Fuß eine knappe halbe Stunde. Normalerweise machte mir die Entfernung nichts aus, aber es hatte heute den ganzen Tag geregnet und die Jacke, die ich an den Riemen meiner Tasche geknotet hatte, war eigentlich zu dünn für diese Jahreszeit. Vor allem in Kombination mit einer Spitzenbluse. Obendrein war Bratt auf die grandiose Idee verfallen, dass hochhackige Schuhe seinen Mädels zu längeren Beinen verhalfen, was für ihn potenziell mehr Umsatz bedeutete. Ich hatte die ungewohnten Riemchensandalen mit einem kleinen Absatz zwar längst wieder gegen meine bequemen Docs getauscht, trotzdem taten mir die Füße weh.
»Mein Wagen steht nur ein paar Straßen weiter.« Er streckte mir auffordernd die Hand hin. Als hätte er einkalkuliert, dass es für mich wieder der Pier sein würde, wenn er mir die Wahl ließ. Ich ergriff sie. Warm und fest schlossen sich seine Finger um meine, drückten sie kurz. Fühlte sich so Geborgenheit an? Cris bedachte mich noch einmal mit jenem ganz bestimmten Lächeln, dann drehte er sich um und bahnte uns einen Weg durch das Gedränge um die Bar herum. Josh zwinkerte mir grinsend zu, als wir auf seiner Höhe waren, und ich musste mich zusammenreißen, um ihm nicht den Mittelfinger zu zeigen. Cris zog mich unbeirrt weiter Richtung Ausgang. Meine Hand fest in seiner.
Sobald wir die Bar und die Tanzfläche hinter uns gelassen hatten und aus den ›Katakomben‹ des Forty-two heraus waren, löste das sanfte Licht stylish-moderner Wandlampen das dämmrige Halbdunkel ab. Mit jedem Schritt, den wir die breite Treppe ins Erdgeschoss und damit in den Eingangsbereich hinaufstiegen, blieb die Musik weiter hinter uns zurück. Dafür wurde das Stimmengewirr vor uns lauter. Wie jeden Abend konnte die Security sich nicht über Arbeitsmangel beklagen. Marcus und Glen schenkten uns nur flüchtig ihre Aufmerksamkeit. Sie interessierte mehr, was in den Club hineinwollte als was ihn verließ – solange Letzteres weder betrunken war noch randalierte. Lisa, neben den beiden Hünen die heutige Quotenfrau für potenzielle Leibesvisitationen bei weiblichen Gästen, winkte mir zu und fächelte sich mit einem vielsagenden Blick auf Cris theatralisch Luft zu, bevor sie eine zierliche Blondine und ihren Begleiter durchnickte. So harmlos sie wirkte: Mochte Gott dem gnaden, der sich mit ihr anlegte.
Cris grinste und hob meine Finger in einem kurzen Kuss an seine Lippen, während wir an ihr vorbeigingen; woraufhin Lisa eine Schnute zog und dramatisch den Handrücken gegen die Stirn legte. Ich zwang mich zu einem Lächeln und winkte ihr meinerseits – schon fast an der Tür – zu. Sie gehörte zu denen, die ich besonders vermissen würde.
Draußen begrüßte uns kühle, feuchte Nachtluft. Der Asphalt glänzte. Pfützen schimmerten im Licht der Straßenlaternen. Es musste auch während meiner Schicht geregnet haben.
»Da lang.« Cris legte mir den Arm um die Schultern und wandte sich mit mir nach rechts, weg von der Menschentraube, die noch darauf wartete, ins Forty-two gelassen zu werden. Ich wagte es, mich in seine Berührung zu schmiegen. Und wünschte mir einmal mehr, das hier für immer haben zu können. Nur dass meine Wünsche sich gewöhnlich nie erfüllten. Auf der anderen Straßenseite stand ein silbergrauer Sedan. Ich stockte für den Bruchteil einer Sekunde. Mein Herz klopfte plötzlich schneller. Zwei Männer saßen darin. Der auf der Beifahrerseite sah von seinem Handy auf, über die Straße. Sein Blick fiel auf Cris und mich, wanderte weiter, kehrte zu seinem Handy zurück. Bestimmt warteten sie nur auf jemanden. Vielleicht die Bodyguards irgendeines Gastes im Forty-two. Wahrscheinlich.
»Alles in Ordnung?« Cris’ Frage ließ mich zusammenzucken.
Ich nickte schnell, lächelte ihn an. »Ja. Alles bestens.« Wie gut ich doch im Lügen war. Aber ich würde nicht zulassen, dass mein Leben mir das mit Cris zerstörte. Niemals. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern konnte.
Er neigte den Kopf ein wenig, musterte mich prüfend.
»Vielleicht ein bisschen müde.«
»Armes.« Sein Arm zog mich enger an seine Seite. »War die Schicht so schlimm?« Als sei ihm plötzlich ein Gedanke gekommen, blieb er stehen. »Soll ich dich vielleicht lieber nach Hause bringen und wir …«
»Nein!« Viel zu laut und viel zu hart. Verblüfft rückte er ein Stückchen von mir ab. »Ich …« Das hier war Cris. Ich konnte ihn mit zu mir nach Hause nehmen. Ich konnte ihm vertrauen. Er würde mich nicht verraten. Er würde auch nicht die Nase rümpfen, wenn er sah, wie ich wohnte. Und trotzdem … Ich rang mir ein Lächeln ab. »Nein. Ich habe mich so auf den Abend mit dir gefreut. Ein bisschen frische Luft und bis wir am Auto sind, bin ich wieder fit. Versprochen.« Lügnerin!
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher.« Ich schob mich unter seinen Arm zurück und lehnte meinen Kopf gegen seine Schulter. Ein kurzes, irgendwie noch immer zweifelndes Zögern, dann zog Cris mich wieder dicht an sich und wir gingen weiter. Schweigend. Ich genoss es.
An der nächsten Ecke bogen wir in eine Seitenstraße. Anscheinend hatten die Häuser bisher den Wind von uns abgehalten, denn nun schlugen uns die kalten Böen ungemindert entgegen, schüttelten Nässe von den Straßenlaternen. Ihr gelbes Licht glänzte in den Pfützen. Fröstelnd zog ich die Schultern hoch, löste im Gehen meine Jacke von meiner Tasche und schlüpfte in die Ärmel. Viel würde sie vermutlich nicht bringen, aber sie war immer noch besser als nichts. Cris’ Arm war von meinen Schultern gerutscht. Er sah auf mich hinab. Beim Anblick meiner Jacke huschte etwas über sein Gesicht, das ich nicht deuten konnte.
»Hier!« Er blieb stehen, zog sein Sweatshirt von den Schultern und legte es mir um. »Lass uns zusehen, dass wir dich ins Auto und dann ins Warme bringen. Es ist nicht mehr weit. Nur noch zwei Blocks.« Seine Hand streifte meine Wange, dann beugte er sich zu mir, um mich erneut zu küssen. Ich reckte mich ein wenig, kam ihm auf halbem Weg entgegen. Ein Auto fuhr an uns vorbei, wurde langsamer – für einen Moment versteifte ich mich – und beschleunigte wieder. Cris’ Zunge stahl sich in meinen Mund. Seine Arme hielten mich. Ich verbannte die Welt aus meinen Gedanken, schmiegte mich an ihn. Es war mir egal, wer uns sah. Meinetwegen konnten wir die ganze Nacht so zubringen.
Ich spürte ihn in der Sekunde, in der Cris seine Lippen von meinen löste. Schnell machte ich einen Schritt zurück.
»Was …?«, setzte Cris verblüfft an, verstummte dann aber, als ich seine Hand ergriff und ihn hastig vorwärtszog.
Er war auf der anderen Seite. Noch ein Stück weit von uns entfernt. Ein schlanker, mittelgroßer Mann. Dunkelblond. Abgesehen davon, dass er verwirrend gut aussah, wirkte er nicht anders als ein normaler Mensch. Anscheinend knapp um die vierzig. Das bedeutete, er war alt. Und entsprechend mächtig. Warum jetzt? Warum heute Nacht? Sie haben mich so lang nicht gefunden … Hast du tatsächlich gedacht, das Schicksal würde es einmal gut mit dir meinen, Lucinda? Er war nicht allein. Drei weitere Männer. Sie waren nicht wie er. Zwei hinter uns, aus der Richtung des Forty-two. Einer bei ihm auf der anderen Seite der Straße – die sie eben überquerten. Direkt auf uns zu. Ansonsten war keine Seele zu sehen. Boston hätte von einer Sekunde zur anderen eine Geisterstadt sein können. Natürlich. Sie wollten keine Zeugen. Mehrere Blocks weiter leuchteten die Rücklichter eines Wagens rot auf.
Ich beschleunigte meine Schritte. Zog Cris hinter mir her. Wobei … Eigentlich musste ich das gar nicht. Er ging ebenso schnell wie ich. Hatte er die Männer auch bemerkt? Ahnte er, was sie wollten? Nein, wie hätte er. Das hier war eine Welt jenseits der der ›normalen‹ Menschen. Trotzdem stellte er keine Fragen. Aber er würde es tun. Früher oder später.
Nur ein paar Meter weiter war eine kleine Seitengasse; wenn wir sie erreichen konnten …
Ein dunkles Schimmern kräuselte plötzlich den Asphalt. Kroch auf uns zu. Der Boden unter unseren Füßen war mit einem Mal klebrig, erschwerte jeden Schritt. Wie in einem Albtraum, in dem man rannte und doch nicht von der Stelle kam. Die Männer hinter uns hatten uns beinah eingeholt. Die vor uns waren stehen geblieben, erwarteten uns – mich. Ich blieb ebenfalls stehen. Cris hielt genauso abrupt an, drehte sich zu mir, sah zwischen mir und den Männern hin und her. Wachsam, angespannt. Versuchte mich weiter zu ziehen. Ich rührte mich nicht. Sie wollten mich. Nicht ihn. Nur mich. Der Eingang zur Gasse verschwamm, wurde unscharf, als sei er da und irgendwie doch nicht. Cris stöhnte. Ich befreite meine Hand aus seiner. Er bemerkte zu spät, was ich tat, schüttelte den Kopf. Der eine vor uns schnalzte mit der Zunge, schaute Cris an.
»Was wohl der gute Joaquín dazu sagen wird?« Wozu auch immer er etwas sagen sollte, er sollte daran ersticken. Seine Augen wanderten weiter zu mir. »Weglaufen ist vollkommen zwecklos, meine Liebe.« Er lächelte. Ich konnte seine Eckzähne sehen. Vampir! In meiner Brust zogen sich meine Lungen zusammen. Jetzt nicht! Bitte, lieber Gott, jetzt nicht! Atmen, Lucinda! Atmen! Einer meiner Anfälle war das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte!
Die Männer hinter uns hatten in ein paar Metern Distanz Stellung bezogen. Vor mir ballte Cris die Fäuste. Wollte er etwa mit ihnen kämpfen? Er hatte keine Chance. Selbst das Messer in meiner Hosentasche kam mir auf einmal wie ein schlechter Scherz vor. Sie würden ihn umbringen. Er war für sie ohne Bedeutung. Sie würden ihn umbringen, nur weil er bei mir war. Bei mir. Einer Blutbraut.
»Lauf!« Erst als Cris mir einen hastigen Blick über die Schulter zuwarf, war ich sicher, dass das Wort über meine Lippen gekommen war. »Lauf!« Seine Augen weiteten sich. Ich zwang meine Beine, sich zu bewegen, schob mich an ihm vorbei. Seine Hand schloss sich um meinen Arm. Versuchte, mich zurückzuhalten. Das Lächeln des einen wurde verächtlich.
»Wie rührend – «
Der Wagen hielt keinen Meter neben uns. Ein zweiter knapp dahinter. Türen wurden aufgerissen. Eine Stimme zischte: »Einsteigen! «, während ich zugleich um die Mitte gepackt, rückwärts herumgerissen wurde. Ich konnte nur erschrocken aufkeuchen. Cris stolperte von mir weg, wurde auf den anderen Wagen zugezerrt. Jemand heulte wutentbrannt: »Rafael!«. Etwas raste auf uns zu – etwas, von dem ich wusste, dass es wehtun würde – und zerfaserte knapp vor mir zu nichts. Ein Lachen dicht neben meinem Ohr, zugleich ein Stoß, ich landete verdreht auf dem Rücksitz des Autos, schlug mir das Knie an, ein Mann direkt hinter mir, die Tür schlug zu. Ich versuchte hochzukommen. Reifen quietschten, ich fiel auf das Polster.
»Zum Flughafen, Felipe!« Dieselbe Stimme, die eben noch ›Einsteigen‹ gezischt hatte. »Wir haben, was wir wollten.« Oh mein Gott. Sie gehörten zu ihm. »Komm hoch, Kleines!« Eine Hand an meinem Arm. Ich riss mich los. Flüchtete in die andere Ecke des Rücksitzes, drückte mich gegen die Tür. Nur kurz glaubte ich, Cris auf dem Beifahrersitz des Wagens hinter uns zu sehen. Sie nahmen ihn mit. Nein! Schlagartig zitterte ich.
»Er hat nichts damit zu tun …« Die Worte waren mehr ein Stöhnen. Meine Lungen weigerten sich, etwas anderes als kurze, japsende Atemzüge zuzulassen. Panisch tastete ich hinter mich. Der Mann neben mir runzelte verständnislos die Stirn. Seine Haut war hell, blass, nur mit einem Hauch Gold überzogen. Augen wie fahles blaues Eis. Mit einer nachlässigen Bewegung strich er sich sein weißblondes Haar zurück. Kinnlang. Schön wie ein Engel. Und nicht viel älter als Cris; ungefähr in seinem Alter.
Er war nicht wie sie. Kein Hexer der Hermandad. Und auch kein Nosferatu. Er fühlte sich zumindest nicht so an. Und trotzdem war er … anders.
Endlich fand ich den Türgriff hinter meinem Rücken. Ich zerrte daran. Nichts rührte sich. Beinah hätte ich geschluchzt. Sie gehörten zu IHM. »Ihr müsst ihn gehen lassen …«
Das Stirnrunzeln wurde unwillig. »Ihn gehen lassen wie ›ihn in Boston zurücklassen‹? – Ja, natürlich.« Er lachte spöttisch. Ich sah seine Eckzähne. Keine Reißzähne. Und doch … fast. »Ezra würde ihn Stück für Stück auseinandernehmen, als Vergeltung dafür, dass ich seinem Schoßhund Abner gerade Joaquín de Alvaros Blutbraut direkt vor der Nase weggeschnappt habe – im wahrsten Sinne des Wortes. Und das auch noch in Boston, seiner Hochburg. Als Patron der Cohen-Familie könnte er so etwas gar nicht ungesühnt lassen.« Ein kurzer Blick durch das Heckfenster zu dem Wagen hinter uns, dann sah er mich wieder an. »Ganz nebenbei wird Joaquín selbst ein klitzekleines Hühnchen in der Größenordnung eines Truthahns mit dem lieben Cris rupfen wollen.«
»Nein. Er hat doch mit alldem gar nichts tun.« Woher kannte er Cris’ Namen? Wie lange beobachteten sie mich schon? Oh Gott, Cris, es tut mir so leid! Ich wollte nicht, dass das passiert, dass du da mit hineingezogen wirst …
Der Wagen bog um eine Kurve, Gebäude huschten vorbei. Noch zwei Ampeln und wir waren auf der Massachusetts Turnpike – und dann war es zu spät. Ich presste mich fester gegen die Tür. Vor uns die erste Ampel. Sie sprang auf Gelb, dann auf Rot. Der Wagen wurde langsamer.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Nichts zu tun?«, brummte er abfällig.
Ich stieß mich von der Tür ab, versuchte, zwischen und über die Vordersitze hinwegzuklettern. Der Fahrer jaulte, als ich ihm unabsichtlich das Knie in den Nacken rammte, der andere erwischte mich am Bund meiner Jeans, riss mich zurück. Ich schrie, klammerte mich an den Lehnen fest, trat um mich. Er fluchte, wich mir aus, löste meine Finger mit Gewalt.
»Hör auf! Ich will dir nicht wehtun müssen. – Fahr, Felipe! Keine Stopps mehr. Scheiß auf die Ampeln!«
Der Wagen setzte sich wieder in Bewegung. Ein Ruck, ich heulte auf, landete halb neben, halb auf ihm auf dem Sitz. Er packte mich bei der Jacke, versuchte, mich von sich herunter-und wieder neben sich zu zerren. Ich fuhr mit der Hand in meine Hosentasche, zog sie mit dem Messer wieder hervor, ließ die Klinge herausspringen, rammte sie ihm in den Oberschenkel. Er brüllte. Ich warf mich auf die Tür auf seiner Seite zu. Der Fahrer trat auf die Bremse, versuchte, nach mir zu greifen. Hinter uns kreischte eine zweite Bremse. Lauf, Cris! Plötzlich war etwas zwischen meinen Beinen, riss sie mir weg. Die Seitenscheibe. Direkt vor mir! Ich schlug mit der Stirn dagegen, war unvermittelt auf dem Boden zwischen den Vorder – und Rücksitzen, ohne zu wissen wie, warum. Eine seltsam klebrige Wärme war an meiner Stirn, meinem Arm. Eine Stimme über mir. Grollend. Benommen wollte ich mich aufsetzen. Mein Kopf pochte. Der Wagen bewegte sich nicht mehr. Vor mir wurde die Tür geöffnet. Kalte Nachtluft wehte herein. Jemand stand davor. Schwarze Hosen. Mit vielen Taschen. Ich wollte daraufzukriechen. Eine Hand in meinem Nacken hielt mich nieder.
»Rafael, was zum Teufel …«
»Cris!« Ich wimmerte, schluchzte.
»Halt die Klappe, Cristóbal.« Wieder die Stimme. Dann war sie ganz dicht an meinem Ohr. »Ich hatte gehofft, wir könnten das nett und freundlich über die Bühne bringen, aber ich werde keine weiteren blauen Flecken an dir vor Joaquín verantworten, Kleines. Ganz zu schweigen von noch mehr Blut.« Ich sah das Glänzen nur aus dem Augenwinkel. Die Nadel einer Spritze. Etwas in mir wusste, ich musste mich bewegen, es wenigstens versuchen … Ein Stich in der Schulter. Ein Brennen. Trübe, die sich wie ein Sack über mich stülpte … Jemand jammerte, leise und hell. Mehrere Hände. Hievten mich in die Höhe. Der Sitz. Ich sank gegen die Rückenlehne, rutschte halb zur Seite. Ein Griff an der Schulter. Zurück in die Senkrechte. Zumindest ein Stück. Berührung an meinem Gesicht, meinen Lidern. Grelles Licht in meinen Augen. Schmerzhaft. Das Jammern war einem schwachen Klagen gewichen.
»In Ordnung. Sie ist nicht ganz weg, aber sie wird uns keine Schwierigkeiten mehr machen, bis wir in der Luft sind. – ¡Que duermas bien, tigresa!« Die Berührung verschwand. Unter meiner Wange war das Polster. »Sehen wir zu, dass wir von hier wegkommen, bevor Ezra ein paar Fäden in seiner Domäne zieht und den Flughafen dichtmacht. – Das alles wird deinem Bruder gar nicht gefallen. Hoffentlich hast du eine verdammt gute Erklärung dafür.« Murmeln. »Mach das mit Joaquín aus, nicht mit mir.« Die Tür schlug zu. Der Wagen setzte sich in Bewegung, beschleunigte. Lichter huschten draußen vorbei. Huschten. Huschten.
Cristóbal … deinem Bruder … Nein! Oh nein! Cris … Die Lichter huschten weiter. Huschten …
Kälte strich über mein Gesicht. Die Lichter standen still.
»… dann nimm du sie. Besser, als dass ich sie am Ende fallen lasse …«
Arme, die mich hochhoben. Mein Kopf fiel gegen eine Schulter. Vertrauter Geruch. Cris. Ich lehnte mich an ihn. Aber da war etwas … etwas, das mit Cris zu tun hatte. Cris, der … was?
Rauer Wind. Ich schmiegte mich fester an Cris. Stufen, aufwärts.
»… können jederzeit starten, Rafael …«
Die Arme setzten mich ab. Ein anderes Polster unter meiner Wange. Kühler. Glatter. Ein hohes Pfeifen erwachte irgendwo.
»… sieh an. Abner und seine Freunde. Schicker Ferrari. Aber kanariengelb? Autsch. Bisher dachte ich, nur Nosferatu hätten ein Problem mit Farben … Bring uns in die Luft, Lope, bevor sie uns den Weg abgeschnitten haben … Schnall sie an.«
Ein Schatten beugte sich über mich, legte etwas über meine Mitte, zog es an, murmelte.
»… auch jemand wie Ezra, Patron hin oder her, kann es sich nicht erlauben, seine Leute auf dem Logan Airport herumballern zu lassen. …«
Wieder Bewegung, wieder Lichter, die huschten, weiße Streifen vor Schwärze zuckten vorbei, wurden zu einem, ein Ruck …
›Flugzeug‹ war das Erste, was in meinen Gedanken aufflammte, als mein Verstand zurückkehrte. Vor dem Fenster herrschte schwarze Dunkelheit. Sterne hingen darauf. Ich saß einfach nur da. Benommen. Irgendwie orientierungslos. Ich wusste nicht wie lange. Mein Kopf war zu schwer, um ihn zu heben. Gelegentlich trieb der fahle Schleier einer Wolke draußen vorbei. Gefangen. In Tausenden Fuß Höhe. Keine Möglichkeit zur Flucht. Unter meiner Wange war kühles Leder. Natürlich. Was sonst. Das hier war wahrscheinlich sein Privatjet. Das Beste vom Besten war für Joaquín de Alvaro gerade gut genug. Monster. Ich schloss die Augen, öffnete sie aber sofort wieder, als das leise Schaben von Stoff auf Leder ganz in meiner Nähe erklang. Langsam wandte ich den Kopf. Auf der anderen Seite der Kabine hockte Cris in einem weiteren Sessel. Die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt. Die Finger ineinandergeschlungen – nein, ineinandergekrallt. Der Kerl, der mir die Spritze verpasst hatte, dieser Rafael, saß mir schräg gegenüber. Eben schob er sein Handy in die Hosentasche. Hatte er ihm unser Kommen angekündigt? Was sonst – auch wenn ich mich nicht erinnern konnte, seine Stimme gehört zu haben. Seine hellblauen Augen musterten mich. Ich biss die Zähne zusammen, gab seinen Blick möglichst kalt zurück und richtete mich zugleich aus meiner beinah halb und quer über den Sitz hingegossenen Position auf. Er drehte sich bei der Bewegung ein kleines bisschen. Seine Lippen verzogen sich zu einem feinen, spöttischen Lächeln.
»Wieder wach, tigresa?« Die oberen Knöpfe seines dunkelgrauen Hemdes standen offen. Die Ärmel waren fast bis zu den Ellbogen hochgekrempelt. Ein breites Lederarmband mit irgendeinem Tribal-Muster lag um sein rechtes Handgelenk. Die Uhr auf der anderen Seite sah ziemlich teuer aus. Hatte er im Auto nicht einen dünnen Rollkragenpullover und ein Sportsakko getragen? »Wie fühlst du dich? Du hast mehr als die Hälfte des Fluges verschlafen.« Auf seinen Jeans war keine Spur von Blut. Er bemerkte meinen Blick. »Das mit dem Messer war kein feiner Zug. – Ich bin Rafael.«
Erwartete er jetzt ein schlechtes Gewissen von mir? »Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich ›Mistkerl‹ zu dir sage. Oder lieber ›Bastard‹?« Vielleicht war der Umstand, dass ich die Worte nur hervorzischte, dafür verantwortlich, dass meine Stimme nicht zitterte. Und warum sollte ich nett zu ihm sein? Auf wessen Seite er stand, war klar. Daran würde garantiert nichts etwas ändern.
Sein Lächeln wurde schief und vertiefte sich gleichzeitig. »Autsch, tigresa, autsch. Ich bin gespannt, was Joaquín sagt, wenn du deine Krallen bei ihm auch so ausfährst. Aber sei vorsichtig, nicht dass du damit irgendwo hängen bleibst und sie dir selbst ausreißt. Er mag es zwar, wenn ihm jemand Kontra gibt, trotzdem solltest du es nicht übertreiben. – Nun, wie ist es? Hungrig? Durstig? Kann ich dir etwas bringen?«
»Ich will zurück nach Boston!« Scharf und fest. Noch immer keine Spur von Unsicherheit. Obwohl mir viel eher nach Betteln und Flehen zumute war. Und das mit jeder Minute mehr. Ich war auf direktem Weg zu ihm. Dem Typen, der mein Blut wollte, der der Grund war, dass ich mein ganzes Leben davongelaufen war.
»Dein Platz ist auf Santa Reyada. Und genau dorthin werde ich dich bringen.« Mit einem Schlag war jede Spur von Belustigung aus seinem Gesicht verschwunden. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich zurückgewichen.
Santa Reyada. An der Westküste. Irgendwo zig Meilen östlich von Los Angeles. »Ich will …«
Abrupt stand er auf. Seine Augen waren von einer Sekunde zur nächsten eiskalt. Was auch immer ich ›gewollt‹ hatte: Es blieb mir im Hals stecken. »Im Moment hast du nichts zu wollen.«
»Lass sie in Frieden, Rafael.«
Er warf Cris einen harten Blick zu, wandte sich dann wieder mir zu. »Wenn ich nichts für dich tun kann, entschuldigst du mich besser.« Ebenso jäh, wie er aufgestanden war, drehte er sich um und marschierte Richtung Cockpit, jeder Schritt ein unübersehbares Hinken. Gleich darauf klackte eine Tür.
Ich starrte ihm nach. Er würde mich zu ihm bringen und ich konnte nichts dagegen tun. In meinem Magen saß ein Zittern, das nackte Angst war. Er würde seine Zähne in meinen Hals schlagen. Er würde mein Blut trinken. Wie damals! Es würde sein wie damals! Allein die Erinnerung zog meine Lungen zusammen, machte mir das Atmen schwer. Damals als … Tante María hatte gebettelt, geschrien … Das Blut war in Strömen aus dem Loch an ihrer Kehle geflossen. Er hatte immer wieder zugebissen … Dieser andere Nosferatu … Atme, Lucinda, atme! Ich presste die Lider so fest zusammen, wie ich konnte.
»Lucinda …« Cris. Ich grub die Fingernägel in das Leder meiner Armlehnen, öffnete die Augen. Jetzt beugte er sich ein Stück weiter zu mir. Hatte er meinen richtigen Namen von Anfang an gekannt, oder hatte dieser Rafael ihn ihm erst heute gesagt? Ersteres, Lucinda, wetten? Der Gedanke hinterließ ein Gefühl der Bitterkeit.
»Warum hast du mich belogen?«
Cris sah mich an. Hundeblick. So sanft. Es tat weh.
»Lucinda, ich …«
»Warum hast du mir nicht gesagt, wie du wirklich heißt? Dass du sein Bruder bist?« Ich konnte nicht mehr länger verhindern, dass meine Stimme zitterte, sogar ein Stück weit brach. Das war Cris! Mein Cris. Ich hatte ihm vertraut! Ich hatte mit ihm schlafen wollen! Wie hatte ich auch nur eine Sekunde annehmen können, das Schicksal würde es ein einziges Mal gut mit mir meinen? Ich könnte zumindest für eine kleine Weile aus dem Albtraum aussteigen, der mein Leben war?
»Lucinda, bitte …«
»Warum, Cris? Du hast die ganze Zeit gewusst, wer ich bin. Warum hast du mit mir gespielt? Hat dein Bruder dich geschickt? « Wieso war er nicht wie er? Wieso hatte ich bei ihm nicht das geringste Anzeichen von ›Vampir‹ spüren können?
»Nein …« Hastig, beinah überstürzt sprang er auf, durchquerte die Kabine, wechselte auf den Sitz mir gegenüber; schüttelte den Kopf. »Nein! Bitte! Glaub das nicht.« Er streckte die Hände nach mir aus, zog sie zurück, schlang sie erneut ineinander. »Ich … Das darfst du nicht denken. Joaquín hatte keine Ahnung. Die ganze Zeit nicht. Er wusste nichts! Und ich habe nicht mit dir gespielt! Ich wollte dir nicht wehtun. Niemals. Bitte, ich …« Er verkrallte die Finger noch härter. »Ich wollte das alles nicht. Nicht so. Das musst du mir glauben!«
»Dann sag mir, warum.« Meine Kehle war eng. Ich habe dir vertraut! Ich habe gewagt, zu träumen. Davon, dass mein Leben endlich einmal besser werden würde, dass ich vielleicht nicht mehr davonlaufen müsste oder zumindest für kurze Zeit jemanden hätte, auf den ich mich verlassen könnte. Der für mich da wäre, dass mein Leben vielleicht endlich normal sein könnte. Und jetzt?
Cris starrte auf seine Hände. »Weil ich Angst hatte, dass du genau so reagieren würdest, wenn du es erfährst. Dass du mich hasst, weil ich Cristóbal de Alvaro bin. Weil Joaquín mein Bruder ist«, sagte er schließlich leise, sah mich dann doch wieder an. »Ich würde alles dafür geben, wenn es nicht so wäre. Das musst du mir glauben. Bitte!« Sein Blick huschte zur Seite, kehrte zurück. »Aber als ich dich vor vier Wochen im Forty-two zum ersten Mal gesehen habe, da … Ich konnte nicht anders. Ich wollte nicht, dass das zwischen uns steht. Dass Joaquín zwischen uns steht.«
Wie gern hätte ich die Beine auf den Sitz gezogen und die Arme darumgeschlungen, den Kopf darauf gepresst, mich in mich selbst verkrochen. »Warum bist du nach Boston gekommen? Das war doch kein Zufall. Wie hast du mich gefunden?« Hörte er, wie sehr meine Stimme zitterte? Hörte er, welche Angst ich vor seiner Antwort hatte? Und doch musste ich es wissen. »Warum warst du in Boston?«
»Ich …« Cris zögerte, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ich konnte dich spüren. Plötzlich. Ich wusste, dass du da warst, dass du am Leben warst, nicht tot, wie alle dachten.« Wieder leckte er sich die Lippen. »Als ich nach Boston kam, da … ich wollte dich zu Joaquín bringen. Aber dann … dann habe ich dich gesehen und … ich konnte es nicht mehr. Weil ich mich in dich verliebt habe, Lucinda.«
Es tat so weh. »Du hast mich belogen.«
Er senkte den Kopf. »Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen.«
»Ich habe dir vertraut.« Meine Augen brannten.
»Verzeih mir.«
Ich wandte das Gesicht ab. Draußen huschte ein Wolkenschleier vorbei. ›Verzeih mir.‹ Es klang so einfach …
»Lucinda, bitte! Ich schwöre, ich wollte das alles nicht.« Ich konnte hören, wie er auf seinem Sitz vorrutschte. Näher kam. Ich sah weiter in die Dunkelheit. »Ich bin nicht wie er. Ich werde nie so sein. Ich … ich hoffe es zumindest. Ich meine … bei mir reicht es gerade mal dazu, eine Kerze anzuzünden. Wenn überhaupt. Und Joaquín … das ganze Konsortium hat Angst vor ihm – die Männer, die eigentlich seine Berater sein sollen.« Cris lachte gepresst. »Wahrscheinlich gibt es sogar in der gesamten Hermandad keinen, der es wagt, sich offen gegen ihn zu stellen.« Die Hermandad … die Bruderschaft jener Hexer, deren Vorfahren vor Hunderten von Jahren einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten. Die Gesamtheit all derer, die waren wie er. Bei Tag zumindest äußerlich normale Menschen, aber bei Nacht … Vampire. – Camorra, Cosa Nostra, Mafia; wie auch immer sie hießen: Verglichen mit der Hermandad waren sie … harmlos. Tante María hatte mir so viel erzählt. Weil sie wollte, dass ich wusste, wer mich jagte. Und Joaquín de Alvaro war einer von denen, die an ihrer Spitze standen. Zusammen mit Männern, von denen jeder einzelne Jahrzehnte älter war als er; mächtiger hätte sein müssen. Und es nicht war. Cris’ Stimme sank zu einem Flüstern herab. »Ich werde nicht zulassen, dass Joaquín irgendetwas tut, was du nicht willst. Ich meine, ich … habe ihm zwar nichts entgegenzusetzen, aber … ich schaffe es. Irgendwie, Lucinda. Ich verspreche es!«
Ich hielt den Blick starr aus dem Fenster gerichtet. ›Ich verspreche es.‹ Ich hätte ihm so gern geglaubt. Aber wie konnte ich das noch? Er brachte mich zu ihm. Dem Monster, vor dem ich mein ganzes Leben davongelaufen war. Er war sein Bruder. ›Ich verspreche es. ‹ – Oh Gott, Cris.
»Ich werde dich beschützen. Irgendwie. Niemand darf dir wehtun. Auch Joaquín nicht«, wiederholte er nach einigen weiteren Sekunden noch einmal und stand auf. »Ich verspreche es dir.« Ich rührte mich nicht. Schwieg. Irgendwann kehrte er auf seinen Platz auf der anderen Seite der Kabine zurück. Jenseits der Scheibe blitzten die Sterne auf dem Nachthimmel. Ich saß einfach nur da. ›Ich verspreche es dir.‹ Ebenso einfach zu sagen wie ›Verzeih mir‹. Aber unmöglich zu halten. ›… das ganze Konsortium hat Angst vor ihm.‹ Die mächtigsten Hexer der Familie. Die seit Hunderten von Jahren immer den Männern der de-Alvaro-Linie Rechenschaft schuldig gewesen waren. Die jetzt ihmRechenschaft schuldeten. Obwohl er jünger war als sie. Und Cris …? Ob er seinem Bruder etwas antun würde, wenn der es wagte, sich gegen ihn und vor mich zu stellen? Wahrscheinlich hatte er nach den Gesetzen der Hermandad sogar das Recht dazu. Immerhin war ich ja seine Blutbraut. Und wenn … wenn ich es einfach hinnahm? Es geschehen ließ? Allein bei dem Gedanken war der Krampf in meiner Brust mit einem Schlag da. Nein! Nein, das … ich konnte nicht. Niemals. Tante María hatte geschrien und gebettelt. Ihr Blut war überall gewesen. Er hatte immer wieder zugebissen. Ich zwang mich, weiterzuatmen. Ein und aus. Nur ein und aus. Er brauchte mich, wenn er nicht zum Nosferatu werden wollte. Er konnte mich nicht töten. Er brauchte mich lebend. Es gab noch andere wie mich. Auch wenn ich die Einzige war, die für ihn ›passte‹. Sie ertrugen es doch auch … Meine Lungen zogen sich noch ein Stück weiter zusammen. Nein! Nein, ich … Nein! Der Schmerz, als er damals die Zähne auch in meinen Hals geschlagen hatte … Atme, Lucinda! Ich umklammerte die Armlehne, so fest ich konnte. Aber vielleicht schaffte ich es, so zu tun, als hätte ich mich mit meinem Schicksal abgefunden? Vielleicht ließ er mich dann noch ein oder zwei Tage in Ruhe? Gab mir Zeit, mich an ihn zu gewöhnen? Dann hatte ich vielleicht eine Chance, doch noch einmal zu entkommen. Wenn ich ihn täuschen konnte … nur ein oder zwei Tage … Irgendeine Gelegenheit würde sich ergeben. Bestimmt. Vielleicht würde Cris mir ja helfen. Solange er nur nicht sofort über mich herfiel … Wenn ich ihn täuschen konnte … nur ein oder zwei Tage …
Als ich aufsah, wurde mir klar, warum ich es nie schaffen würde, ihm etwas vorzumachen: Rafael. Er stand im Gang, die Hand locker auf die Lehne des Sessels neben ihm gelegt. Ich hatte nicht gehört, dass er zurückgekommen war. Reglos schaute er mich an. Vielleicht würde ich jeden anderen täuschen können, aber ihn nicht. Und er würde nicht zulassen, dass ich ihn täuschte. Aber musste ich es nicht wenigstens versuchen? Seine Augen waren im Licht der Kabine beinah ebenso glitzernd und farblos wie die eines Nosferatu, nur ein Hauch von fahlem Blau in den Tiefen. Ich konnte seinen Blick kaum erwidern. Für eine Sekunde hob er wie fragend eine Braue, doch als ich schwieg, nahm er die Hand von der Lehne, ging ein Stück weiter den Gang entlang Richtung Heck, wo er sich auf einer ausladenden Sitzbank niederließ und sein Handy aus der Hosentasche zog.
Einer der beiden Männer hinten in der Kabine ließ die Zeitung sinken, in der er anscheinend die ganze Zeit gelesen hatte, und sagte etwas. Der andere lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen in einer Ecke und rührte sich nicht, schlief vermutlich. Ich hatte sie bisher nur am Rande wahrgenommen. Rafaels Antwort war ein Murmeln, zu leise, als dass ich ihn hätte verstehen können. Der Mann nickte und widmete sich weiter seiner Zeitung.
Ich sah wieder aus dem Fenster. Ich musste es zumindest versuchen. Immerhin hatte ich nichts zu verlieren. Und trotzdem war ein Teil von mir vor Angst wie benommen.
Unter uns war nichts als Dunkelheit, als sich die Nase des Jets irgendwann sacht dem Boden entgegen zu senken begann. Nur als er sich einmal in eine weite Kurve legte, erhaschte ich einen kurzen Blick auf ein breites Band funkelnder Lichter, die der Linie einer Küste zu folgen schienen. Doch kurz darauf waren auch sie schon wieder in der Schwärze verschwunden.
Und dann hatte Rafael unvermittelt vor mir gestanden, wortlos den Gurt um meine Mitte geschlossen und sich erneut in den Sessel mir gegenüber niedergelassen. Seitdem lag sein Blick wieder unverwandt auf mir. Ich konnte ihn spüren, obwohl ich die Augen starr aus dem Fenster gerichtet hielt.
Als die Landebahn vor uns auftauchte, bewegte Cris sich auf seinem Platz auf der anderen Seite des Ganges unruhig. Ich saß einfach nur da. Lichter blitzten entlang der fahlen Linie aus Asphalt, die sich in der Nacht verlor. Ein kleiner Tower. Ein Hangar. Ein Schuppen. Die Schatten von ein paar Autos huschten unter uns vorbei … Der Umriss eines schlanken Flugzeugs mit schmalen, verwirrend langen Tragflächen … Ein Ruck und das Geräusch der Bremsen, das Pfeifen der Triebwerke …
Selbst als der Jet schließlich stand, rührte ich mich nicht. Durch das Fenster konnte ich in der Ferne ein paar einzelne Lichtpunkte ausmachen. Häuser? Wie weit war es bis zur nächsten Stadt? Kühle Nachtluft drang von draußen herein. Jemand musste die Tür geöffnet haben. Ich löste die Augen aus der Dunkelheit, als Rafael sich über mich beugte und meinen Gurt löste. Sie brachten mich zu ihm. Rafael ergriff mich am Arm, zog mich von meinem Sitz hoch. Nicht grob. Oder unfreundlich. Er tat es einfach. Außer uns war niemand mehr in der Maschine. Er sagte etwas, aber ich verstand ihn nicht. Er brachte mich zu ihm. Die Hand immer noch an meinem Ellbogen, hielt er auf die Tür zu. Ich ging neben ihm her. Sein Blick glitt immer wieder zu mir. Prüfend. Misstrauisch. Auf der Treppe verfehlte ich einen Tritt. Oder wollten meine Beine mich einfach nur nicht mehr weiter tragen? Sein Griff verhinderte, dass ich mehr tat, als die letzten beiden Stufen schneller zurückzulegen als die vorherigen. Wieder ein Blick.
»Alles okay?«
Ich hätte nichts lieber getan, als meinen Ellbogen aus seiner Hand zu reißen und um mein Leben zu rennen. Er brachte mich zu ihm. Und fragte allen Ernstes, ob alles in Ordnung war?
»Da lang.« Hatte es ihm mit meiner Antwort zu lange gedauert? Hatte er überhaupt eine erwartet? Er dirigierte mich auf eine dunkle Limousine zu. Sah sich dabei immer wieder um.
Hinter uns verloschen die Lichter der Landebahn. Nur über dem Tor des Hangars brannte noch eine Lampe. Der Lack des Wagens schimmerte wie graue Perlen. Ein Stück weiter rechts schlugen Türen, grollte ein Motor, Scheinwerfer flammten auf, entfernten sich. Verwirrt sah ich ihnen nach. Rafael ging wortlos weiter. Seine Finger umschlossen immer noch meinen Arm. Ich stolperte neben ihm her. Cris wartete an der Beifahrertür. An der hinteren ein Mann mittleren Alters. Das Haar schon schütter und beinah weiß im Licht der Scheinwerfer.
»Sanguaíera.« Mit etwas wie einer Verbeugung öffnete er die Tür, sah mich dabei aufmerksam an. Ich blieb stehen. ›Sanguaíera. ‹ Blutbraut. Sie brachten mich zu ihm. Ich drehte mich um und rannte. Oder wollte es. Rafaels Hand war noch immer an meinem Arm. Hielt mich fest, riss mich zurück. Ich strauchelte, schürfte mir die Handfläche auf dem Asphalt auf, den Arm verdreht, noch immer in seinem Griff, schrie, zerrte daran, schlug nach seinem verletzten Bein. Er wich aus, fluchte. Für eine Sekunde war ich frei. Ich taumelte hoch und vorwärts, knickte um, fing mich. Meine eigenen Haare waren in meinem Mund. Im nächsten Moment packte er mich um die Mitte, nahm mir den Boden unter den Füßen, drückte mich gegen seine Brust, schleifte mich zum Wagen zurück. Aus! Ich erschlaffte in seinem Griff, schluchzte nur noch. ›Sanguaíera.‹ Sie brachten mich zu ihm.
»Worauf wartest du? Steig ein.« Die Worte waren nur ein Grollen, galten Cris. »Abner hatte in Boston viel zu viel Zeit, sich daran zu erinnern, dass sein Patron gerade hier ganz in der Nähe ist. Vielleicht ist er längst auf die Idee gekommen, Ezra zu stecken, wo er uns eventuell finden kann. Ich will sie so schnell wie möglich auf Santa Reyada und in Sicherheit haben.« Rafael schob mich in den Fond der Limousine. Der andere Mann starrte mich erschrocken an. Ich stolperte über den Schweller, landete auf Händen und Knien zwischen der Sitzbank und der Trennwand, riss Rafael halb mit. Sandfarbenes Leder, helles Holz, samtiger Teppich.
»Nach Santa Reyada, Hernan!« Er zog mich vom Boden hoch auf den Rücksitz.
»Sí, Rafael.« Die Tür schlug hinter uns zu. Ich krümmte mich zusammen. Gleich darauf eine zweite, dann noch eine. Der Motor schnurrte kaum hörbar auf, der Wagen setzte sich in Bewegung. Das Einrasten einer Türverriegelung. Rafaels Arm lockerte sich um meine Mitte, gab mich schließlich endgültig frei. Beinah lautlos senkte sich die Trennscheibe. Cris hatte sich auf dem Beifahrersitz umgedreht.
»Bist du in Ordnung, Lucinda?«
Ich sah ihn an. Was dachte er? Sie brachten mich zu ihm. Ich kroch in die Ecke, fort von Cris, fort von Rafael, begegnete den Augen des Fahrers im Rückspiegel.
»Lucinda?« Cris hatte sich noch weiter umgewandt.
»Lass sie in Ruhe, Cris.« Mit einer entschiedenen Geste ließ Rafael die Trennscheibe wieder hochfahren, blickte zu mir her, schüttelte den Kopf. »Komm schon, tigresa, niemand wird dir etwas tun. Es gibt keinen Ort, an dem du sicherer wärst als auf Santa Reyada. Joaquín wird den Boden unter deinen Füßen anbeten, nachdem wir dich endlich gefunden haben.«
Ich drückte mich noch tiefer in die Ecke. Er stieß ein Seufzen aus, sagte aber nichts mehr. Ich saß da und starrte aus der dunkel getönten Scheibe, blind, ohne etwas zu sehen, selbst wenn es etwas zu sehen gegeben hätte. Es war vorbei. Ich hatte meine letzte Chance verspielt. Ich konnte niemanden täuschen. Ich konnte es einfach nicht ertragen. Er würde seine Zähne in meinen Hals schlagen, wann immer er mein Blut brauchte. Ich würde den Rest meines Lebens eingesperrt verbringen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich damals nicht entkommen, sondern gestorben wäre, wie Tante María.
Santa Reyada war dunkel, als wir es erreichten. Ein massiger, zusammengekauerter Schatten, in dessen hohen Fenstern sich der Nachthimmel mit seinen Sternen spiegelte. Scheinbar verlassen. Würde nicht irgendwo Licht brennen, wenn er da wäre? War er fort? Auf der Jagd, sich irgendwo ein anderes Opfer suchen? Hatte ich doch noch eine kleine Gnadenfrist? Mein Herz hing in meinem Hals.
Die Hand wie zuvor an meinem Ellbogen, dirigierte Rafael mich aus der Limousine und die Stufen der ausladenden Treppe hinauf. Cris war hinter uns. Zu beiden Seiten wuchsen Büsche. In einem raschelte es. Gleich darauf flatterte ein Vogel davon. Rafael stieß die schwere Eingangstür auf. Nicht verschlossen. Würde sie es später sein? Jetzt, da ich hier war? Ein Ornament aus buntem Glas schimmerte auf, als sie aufschwang, klirrte leise. Dahinter: Schwärze. Rafael brummte, schob mich weiter, das Klacken eines Schalters, dann flammte sanft gedämpfte Helligkeit auf. Weiß verputzte Wände, helle Steinfliesen auf dem Fußboden; dicke, bunte Teppiche; weit offen stehende Türen und Durchgänge, die in den hinteren Teil des Hauses und in dunkle Räume rechts und links führten. Gegenüber der Eingangstür die Treppe in den ersten Stock. Auf dem Absatz, dort, wo sie im rechten Winkel die Richtung wechselte, stand eine riesige Bodenvase mit Blumen. In ihrem Schatten glänzte der schwarze Lack eines Flügels. Rafael ging mit mir weiter, die Stufen hinauf. Der Duft von Lavendel strich mir entgegen.
»Warte!« Plötzlich war Cris’ Hand an meinem anderen Arm, zwang mich stehen zu bleiben.
Rafael drehte sich unwillig um. »Was ist?«
»Hältst du das wirklich für eine gute Idee?« Cris trat näher an mich heran, zog mich in der gleichen Bewegung weiter zu sich. »Es ist mitten in der Nacht. Sie hat den ganzen Tag gearbeitet; der Flug … Sie ist müde. Reicht es nicht, wenn sie Joaquín morgen früh sieht? – Auch oben ist alles dunkel, wahrscheinlich ist er selbst schon zu Bett …«
»Dein Bruder? Zu Bett?« Der Laut, den Rafael von sich gab, war irgendwo zwischen Schnauben und Lachen. »Wie lange warst du nicht mehr hier, Niño? – Lass es mich so sagen: Du wirst feststellen, dass sich in den letzten Wochen hier einiges verändert hat.«
»Was soll das heißen?« Cris’ Finger schlossen sich fester um meinen Arm.
»Lass dich überraschen.« Rafael nickte mir zu. »Komm, tigresa, es würde mich sehr wundern, wenn Joaquín nichts von unserer Ankunft mitbekommen hat. Du wirst vermutlich schon erwartet.«
Cris ließ mich noch immer nicht los. »Verdammt, Rafael, gib ihr wenigstens die Chance, sich frisch zu machen. Sie hat ja immer noch Blut – «
»¡Dios mío!« Rau. Kehlig. Mehr Knurren als Worte aus der Dunkelheit am Ende der Treppe. Eine Bewegung. Rafael und Cris drehten sich gleichzeitig um. Ich wich zwischen ihnen zurück, soweit ihr Griff es erlaubte. Er!
»Joaquín. Ich habe den ganzen Flug versucht, dich zu errei…«
»¿Que hace ella aquí? ¿Por que la ella traído aquí?« Er kam die Stufen herunter. Im ersten Moment nicht mehr als ein Schatten.
»¿No entiendo …?« Eine scharfe Falte erschien auf Rafaels Stirn. Ich versuchte, weiter zurückzuweichen. Plötzlich war ein Brennen in meiner Brust.
»¡Estúpido!« Immer näher. Farblose Augen. Glitzernd. Unverwandt auf mich gerichtet. Nosferatu. Meine Lungen verkrampften sich.
»Heilige Muttergottes …« Cris zuckte zurück, ließ mich los, schob sich vor mich.
»¿Cómo?« Rafael starrte ihn an, gab mich endlich auch frei. Ich prallte gegen die Wand. Wimmerte.
Er packte seinen Bruder am Hemd, stieß ihn einfach aus dem Weg. Meine Brust zog sich mit jedem Atemzug mehr zusammen. Glitzernde Augen. Farblos. Nicht ganz. Ein letzter Rest fahlgelb. Cris stolperte gegen das Treppengeländer. Keuchte. »Joaquín …«
Fauchen. Direkt vor mir blieb er stehen. Lehnte sich vor, stützte die Hände zu beiden Seiten neben meinem Kopf an die Wand. Nah! Entsetzlich zu nah! Sein Körper drückte gegen meinen. Luft! Ich konnte mich nicht bewegen. Er beugte sich noch näher. Fänge. Weiß, spitz und scharf. Sein Atem fuhr über meinen Hals, wurde wieder eingesogen; lange, tief. Ich drehte den Kopf weg, begriff zu spät, dass ich meine Kehle entblößte. Wieder sein Atem an meiner Haut. Heiß. Meine Lungen verkrampften sich noch stärker. Ich bekam noch immer keine Luft! Seine Wange streifte meine. War das sein Mund auf meinem Hals? Nein, nein! Bitte! Luft!
»Sie hätten dich niemals finden sollen, mi corazón«, sagte er direkt neben meinem Ohr.
Dunkelheit schlug in meinem Verstand zusammen.
2
Lucinda Moreira war also wieder aufgetaucht. Zum zweiten Mal – wenn man ihr erstes großes Auftauchen vor einigen Jahren nicht mitrechnete. Damals war er bedauerlicherweise nicht schnell genug gewesen. Und dann war sie wieder so gründlich verschwunden wie zuvor. Vor einigen Wochen hatte er sie dann abermals kurz gespürt. Zu kurz, um sie finden zu können. Aber offenbar doch lang genug, dass der Junge sie hatte aufstöbern können. Und diesmal hatten auch die anderen sie spüren können. Lästig. Aber nicht wirklich ein Problem.
Was allerdings ein Problem darstellte, war der Umstand, dass sie erneut nach Santa Reyada gebracht worden war. Nun ja, solange Joaquín davon ausging, dass er sie nur vor den gierigen Händen der Hermandad beschützen musste …
Schon Estéban hatte sich gegen ihn gestellt. Und Joaquín war keinen Deut besser als sein Vater. Im Gegenteil. Er hasste die Nosferatu wie kein Zweiter in der Hermandad. Spöttisch verzog er den Mund. Und jetzt wurde er offenbar inzwischen unaufhaltsam selbst zu einem. Wie be-dau-er-lich. Aber nein. Joaquín würde eher sterben, als Nosferatu zu werden. Und das wiederum konnte er nicht zulassen. Eine solche Macht durfte nicht auf diese Weise verschwendet werden. Im Gegenteil. Er hatte Pläne mit dem lieben Joaquín. Und in denen spielte die süße Lucinda eine ganz entscheidende Rolle.
Die Kleine auf dem Tisch wimmerte, als er die Zähne tiefer in ihr Handgelenk grub. Sie erinnerte ihn an Juana. Dasselbe blasse, glatte Fleisch, dieselben schlanken, weichen Flanken, schwarzes Haar … Nur die Augen waren anders. Nicht die Augen einer Sanguaíera. Nur ein Mensch. – ›Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.‹ Auch dann nicht, wenn es das deines Sohnes ist. Wenn die Kleine noch ein wenig mehr zerrte, hatte sie das Messer zwischen ihren Fingern herausgerissen, das sie auf den Tisch nagelte. Ihre Brust drängte sich in seine Hand, als sie sich ein weiteres Mal aufbäumte. Sein Ärmel streifte ihre Schulter, tauchte in Blut. Er zischte. Bisher hatte er es erfolgreich vermieden, seinen Anzug damit zu besudeln, und nun das. Mit einer eleganten Bewegung schob er den Stuhl zurück, beugte sich über sie. Ihre Augen weiteten sich noch ein Stück mehr. Bedächtig schlitzte er mit dem Fingernagel auch ihre andere Schulter vom Hals bis zum Brustansatz auf. Ein Gurgeln kam aus ihrer Kehle. Blut quoll aus dem Schnitt. Lächelnd leckte er es ab, langsam, genoss sein Bouquet. Für einen Menschen schmeckte sie exquisit. Dazu der Hauch von Alkohol in ihrem Blut … Benedicto hatte ganze Arbeit geleistet. Vielleicht sollte er ihn dafür mit ein wenig mehr als nur totem Fleisch belohnen. Ihre Augen wurden allmählich glasig. Viel hatte er schon jetzt nicht von ihr übrig gelassen. Aber sie hatte so entzückend gekämpft, als er ihr das Messer durch die Hand gestoßen hatte.
Nein! Er ließ ihren Arm fallen, machte entschieden einen Schritt zurück. Man sollte aufhören, wenn es am schönsten war.
Sofort war Benedicto bei ihm und reichte ihm ein feuchtes Tuch, damit er sich säubern konnte.
1. Auflage 2011
© 2011 cbt Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten
st · Herstellung: AnG
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-07081-6
www.cbt-jugendbuch.de
www.randomhouse.de
Leseprobe