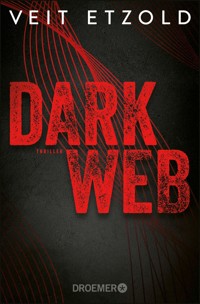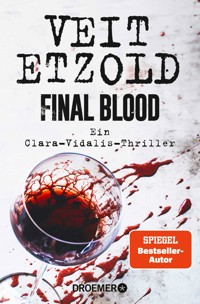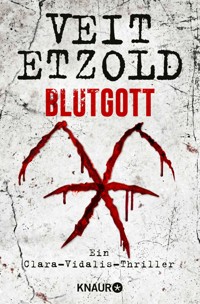
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Clara-Vidalis-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kindliche Killer-Kommandos versetzen Deutschland in Angst und Schrecken: der siebte Teil der Thriller-Reihe mit Patho-Psychologin Clara-Vidalis – beste Unterhaltung für alle Fans harter Thriller im US-Stil Ein Mädchen sitzt allein in einem schäbigen alten Abteil eines IC, der gerade Nordrhein-Westfalen durchfährt. Plötzlich öffnet sich quietschend die Tür: Eine Gruppe Jungen betritt das Abteil. Zielstrebig nähern sie sich den Fenstern und ziehen die Vorhänge zu. Was dann geschieht, jagt den hartgesottenen Ermittlern vom LKA Berlin um Patho-Psychologin Clara Vidalis Schauer über den Rücken … Und es bleibt nicht bei diesem einen außergewöhnlich brutalen Mord, verübt noch dazu von einer Gruppe Minderjähriger – bald schlagen die kindlichen Killer-Kommandos in ganz Deutschland zu. Clara Vidalis glaubt nicht an Zufälle. Und sie kann (und will) auch nicht glauben, dass die Teenager auf eigene Faust gehandelt haben. Was sie nicht ahnt: In seiner Welt ist ihr wahrer Gegner ein Gott. Und die Messen, die er von seinen Anhängern fordert, sind blutige »slash mobs«. Die Thriller-Reihe mit Clara Vidalis von Bestseller-Autor Veit Etzold ist in folgender Reihenfolge erschienen: • Final Cut • Seelenangst • Todeswächter • Der Totenzeichner • Tränenbringer • Schmerzmacher • Blutgott
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Veit Etzold
Blutgott
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kindliche Killer-Kommandos versetzen Deutschland in Angst und Schrecken: der siebte Teil der Thriller-Reihe mit Patho-Psychologin Clara-Vidalis – beste Unterhaltung für alle Fans harter Thriller im US-Stil
Ein Mädchen sitzt allein in einem schäbigen alten Abteil eines IC, der gerade Nordrhein-Westfalen durchfährt. Plötzlich öffnet sich quietschend die Tür: Eine Gruppe Jungen betritt das Abteil. Zielstrebig nähern sie sich den Fenstern und ziehen die Vorhänge zu. Was dann geschieht, jagt den hartgesottenen Ermittlern vom LKA Berlin um Patho-Psychologin Clara Vidalis Schauer über den Rücken …
Und es bleibt nicht bei diesem einen außergewöhnlich brutalen Mord, verübt noch dazu von einer Gruppe Minderjähriger – bald schlagen die kindlichen Killer-Kommandos in ganz Deutschland zu.
Clara Vidalis glaubt nicht an Zufälle. Und sie kann (und will) auch nicht glauben, dass die Teenager auf eigene Faust gehandelt haben. Was sie nicht ahnt: In seiner Welt ist ihr wahrer Gegner ein Gott. Und die Messen, die er von seinen Anhängern fordert, sind blutige »slash mobs«.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
BUCH 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
BUCH 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
BUCH 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Zitat
Epilog
Dankwort
Leseprobe: FINAL CONTROL
Prolog
Buch 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Für Saskia
I went to God just to see,
And I was looking at me,
Saw heaven and hell were lies,
When I’m God, everyone dies.
Marilyn Manson, »The Reflecting God«1
Prolog
Welche Fähigkeit hättet ihr gern?«, fragte die Lehrerin.
Der Junge sah sich um. Er drehte den Kopf von der einen zur anderen Seite, langsam, mechanisch. Wie ein Roboter.
Es lief die sechste Stunde in der sechsten Klasse. Es war heiß und stickig, wie immer in Schulen im Juni. Draußen knatterte ab und zu ein Moped, und der Hausmeister hantierte mit einer Bohrmaschine, als versuchte er zu erreichen, dass das marode, baufällige Schulgebäude erst übermorgen anstatt schon morgen in sich zusammenstürzte. Fliegen surrten durch die Luft.
Matthias hatte sich mit seinem Stuhl an die Wand gelehnt und ein Buch als Kissen zwischen Kopf und Wand geklemmt. Leon hatte sich gleich mit dem Kopf auf den Tisch gelegt, neben sich auf der Platte nicht das Schulheft, sondern einige Karten aus einem Magic-Fantasy-Spiel.
Die Lehrerin merkte es gar nicht. Sie blickte über die Reihen der Schüler, wartete darauf, dass irgendeine Reaktion kam von denen, die nicht über ihre Smartphones gebeugt waren und in irgendwelchen sozialen Netzwerken neidisch die Posts von Menschen verfolgten, die scheinbar ein so viel besseres Leben hatten als sie. Bin auf Mallorca, bin auf dem Konzert, bin beim Essen, bin auf dem Klo … Allen gefällt das …
»Also«, sagte die Lehrerin noch einmal, »welche Fähigkeit hättet ihr gern?«
Leon hob den Kopf. »Ich hätte gern einen Zauberstab«, knurrte er. Dann ließ er den Kopf wieder heruntersacken, als würde ein Scharnier zuschnappen.
Die Lehrerin nickte. »Sehr gut!«
»… um diese Scheißschule wegzuzaubern«, murmelte Leon leise hinterher, doch das hörte nur Mirco, sein Nachbar. Der kicherte kurz, hob den Daumen und knuffte ihm anerkennend in die Seite.
Plötzlich knallte es. Matthias’ Buch, das er zwischen Hinterkopf und Wand geklemmt hatte, war heruntergefallen. Die Sitznachbarn, Michi und Flo, lachten, der Rest beachtete es gar nicht. Die Lehrerin schien es nicht gemerkt zu haben, oder sie ignorierte es. Matthias bückte sich knurrend nach dem Buch.
»Was noch?« Die Lehrerin reckte das Kinn.
Sabine meldete sich. »Ich möchte fliegen können.«
»Ja …« Die Lehrerin nickte. »Das ist ein alter Traum der Menschheit. Davon hat schon da Vinci geträumt.«
»Der von Dan Brown?«, fragte Sabine.
»So ähnlich.« Die Lehrerin nickte. Offenbar war sie froh, dass überhaupt noch irgendetwas gelesen wurde. Es war ein offenes Geheimnis bei vielen Pädagogen, dass Autoren wie Dan Brown bei der Bildung der meisten Menschen »letzter Mann« spielen mussten und mehr für das kulturelle Verständnis taten, als die meisten Kritiker wahrhaben wollten. Die Lehrerin hielt kurz inne.
Irgendwie, dachte der Junge, erinnerte sie ihn an eine Ente. Eine dicke, hässliche, watschelnde Ente.
»Was noch?«, fragte sie.
»Ich will Milliardär werden«, sagte Eric. Von Eric wusste man, dass er auf seinem Smartphone keine Facebook- oder Instagram-Posts las, sondern Börsenkurse und sich immer ärgerte, dass er volljährig sein musste, um CFD Trading zu betreiben.
Die Lehrerin schüttelte den Kopf. »Immer nur Geld«, sagte sie. »Geld ist doch nicht alles.«
»Aber ohne Geld ist alles nichts.« Eric lachte meckernd. »Sagt mein Vater immer.«
Die Lehrerin schritt den Gang ab. Näherte sich dem Jungen.
»Noch ein Wunsch?«
»Den Weltfrieden«, sagte Laura, mit Rastalocken und einer kleinen Tigerente an ihrer Federmappe.
»Das ist doch mal ein schöner Wunsch.« Die Lehrerin ging einen Schritt weiter. Blieb vor dem Jungen stehen. »Was ist mit dir, Tim?«
Der Junge sah langsam nach oben. »Mit mir?«, fragte er. Seine Augen fixierten die Lehrerin, ohne sich zu bewegen.
»Ja, mit dir. Du hast heute noch gar nichts gesagt. Welche Fähigkeit hättest du gern?«
Der Junge, der Tim hieß, bewegte den Kopf langsam von der einen zur anderen Seite. Dann starrte er die Lehrerin unverwandt an. »Ich hätte gern …«, begann er langsam, »ich hätte gern eine Klinge statt einer Zunge.«
Auf der Stirn der Lehrerin entstand eine Falte. »Du hättest gern was?«
Der Junge nickte mechanisch. »Ich hätte gern eine Klinge statt einer Zunge.«
Die Lehrerin blickte sich im Raum um und fixierte dann wieder den Jungen namens Tim.
»Und warum?«, fragte sie.
»Es ist doch ganz einfach«, sagte der Junge, der Tim hieß, »ich möchte die Menschen schmecken, während ich sie zerschneide.«
BUCH 1
I have whirl’d with the earth at the dawning,
When the sky was a vaporous flame;
I have seen the dark universe yawning,
Where the black planets roll without aim;
Where they roll in their horror unheeded,
Without knowledge or lustre or name.
H. P. Lovecraft, »Nemesis«
Kapitel 1
Der Intercity, auch kurz genannt IC, zwischen Dortmund und Frankfurt rumpelte widerwillig über die Gleise, das Fahrwerk und die Technik genauso veraltet wie die verkeimten Abteile im Inneren.
Der Zug, in dem Mia saß, hatte um 18 Uhr 36 seine Fahrt in Dortmund aufgenommen, um 22 Uhr 21 war Umsteigen in Frankfurt angesagt, und dann fuhr ein Regionalexpress weiter nach Gießen. Eine Weltreise, um nur wenige Hundert Kilometer zurückzulegen. Dritte Welt Deutschland.
Mia konnte nicht behaupten, dass sie gern Bahn fuhr. Sie wusste, dass früher die Eisenbahnwaggons Strafgefangene in Arbeitslager gefahren hatten. Auch wenn das glücklicherweise Geschichte war, liebte es die Bahn scheinbar noch immer, ihre Passagiere zu quälen. So kam es ihr jedenfalls vor. Deutschland war eines der wenigen Länder, in denen man noch immer in die Züge hochsteigen musste, weil Zug und Bahnsteig nicht auf einer Ebene waren, und wo man seine Koffer mit Gewalt nach oben wuchten musste und immer das Gefühl hatte, man müsse sich als kleiner Untertan den Weg nach oben in die Reichsbahn, Bundesbahn, Deutsche Bahn oder wie immer sie heute hieß, hart erarbeiten und verdienen. Wie es Leuten mit Gipsbeinen, Krücken oder Menschen mit Gehbehinderungen gelingen sollte, Bahn zu fahren, war Mia, die in einem Abteil saß, ein Rätsel. Aber nur weil sie über das Thema Barrierefreiheit in der Bahn nachdachte, hieß das nicht, dass auch bei der Bahn irgendjemand darüber nachdachte. Umsteigen oder zusteigen klang sehr ähnlich wie Bergsteigen, und so sollte es auch bleiben. Alles musste hier mit Anstrengung, Ärger und Frust verbunden sein, sonst war es keine typische Bahnreise, jedenfalls keine im IC. Vielleicht war das Kalkül: Wenn der Kunde nass geschwitzt und abgekämpft seinen Platz erreichte, durchströmten ihn Erleichterung und Glückseligkeit wie nach einer gelungenen Gipfelbesteigung, sodass der schlechte Zustand der Sitzpolster gar nicht weiter auffiel.
Mia, neunzehn Jahre alt, saß allein in einem der Abteile auf den speckigen Polstern, zwischen denen Kaugummis, Müll und Zigarettenkippen hingen, denn dieser Wagen kam aus der Zeit, in der man in Zügen noch rauchen durfte. Gefühlt kam der Zug allerdings aus der Zeit, als man den Tabak noch in Lederbeuteln am Gürtel mit sich trug und Zigaretten noch gar nicht erfunden waren. Mia studierte Theaterwissenschaften und wollte zum theaterwissenschaftlichen Diskurs der Uni Gießen, dort einige Leute treffen und am Abend noch ein wenig die Stadt unsicher machen. Die Lampe oben im Abteil flackerte wie in einem nordkoreanischen Foltergefängnis. Die Landschaft Nordrhein-Westfalens draußen war genauso trostlos wie das Innere des abgewetzten Wagens.
Es war einer von diesen ICs, die nur Abteile hatten und keine Großraumwaggons wie die sehr viel komfortableren ICEs. Die Abteile waren enge abgeschlossene Räume, wie Gefängniszellen.
Sie hörte lautes Grölen und Lachen auf dem Gang und zuckte zusammen. Sie hatte die Vorhänge zugezogen und hoffte, dass man sie in Ruhe lassen würde und sich nicht irgendeine Gruppe von Betrunkenen zu ihr setzen würde, oder irgendein anderer unangenehmer Trupp von der Sorte, die besonders gern IC und besonders gern am Abend Bahn fuhr. Die Bahn legte Wert auf solche Gäste und beeilte sich immer, Sparpreise extra für Fußballfans anzubieten, die zum Dank für den Schleuderpreis dann den gesamten Waggon auseinandernahmen. Das Bahnpersonal versteckte sich vor solchen Gruppen immer in seinen kleinen Kabuffs nahe der Lok und verzichtete komplett auf Fahrkartenkontrollen. Am allerbesten schwarzfahren ließ es sich folglich dann, wenn möglichst viele Hooligans, Betrunkene und Randalierer, die mit besagten Sparpreisen gelockt worden waren, die Züge bevölkerten. Dann sah man die Bediensteten der Bahn genauso häufig, wie man einen Menschen am Rande des Sonnensystems sehen würde – nämlich gar nicht.
Die Schatten liefen an ihrer Tür vorbei. Das heisere Lachen wurde leiser. Mia spürte ihr Herz schlagen. Sie atmete kurz durch, ging dann zum Vorhang. Zog ihn zögernd ein kleines Stück beiseite. Der Gang war leer.
Mia atmete erleichtert auf. Ihr Herz pochte noch in ihren Ohren.
Zum Glück kannte Mia den Film »Hostel« nicht. Ein Film, in dem Menschen, besonders Touristen, entführt wurden, die dann von reichen Sadisten gegen viel Geld gefoltert und getötet werden konnten. In »Hostel« leuchtete über den Zellen, in denen die Folteropfer saßen, immer ein Licht. Es war grün, wenn der Raum frei war, und rot, wenn dort gerade »gearbeitet« wurde. Was man normalerweise aber auch an den Schreien hörte.
Würde sie hier jemand schreien hören? Der Zug war fast leer, das Bahnpersonal hatte sich weit entfernt Richtung Lok versteckt, und die einzige Zivilisation, die an den Fenstern vorüberzog, war hier und da das Licht eines einzelnen Hauses oder Gehöfts. Es mussten Häuser sein wie das, in dem das Horror-Paar von Höxter seine Opfer festgehalten und gequält hatte. In »Hostel« waren es Lichter, die über den Zellen leuchteten. Auch hier leuchteten außen Lampen über den Abteilen des ICs. So als wollten sie sagen: Hier sitzt jemand allein, mit dem ihr euren Spaß haben könnt. Jemand, der sich nicht wehren kann. Und dem auch niemand helfen wird, wenn es ernst wird. Ja, es war besser, dass Mia diesen Film nicht kannte, ansonsten wäre ihr vielleicht klar geworden, dass die ICs der Bahn, mit ihren Abteilen, eine Art mobiles Hostel, eine Art mobile Gefängniszellen-Reihe waren, in der sich die Täter, wie in einem Laufhaus in Amsterdam, ihre Opfer durch die Scheibe hindurch anschauen konnten, bevor sie zu ihnen kamen. Ja, in der Tat, genau so wie in den Bordellen der holländischen Hauptstadt, wo die Freier ihre Huren in aller Ruhe in Augenschein nahmen.
Kurz war es still. Dann hörte sie, wie der Lärm wieder anschwoll. Die Gruppe war offenbar umgekehrt. Näherte sich Mias Abteil. Sie hörte die Schritte. Ihr Herz pochte in ihren Ohren und schlug im Takt der Schritte auf dem Flur.
Sie hoffte, dass das, was sie befürchtete, nicht geschehen würde, und dass die Gruppe Betrunkener erneut an ihrem Abteil vorübergehen würde. Doch das, was man befürchtete, geschah nun mal nur allzu oft.
Langsam öffnete sich die Abteiltür.
Sie blickte in ein Gesicht. Ein Paar Augen. Dahinter drängten sich noch mehr Menschen.
»Ist hier noch frei?«, fragte das Paar Augen.
Doch es war keine Frage.
Es war ein Befehl.
Kapitel 2
Es war ein Dienstag im Mai, und der Sommer stand direkt vor der Tür. Einer dieser üblen, brütenden, 40 Grad heißen Sommer in Berlin, voller Schlägereien, besoffener Touristen und schlafloser Nächte, einer dieser Sommer, der gefühlt Jahre dauerte und bei dem alle wahnsinnig wurden – nur noch schlimmer als in den letzten Jahren. Als auch schon die Seen austrockneten, die Wälder verbrannten, die verkrachten Existenzen sich die ganze Nacht prügelten und die alten Menschen in den Heimen reihenweise starben.
Winter is coming, war die ewige Drohung in dem Fantasy-Epos »Game of Thrones«, doch der Berliner Winter war in den letzten Jahren, mit ein paar kalten Tagen im Februar, komplett harmlos geworden. Summer is coming war in diesem Jahr – und würde es wahrscheinlich auch in allen kommenden Jahren sein – die reale Drohung in Berlin.
Clara überprüfte die Magazine, die Munition. Vor ihr auf dem Tisch lagen die Glock Kaliber 9 Millimeter Luger und die Sig Sauer. Vor ihnen der Schießstand und die Zielscheiben. Auf dem Sandboden blitzten von Zeit zu Zeit Patronenhülsen. Gedämpfte Schüsse klangen durch die Ohrschützer, vermischt mit Vogelgezwitscher aus dem nahen Wald. Denn mit den 3M-Ohrschützern konnte man leise Geräusche besser hören, während der Knall einer Pistole gedämpft wurde. Deswegen waren diese Ohrschützer auch bei Jägern sehr beliebt. Clara dachte kurz an den uralten Sommerhit »Vamos a la Playa« aus Italien von 1983. Die meisten glaubten, der Song beschreibe einen heißen Sommer, dabei handelte es sich, wenn man sich den Text einmal genauer anschaute, um die Beschreibung eines Strands nach einer Nuklearexplosion. Der Schrecken war halt überall, auch in einem schönen Strandlied.
Doch noch war Frühling, und es war Dienstag, und Clara war im Dienst. Am Montag war der Schießstand geschlossen. Dafür war er am Sonntag geöffnet. »Sunday is gunday«, sagte man in Amerika. Oder »gun is fun«.
»Du zuerst?«, fragte Clara. Sie wusste, dass gun nicht unbedingt fun bedeuten mussten, sondern die schlimmsten Verletzungen hervorrufen konnten. Sie wusste aber auch, dass die Tatsache, niemals etwas mit Waffen zu tun haben zu wollen, einen nicht davor beschützte, von einer Waffe getötet zu werden.
Sophie nickte. Sie war Claras Kollegin und arbeitete dem LKA im Team der Rechtsmedizin zu. Sie hatte als Rechtsmedizinerin noch nicht so viel geschossen wie Clara und auch längst nicht so viel Erfahrung auf dem Schießstand, wollte es aber lernen. Ihr Freund, Frank Deckhard, der auch Polizist war, hatte sie einmal mit auf den Schießstand genommen, um ihr alles ein bisschen beizubringen. Die beiden hatten sich allerdings bereits während der ersten Übungsstunde derart gestritten, wie es halt oft passierte, wenn Partner einander etwas beibringen wollen, dass Sophie sich danach an Clara gewandt und Clara ihr versprochen hatte, sie beim Schießenlernen ein wenig zu unterstützen.
»Hast du die Ohrschützer angestellt?«, fragte Clara.
»Denke schon«, antwortete Sophie, »es hat eben gepiept.«
»Reib dir die Hände«, sagte Clara. »Wenn du das Reiben laut hörst, dann sind die Dinger an.«
Sophie rieb sich die Hände. »Höre ich«, stellte sie fest. »Und die Vögel höre ich auch.«
»So soll es sein. Dann aufstellen!«
»Fünf Meter?«
Clara nickte. »Okay.«
Heute übten sie mit einer Sig Sauer, weil das die Waffe der Berliner Polizei war. Hart, kompakt, zuverlässig. Die J.P. Sauer GmbH war aus der 1751 gegründeten Waffenmanufaktur Lorenz Sauer hervorgegangen. SIG stand für »Schweizerische Industrie Gesellschaft«, zu der das Unternehmen rund dreißig Jahre gehört hatte. Ansonsten schoss Clara mit einer Glock. Sechzehn Schuss, Kaliber 9 Millimeter Luger, aus Österreich. Die Lieblingswaffe der US Police. »Our Austrian friend«, sagten die US-Polizisten dazu. Und Clara Vidalis musste ihnen recht geben. Die Waffe schoss wirklich gut und war leicht. Dafür hatte sie mehr Rückstoß, weil sie mit siebenhundert Gramm weniger wog als die schwereren Waffen, etwa die Sig Sauer, die durch ihre größere Masse stabiler waren. Sie hatte auch keinen manuellen Sicherungshebel, was bedeutete, dass man jederzeit mit ihr schießen konnte. Durch die Umgestaltung des Griffrahmens war sie für Nutzer mit kleineren Händen und kürzeren Fingern ideal und daher bestens geeignet zur persönlichen Verteidigung und auch, um sie im Verborgenen zu tragen.
Irgendwann würde Clara Sophie auch zeigen, wie man mit einer Glock schoss. Nur heute noch nicht.
Sophie feuerte. Beide standen hinter der Linie. Das Wichtigste auf dem Schießstand waren die drei Regeln: Richte die Waffe nur auf das, auf das du schießen willst, behandele jede Waffe so, als wäre sie geladen, und halte den Finger nur dann am Abzug, wenn du in der nächsten Sekunde schießen willst.
Der Schuss landete weit außen. »Na ja«, knurrte Sophie. »Genau ins Schwarze war das nicht unbedingt.«
»Nicht negativ denken, nicht kommentieren«, gab Clara zurück. »Das beeinflusst deinen nächsten Schuss. Schießen, schauen, wieder schießen. Nicht zu viel denken.«
Sophie gab mehrere Schüsse hintereinander ab, die sich allmählich der Zielscheibe näherten.
»Jetzt das Magazin wechseln!«
Sophie ließ das Magazin aus der Waffe fallen und schob das neue hinein.
»Werfe ich das alte einfach so auf den Boden?«
»Hast du ja schon«, sagte Clara.
»Okay, und war das richtig, die runterzuschmeißen?«
»Natürlich, was sonst?«, fragte Clara. »Glaubst du, du hast im Ernstfall noch Zeit, das Ding säuberlich auf den Boden zu legen oder umständlich in die Tasche zu stecken, wenn das Wildschwein angerannt kommt und dich angreifen will?«
»Das Wildschwein? Welches Wildschwein? Wir sind doch hier nicht bei Asterix.«
»Doch, genau, das Wildschwein im Grunewald. Der ist hier ja gleich um die Ecke. Wir reden hier von Wildschweinen, nicht von Menschen. Zielübungen auf Menschen sind verboten.«
»Es sterben aber mehr Menschen durch Menschen als durch Wildschweinangriffe.«
»Erkläre das mal den Politikern.«
»Ich war mal in den USA auf einem Schießstand«, erzählte Sophie, »da schießen sie auf Zombies, Monster und sogar auf Kamele.«
»Aber hoffentlich keine echten Kamele?«
»Nein, das sind alles Figuren. Den Kamelen muss man den Turban abschießen.«
»Immerhin nicht den Höcker. Wann warst du dort?«
»2008. Ich war da mit meinem Ex-Freund. Der kam aus Österreich.«
»Wie die Glock.«
»Genau. Er hatte aber keine, der war Anwalt.«
Clara grinste. »Die haben andere Waffen. Wusste schon der Pate Don Corleone: Ein Anwalt kann mit seinem Aktenkoffer mehr stehlen als hundert Männer mit Kanonen.«
»Warst du nicht auch mal mit einem Unternehmensberater zusammen? Ist ja fast so ähnlich.«
»Ja.« Clara nickte. Ähnlich waren sich Berater und Anwälte in der Tat, fand sie.
Sophie sprach weiter. »Jedenfalls ist, gerade als wir in der Luft waren, die Sache mit diesem Fritzl aufgeflogen. Du weißt ja, der Typ, der seine Tochter jahrzehntelang im Keller eingesperrt hat.«
»Hat er mit ihr nicht sogar Kinder gezeugt?«
»Ja, das auch noch. Jedenfalls wussten alle in Amerika schon davon, nur wir nicht, weil wir da gerade über den Atlantik geflogen waren. Als die Amis rausfanden, dass mein Freund aus Österreich kam, wollten sie alle wissen, was denn dieser Fritschl für ein Mensch sei.«
Clara lachte. »So als ob dein Freund ihn automatisch kennen müsste, wenn er aus Österreich kommt, weil das ja so klein ist?«
»Ja, so in etwa. Das Thema Fritzl war jedenfalls das Dauerthema während des gesamten Urlaubs.« Sie befühlte kurz die Waffe in ihrem Holster. »Die Horrormeldungen lassen einen nicht in Ruhe.«
»Das Wildschwein hier auch nicht!« Clara richtete sich auf. »Weiter.«
Sophie schoss das neue Magazin leer.
Clara kniff die Augen zusammen. »Gar nicht schlecht. So, dann nachladen.« Sie gingen zum Tisch, auf dem die Patronen und die anderen Magazine lagen. Daneben lag Klebespray, um Zielscheiben an die Holzgerüste zu kleben, und zwei Druckverbände, für den Fall der Fälle.
»Meine Fingernägel sind zu lang für dieses verdammte Nachladen«, knurrte Sophie, die sich redlich abmühte, die Patronen in das Magazin zu bekommen.
»Darum habe ich keine langen Fingernägel mehr«, erklärte Clara. »Mir sind die früher immer abgesplittert.«
»Ist echt ungerecht«, beschwerte sich Sophie. »Männer haben viel härtere Fingernägel als Frauen. Dabei sind Frauen diejenigen, die die Nägel meist lang tragen.«
»Oder auch nicht. Im Notfall darfst du nämlich nicht davon abhängig sein, dass irgendein Ausbilder dir die Magazine füllt, so wie das immer beim Presseschießen der Polizei ist.«
»Tja, ich bin ja auch nur Rechtsmedizinerin und keine echte Polizistin. Ich musste ja diesen Polizeitest nicht machen.«
»Ich würde ihn heute wohl auch nicht mehr schaffen«, sagte Clara. »Und es gibt immer weniger, die den noch bestehen. Derzeit nur fünfzehn Prozent. Das Übelste ist dieses ständige zwischen den Stangen Hin- und Herlaufen. Damals habe ich dabei fast gekotzt.«
»Und Psychotests machen die doch sicher auch?«
»Na klar. Tausende von Fragen. Und dazwischen immer dieselbe Frage: Haben Sie schon mal einen Kuli geklaut?«
»Und wenn man da versehentlich Ja sagt?«
»… ist man raus.« Clara musste grinsen. »Ich muss noch an die letzten Worte denken, bevor es dann zwei Wochen später losging: Tätowieren Sie sich nicht und werden Sie nicht straffällig. Falls doch, sagen Sie es uns. Wir erfahren es sowieso.« Clara schaute etwas belustigt zu, wie Sophie die Patronen in das Magazin quälte.
»Ich helf dir, sonst sitzen wir im Hochsommer noch hier.« Sie nahm das Magazin. »Wenn du allerdings öfter schießen willst, führ mal ein ernstes Gespräch mit deinem Maniküre-Studio.«
Sophie verkniff das Gesicht. »Schwere Entscheidung.«
»Okay«, sagte Clara, »alles geladen? Magazine voll?«
»Jawohl!«
»Dann drei Meter zurück und das Ganze noch einmal.«
Clara dachte an die Worte ihres Ausbilders damals. Wir erfahren es sowieso. Heute erfuhr die Polizei so gut wie nichts mehr. Das Verbrechen war digital viel stärker hochgerüstet als die Polizei. Das Einzige, was blieb, war ein Filter. Ein Filter im Kopf des Polizisten. Aus jahrelanger Erfahrung zu wissen, wenn etwas schieflief oder schieflaufen konnte. Irgendwann wusste man, wie Dinge aussehen, die nicht sein sollten. Warum hängt dieser Typ da rum, wo er nichts zu tun hat? Warum treffen sich dort gerade diese drei Männer? Es war dieser Filter, den man als guter Polizist hatte. Und die, die ihn nicht hatten, blieben nicht lange Polizisten. Oder am Leben.
Die Schüsse hallten. Clara kniff blinzelnd die Augen zusammen.
»Gar nicht schlecht, aber du warst zu gierig am Abzug«, stellte sie fest.
»Zu gierig am Abzug?«
»Ja, du hast zu schnell abgedrückt. Und du musst mit der linken Hand stärker sichern. Sonst geht der Schuss immer nach links unten. Wie dort.« Sie zeigte auf die Scheibe. »Siehst du?«
Sophie nickte. Zufrieden mit dem Ergebnis war sie nicht.
»Dann weiter«, ordnete Clara an. »Wir haben noch fünfzig Patronen. Die schießen wir heute noch leer.« Sie begann, das nächste Magazin zu füllen.
»Danach kann Tante Sophie Victoria erzählen, was Mama ihr heute Schönes beigebracht hat.«
»Oder auch nicht«, sagte Clara. Ihre Tochter Victoria, die mittlerweile knapp zwei Jahre alt war, wollte sie nicht als Erstes mit ihrem Job, Pistolen und dem Tod konfrontieren. Victoria würde früh genug Fragen stellen. Mama, was arbeitest du denn so? Claras Mann Martin Friedrich wurde wegen seiner Vorliebe für Shakespeares problematischen Helden Macbeth MacDeath genannt. Er arbeitete als Profiler beim LKA, wo er die operative Fallanalyse leitete, und ging Clara in letzter Zeit zunehmend auf die Nerven, da er noch ein weiteres Kind wollte. Clara, an der die meiste Arbeit hängen blieb, wenn nicht gerade Sophie und ihr Freund Frank Deckhard auf das Kind aufpassten, war nicht ganz sicher, ob sie das auch wollte.
Clara hatte drei Magazine gefüllt, Sophie mit Ach und Krach eines.
»Alles klar«, sagte Clara. »Laden, Holstern und dann schießen.«
Sophie grinste. »Yes, Madam.«
Kapitel 3
Ist hier noch frei?«
Es war keine Frage gewesen. Es war ein Befehl.
Sie kamen herein. Einer, zwei, drei, vier …
Draußen zog irgendein Kaff vor dem Fenster vorbei.
Mia hielt ihre Tasche fest, als wäre irgendein geheimnisvolles Elixier darin. Doch da war nichts. Keine Hilfe, keine Rettung, nichts.
Der Letzte von ihnen ließ die Tür zuknallen. Und zog den Vorhang wieder zu.
»Ein Mädchen«, sagte einer, so als wäre sie gar nicht da.
»Das Mädchen«, sagte ein anderer.
»Ein Neutrum«, sagte der Dritte.
»Alles, was ein Neutrum ist, darf missbraucht werden. Das Ding, das Kind, das Mädchen …«
Der Anführer grinste sie an.
»Wie heißt du?«, fragte er.
»Mia«, sagte sie tonlos.
»Mia …«, wiederholte der Anführer.
Angst kroch in Mia hoch. Trotz ihres pochenden Herzens atmete sie leise, so leise sie konnte. Nicht nur wegen der bedrohlichen Stille. Wenn die anderen hörten, dass sie laut atmete, merkten sie, dass sie Angst hatte. Und das war wie bei den Raubtieren. Sie merkten, welche Antilope am meisten Angst hatte, weil sie am schwächsten war. Und damit umso leichtere Beute. Sie spürte einen Luftzug, der von irgendwoher unter ihrem Sitz hervordrang. Die Luft war kalt und muffig, als käme sie aus einer unterirdischen Höhle.
»Und du?«, fragte sie dann. Vielleicht war es schlau, ihn oder all die anderen in eine Unterhaltung zu verwickeln. Vielleicht würde dann alles gut werden. Doch sie spürte, dass es nicht gut werden würde. Dass die, die gerade in das Abteil eingedrungen waren, irgendetwas wollten, irgendetwas von Mia wollten.
»Ich?« Sie sah noch mehr Grinsen. »Ich heiße Tod.«
Kapitel 4
Henning Lang von der Bundespolizei Dortmund/Hagen hatte den Anruf entgegengenommen und hörte aufmerksam zu.
Der Anruf kam von einem Zug der Bahn an die Bundespolizei. Das geschah häufiger. Zum Beispiel bei einem sogenannten »Personenschaden«, wenn sich ein Selbstmörder auf die Schienen gelegt hatte. Der Zug musste dann unter Umständen auf der Strecke bleiben, weil der Zug selbst als Beweisstück galt, und die Passagiere mussten ausharren, bis die Polizei den Zug wieder freigab. Bis dahin war die Strecke komplett gesperrt, und alle anderen Züge wurden umgeleitet. Die Bergung der Leiche konnte, abhängig von ihrem Zustand, bis zu mehreren Stunden in Anspruch nehmen. Die Fahrgäste durften den Zug in dieser Zeit nicht verlassen. Das lag einerseits an den stromführenden Leitungen und andererseits schlicht und einfach daran, dass sich Menschen selten in Bahnhöfen auf die Schienen legten, sondern eher auf den offenen Strecken, wo die Züge bis zu dreihundert Stundenkilometer schnell fuhren. War das Schlimmste überstanden, fuhr der Zug, wenn die Spurensicherung fertig war, zum nächsten Bahnhof, wo die Fahrgäste in einen neuen Zug gesetzt wurden. Unterdessen waren die Rettungssanitäter und schließlich die Kriminaltechniker mit Gummihandschuhen auf den Schienen. Männer mit der Aufschrift »Notfallteam« auf der orangefarbenen Weste. Dann wurde den Gästen gesagt, doch bitte nicht aus dem linken (oder aus dem rechten) Fenster zu sehen, weil dort normalerweise das lag, was noch von dem Suizidenten übrig war. Unser Zug wird in Schrittgeschwindigkeit langsam an der Unfallstelle vorbeifahren, dann in normaler Geschwindigkeit zum nächsten Bahnhof, wo ein Ersatzzug für Sie wartet. Bitte schauen Sie nicht aus dem linken Fenster. Was natürlich dazu führte, dass viele Gäste erst recht aus dem linken Fenster schauten. Und die nächsten Nächte nicht schlafen konnten. Ebenso wie der Zugführer, der, ohne Schuld, einen Menschen überfahren hatte.
Meist konnte der Zug nach der Bergung der Leiche respektive ihrer Reste langsam zum nächsten Bahnhof weiterfahren, da der menschliche Körper einem Zug aus Stahl nicht wirklich etwas entgegenzusetzen hatte. Den stärksten Schaden nahm in der Regel die Spitze des ICE, die jedoch auch nur aus Plastik bestand und dem Zug eine stärkere Aerodynamik verleihen sollte, für die Fahrtüchtigkeit aber nicht wirklich relevant war. Leider waren Personenschäden Alltag bei der Deutschen Bahn. Seit einiger Zeit hatte die Bahn firmeneigene Psychologen eingestellt, da jeder Lokführer in seinem Berufsleben im Schnitt vier Menschen überfuhr, die meisten davon Suizid-Kandidaten. Da war es günstiger, die Mitarbeiter gleich konzernintern behandeln zu lassen, anstatt das ganze Prozedere teuer auszulagern.
Bei dem heutigen Anruf jedoch ging es um etwas anderes. Angerufen hatte ein Zugbegleiter namens Klose von der Deutschen Bahn, der Henning Lang von der Bundespolizeidirektion Dortmund/Hagen erreichte.
Lang hörte aufmerksam zu. Auf seinem Tisch lag das Buch »Mindhunter«, »Die Seele des Mörders«, von John Douglas vom FBI, dem John Douglas, der die FBI-Abteilung für Verhaltensforschung gegründet und die ersten Interviews mit Serienkillern geführt hatte. Ed Kemper und Jeffrey Dahmer waren seine Gesprächspartner gewesen. Besonders aber immer wieder Ed Kemper. Lang hatte sich oft gefragt, ob er einmal einen ähnlichen Fall haben würde, hielt dies aber für fast ausgeschlossen. Sollte dies jedoch jemals geschehen, wollte er vorbereitet sein, und darum hatte er das Buch gelesen. Und las immer wieder darin, wenn er einmal Zeit hatte.
»Mord«, stammelte Klose von der Bahn.
»Aber nicht im Orient Express?« Manchmal konnte sich Lang einen dummen Spruch nicht verkneifen.
»Nein, so gar nicht. Mord im IC, Höhe Siegen gegen 20 Uhr«, stotterte Klose. »Ein … totales Massaker. Hier ist überall Blut!«
»Ein totales Massaker?«, fragte Lang.
»Ja, das sagte ich. Hören Sie schlecht?«, stieß Klose am anderen Ende hervor. Seine Stimme überschlug sich fast. »Der Notarzt war da, der hat aber gleich gesagt, dass er nichts mehr machen kann. Und er hat gesagt, dass ich sofort die Polizei anrufen soll.«
»Ganz ruhig«, versuchte Lang, Klose zu beschwichtigen. »Bleiben Sie vor Ort, wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen. Und fassen Sie nichts an!«
Er stand auf. Wahrscheinlich übertrieb dieser Zugbegleiter maßlos. Er war halt kein John Douglas. Wahrscheinlich gab es nicht mal eine Leiche, sondern irgendwelche Prolls hatten in dem Abteil mit Ketchup verfrühtes Halloween gespielt.
Doch Klose hatte nicht übertrieben. Zwanzig Minuten später stand Lang in dem Abteil. Verdammt, dachte er, der Mann hatte nicht gelogen. Das war kein Massaker. Es war schlimmer, viel schlimmer. Er kniff die Augen zusammen. Versuchte, die Bilder zu vergessen. Aber das ging nicht, genauso wie die Fahrgäste die zerrissene Leiche eines Selbstmörders auf den Bahnschienen nicht vergessen konnten. Manche Dinge brannten sich auf eine perverse Weise ins Gehirn ein, wie eine Virendatei auf dem Computer, die man nie wieder löschen konnte.
Klose stand ganz in der Nähe auf dem Gang. Er wollte sich das Horrorszenario nicht noch einmal anschauen.
Lang nahm sein Smartphone. Machte Fotos. Bereitete eine E-Mail vor. Eigentlich war es verboten, solche Fotos digital zu schicken, aber das war Lang in diesem Fall herzlich egal. Er schüttelte noch einmal den Kopf. Dann sah er das Symbol. Es war in Blut an die Scheibe geschmiert. Und auf die Sitze. Und auf das Opfer.
»Haben das die Täter mit ihr angestellt?«, fragte er und drehte sich zu Klose um. Der sagte nichts. Was sollte er auch sagen? Natürlich waren es die Täter gewesen. Wer sonst?
Einer der Schutzpolizisten namens Ralf hielt sich ein Taschentuch vor die Nase. Wer Jäger war, wusste, dass aufgebrochene Tiere furchtbar stanken. Bei Menschen war das leider nicht anders.
»Ich habe gehört, Sie interessieren sich für Ritualmorde, oder wie das heißt«, sagte Ralf.
»Geht so«, antwortete Lang.
»Was machen Sie jetzt?«, fragte Klose vom Gang aus.
»Wir schicken sofort Kollegen vorbei«, sagte Lang.
»Wann können die da sein?«, wollte Klose weiter wissen.
Lang schaute auf die Uhr. »Ich weiß es nicht. Das ist hier eine Nummer zu groß für uns. Wir müssen das BKA rufen.«
»Bundeskriminalamt?«, fragte Klose.
»Ja. Besonders deswegen.« Er schaute auf das blutige Symbol an der Scheibe.
Lang beugte sich über sein Smartphone und bereitete eine E-Mail vor. Schob die Fotos in die Mail. Das von dem Symbol. Und das, auf dem man sehen konnte, was die Täter mit ihr gemacht hatten. Adressat war Maren Kaiser, Oberkommissarin beim BKA. Lang hatte irgendwann einmal einen Vortrag von Kaiser gehört. Da ging es um Serien- und Ritualmorde, und um einen bizarren Killer in Berlin, der sich Der Totenzeichner nannte. Lang wartete ein paar Minuten. Dann rief er sie auf dem Festnetz an. Nichts. Dann das Handy. Nach dreimal Klingeln meldete sie sich.
»Kaiser.«
»Hier ist Lang, BuPo Dortmund. Ich habe Ihnen etwas geschickt, das Sie interessieren könnte.«
»Per Mail?«
»Ja.«
»Warten Sie, ich schaue nach.«
Kaiser nestelte offenbar an ihrem Smartphone herum. Stille.
»Wo ist das?«, fragte sie tonlos.
»IC. Heute Abend. Höhe Siegen.«
Kaiser stockte ein paar Sekunden. »Das haben die in der Bahn gemacht?«
»Sieht so aus.«
»Und dieses Symbol?«
»Das waren wohl auch die Täter. Und darum rufe ich an.« Lang atmete aus und lehnte sich zurück. »Es gab doch damals diesen Fall in Berlin mit diesem Verrückten, der den Leichen Symbole in die Haut geritzt hat?«2
»Der Totenzeichner, so wurde der genannt«, sagte Kaiser. »Der Totenzeichner hatte seinen Opfern immer das gleiche Symbol in die Haut geritzt.«
Lang nickte. Menschen, die so etwas machten, waren oft Serienmörder. Und das bedeutete, dass all diese Mörder, wer immer sie waren, wieder morden würden, solange niemand sie aufhielt.
»Könnte das hier auch kultisch sein? Oder ein Ritualmord?« Er versuchte, sich an die entsprechende Passage in dem »Mindhunter«-Buch zu erinnern.
»Möglich. Bitte beschlagnahmen Sie in jedem Fall den Zug und lassen Sie ihn ins nächste Zugdepot fahren. Wir könnten ein Team dorthin schicken oder …«
»Oder?«
»Oder«, sagte Kaiser, »wir schicken gleich die, die damals diesen Totenzeichner gejagt haben.«
»Meinen Sie, es ist derselbe?«
»Derselbe Killer? Eher nicht. Soweit ich weiß, ist der, den Sie Totenzeichner nannten, mittlerweile über alle Berge. Aber es scheint ein Ritualmord zu sein.«
»Haben Sie nicht zufällig einen Experten, der sich da auskennt?«, fragte Lang.
»Haben wir sogar. Sogar einen, der mal beim FBI war«, sagte Kaiser. »Wir haben einen, der ist zu 25 Prozent bei uns und zu 75 Prozent beim LKA Berlin. Der war damals auch bei dem Fall mit dem Totenzeichner involviert. Sie erinnern sich vielleicht an meinen Vortrag dazu.«
»Genau deswegen habe ich mich gleich bei Ihnen gemeldet.«
Kaiser schien sich geschmeichelt zu fühlen. »Einer der besten Profiler, die es in diesem Land gibt. Das muss ich neidlos anerkennen. Sein Team ist auch super. LKA 113.«
»Friedrich, richtig?«, fragte Lang. Er hatte sich den Namen damals auf die Innenklappe des »Mindhunter«-Buches notiert, und eben war er ihm wieder eingefallen.
»Ja, Martin Friedrich. War in der Tat früher beim FBI. Hat Robert Ressler und John Douglas getroffen.«
»John Douglas?« Langs Augen weiteten sich. Er sah das Buch vor seinem inneren Auge vor sich und las den Namen John Douglas auf dem Buchcover. »Wäre gut, wenn wir den dabeihätten. Oder sein Team.«
Kaiser schien nachzudenken. Oder auf die Fotos zu schauen. Oder gerade zu versuchen, nicht auf die Fotos zu schauen.
»Ich werd sehen, was ich machen kann«, sagte sie.
Lang legte auf. Musste ebenfalls noch einmal auf das schauen, was er Kaiser gerade geschickt hatte. Allerdings im Original. Und kniff die Augen zusammen.
Kapitel 5
Clara hatte sich vor dem LKA von Sophie verabschiedet und war in die Kaffeeküche der Abteilung LKA 113 gegangen. Neben der alten, rumpelnden und fauchenden Kaffeemaschine stand mittlerweile eins von diesen kleinen Kapselgeräten. Clara schenkte sich trotzdem einen Kaffee aus der betagten Maschine ein und schüttete Milch und Süßstoff hinzu. Sie fand, dass der altmodische Kaffee besser schmeckte, und außerdem hielt sie den Kapselverbrauch bei den Mengen an Kaffee, die sie manchmal trank, für überteuert und reine Rohstoffverschwendung. Während der Schwangerschaft mit der kleinen Victoria hatte sie so gut wie keinen Kaffee getrunken, dafür trank sie jetzt wieder umso mehr.
Sie betrachtete ihre Finger. Sie waren, obwohl sie sich gründlich die Hände gewaschen hatte, noch immer ein wenig grauschwarz, wie immer, wenn sie Patronen eingelegt und geschossen hatte.
Sie hörte schwere Schritte auf dem Gang. Das konnte nur ihr Chef, Kriminaldirektor Winterfeld, sein. Die Schritte erkannte sie sofort. Er kam mit seiner leeren Kaffeetasse in die Küche, in der anderen Hand eine Zigarilloschachtel und einen Brief. Er trug eine dunkle Hose, ein graues Sakko und hatte die Krawatte halb geöffnet.
»Ah, Señora, buenos dias«, sagte er. Er begrüßte sie öfter auf Spanisch, da ein Teil von Claras Familie aus Spanien kam. »Sie waren Schießen mit Sophie? Konnten Sie ihr etwas beibringen?«
»Ja, sie lernt schnell.«
»Sig Sauer, Glock oder was ganz anderes?«
»Erst mal Sig Sauer, dann irgendwann Glock.«
»Sehr gut.« Er nickte bestätigend und kratzte sich mit der Kante des Briefs am Kopf. »Ich brauche erst mal einen Kaffee und einen Zigarillo am Fenster. Kommen Sie mit?«
Clara nickte. »Gern.«
Winterfeld schenkte sich ebenfalls eine Tasse ein, fluchte, als sie nur noch halb voll wurde, kam aber auch nicht auf die Idee, neuen Kaffee zu kochen, und ließ die leere Kanne auf der Heizplatte der Maschine stehen.
Sie gingen zum Fenster auf dem Flur des LKA mit Blick auf den Innenhof. Dort sah man einige krumme Sträucher und ein paar Einsatzfahrzeuge stehen.
»Was ist denn los?«, fragte Clara.
»Ach«, schnaubte Winterfeld, öffnete das Fenster, zündete sich seinen Zigarillo an und paffte in die Frühlingsluft. »Das wird wieder ein beschissen heißer und chaotischer Sommer. Wissen Sie, was die Hauptstädte mit den höchsten Mordraten auf dieser Welt alle gemeinsam haben?«
»Hm, mal schauen. Das sind El Salvador«, begann Clara, »Caracas …«
»Mexiko City, Bogotá, genau …«, fuhr Winterfeld fort und stieß Qualm aus. »Was haben die gemeinsam?« Er sah Clara erwartungsvoll an.
»Es ist überall warm?«, fragte Clara und trank von ihrem Kaffee.
»Richtig. Je heißer es wird, desto mehr Gewalt. Geht hier auch schon los.«
»Waren Sie nicht eben mit Rudolf essen?«, fragte Clara.
»War ich. Kollege Rudolf von der Zollfahndung. Der hat wieder Storys erzählt.« Winterfeld blickte sich um. »Die Zollfahndung war gerade unterwegs, LKA mit acht gemeinsamen Ermittlungsgruppen, LKA 43, Rauschgift und Arzneimittelkriminalität. Die haben eine Cannabis-Plantage unter einer Kfz-Werkstatt in Schöneberg gefunden. Zweitausendsechshundert Pflanzen. Können Sie das glauben? Aber das ist nicht alles. Heroin kommt aus dem Mittleren Osten, synthetische Drogen aus den Niederlanden, Marihuana aus Spanien oder Nordafrika und Crystal Meth aus Tschechien.« Er nickte zu sich selbst. »Das bringt die Leute um. Früher haben die Dandys Opium genommen, heute gibt es in den USA eine regelrechte Schmerzmittel-Epidemie. Woran, glauben Sie, ist Prince im April 2016 gestorben?«
»Hat der sich nicht etwas zusammengemischt?«
»Ja. Habe dazu letztens auch mit von Weinstein gesprochen. Rudolf sieht das genau so. Prince hat Fentanyl mit anderen Schmerzmitteln gemischt. Das war dann der letzte Cocktail seines Lebens.«
Clara schwieg. Sie kannte von Weinstein, den stellvertretenden Chef der Rechtsmedizin, gut. Der Mann hatte nicht gerade die politische Korrektheit erfunden und machte öfter mal einen dummen Witz, auch wenn es nicht angemessen war. Das hatte er mit seinem Kollegen Winterfeld gemeinsam.
»In Chicago«, sagte Winterfeld, »ist der Krieg kürzlich zwischen den Gangs noch einmal richtig aufgeflammt. Wissen Sie, warum?«
»Warum?« Ein wenig kam sich Clara vor wie bei der Sendung mit der Maus.
»Ein Grund ist die Hitze im Sommer. Womit wir wieder beim Thema wären. Der andere Grund ist Facebook. Die beschimpfen sich alle auf den sozialen Netzwerken. Dann gibt es mehr Unfrieden und mehr Gangster, die sich gegenseitig erschießen.«
»Zyniker sagen, dass sich damit ein Problem löst.«
»Das sagen nicht nur die Zyniker«, sagte Winterfeld, »das sage auch ich. Es gibt auch Gerüchte, dass die Chicago Cops extra durch falsche Posts Hass schüren, um die Anzahl der Gangster durch interne Kriege zu dezimieren.«
»Das ist aber nicht sehr nett.«
»Und auch nicht sehr elegant. Kann man auch geordneter machen. Die Chinesen kontrollieren gleich ihre sozialen Netzwerke. Die brauchen da nicht zu improvisieren.«
»Und die Hitze?«, fragte Clara. »Sie fingen an mit der Hitze.«
»Durch die Drogen und die Hitze werden die alle noch viel verrückter«, sagte Winterfeld und schüttelte den Kopf. »Bald brauchen wir hier chinesische Überwachungsmethoden, sonst herrscht hier Bürgerkrieg.«
»Solange wir nicht verrückt werden …«, sagte Clara.
»Meine Ex-Frau wird auch verrückt.« Winterfeld blickte auf den Brief.
»Sabine?« Clara kannte die Story von Winterfelds zweiter Scheidung. Das Ganze war noch in Hamburg über die Bühne gegangen und nicht schön gewesen.
»Es geht schon wieder um das Haus«, knurrte Winterfeld. Er schaute Clara an. »Gibt es auch Auftragskiller, die man auf Ex-Frauen ansetzen kann?«
»Das habe ich jetzt aber nicht gehört.«
»Bei uns war es der Klassiker«, sagte Winterfeld, halb zu Clara, halb zu sich, und blies Rauch aus dem Fenster.
»Der Auftragsmord? Dann will ich lieber nichts davon wissen.« Sie grinste. »Sonst muss ich noch gegen Sie ermitteln.«
»Nein. Natürlich die Scheidung«, knurrte Winterfeld. »Außerdem bin ich hier für die dummen Witze zuständig. Scheidungsantrag im Januar. In dem Monat werden die meisten Scheidungen eingereicht. Das ist fast immer so. Ich habe da einen Bericht aus den USA gelesen. Nach Weihnachten stellen die Leute fest, dass sie mit ihrem Partner kein weiteres Weihnachten erleben wollen. Da ist der Scheidungsantrag dann quasi so etwas wie ein weiterer guter Vorsatz für das neue Jahr, gleich nach mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören und abnehmen.«
»Hat’s funktioniert?«
Winterfeld zuckte die Schultern. »Meine Ex hat quasi in einer Sekunde neunzig Kilogramm verloren, als sie sich von mir trennte.«
Clara nickte. Sie war seit zweieinhalb Jahren mit Martin Friedrich, genannt MacDeath, dem Leiter für operative Fallanalyse, verheiratet. So etwas war jobtechnisch immer etwas heikel. Würde es ihnen auch passieren können, dass es irgendwann einmal zur Scheidung kam? Natürlich nicht, dachte sie. Aber dachten nicht alle, dass ihnen so etwas niemals passieren würde?
»Die Frauen, die in den USA schlau sind, lassen sich in Kalifornien scheiden. Das Land der Träume bei den Hochzeiten – und der Albträume, wenn es zur Scheidung kommt.« Winterfeld stippte Asche aus dem Fenster. »Die haben ein hartes Eherecht, alles wird geteilt. Kommt noch aus der Zeit, als die Siedler aus dem Osten Amerikas kamen. Sie sind mit ihren Familien zusammen ins Risiko gegangen, dann sollte beim Auseinanderbrechen auch ehrlich geteilt werden. Manche haben daraus schon ein Geschäftsmodell gemacht.«
»Ach ja?« Clara kannte ihren Chef mittlerweile. Er erwartete bei der Sache mit seiner Frau gar keinen Rat von ihr, er wollte einfach nur ein bisschen reden. Idealerweise mit einer Frau, wahrscheinlich weil er glaubte, dass sich dann der Ärger mit seiner Ex-Frau einfacher löste.
»Ja, das sind Frauen, die hängen in den Bars rum, wo die NBA-Spieler hingehen, bieten den Lakers oder Clippers ungeschützten Sex an. Dann werden sie schwanger, und dann kriegen die NBA-Blödmänner eine Vaterschaftsklage an den Hals inklusive DNA-Test. Wenn die Frauen einen guten Kettenhund von Anwalt haben, kriegen sie achtzehn Jahre lang fünfundzwanzigtausend Dollar im Monat. Steuerfrei, versteht sich. In Beverly Hills gibt es eine ganze Reihe von Anwaltskanzleien, die nur auf so etwas spezialisiert sind. Angeblich fordern einige Anwälte auch die Frauen auf, den Lakers ungeschützten Sex anzubieten.«
Clara schüttelte den Kopf. »Dummheit und Geld bleiben halt selten zusammen.«
Winterfeld schaute auf den Brief. »Tja, was soll ich sagen. Vielleicht bin ich auch nicht der Richtige, um da Urteile zu sprechen. Werde nachher mal mit meinem Anwalt sprechen, wie wir das Thema endlich zu einem Ende bringen können.«
Er drehte sich um. Hermann, der IT-Experte des LKA 113, hatte sich leise genähert.
»Na, alter Lötkolbenbastler, schleichst dich hier wieder an«, begrüßte ihn Winterfeld, »was willst du denn schon wieder? Neue Festplatten gibt es erst, wenn wir im Herbst noch Budget haben.«
Hermann verzog keine Miene. »Die Sache ist leider nicht witzig.«
Winterfeld hob die Augenbrauen. »Was ist denn los?«
»Eine Kollegin vom BKA ist gerade am Telefon. Könnt ihr kurz dazukommen?«
Kapitel 6
Es war 2 Uhr 30.
Alle schliefen. Seine Eltern. Seine Schwester. Und die Scheißnachbarn wahrscheinlich auch. Die Scheißnachbarn, die entweder zu laut ihre Schlagerscheiße hörten oder sich beschwerten, wenn er seine Musik hörte.
Noah sah die Zeitanzeige auf seinem Laptop. Morgen war wieder Schule, 8 Uhr. Scheißschule. Alles war scheiße. Die Nachbarn, die Musik von denen, die Schule und das Leben. Am scheißigsten war aber die Schule und vor allem die Zeit, zu der die Scheißschule anfing. Es war wissenschaftlich erwiesen, dass die meisten Jugendlichen eher später ins Bett gingen und morgens länger schliefen. Das hatte Noah mal irgendwo gelesen. Trotzdem begann die Schule, wie ein Arbeitslager, jeden Morgen um 8 Uhr oder manchmal sogar noch früher. Nur damit sie lernten, wie der Enddarm einer Wespe aussah, dachte Noah, und nicht die Dinge, die wirklich wichtig fürs Leben waren. Welcher Job der beste war, wie man ein Unternehmen anmeldete oder wie man die richtige Frau rumkriegte. Wenn man bedachte, dass die Schulen kaum aufs Leben vorbereiteten und am liebsten Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger produzierten, war es ziemlich komisch, dass die Schüler mindestens zehn Jahre lang jeden Morgen um spätestens 7 Uhr 30 aus dem Haus mussten, um dann für den Rest ihres Lebens als Sozialhilfeempfänger auf Staatskosten ausschlafen zu können.
Noah verstand das alles nicht und würde es auch nie verstehen. Vielleicht war es an der Zeit, dass es mal richtig knallte. Er klickte durch die Seiten, es waren Seiten, die er erst nach langem Suchen gefunden hatte. Seiten, die er interessant fand. Creepy Pasta, Goregrish und wie sie alle hießen.
Ein Arzt hat bei einem Menschen einen Zugang gelegt, stand dort. In dem Zugang war aber kein Blut, sondern Wein. Er hat das Blut des Menschen mit Wein ausgetauscht. Der Mensch war mariniert. Er wurde mariniert, während er lebte, und während er mariniert wurde und sein Blut gegen Wein getauscht wurde, starb er. Und schmeckte dann sehr gut …
Noah klickte weiter.
Wie werde ich ein Psychopath?, stand dort. Das hörte sich interessant an.
Noah las weiter.
Steh sehr früh auf, sei groggy genug, um unausstehlich zu sein.
Mache abwechselnd gute und schlechte Sachen.
Gut ist: 40 Euro ausgeben, um für einen Obdachlosen einzukaufen.
Schlecht ist: Ein schönes Auto kaputt zu machen.
Weiter ging’s.
Fahre selbst Auto.
Fahre bewusst langsam, bis es Ärger und vielleicht sogar Prügeleien gibt.
Noah musste grinsen. Es ging noch weiter.
Betrink dich mit Schnaps.
Geh auf einen Spielplatz und sprich besoffen Kinder an, vor allem, wenn die Eltern dabei sind. Die Eltern werden ausrasten.
Noah musste noch mehr grinsen.
Lies die ganze Nacht Internet-Propaganda und Verschwörungstheorien, solche von der übelsten Sorte, die einen richtig wütend machen. Trinke die ganze Nacht Tee.
Zeichne komische Bilder und klebe dein Zimmer damit voll.
Geh morgens lange joggen und dusche nicht danach. Geh dahin, wo viele Menschen sind.
Jetzt bist du so weit, dass du alle möglichen Dinge ohne jedes Gefühl machen kannst.
Noah las weiter. Jetzt wurde es richtig spannend.
Zum Beispiel das: Trinke viel Milch und Wasser und erbrich dich auf die Tische in einem teuren Restaurant. Dann renn schnell weg.
Such dir in einem Klub eine hässliche Frau, die dich toll findet. Sag ihr, dass du nach einer Weile zurückkommst, wenn du merkst, dass sie bereit ist, dich zu küssen. Trink wieder viel Milch und Wasser. Warte lange genug, sodass das Zeug in deinem Magen schon ordentlich mit Magensäure angereichert worden ist. Geh aufs Klo und steck den Finger in den Hals, um deinen Magen zu reizen. Dann geh zu der Frau und küss sie. Wenn du richtig gut bist, kotzt du genau zum richtigen Zeitpunkt …
Noah lächelte. Es war krank, aber es war irgendwie auch interessant.
Ihm würden einige einfallen, mit denen er so etwas gerne machen würde.
Bling!
Das Geräusch aus seinem Skype-Account ließ ihn zusammenzucken. Eine Nachricht.
Er schaute auf den Absender.
Eine Nachricht von BG666.
Er hatte den Namen noch nie gehört.
Eine kurze Nachricht.
»Dein Gott spricht zu dir.«
Kapitel 7
Hermann, Clara und Winterfeld gingen mit schnellen Schritten in Hermanns Büro.
»Haben die bei dir angerufen?«, fragte Winterfeld.
Hermann nickte. »Ja, die sind noch in der Leitung. MacDeath ist auch schon in meinem Büro und wartet auf uns.«
Sie betraten das Büro. Hermanns Arbeitsplatz war voll mit Platinen, Laptops und CD-ROMs. Irgendwo dazwischen versteckt stand das Telefon, der Hörer lag daneben. Das rote Licht leuchtete, es war auf laut gestellt. MacDeath stand mit Hemd, Pullunder und Krawatte und verschränkten Armen neben dem Tisch, die Brille in einer Hand, in der anderen eine Tasse Tee. Earl Grey, den er aus seinem Büro nach unten mitgenommen hatte. Er schien bereits nachzudenken.
Winterfeld setzte sich auf den knarzenden alten Drehstuhl und sprach in die Leitung. »Winterfeld hier«, sagte er. »Mit wem spreche ich?«
»Lang. Bundespolizei. Ich grüße Sie, Herr Kollege. Machen wir es kurz: Ich habe einen außergewöhnlichen Fall und bräuchte bitte Ihre Unterstützung. Ich habe es eben schon Ihrem Kollegen erzählt. Das BKA hat mir geraten, mich gleich direkt an Sie zu wenden.«
»Erzählen Sie noch einmal, worum es geht.« Clara und Hermann setzten sich auf die Tischkante.
»Ein junges Mädchen wurde in einem IC von Dortmund nach Frankfurt … zerhackt.«
»Zerhackt?« Winterfeld hob die Augenbrauen.
»Ja, das Verb trifft es am besten. Ich schicke Ihnen gleich die Fotos.« Er räusperte sich. »Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten und dann mit dem toten Körper noch einige Dinge mehr angestellt.«
»Was genau ist passiert?«, fragte Clara.
»Der Täter …«, begann Lang.
»Der Täter? Sind Sie sicher, dass es ein Einzeltäter gewesen ist?«, fragte MacDeath. »Können es nicht auch mehrere gewesen sein?«
»Das wissen wir noch nicht. Die Kameraauswertungen der relevanten Bahnhöfe laufen schon.« Lang räusperte sich. »Der Fall ist besonders in jeder Hinsicht. Soll ich schon in die Details gehen?«
»Klar«, antwortete Winterfeld. »Wir haben schon so manches gehört und gesehen und müssen alles wissen, um den Fall richtig einschätzen zu können.«
»Das hier haben Sie vielleicht noch nicht gesehen, aber gut, fangen wir an.« Lang räusperte sich erneut. »Also, der oder die Täter haben das Mädchen auf einen der Sitze gesetzt und ihr die Eingeweide aus dem Leib gezogen. Die Eingeweide haben sie, mit Tackern, parallel zu ihren Beinen an die Polster geheftet. Laut ersten Berichten der Rechtsmedizin Dickdarm, Dünndarm und Teile des Magens. Wie ein bizarrer … Rock.«
»Wie sieht die Wunde am Bauch aus?«, fragte MacDeath.
»Das können wir derzeit noch nicht sagen.«
»Was?« MacDeath schüttelte den Kopf. »Sie können doch die aufgeschnittene Bauchdecke untersuchen und vielleicht anhand der Wundränder feststellen, welche Waffe verwendet wurde. Vielleicht ist es etwas Exotisches und wir …«
»Die Bauchdecke ist völlig unversehrt«, erklärte Lang tonlos.
Claras Augenbrauen zogen sich zusammen. »Aber wie wurden ihr dann die Organe entnommen …?«
»Der Täter hat ihr die Eingeweide durch die Vagina herausgezogen.«
Ein ekelhafter Kloß schob sich plötzlich Claras Speiseröhre hinauf, als sie die Worte hörte. Ihr war, als würde sich der Boden unter ihr bewegen. Sie musste sich an der Tischkante festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, während ihr Blick hinter einer schwarzen Wolke verschwamm. Sie riss die Augen auf, atmete tief durch und konnte erst nach ein paar Sekunden wieder fest stehen.
»Alles in Ordnung?«, fragte MacDeath und nahm ihre Hand.
»Ja!«, antwortete Clara ein wenig unwirsch, während sie versuchte, die Bilder, die sofort vor ihrem inneren Auge erschienen, unter die Oberfläche des Bewusstseins zu drücken. Sie brauchte hier keinen Märchenprinzen, der ihre Hand hielt. Sie brauchte eigentlich eine Welt, in der so etwas nicht passierte. So etwas wie das hier.
Er hat ihr die Eingeweide durch die …
»Wie lange ist das her?«
»Maximal wenige Stunden.«
»Und der Kehlenschnitt?«
»Wohl genauso lange.«
»Hat sie dabei noch gelebt?«, fragte Clara. »Bei der Sache mit … den Eingeweiden?«
»Die Rechtsmedizin konnte sich am Tatort dazu noch nicht äußern«, begann Lang.
»Mit anderen Worten?«, fragte Winterfeld.
»Noch wissen wir es nicht.«
Winterfeld, Clara, Hermann und MacDeath sahen zu Boden. Zunächst sprach keiner ein Wort. Lang war der Erste, der die Stille brach. »Ich nehme an, Sie haben es nicht eilig mit den Bildern?«
»Nicht wirklich«, antwortete Winterfeld, »aber Dienst ist Dienst. Dennoch …« Er zog sein Benzinfeuerzeug aus der Tasche, nestelte daran herum und steckte es dann wieder in die Tasche zurück.
Clara hielt ihre Hände umklammert, um das Zittern zu unterdrücken. Die Eingeweide durch die …
Winterfeld schien seine Fassung als Erster wiederzugewinnen und zur Routine zurückzukommen. Und Routine hieß auch in diesem Fall, Befehlsketten, Zuständigkeiten und Entscheidungswege zu klären. »Was, lieber Kollege Lang, haben wir Ihrer Meinung nach damit zu tun?«, fragte Winterfeld. »Der Fall ist jetzt bei der Bundespolizei NRW. Wir hier sind das LKA 113 in Berlin. Es ehrt uns sehr, dass Sie uns daran beteiligen wollen, aber Sie kennen den Papierkram. Und wir langweilen uns hier auch nicht.«
»Das weiß ich«, gab Lang zurück. »Es ist aber nicht mehr Fall der Bundespolizei.«
»Sondern?«
»Das BKA will den Fall übernehmen und bittet um Ihre Unterstützung. Maren Kaiser vom BKA wird Sie dazu auch noch direkt kontaktieren. Sie dachte nur, dass es sinnvoll ist, dass wir als Erste direkt miteinander sprechen, da ich als erster Kollege am Tatort war. Selbstverständlich bekommen Sie noch einen umfassenden Bericht, aber es war Maren Kaiser in diesem Fall besonders wichtig, dass ich Sie so schnell wie möglich mit ersten Informationen versorge.«
MacDeath nickte. »Das BKA vermutet einen Ritualmord? Wegen der Eingeweide?«
»Exakt«, erklärte Lang. »Maren Kaiser vom BKA hat Sie genau genommen empfohlen. Berlin ist ja in vielem eher Schlusslicht, aber es ist das einzige deutsche Bundesland, das mit Ihnen einen Fulltime-Profiler innerhalb des Teams beschäftigt. Und es ist dem BKA wichtig, dass das Profiling schon während der Tatortarbeit beginnt und nicht erst in der operativen Fallanalyse, wenn der Fall nicht gelöst werden konnte. Daher sollte ich Sie und Ihren Vorgesetzten Walter Winterfeld direkt anrufen.«
»Hat das BKA noch weitere Vermutungen?« Das war Clara. Sie glaubte nicht, dass es nur um die Kompetenz von MacDeath ging.
»Ja, in der Tat. Aber das will noch keiner so richtig zugeben«, sagte Lang. »Eine Eingeweide-Inszenierung heißt Ritualmord. Ritualmord heißt möglicherweise Serienkiller. Und Serienkiller heißt, es gibt noch mehr Morde. Da wollen die jetzt schnell Abhilfe schaffen. Die wollen verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.«
»Wie alt war das Mädchen überhaupt?«, wollte Clara wissen.
»Laut Ausweis neunzehn Jahre. Sie hatte einen Studentenausweis der Uni Gießen dabei. Theaterwissenschaften.«
Clara atmete aus. »Mein Gott! Neunzehn Jahre!« Theaterwissenschaften … Theater des Grauens, schoss es ihr durch den Kopf.
»Und da ist noch etwas«, sagte Lang. »Das habe ich Ihren Kollegen schon erzählt. Das Symbol.«
»Was für ein Symbol?«, fragte Winterfeld.
»Ein Symbol. Irgendein Zeichen. Mit Blut an die Scheibe des Abteils gemalt.«
»Schicken Sie uns die Fotos doch am besten schnell rüber«, sagte Winterfeld.
»Mache ich.«
Man hörte, wie Lang auf der Tastatur tippte. In Hermanns Inbox ploppte eine Mail auf. Er öffnete die JPEG-Datei.
Auf dem Foto sahen sie das Fenster des Zuges. Das Blitzlicht, das sich im Fenster spiegelte. Ebenso die Schatten des Fotografen. Hinter dem Fenster irgendein Abstellgleis eines Bahnhofs. Blutspritzer und irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten. Über die gesamte Fensterscheibe war in Blut etwas gemalt.
Kapitel 8
Eine Nachricht war in Noahs Skype-Account aufgeploppt.
Kurz. Und irgendwie seltsam.
Dein Gott spricht zu dir.
Absender: BG666.
Noah runzelte die Stirn.
Dann tauchte schon die nächste Nachricht auf.
Wann kannst du deinen Führerschein machen?
Noah zögerte kurz.
Meinst du fürs Auto?
Ja, meine ich. Was denn sonst? Weltraumraketen?
Was ist das für ein Assi, dachte Noah. Aber diese eine Antwort sollte er noch kriegen.
Mit 18.
Richtig. Noch fünf Jahre hin, oder?
Noah überlegte, ob er die Verbindung beenden sollte. Erst hatte er den Typ nur klugscheißerhaft und aufdringlich gefunden. Aber jetzt fand er ihn irgendwie auch unheimlich. Woher wusste der Typ, wie alt Noah war?
Du könntest aber jetzt schon tolle Sachen machen. Ohne jemanden zu fragen.
Auto fahren?
Auto fahren auch. Du hast dir doch eben ein paar Psychopathen-Seiten angeschaut. Zum Beispiel mit dem Auto extra langsam fahren. Und dadurch Streit vom Zaun brechen.
Woher weißt du, was ich eben gesehen habe?
Ein Gott weiß so etwas. Ein Gott ist nämlich überall. Zur gleichen Zeit.
Es passierte eine Weile nichts. Noah schrieb, obwohl er es eigentlich nicht wollte. Irgendetwas brachte ihn dazu, die Verbindung nicht abzubrechen.
Bist du noch da?
Die Antwort kam sofort.
Ein Gott ist immer da.
Kurz darauf die nächste Nachricht.
Du kannst Leute auf verschiedene Art und Weise mit dem Auto überfahren. Oft berühren die Räder den Körper gar nicht. In seltenen Fällen geht das sogar ohne Verletzung ab. Zum Beispiel, wenn du einen Sportwagen fährst, langsam fährst und das Unfallopfer sich gut abrollt. Wenn du aber willst, dass die Leute unter die Räder kommen, musst du einen SUV fahren.
Und wenn ich niemanden überfahren will? Noah war sich allerdings selbst gar nicht ganz sicher, ob es nicht doch ein paar Leute gab, die er gern überfahren würde. Die Nachbarn mit ihren Scheißschlagern zum Beispiel. Und dann einige Typen in der Schule. Besonders ein Typ. Und was der Typ hier auf Skype schrieb, dieser BG666, war interessant. Jedenfalls interessanter als das Geseiere von seinen Eltern, das dumme Gelaber von seinen Lehrern oder der Scheiß aus dem Fernsehen oder den ganzen Klamottenspinnern und Schminktipps-Schwuchteln auf YouTube. Mal schauen, dachte er, was noch so kommt.
Glaub mir, du willst. Beim Aufprall wird der Fußgänger erfasst, beschleunigt, stößt auf die Motorhaubenvorderkante, der Oberkörper prallt auf die Motorhaube, der Kopf auf die Frontscheibe, dann wird der Fußgänger abgeworfen und prallt auf die Fahrbahn. Manchmal kratzt die Schuhsohle noch über die Straße, dann kann man auf dem Straßenbelag sehen, ob der, der überfahren wurde, Gummi- oder Ledersohlen hatte.
Aber dann kommt er nicht unter die Räder?
Nein, das geht nur bei Lastwagen. Vielleicht noch bei riesigen SUVs, die es nur in den USA gibt. Dann wird es richtig … hässlich.
Der andere schrieb nichts mehr.
Und auch Noah schrieb nichts mehr. Von ferne hörte er das Ticken der Uhr aus dem Wohnzimmer. Wahrscheinlich war es schon 3 Uhr morgens. Und morgen klingelte um sieben der Scheißwecker. Spätestens.
Weißt du, was das Stockmaß ist? Auf einmal war wieder eine Nachricht da.
Nein.
Das ist die Rückenhöhe von Tieren. Daran bemisst sich die Höhe der Tierversicherung. Ein kleines Tier, das angefahren wird, verschwindet unter den Rädern. Das macht nur etwas hässlichen Matsch, aber mehr nicht. Aber ein großes Tier kracht durch die Windschutzscheibe und manchmal auch in die Fahrgastzelle. Das ist dann nicht so schön.
Noah atmete aus und verdrehte die Augen. Langsam wurde es ihm doch zu blöd. Und vor allem wurde es spät.
Was willst du eigentlich?
Dich etwas fragen.
Und was?
Du darfst noch keinen Führerschein machen.
Ja, weiß ich.
Aber etwas anderes weißt du nicht: Du darfst nämlich jetzt andere Sachen machen. Sachen, die du nicht mehr machen darfst, wenn du den Führerschein hast.
Was für Sachen?
Schlimme Sachen.
Das verstehe ich nicht.
Das wirst du noch verstehen. Ich erkläre es dir.
Noah schüttelte den Kopf.
Und wenn ich beides nicht will? Schlimme Sachen machen und es erklärt bekommen?
Wieder einige Sekunden Pause. Dann kam die Nachricht.
Glaub mir, du willst! Beides!
Kapitel 9
Vier Stunden später war das gesamte Team unterwegs. Clara, Winterfeld, Hermann und MacDeath. Es war ein wenig wie eine Ferienreise, wenn nur das Thema nicht so furchtbar gewesen wäre.
Furchtbar war im Übrigen auch die Frage gewesen, wie man mit vier Leuten überhaupt nach Nordrhein-Westfalen kommen sollte, denn auf schnelle Entscheidungen war der öffentliche Dienst, und das nicht nur in Berlin, nicht ausgerichtet. So war Winterfeld eine Weile brüllend und telefonierend durch sein Büro gestapft, bis sich endlich eine Lösung gefunden hatte.