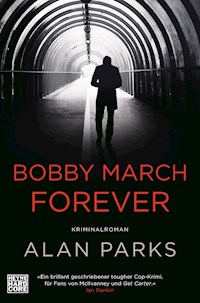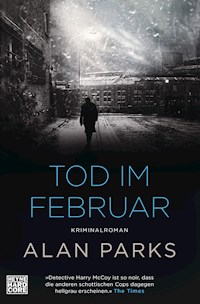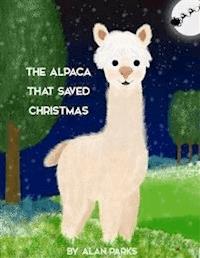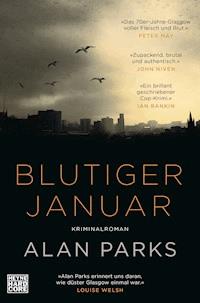
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Harry McCoy-Serie
- Sprache: Deutsch
Januar 1973: Mitten in Glasgow erschießt am helllichten Tag ein Jugendlicher auf offener Straße eine junge Frau, bevor er sich selbst eine Kugel in den Kopf jagt. Detective Harry McCoy, dem der Mord am Tag zuvor im Gefängnis von einem psychotischen Gefangenen angekündigt wurde, steht vor einem Rätsel. Zumal der Gefangene selbst um die Ecke gebracht wird. McCoy nutzt seine alten Verbindungen zu Glasgows Unterwelt, um in den Ermittlungen voranzukommen, legt sich dabei aber schnell mit den Dunlops an, der mächtigsten Familie der Stadt. Und auch sein Boss pfeift ihn zurück. Aber McCoy lässt sich nicht beirren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Januar 1973: Mitten in Glasgow erschießt am helllichten Tag ein Jugendlicher auf offener Straße eine junge Frau, bevor er sich selbst eine Kugel in den Kopf jagt. Detective Harry McCoy, dem der Mord am Tag zuvor im Gefängnis von einem psychotischen Gefangenen angekündigt wurde, steht vor einem Rätsel. Zumal der Gefangene selbst um die Ecke gebracht wird. McCoy nutzt seine alten Verbindungen zu Glasgows Unterwelt, um in den Ermittlungen voranzukommen, legt sich dabei aber schnell mit den Dunlops an, der mächtigsten Familie der Stadt. Und auch sein Boss pfeift ihn zurück. Aber McCoy lässt sich nicht beirren.
Blutiger Januar ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle und führt den Leser in die feinsten Eliten der Stadt, lässt ihn die blühende Musikszene der Siebziger spüren und die brutale Welt der gefürchteten Gangs erleben. Parks schreibt so authentisch, direkt und mit Liebe zum Detail, dass der Leser die Stadt förmlich riecht, schmeckt und hört.
Der Autor
Alan Parks studierte an der Universität von Glasgow Philosophie. Nach dem Studium arbeitete er als Creative Director bei London Records und später bei Warner Music, wo er für Acts wie All Saints, New Order, The Streets oder Gnarls Barkley zuständig war. Heute lebt er in Glasgow und London. Blutiger Januar ist sein Debütroman und Auftakt einer Krimiserie mit Detective McCoy.
ALAN PARKS
BLUTIGER JANUAR
Kriminalroman
Aus dem schottischen Englisch
von Conny Lösch
WILHELM HEYNE VERLAG
München
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel BLOODY JANUARY bei Canongate Books Ltd, Edinburgh
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook
Copyright © 2017 by Alan Parks
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung des Originalumschlags von Christopher Gale
Umschlagillustration: © Getty Images/Stephen Mahoney/EyeEm
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-23402-7V002
Für Mum und Dad
»Denn jede Stadt besteht aus einer Vielzahl von Städten. Mindestens zwei stehen einander feindlich gegenüber, die Stadt der Reichen und die der Armen.«
Nach Platon
»Every picture tells a story, don’t it?«
Rod Stewart
Der Fall wurde einer, an dem Polizisten ihre berufliche Laufbahn maßen. Peter Manuel, »Bible John« und »Bloody January«. Niemand wusste so genau, woher die Bezeichnung eigentlich kam, wahrscheinlich ging sie auf eine beiläufige Bemerkung in der Pitt Street oder einer Bahnhofskneipe zurück. Die Zeitungen stürzten sich sofort darauf. Schlagzeilen auf den Titelseiten von Anfang an. Die berühmteste hängt bis heute gerahmt in den Polizeiwachen der Stadt.
BLUTIGER JANUAR: Wie viele müssen noch sterben?
Viele Jahre später erklärten die älteren, die an dem Fall gearbeitet hatten, ihren jüngeren Kollegen, sie wüssten nicht, was damals wirklich passiert sei. Sechs Leichen in einer Woche. Sie hockten in den Pubs und schwelgten in Erinnerungen, inzwischen pensioniert, setzten sie Fett an und tranken zu viel, hatten sonst nichts zu tun. Unermüdlich erzählten sie Geschichten vom Krieg, wie sie kurz vor einer Festnahme gestanden oder fast eine Leiche gefunden hätten. Die jüngeren grinsten und nickten, lauschten mit einem Ohr den Fußballergebnissen im Fernsehen und dachten: »So schlimm kann’s nicht gewesen sein.«
Aber da irrten sie sich.
1. Januar 1973
Eins
McCoy steuerte auf die Treppe zu, seine Schritte klapperten über den stählernen Steg, sein Atem bildete Dunstwolken vor seiner Nase. Barlinnie war unverändert wie eh und je. Eiskalt im Winter, brütend heiß im Sommer. Das alte viktorianische Gebäude würde es nicht mehr lange machen. Für die Anzahl an Häftlingen, die man hier untergebracht hatte, war es nicht gebaut worden. Sie saßen zu dritt, manchmal zu viert, eingepfercht in Zellen, die ursprünglich für zwei gedacht waren. Kein Wunder, dass es im gesamten Gefängnis widerlich stank. Der Geruch nach überlaufenden Gülle-Eimern und abgestandenem Schweiß war so heftig, dass er sich einem in den Rachen setzte, sobald sich die Tore öffneten; wenn man wieder ging, blieb er in den Klamotten hängen.
Seit seiner Anfangszeit bei der Streife kam McCoy schon hierher. Das einzig Gute an Barlinnie war, dass es einem Wege ersparte. Das ganze Spektrum Glasgower Übeltäter landete hier. Angefangen von Vergewaltigern und Mördern, Sexualverbrechern und Kinderschändern bis hin zu verdatterten alten Männern, die sich kurz nach der Beerdigung ihrer Frauen mit zwei Dosen Lachs unter dem Pullover im Co-op hatten erwischen lassen. In Barlinnie war man nicht wählerisch, hier wurden alle genommen.
Er beugte sich über das Geländer und schaute durch das Netz und den Tabakdunst in den Freizeitbereich hinunter. Die üblichen Typen liefen dort in Jeans und weißen Sportschuhen herum.
Ein paar, deren Namen er vergessen hatte, spielten Tischtennis. Rangniedrige Bandenmitglieder aus Milton scharten sich um den Billardtisch, alle mit langen Haaren, Schnurrbärten und Tätowierungen noch aus dem Jugendknast. Einer von ihnen zeigte mit dem Queue auf Jack Thomson, als der vor den Fernseher geschoben wurde, und kicherte. Vor einem Jahr hätte er sich nicht mal getraut, einen wie Thomson auch nur anzuschauen. Jetzt hatte das arme Schwein ein so großes Loch im Kopf, dass man’s von hier oben sah. So ist das, wenn man einen Vorschlaghammer auf die Knie und den Schädel bekommt. Laufen kannst du vergessen, und vor lauter Brei im Hirn weißt du nicht mehr, wo du bist.
Er knöpfte seinen Trenchcoat zu und blies sich in die Hände. Arschkalt war’s. Ein kleiner Dicker in der Runde der Kartenspieler stand auf, schaute nach oben, nickte. Steph Andrews. Bildete sich immer noch ein, niemand wüsste, dass er ein Spitzel war. McCoy kramte in seiner Tasche, zog eins von seinen mitgebrachten Päckchen Regal heraus und ließ es über das Geländer fallen. Steph fing es, steckte es ein und war weg, bevor die anderen es mitbekamen. Erste Regel bei einem Besuch in Barlinnie: Kippen mitbringen. McCoy beugte sich noch ein Stück weiter vor, konnte aber den, dessentwegen er gekommen war, nicht entdecken.
»Raubtierfütterung, hm?«
Er drehte sich um und sah Tommy Mullen neben sich am Geländer. Mullen nahm die Kappe ab, kratzte sich am Kopf. Bei McCoys ersten Besuchen in Barlinnie waren seine Haare noch schwarz gewesen. Jetzt waren sie größtenteils grau.
»Wie lange hast du noch, Tommy?«, fragte McCoy.
»Drei verfluchte Wochen. Ich zähl schon die Tage.«
»Bist du nicht traurig, dass du gehst?«
»Machst du Witze? Ich kann’s kaum erwarten. Der Bruder von meiner Frau hat einen kleinen Wohnwagen unten in Girvan gekauft. Frische Luft. Damit ich den Gestank hier aus der Nase bekomme.«
»Was will er denn?«, fragte McCoy. »Ich weiß nur, dass auf der Wache angerufen wurde, ich soll herkommen.«
Mullen zuckte mit den Schultern. »Meinst du, das sagt er mir?« Er nahm eine Selbstgedrehte aus seiner Tabakdose und zündete sie sich an. McCoy schaute erneut über das Geländer, suchte in der Menge.
»Da unten wirst du ihn nicht finden«, sagte Mullen. »Er wurde verlegt. Ist jetzt in der Special Unit.«
McCoy pfiff leise. Die sagenumwobene Special Unit.
Niemand wusste viel darüber oder wie’s damit funktionierte, sie war erst letztes Jahr eingerichtet worden. Im Strafvollzug hatte man ziemlich spät was von den Sechzigern mitbekommen. McCoy erinnerte sich an eine Diskussionsrunde im Fernsehen. Ein Wärter mit finsterer Miene hatte flankiert von zwei professoralen Hippietypen an einem Tisch gesessen. Die Hippies hatten was von Kunsttherapie, positivem Gewahrsam und dem Überwinden von Grenzen gelabert.
Obwohl sie noch ganz am Anfang damit standen, hatte man in den Zeitungsredaktionen schon bei der bloßen Erwähnung der Special Unit mit Schaum vor dem Mund reagiert, bei der Polizei ebenso. Dort war man der Ansicht, die Special Unit sei so was wie ein neu an den Ufern des Clyde entstandenes Sodom und Gomorrha. Dabei handelte es sich den Hippies zufolge nur um einen kleinen Bereich des Gefängnisses, in dem Hochsicherheitsgefangene wie Menschen behandelt werden sollten. McCoy war unentschieden, die althergebrachten Methoden funktionierten schließlich auch nicht. Lästige Insassen wurden verprügelt und in eiskalten, feuchten Kellern in Käfige gesperrt. Seiner Meinung nach wurden diese Irren dadurch nur noch schlimmer; umso mehr bereit, jeden Schließer abzustechen oder zusammenzuschlagen, der sie auch nur komisch ansah.
Mullen und McCoy verließen das Hauptgebäude, zogen sich die Mäntel über die Köpfe und liefen über den Gefängnishof zu der roten Tür ganz hinten. Das Wetter verschlechterte sich erneut, eisiger Schneeregen und ein Wind, der Laub und Abfall über den Hof peitschte. Mullen zog die Tür auf, und schon waren sie drin.
McCoy blieb stehen und sah sich um, betrachtete alles genau. Alice hinter den Spiegeln.
Vor sich hatten sie zwei Gewächshäuser voller Blumen und Tomatenpflanzen. In den Beton waren Beete gegraben und ordentlich mit Gemüsereihen bepflanzt. Große Steinbrocken lagen in einem davon abgetrennten Bereich, halb fertige Gesichter oder Gestalten waren hineingeritzt, der feuchte Granit glänzte. Neben McCoy und Mullen öffnete sich die Tür zu einem kleinen Schuppen, und ein dünner Mann kam heraus, er hatte langes blondes Haar, einen Meißel in der Hand und eine schmutzige Lederschürze umgebunden. Er hob seine Schutzbrille an.
»Alles klar, Tommy?«, fragte er. »Lange nicht gesehen.«
McCoy brauchte ein paar Sekunden, um zu kapieren, wer das war. Bobby Munro. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Bobby »Razor« Munro stand mit einem Meißel in der Hand in Barlinnie? Kein Wunder, dass die Zeitungen durchdrehten. Musste wohl das erste Mal sein, dass er das Werkzeug dafür benutzte, wofür es eigentlich gedacht war; normalerweise hätte er es jemandem an die Kehle gepresst.
»Alles gut«, sagte Mullen. »Wir suchen Howie.«
»Hängt bestimmt vor der Glotze, wie immer.« Er zeigte auf eine Tür. »Da lang.«
»Dann bist du jetzt also ›Tommy‹?«, fragte McCoy. »Beste Freunde, oder wie?«
»Fang bloß nicht an«, sagte Mullen, als sie durch die Tür gingen. »Hat ganz schön gedauert, bis ich mich dran gewöhnt hab, das kann ich dir sagen. ›Die Verwendung von Nachnamen ist herabwürdigend und entpersönlichend und daher zu unterlassen‹«, zitierte er mit vornehmem Akzent. »Blödes Geschwätz.«
Bei McCoys letztem Besuch im Waschhaus hatten dort Industriemaschinen gestanden, und Männer, kaum zu erkennen im feuchtkalten Dunst, hatten große elektrische Bügelmaschinen bedient. Jetzt nicht mehr. Jetzt war der Raum fast leer, weiß gestrichen, an den Wänden hingen gerahmte Bilder und Plakate, mittendrin riesige Metallskulpturen. Soweit McCoy das beurteilen konnte, handelte es sich um zwei Hunde mit menschlichen Gesichtern, die gegeneinander kämpften oder vielleicht auch miteinander fickten, so genau ließ sich das nicht feststellen. Mullen zeigte auf eine Tür in der Ecke.
»Das Wohnzimmer ist da drüben.«
McCoy ging weiter. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber das jedenfalls nicht: als würde er in die gemütliche gute Stube seiner Tante treten. Geometrisch gemusterte Tapete, ein heimeliges Gasfeuer und eine dreiteilige Sitzgarnitur mit hölzernen Armlehnen vor einem Farbfernseher. Es stank nicht mal nach Gülle-Eimern. Nur eines verdarb die heimelige Atmosphäre: Howie Nairn. Er fläzte sich auf dem Sofa. In der Special Unit trugen die Häftlinge keine Jeans und keine weißen Sportschuhe, sondern ihre eigene Kleidung. In Nairns Fall war das nicht unbedingt besser. Ein schmutziges Che-Guevara-T-Shirt, ein karierter Schal um den Hals, Jeans mit Schlag und das lange, lockige kastanienbraune Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Sogar Hausschuhe hatte er an. Er war ein bisschen dünner, sah aber im Prinzip noch genauso aus wie bei seiner letzten Begegnung mit McCoy. Vor allem eins hatte sich nicht verändert: die wulstigen, gezackten Narben am Hals, die im Kragen seines T-Shirts verschwanden.
»Der scheiß Schließer soll sich verpissen«, sagte Nairn, wandte dabei den Blick nicht vom Fernseher ab. »Der darf hier gar nicht rein.«
»Wie du willst«, sagte Mullen. »McCoy?«
Er nickte, und Mullen verzog sich. »Dann lasse ich euch alleine. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid.«
McCoy setzte sich auf die Sofalehne, legte ein Päckchen Regal auf das mosaikverzierte Beistelltischchen. Wartete. Er war sicher, dass er Dope roch. Würde ihn nicht wundern. Hier wunderte ihn gar nichts mehr. Nairn sagte nichts, hielt den Blick fest auf den Fernseher gerichtet. Also war’s an McCoy.
»Hab die Nachricht bekommen. Muss mich wohl geehrt fühlen, oder wie?«
Nairn brummte. »Bild dir bloß nichts ein, McCoy. Du warst der einzige scheiß Polizist, dessen Name mir eingefallen ist.«
McCoy betrachtete die mit Tesafilm an der Wand befestigten Plakate. Nicht wie sonst überall Mädchen mit gespreizten Beinen, hier nicht. Stattdessen eine Karte von Mittelerde und ein Bild des Großen Vorsitzenden Mao. Die Bücher auf dem Regal waren genauso abgedroschen. Die Autobiografie von Malcolm X. Fremder in einer fremden Welt. Die Bhagavad Gita.
»Funktioniert der ganze Hippiekram denn?«, fragte er. »Kein Verlangen mehr, dem Wärter aufs Maul zu hauen?« Keine Antwort. Er seufzte, versuchte es noch einmal. »Dann geht’s also um Garvie, oder?«
Endlich löste Nairn den Blick von Zebedee und Dougal. »Um wen?«
»Stan Garvie. Steckte in einer Teekiste und wurde zusammen mit ein paar Eisengewichten im Clyde versenkt? Ich denke, das war dein Werk. Der Aufenthalt in diesem Ferienheim hier hat dich geständig gemacht, oder?«
Nairn grinste, wirkte sehr zufrieden mit sich. »Ach, so hieß das Arschloch also?« Er schüttelte den Kopf. »Nee, darüber weiß ich nichts, Detective McCoy.«
McCoy hob die Augenbrauen. »Solche Neuigkeiten sprechen sich schnell rum.«
Nairn setzte sich auf, schob eine Hand in seine Jeans, kratzte sich am Sack und schnüffelte anschließend an seinen Fingern. »Na schön, ich hab noch mehr Neuigkeiten für dich. Morgen wird jemand umgebracht.«
»Willst du einen unter der Dusche abstechen? Und mich schon mal vorwarnen?«
Nairn grinste erneut, zeigte dabei eine Reihe gelber Zähne.
»Hältst dich wohl für wahnsinnig witzig, McCoy. Dabei bist du so witzig wie ein Krebsgeschwür. In der Stadt, ein Mädchen namens Lorna.«
McCoy wartete, aber mehr kam nicht. Er begriff, dass er mitspielen musste. »Und wer will diese Lorna töten?«
Nairn guckte angewidert. »Leck mich, ich bin doch kein Spitzel.«
McCoy lachte. »Du bist kein Spitzel? Scheiße, warum bin ich dann überhaupt hier?«
»Du bist hier, weil ich in diesem Dreckloch festsitze und den Mord nicht verhindern kann, also musst du.«
»Und wie soll das gehen? Soll ich im Radio durchgeben, dass alle, die Lorna heißen, den Tag lieber im Bett verbringen sollen? Das ist doch scheiße, Nairn, du verschwendest meine Zeit.«
Er stand auf. Seit fünf Uhr früh war er auf den Beinen, war müde und nicht in Stimmung. Jetzt wollte er nur noch ein Bier, möglichst weit weg von diesem Gefängnis, weit weg von Howie Nairn und dem ganzen Mist. Er beugte sich vor und nahm die Zigaretten vom Tisch, aber Nairns Hand schoss hervor, packte ihn am Arm. Nairn zog ihn zu sich, sein Gesicht war jetzt direkt vor McCoys.
»Du passt gut auf, was ich dir sage, McCoy, sonst werde ich schrecklich wütend. Kapiert?«
McCoy sah auf Nairns tätowierte Finger hinunter, die sich um seinen Arm schlangen, die Knöchel waren weiß. Nairn war Häftling und McCoy Polizist. Es gab Grenzen, und die hatte Nairn gerade überschritten. Jetzt war’s kein Spiel mehr.
»Nimm deine verdammten scheiß Finger von mir, Nairn«, sagte McCoy leise. »Sofort. Und fass mich nie wieder an. Verstanden?«
Nairn hielt ihn noch ein paar Sekunden länger fest, dann ließ er McCoy los und stieß dessen Arm von sich. McCoy setzte sich wieder.
»Entweder du redest jetzt vernünftig, oder ich bin weg. Letzte Chance.« Er wartete. Nairn starrte ihn an, wässrige blaue Augen fixierten ihn. Wenn er McCoy einschüchtern wollte, dann wurde nichts daraus. Ihn hatten schon Schlimmere angestarrt. Schulterzuckend stand er auf. »Die Zeit ist um.«
Er ging zur Tür, rief Mullen, hörte dessen Stiefelschritte im Gang, die metallverstärkten Absätze klapperten auf dem Linoleumboden. Hinter ihm eine Stimme.
»Sie heißt Lorna, ihren Nachnamen kenne ich nicht. Sie arbeitet in der Stadt. In einem von den vornehmen Restaurants. Malmaison oder Whitehall. Weiß nicht, von wem, aber morgen wird sie umgebracht.«
McCoy drehte sich um. »War’s das?«
Nairn starrte wieder auf den Fernseher. »Reicht doch.«
»Nur mal angenommen, ich glaube dir, und nur mal angenommen, ich kann’s verhindern. Verrätst du mir dann, was das alles soll?«
Nairn nickte. »Jetzt verzieh dich. Stinkst mir mein ganzes Wohnzimmer voll.«
»Und was sollte das jetzt?«, fragte Mullen, als sie wieder im Hauptgebäude waren. Zeit für den Einschluss. McCoy musste die Stimme heben, um sich trotz des Pfeifkonzerts und der zuschlagenden Zellentüren verständlich zu machen.
»Weiß der Henker. Hat mir erzählt, dass morgen jemand ermordet wird.«
»Aber nicht hier, oder?«
McCoy schüttelte den Kopf. »In der Stadt.«
Mullen wirkte erleichtert. »Gott sei Dank. Ich hab nämlich morgen Dienst. Und woher hat der Clown die Info?«
»Weiß der Kuckuck. Ich glaube, er will nur testen, ob er’s mit mir machen kann.«
Sie warteten, bis ein Häftling mit blauem Auge und blutender Lippe an ihnen vorbeigegangen war; die Hände auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt, flankiert von jeweils einem Beamten, schrie er herum.
»Das ist ja das Komische«, fuhr McCoy fort. »Ich war dabei, als er festgenommen wurde, aber eigentlich war Nairn Brodys Fall, nicht meiner. Keine Ahnung, warum er mit mir sprechen wollte.«
»Brody. Du lieber Himmel, mit dem Wichser will doch keiner reden. Hat er ihn reingelegt?«
McCoy schüttelte den Kopf. »Nein, ausnahmsweise war die Sache sauber. Nairn war so schuldig, wie’s nur geht. Wurde mit drei Abgesägten in einer Reisetasche erwischt.«
Mullen begleitete McCoy zum Ausgang und verriet ihm noch, wo seine Abschiedsfeier steigen würde. McCoy konnte Mullen echt gut leiden, aber auf keinen Fall würde er einen Abend mit einem Haufen schlecht gelaunter Gefängniswärter verbringen, die sich gegenseitig alte Geschichten erzählten.
Ein Mädchen namens Lorna. Vielleicht sollte er für alle Fälle mal in den Restaurants anrufen. So viele Lornas konnten da ja nicht arbeiten. Trotzdem fiel ihm kein Grund ein, weshalb Nairn ihm so was verraten würde. Auch bei seiner Verhaftung hatte er ihn kaum angesehen, war vollkommen ausgelastet damit gewesen, Brody zu treten und mit jedem nur erdenklichen Schimpfwort zu belegen. McCoys Blick wanderte zu dem Kalender hinten an der Wand des winzigen Pförtnerbüros. Ein Oben-ohne-Mädchen rekelte sich auf einer Motorhaube. Gab sich dabei die größte Mühe, den Eindruck zu erwecken, als würde sie auf der ganzen Welt nichts lieber tun, als richtig große Schraubenschlüssel in der Hand zu halten. Er hatte gar nicht gemerkt, dass es Donnerstag war. Vielleicht sollte er Nairns Blödsinn einfach vergessen und stattdessen lieber Janey besuchen. Schließlich hatte er noch was gut bei ihr. Der Summer ertönte, und das Schloss entriegelte mit einem lauten Knacken. Der Pförtner machte die Tür auf, der Wind rüttelte daran. McCoy betrachtete die Bäume rings um den Parkplatz, die sich im Sturm bogen.
Der Pförtner verzog das Gesicht, grinste schief. »Mann, bin ich froh, dass du da rausmusst und nicht ich.«
McCoy rannte los, sprang in den nicht als Polizeifahrzeug gekennzeichneten Viva und knallte die Autotür hinter sich zu. Er ließ den Motor an, das Radio dudelte los. »Chirpy Chirpy Cheep Cheep« erfüllte plötzlich den Innenraum hinter den beschlagenen Scheiben. Er fluchte, wechselte den Sender, Rod Stewart, »Maggie May«. Schon viel besser. Er drehte die Heizung voll auf und scherte aus auf die Cumbernauld Road, fuhr Richtung Stadt. Wenn er zu Janey wollte, musste er erst bei Robbie vorbei.
Zwei
»Wie lange haben wir?«, fragte er.
Sie grinste. »Die ganze Nacht. Stevie hat das mit Iris klargemacht. Glücklich war sie nicht.«
Er nahm ein paar Flaschen Tennent’s von der Kommode, und sie ermahnte ihn mit erhobenem Zeigefinger. »Die Getränke musst du trotzdem bezahlen. Das weißt du.«
Er schüttelte den Kopf, zog fünfzig Pence aus der Tasche, legte sie in die Porzellanschale neben den Flaschen.
Der Puff war groß, untergebracht in einer der riesigen viktorianischen Wohnungen, von denen es in Glasgow viele gab, jeder Raum ein Schlafzimmer, außer der Küche. Die war Iris’ Herrschaftsbereich. Sie saß auf einem alten Stuhl am Eingang, daneben Flaschen in Kisten. Big Chas, der Rausschmeißer, ragte bedrohlich hinter ihr auf. Einmal hatte sie McCoy erklärt, sie würden doppelt so viel Geld mit den Getränken verdienen wie mit den Mädchen, was auch immer das über Glasgow aussagte. Iris machte nicht lange rum. Verkaufte ausschließlich Whisky und Bier. Nimm’s oder lass es bleiben. Red Hackle und Tennent’s.
Nach Kneipenschluss und sonntags kam das meiste Geld rein. Freitags um Mitternacht oder sonntagnachmittags um drei, wenn die echten Säufer das Zittern kriegten, konnte sie ihnen abknöpfen, so viel sie wollte. Er war genug beschämten Frauen und Männern mit wässrigen Augen auf der Treppe begegnet, um zu wissen, wie gut der Laden lief. Säufer trieben immer irgendwo Geld auf. Auch wenn ihre Kinder am nächsten Tag nichts zu essen bekamen.
Janey hatte einen Joint mit dem Gras gebaut, das er gekauft hatte. Laut Robbie guter Stoff – er hatte ihn von einer amerikanischen Band, die am Abend vorher im Green’s Playhouse gespielt hatte. Die eine Hälfte hatte er im Schließfach an der Central Station gelagert, und die andere war direkt in seiner Tasche verschwunden. McCoy hatte er nur ein Pfund dafür abgenommen. Janeys Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hätte er auch mehr dafür verlangen können.
Sie steckte McCoy den dünnen Joint in den Mund, schloss die Lippen über dem brennenden Ende, sodass sie die Glut versiegelten, und blies ihm den Rauch tief in die Lungen. Er hielt die Luft so lange an, wie er konnte, und stieß eine Wolke süßlichen Rauch aus. Es dauerte nicht lange, bis es wirkte. Ihm wurde ein kleines bisschen schwummrig. Gut. Robbie hatte recht. Er nahm Janey den Joint wieder ab, inhalierte noch ein paarmal, gab ihn ihr zurück.
Janey hatte ein Tuch über das kleine Lämpchen auf dem Nachttisch geworfen, Räucherstäbchen angezündet und Bilder aus Zeitschriften von Stränden und teuren Autos an die abblätternde Tapete geklebt. Alles nur, damit der Raum ein bisschen weniger nach dem Hinterzimmer einer Wohnung mit fließend Kaltwasser in Possil Park aussah. »Atmosphäre« nannte sie das. »Die Kunden stehen drauf, jedenfalls die jüngeren.«
Er setzte sich ans Ende des Bettes, versuchte seine Schnürsenkel zu lösen. Er kicherte, war schwieriger als gedacht. Schließlich gelang es ihm, seine Krawatte zu lockern und sein Hemd auszuziehen, doch dann scheiterte er an seinem Gürtel und fing wieder an zu kichern. Janey legte eine Platte auf den Spieler in der Ecke. Their Satanic Majesties Request. Sie durfte aber nicht laut drehen. Iris hatte es nicht gern, wenn jemand Musik auflegte, dann hörte sie nicht, was in den Zimmern vor sich ging. War nicht seine Lieblingsplatte, aber heute Abend klang sie gut. Gras, Bier und Musik wirkten jetzt zusammen, hielten perfekt das Gleichgewicht.
Janey fing an zu tanzen. Betrachtete sich dabei in dem gesprungenen Spiegel im Schrank. Sie wiegte sich zur Musik, sang mit.
Sie war ein gut aussehendes Mädchen: langes schwarzes Haar, Kurven, eine lustige kleine Stupsnase und ein breites Lächeln. Eigentlich sah sie zu gut aus, um hier zu arbeiten. Iris’ Puff war nicht gerade das, was man unter high class verstand. Die Kunden waren größtenteils Bauarbeiter oder Angestellte aus dem Stahlwerk, die freitagabends ihren Lohn verprassten. Jedes Mal, wenn er davon anfing, sie drängte, sich doch was anderes zu suchen, tat sie’s lachend ab. Sie behauptete, ihr gefalle es hier, sie habe schon in viel schlimmeren Läden gearbeitet.
Im Spiegel erwischte sie ihn dabei, wie er sie beobachtete, sie lächelte und streckte ihm die Zunge raus. Er beugte sich vor und zog sie zu sich aufs Bett. Sie lachte, tat, als wollte sie sich wehren. Dann küsste er sie, während sie ihre Plateausandalen von den Füßen kickte und sich aus ihren Hotpants wand. Küsste ihren Hals, streichelte über ihre Brüste, presste seinen bereits harten Schwanz an ihren Schenkel. Jetzt wirkte das Dope erst richtig; er fühlte sich schwer, langsam und entspannt. Rutschte an ihr herunter. Sie fuhr ihm mit den Fingern durchs Haar, er sah zu ihr auf, grinste.
»Du und ich, Janey. Du und ich«, sagte er.
Die Platte war zu Ende, der Arm hob sich, schwenkte zurück, und die Musik fing von vorne an. »She’s a Rainbow.« Jetzt war er in ihr, bewegte sich schneller, atmete schwer an ihrem Hals, fast war er so weit. Sie schlang die Beine um ihn, presste ihn fester an sich, flüsterte ihm ins Ohr. »Komm schon, Darling. Komm …«
Er stieß noch ein paarmal zu, versuchte es zurückzuhalten, aber es ging nicht. Er stöhnte, sackte auf sie herunter, keuchte an ihrer Schulter. Blieb eine Weile so liegen, dann stemmte er sich auf die Ellbogen, sah ihr in die Augen.
»Das war magisch. Und bei dir? Alles klar?«
Sie nickte, klatschte ihm auf den Hintern. »Komm, noch einer, hm?«
Er rollte von ihr runter, lehnte sich ans Kopfende und sah ihr zu. Sie saß im Schneidersitz da, das Tütchen mit dem Gras und die Papers auf dem Plattencover in ihrem Schoß, ihr langes dunkles Haar hing ihr wie ein Vorhang vor dem Gesicht. Sie war Profi, konnte blitzschnell einen Joint bauen, wenn’s sein musste, sogar mit einer Hand.
Er schaute auf die Armbanduhr. Zehn nach zwölf. Heute Abend würde er keine Restaurants mehr besuchen, es war ihm egal, er war zu stoned, um irgendwohin zu gehen. Nairn konnte ihn mal. Er war doch nicht sein verfluchter Laufbursche. Er wollte hier sein, bei ihr. Sie zündete sich noch einen Joint an und nahm einen tiefen Zug.
»Hab seit zehn Minuten Geburtstag«, sagte er. »Am zweiten Januar.«
»Ach komm?«, sagte sie. »Und wie alt bist du?«
»Dreißig. Sogar schon drüber.«
Sie lächelte verträumt, ihr Blick war glasig. Sie beugte sich rüber und küsste ihn, steckte ihm den Joint in den Mund. Er zog, spürte den Rausch in seinem Kopf. Eine bessere Art zu feiern wäre ihm gar nicht eingefallen. Er blies Rauch aus, legte sich aufs Bett. Janey sang vor sich hin und baute noch einen Joint. Eine Tür fiel zu, die Schritte eines Kunden draußen im Flur, dann Iris und das Klappern der Flaschen, die sie ihm übergab.
Janey beugte sich zu McCoy rüber und blies ihm sanft eine Graswolke ins Gesicht. Er atmete den Qualm ein, verfolgte die riesigen Schatten, die die Scheinwerfer der vorbeifahrenden Autos warfen. Lauschte dem Regen, der gegen das Fenster prasselte, erinnerte sich, wie er als kleiner Junge mit seiner Mum und seinem Dad im Wohnwagen gesessen hatte. Janey schaltete die Lampe aus, kuschelte sich neben ihn. Er betrachtete die orangefarbene Jointspitze, als Janey daran zog, sie glühte hell, wurde wieder dunkler. Er legte den Arm um sie, zog sie näher an sich heran, die Augen fielen ihm zu, und er döste ein.
2. Januar 1973
Drei
McCoy wachte auf und fror wie verrückt. Janey hatte alle Decken, nur ein dünnes Betttuch trennte ihn von dem Eis, das sich allmählich innen an den Scheiben bildete. Er versuchte sich in das Tuch zu wickeln und wieder einzuschlafen, aber es funktionierte nicht. Die Kombination aus Kater und Kälte ließ ihm keine Chance. Er versuchte Janey wachzurütteln, aber sie wollte nichts davon wissen, brummte nur und drehte sich um, vergrub sich tief unter den Decken. Er hob seine Klamotten auf, wo er sie fallen gelassen hatte, zog sich rasch an, schloss die Tür hinter sich und ging die Treppe hinunter. Halb sechs. Zu spät, um nach Hause zu fahren, zu früh für die Arbeit. Vielleicht sollte er doch mal in den Restaurants vorbeischauen. Was Besseres hatte er nicht zu tun.
Die Stadt erwachte bereits allmählich, die ersten Busse rollten vorbei, Fahrgäste lehnten noch halb schlafend an den Fenstern, dick eingemummelt gegen die Kälte. Neujahr war vorbei, alles wieder normal, egal wie schlimm der Kater auch sein mochte. Die weihnachtlichen Lichterketten quer über den Straßen brannten, Glöckchen und Stechpalmen blitzten matt durch den eisigen Nebel, und jetzt schneite es auch noch. An der Ecke zur Sauchiehall Street jagte ein Hund ein paar Möwen, die an einer umgekippten Mülltonne fraßen, sie stoben auseinander, schrien in den Himmel.
McCoy fror, seit halb sieben stand er unter dem Vordach des Malmaison, stampfte mit den Füßen auf und blies sich in die Hände, um sich warm zu halten. Er hatte einem Straßenkehrer zugesehen, der versuchte, die durchweichten Chipstüten und leeren Bierflaschen aufzuheben, die sich über den Gehweg verteilten, hatte einem Jungen, der aus einem Kinderwagen Zeitungen feilbot, ein Exemplar abgekauft und war zwei Männern ausgewichen, die einen mit altem Teppichboden beladenen Karren die Hope Street entlangschoben. Gründlich durchsuchte er jede einzelne Tasche, konnte aber seinen zweiten Handschuh nicht finden. Den einen, den er trug, streifte er gerade von der linken Hand und zog ihn über die rechte, als der Geschäftsführer des Restaurants auftauchte. Mr. Agnotti, so stellte er sich vor. Entpuppte sich als echter Schnösel. Kaum denkbar, in so einem Laden arbeiten zu müssen. McCoy war nur einmal in dem Restaurant gewesen. Bei Murrays fünfzigstem Geburtstag. Noch mal würde er da wohl eher nicht hingehen, es sei denn, er gewann im Lotto. Kellner waren mit Silbertabletts und Weinflaschen durch den großen holzvertäfelten Raum gehuscht. Die anderen Gäste waren Geschäftsleute gewesen, hatten durchgebratene Steaks und Krabbencocktails in sich reingestopft und nach dem Essen noch Zigarren in ihre feisten Visagen gesteckt.
Agnotti führte ihn in sein Büro und bat darum, McCoys Dienstausweis sehen zu dürfen, bevor er bereit war, Auskünfte zu erteilen. Fragen gestellt zu bekommen gefiel ihm nicht. Wie sich herausstellte, arbeitete tatsächlich ein Mädchen namens Lorna dort, als Unterkellnerin, was auch immer das war. McCoy schrieb eine Adresse auf ein kleines Kärtchen und reichte es ihm.
»Darf ich fragen, worum es geht?«, fragte Agnotti.
McCoy lächelte ihn an, konnte es sich nicht verkneifen. »Nein«, sagte er. Ein Küchenjunge kam, als McCoy gerade gehen wollte, und kettete draußen sein Fahrrad an. Als McCoy ihn nach Lorna Skirving fragte, zeigte er auf ein Bild an der Infotafel für die Mitarbeiter im Gang. Es war bei einem gemeinsamen Kneipenabend der Belegschaft entstanden. Vier Frauen saßen an einem Tisch, hatten sich aufgedonnert, hoben die Gläser, grinsten breit. Lorna Skirving war die ganz hinten. Neunzehn Jahre alt, tief ausgeschnittenes Kleid, blond gefärbte Haare, gut aussehend. Er nahm das Bild von der Tafel und steckte es ein. Das musste die sein, die Nairn gemeint hatte. Im Whitehall war er bereits gewesen, und dort arbeitete niemand mit dem Namen Lorna: zwei Lauras, aber keine Lorna.
Nach Aussage des Küchenjungen hatte sie kein Telefon, also rief McCoy auf der Wache an und schickte einen Streifenwagen zu ihrer Anschrift, damit sie hergebracht wurde. Er wartete in der Küche, das war der wärmste Ort hier, und sah bei den Vorbereitungen für das Mittagessen zu. In großen Töpfen mit Kartoffeln und Karotten blubberte es, Platten voller Fleisch kamen aus dem Kühlraum. Ein Italiener, der kein Englisch sprach, reichte ihm eine winzige Tasse mit starkem Kaffee. Er sagte »Gracias«, hielt sich dabei für schlau und merkte erst, als der Mann verdattert abzog, dass er es nicht war. Fünfzehn Minuten später rief jemand von der Wache an. Die Kollegen von der Streife hatten sich über Funk gemeldet, es sei niemand an die Tür gekommen. Sie musste wohl schon zur Arbeit gegangen sein. Er seufzte, was anderes blieb ihm ja nicht übrig, dann rief er Wattie vom Münztelefon aus an. Für diesen Job brauchte man mehr als einen.
Das Golden Egg Café war ein echtes Loch, genau wie die vielen Wimpy-Filialen, nur hieß es anders. Dafür gab’s Fotos auf der Speisekarte – seinen Eiern mit Speck nach zu urteilen, waren sie allerdings woanders aufgenommen worden. Doch einen Vorzug hatte der Laden: Er befand sich direkt gegenüber dem Busbahnhof. So nah dran, dass er trotz der Unterhaltungen der anderen Gäste und der durch die Küche gebrüllten Befehle die Lautsprecherdurchsagen hören konnte. Er wischte die beschlagene Scheibe frei und schaute nach draußen. Acht Uhr, und es war noch nicht mal richtig hell. Die Straßenbeleuchtung war noch an, der Schnee wurde immer dichter, blieb jetzt liegen. Autos und Busse schoben sich Schnauze an Hinterteil an die große Kreuzung zur Buchanan Street heran. Lorna Skirvings Adresse war eine in Royston; alle Busse, die von dort in die Innenstadt fuhren, hielten am Busbahnhof. Sie musste hier ankommen. Jetzt galt es, sie in der Menge zu entdecken, bevor sie zur Arbeit ging und dort von einem Kerl gemeuchelt wurde, dem der Hummer Thermidor gestern Abend nicht gemundet hatte.
»Wann fängt sie an?«
McCoy drehte sich um, hatte fast vergessen, dass er da war. Wattie. Ein alter Kumpel von Murray auf der Wache in Greenock hatte ihn angerufen und gesagt, er habe einen aufgeweckten Jungen, zu aufgeweckt für Greenock, eigentlich sollte er in Glasgow mit den Großen rumziehen. Der aufgeweckte Junge saß jetzt kerzengerade auf seinem Stuhl, beobachtete die Menschenmassen draußen, als würde er Palastwache schieben. McCoy hatte sich mit Murray gestritten und versucht, Wattie an Richards, Wilson oder sonst wen abzuschieben. Hauptsache, er hatte ihn nicht an der Backe. Aber Murray war hart geblieben. Drei Monate lang hatte der arme Kerl auf der Wache das Telefon abgehoben und Tee gekocht. Nun war es Zeit, dass er einen Beamten im Dienst begleitete. Murray hatte McCoy auf die übliche Weise rumgekriegt. Mit Schmeicheleien. Der aufgeweckte Junge brauche einen erfahrenen Kollegen als Aufpasser, deshalb könne man ihn keinem Schreibtischhengst wie Richards zuteilen. Keine Ahnung, warum Murray so großen Wert darauf legte, man sollte glauben, er hätte seine Lektion inzwischen gelernt. Auch vorher hatte es schon Beschwerden gegeben, sicher würden wieder welche kommen. Der Letzte, den man ihm an die Seite gestellt hatte, war heulend zu Murray zurückgerannt. »Er verrät mir nicht, was los ist, er redet nicht mit mir, bla bla bla.« Trotzdem saß der Neue jetzt hier, die blonden Haare feucht zurückgekämmt, ein offenes Gesicht, dunkler Anzug und frisch geputzte Schuhe. Sechsundzwanzig war er, sah allerdings aus wie fünfzehn. Grüner ging’s nicht.
»Halb neun soll sie da sein«, sagte McCoy, gähnte mit weit aufgerissenem Mund.
»Darf ich das Foto noch mal haben?«, fragte Wattie.
Er gab es ihm. Wattie zu beobachten war, als würde er sich selbst vor etlichen Jahren sehen. Lange her, seit er ebenso enthusiastisch und arbeitseifrig gestartet war. Lange her, dass er mit geputzten Schuhen und gebügeltem Hemd zur Arbeit erschienen war. Er betrachtete sein Spiegelbild im Fenster, kein schöner Anblick. Dringend hätte er einen anständigen Haarschnitt und einen Anzug gebraucht, der nicht aussah, als hätte er darin geschlafen.
Er stand auf und schaute wieder nach draußen. Eine weiße Schicht bildete sich auf dem Asphalt. »Wir gehen rüber, mal sehen, ob wir sie abfangen können.«
Der Busbahnhof befand sich oberhalb der Innenstadt, grenzte auf der einen Seite an die Hochhauswohnungen in Dobbies Loan und auf der anderen an die neue Autobahn, der die alte Garscube Road hatte weichen müssen. Es war eine riesige asphaltierte Fläche, wohl an die zweitausend Quadratmeter, gesäumt von schräg eingezeichneten Haltebuchten für die Busse. Unterstände und Bänke zogen sich ringsum, und am Eingang war ein Café, neben dem das Golden Egg wie das Malmaison wirkte. Busse trafen von überallher ein – den Sozialsiedlungen am Stadtrand, den reichen Vororten, sogar von der Küste, Ardrossan und Largs. Auch der Bus nach London fuhr hier ab, jeden Morgen einer, und immer gab’s eine lange Warteschlange davor. Die Chance auf ein neues Leben kostete eine Fahrkarte zu fünf Shilling.
Ein dicker Mann mit Hut und Pfeife erklärte ihnen, die Busse aus Royston würden an den Haltebuchten 21 bis 24 eintreffen, und zeigte in die Ecke ganz hinten. Eine alte Frau saß auf einer Bank an der Bucht 22 und warf McCoy einen bösen Blick zu, rümpfte die Nase, als er sich setzte, und schob sich und ihre Plastiktüten ein Stück weiter. McCoy sah Wattie zu, der auf und ab ging, mit den Füßen stampfte, um sich warm zu halten, sein Feuerzeug auf- und zuschnappen ließ, leise vor sich hin summte. Zumindest war er still; der Letzte hatte die Klappe nicht halten können. Ein Schwachkopf aus Edinburgh mit wissenschaftlichem Diplom, den man zur vorgezogenen Beförderung vorgeschlagen hatte, was er einem alle fünf Minuten auf die Nase band. Mit eingezogenem Schwanz war er nach Edinburgh zurückgekrochen, nachdem er zwei Frauen hatte festnehmen wollen, die sich vor dem Barrowlands geprügelt und ihm dies mit einer gebrochenen Nase und einem blauen Auge gedankt hatten.
Ein Doppeldecker bog ab und fuhr in die Bucht vor ihnen. McCoy stand auf. Die Bustür zischte und öffnete sich. Ein paar alte Männer, die irgendwas wegen des Schnees vor sich hin brummten, stiegen aus, gefolgt von einem Kerl im Arbeitsoverall und mit eingepacktem Sandwich unter dem Arm. Dann eine Gruppe Schulkinder, die schrien und sich gegenseitig anrempelten.
Keine Lorna Skirving.
Im nächsten war sie auch nicht. Wattie hatte schließlich genug vom Auf-und-Abgehen, setzte sich auf eine Bank, streckte die Beine aus, gähnte laut. McCoy sah einen alten Mann Krümel auf den nassen Boden werfen. Wie aus dem Nichts kamen Spatzen angeflogen.
Ein weiterer Bus hielt und fuhr wieder weg, noch immer keine Lorna. Allmählich dachte er, Nairn habe ihn doch verarscht, als er die Menschen auf der gegenüberliegenden Seite auseinanderstieben sah. Rufe, ein Mann wollte wegrennen, rutschte aus. Eine Frau schrie.
McCoy lief los. Er hatte den Vorplatz schon halb überquert, als er um ein Haar von einem zurückstoßenden Bus erwischt worden wäre. Er sprang zur Seite, stolperte, schaute auf und sah, wovor die Menge zurückwich. Er war jung, noch ein Teenager, trug Anorak und Jeans. Den linken Arm hielt er ausgestreckt, eine Waffe fest in der Hand.
»Polizei!«, rief McCoy. »Lassen Sie die Waffe fallen!«
Das Klappern schwerer Schuhe, schon stand Wattie neben ihm, sein Atem bildete Dunstwolken, sein Blick sprang hin und her. McCoy packte ihn an der Schulter, zeigte auf die Menschen. »Bring sie in Sicherheit. Jetzt, sofort!«
Wattie nickte, rannte erschrocken los. Doch McCoy hatte keine Zeit, sich Sorgen um ihn zu machen. Er musste dem Jungen die Waffe abnehmen, bevor der auf die Idee kam abzudrücken. Er holte tief Luft und ging langsam auf ihn zu, versuchte, möglichst ruhig zu klingen, was aber nicht leicht war, sein Herz schlug wie ein Hammer in seiner Brust.
»Leg sie einfach weg, Kleiner. Ist ja nichts passiert, hm?«
Seine Stimme klang zu bemüht, zu nett, aber er konnte es nicht ändern. Der Junge sah ihn nicht einmal an, drehte nur immer wieder den Kopf von rechts nach links, überflog die Gesichter in der Menge, suchte jemanden. Hinter sich hörte er Wattie, der dabei war, die Leute aus der Schusslinie zu treiben. Eine Frau weinte, ein kleines Kind heulte, andere schrien. Er versuchte den Lärm auszublenden. Nur er und der Junge mit der Waffe, was anderes zählte nicht. McCoy ging weiter auf ihn zu, ganz langsam, die Hände hoch erhoben, blieb dabei immer zwischen ihm und der Menge.
»Komm schon, Junge, hör auf damit. Leg sie einfach weg, hm? Ist nicht so …«
Plötzlich fokussierte ihn der Junge, als hätte er McCoy gerade zum ersten Mal gesehen. Er schwenkte den Arm in seine Richtung und spannte den Abzug, zielte mit der Pistole auf McCoys Kopf. McCoy erstarrte, der Junge korrigierte leicht und drückte ab. Ein lauter Knall. Eine Spatzenwolke erhob sich vom Dach, und jetzt wurde erst richtig geschrien.
McCoy konnte kaum glauben, dass er nicht getroffen worden war, er hätte schwören können, einen kalten Luftzug direkt über seinem Kopf gespürt zu haben. Die Menschen hinter ihm rannten, fielen, stießen einander zur Seite, wollten entkommen. Wattie schrie sie alle an, sie sollten am Boden bleiben. Sie legten sich hin, und da sah McCoy sie. Sie lag halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße, ihr Körper hing über den Bordstein. Blonde Haare, weißer Mantel, ein glänzender schwarzer Schuh knapp einen Meter weiter. Sie wollte sich aufsetzen, sah sich verdattert um. Blut floss ihre Beine hinab, färbte den Schnee rot. Sie schaute an sich herunter, ihr Mund öffnete sich für einen Schrei, aber es kam kein Ton heraus. McCoy drehte sich wieder zu dem Jungen mit der Waffe um.
»Leg die Waffe ab, Junge, komm schon, du hast es getan. Leg sie einfach hin.«
Der Junge lächelte ihn an, machte nicht den Eindruck, als wäre er bei Sinnen. Sein Blick war leer, entrückt. Er hielt die Pistole von sich gestreckt, betrachtete sie. Schneeflocken hatten sich in seine Haare gesetzt, schmolzen, tropften ihm ins Gesicht. Er wischte sich die Augen, lächelte erneut, und da begriff McCoy, was er vorhatte.
Er rannte auf ihn zu, seine Schuhe fanden kaum Halt auf dem glatten Boden. Er war nur noch wenige Meter entfernt, als der Junge sich den Lauf an die Schläfe hielt. McCoy schrie, er solle aufhören, war fast schon bei ihm, als der Junge die Augen schloss und abdrückte.
Dieses Mal war das Geräusch gedämpft, kein Knall. Roter Dunst trat auf der anderen Seite seines Kopfes aus, Knochensplitter, ein dicker Blutstrahl spritzte schräg empor. Er schwankte, die Augen ins Schädelinnere verdreht, und fiel auf die Knie, verharrte ungefähr eine Sekunde in dieser Haltung, dann kippte er vornüber.
McCoy rannte zu ihm und trat ihm die Waffe aus der Hand, wich dem Blut aus, das noch immer seitlich aus seinem Kopf floss. Aus der Nähe wirkte er noch jünger, als es zunächst den Anschein gehabt hatte. Zwei schmutzig weiße Sportschuhe, ein Daunenanorak mit ausgerissener Tasche und Flaum auf der Oberlippe. Im Mundwinkel hing blutiger Schaum, ein großes Stück vom Schädel fehlte, Knochen und Hirn verteilten sich auf dem Pflaster.
Wattie kniete neben der jungen Frau, hielt ihr einen Finger an den Hals. Wenig später blickte er auf und schüttelte den Kopf. McCoy wunderte sich nicht; bei dem Blutverlust hatte sie kaum eine Chance gehabt. Noch immer kamen Lautsprecherdurchsagen. Der 14er-Bus aus Auchinairn hatte Verspätung. Er sah zum Himmel auf und ließ sich den Schnee aufs Gesicht fallen. In der Ferne hörte er die anschwellenden Sirenen. Er drehte sich um, als ein Bus in die Bucht vor ihnen bog, der Fahrer vorne im Führerhaus starrte mit offenem Mund auf die leblosen Körper. Zu spät trat er auf die Bremse, und sein Bus schlitterte über den Asphalt gegen die Wand. Es krachte, und der Fahrer wurde nach vorne gerissen und landete auf der Hupe. Sie blökte, hallte von den Wänden des Bahnhofsunterstands wider. McCoy sah zurück zu dem Jungen. Seine linke Hand verkrampfte, seine Finger öffneten und schlossen sich, er rollte wild mit den Augen. Hustete einen riesigen dunklen Klumpen Blut. Seine Brust hob und senkte sich kaum merklich, er atmete flach. McCoy ging in die Hocke, nahm seine Hand.
»Wird schon wieder, halt durch, dauert nicht mehr lange.«
Der Junge hustete erneut. Wieder kam Blut, lief an seinem Gesicht hinunter und sammelte sich im frischen Schnee. McCoy hielt seine Hand, sagte ihm, alles würde wieder gut werden, und wusste, dass es nicht stimmte. Er wünschte, er wäre ganz woanders.
Vier
McCoy saß auf der Bank an der Royston-Haltebucht und rauchte, als Murray eintraf. Er brauchte ein bisschen Zeit abseits von Blut und umhereilenden Streifenpolizisten und Wattie, der ihn alle zwei Sekunden etwas fragte.
Die Krankenwagen waren zuerst eingetroffen. Ein Sanitäter hatte ihm eine Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, sie würden jetzt übernehmen. McCoy hatte aufstehen wollen, aber die Finger des Jungen hatten immer wieder seine gedrückt. Er wusste, dass es nur ein Krampf war, aber er konnte nicht loslassen, brauchte das Gefühl, dem Jungen Trost spenden zu können. Der Sanitäter hatte seine Hand von der des Jungen gelöst. Er war stehen geblieben, hatte den Jungen angeschaut und sich schließlich von einem anderen Sanitäter wegführen lassen.
Als Nächstes waren die Polizeiwagen eingetroffen, dann die Transporter mit den Uniformierten, dann die nicht gekennzeichneten Fahrzeuge, schließlich die Laster mit den Absperrplanken. Es herrschte absolutes Chaos, Schreie, Sirenen, weinende Menschen, und immer noch plärrte die Lautsprecheranlage.
Die Reihe an Uniformierten, die den Eingang abriegelte, teilte sich, und ein schwarzer Rover passierte die Absperrung, schlängelte sich durch das dichte Labyrinth der auf dem Vorplatz abgestellten Bussen. Kaum hielt der Wagen, kam ein Streifenpolizist herbeigeeilt, öffnete die hintere Tür, und Murray stieg aus. In wenigen Sekunden war er von Beamten umringt, sie zeigten auf das Mädchen und den Jungen, erklärten, was geschehen war. Murray hörte eine Weile zu, dann hob er die Hand, ließ sie alle verstummen. Er gestikulierte in Richtung der Menge hinter der Absperrung und schickte einen Kollegen dorthin, bellte den anderen Befehle zu und eilte dann im Laufschritt zum Eingang.
McCoy sah ihm nach, als er das Absperrband hob und sich darunter hindurchduckte. Uniformierte und Sanitäter traten zurück, wichen ihm aus. Wattie stand da und versuchte möglichst auszusehen, als wüsste er, was zu tun war. Er hatte sogar sein kleines Notizheft gezückt. Murray nickte ihm zu, ging in die Knie und zog vorsichtig die grüne Abdeckplane von der Leiche des Mädchens. Obwohl der Junge von Ärzten und Sanitätern umringt war, hielt Murray dies nicht davon ab, sie beiseitezuschieben und ihn sich selbst anzuschauen. Er fragte Wattie etwas und sah sich um, suchte McCoy, fand ihn und winkte. Murray erteilte weitere Anweisungen, schickte Wattie eilig los und überquerte dann den Vorplatz. Noch immer schneite es, aber Murray trug keinen Mantel, nur wie gewöhnlich ein Tweedjackett, das an den Schultern spannte, außerdem einen Trilby auf dem Kopf. Er war ein großer Mann, über eins achtzig, seine roten Haare wurden allmählich grau, im geröteten Gesicht spross ein Schnurrbart. Sah aus wie ein aus dem Leim gegangener Rugbyspieler, was er auch war. McCoy war nicht sicher, wieso sie sich verstanden; soweit er das beurteilen konnte, hatten sie nichts gemeinsam. Vielleicht hatten alle anderen einfach nur zu viel Angst vor ihm, um sich normal mit ihm zu unterhalten.
»Wie geht’s?«, fragte er, trat in den Unterstand, zog seinen Trilby vom Kopf und schüttelte ihn.
McCoy nickte. »Gut. Anders als den beiden.«
»Schöne Scheiße«, sagte er und setzte sich neben ihn. »Wattie hat gesagt, ihr seid hergekommen und habt das Mädchen gesucht, bevor’s passiert ist. Hast ihm aber nicht gesagt, warum. Stimmt das?«
McCoy nickte.
»Wie kam’s?«, fragte Murray leise, sein Borders-Akzent war ihm gerade so noch anzuhören. Murray kannte nur zwei Lautstärken. Entweder er schrie, was bedeutete, dass er genervt war, oder er redete sehr leise, was bedeutete, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis er genervt war.
McCoy seufzte, wusste, dass ihm etwas bevorstand. »Nairn war’s, Howie Nairn. Darum ging’s bei dem Anruf, hat mich gestern Abend nach Barlinnie bestellt und mir erzählt, heute würde ein Mädchen getötet werden. Er wollte, dass ich’s verhindere.«
Murray klopfte sein Jackett ab, suchte seine Pfeife. Plötzlich fiel ihm auf, dass ihm zwei Beamte in Zivil gefolgt waren, neben ihm standen und warteten. »Was zum Teufel macht ihr beiden da? Steht da wie zwei überflüssige Stecher auf einer Hochzeit. Verzieht euch und seht zu, dass der Tatort ordentlich gesichert wird, und zwar sofort!«
Die beiden eilten erschrocken davon. Murray hatte endlich seine Pfeife gefunden, steckte sie in den Mund und zeigte mit dem Finger.
»Siehst du das da drüben, McCoy? Die kaputten Busse, das Blut, die Leiche, die heulenden Kinder und die ganzen scheiß Gaffer, die an der Absperrung vorbeiwollen? So was nennt man eine echte ausgewachsene Riesenscheiße. Eine echte ausgewachsene Riesenscheiße, die ich wieder in Ordnung bringen muss. Also, wieso fängst du nicht einfach noch mal von vorne an und erzählst mir, was zum Teufel hier eigentlich los war und was du damit zu tun hast?«
McCoy ließ seine Zigarette auf den Boden fallen, sah zu, wie sie verglühte, und begann seinen Bericht. »Gestern Abend hat mich Howie Nairn nach Barlinnie bestellt, ein Wärter hat für ihn auf der Wache angerufen. Ich komme hin, und er erzählt mir von einem Mädchen namens Lorna, die im Malmaison oder im Whitehall arbeitet. Kein Nachname. Behauptet, sie soll heute umgebracht werden. Ich dachte, er spielt Spielchen, aber ich hab’s trotzdem überprüft, und tatsächlich gibt’s … gab’s … im Malmaison so ein Mädchen, Lorna Skirving.« Er nickte zu der Toten.
»Heute Morgen war sie nicht zu Hause, also sind wir her, um sie abzufangen, nur kam sie nicht mit dem Bus aus Royston, und deshalb haben wir sie verpasst. Anscheinend war sie gestern Nacht nicht in ihrer Wohnung. Bevor wir kapiert haben, was los ist, stand da der Junge mit der Waffe, und sie lag auf dem Boden.«
»Und was hat sie mit Nairn zu tun?«
McCoy zuckte mit den Schultern. »Wollte er mir nicht sagen.«
»Das wollte er dir nicht sagen? Na, stell sich das mal einer vor. Vielleicht hättest du ihn verdammt noch mal fragen sollen!«
»Hab ich ja …« Er versuchte zu protestieren, aber Murray wollte nichts davon hören.
»Dann hast du ihn eben nicht richtig gefragt. Du hättest dieses verfluchte Desaster hier verhindern können. Und übrigens, wie kommt es überhaupt, dass Nairn, dieses Arschloch, dir plötzlich seine Geheimnisse anvertraut?«
»Frag mich nicht. Gestern Abend kam der Anruf, also bin ich hin, hab gedacht, es geht um Garvie oder so. Ich kenne Nairn kaum. Er war Brodys Fall, nicht meiner.«
Murray tippte mit dem Mundstück der Pfeife gegen seine Schneidezähne, schüttelte den Kopf. »Nein. Da ist was, das du mir nicht sagst.«
»Hä?«
»Es muss einen Grund geben, warum Nairn mit dir reden wollte. Welchen?«
McCoy sah ihn an, traute seinen Ohren nicht.
»Wie bitte? Denkst du im Ernst, ich verschweig dir was, meinst du das wirklich? So eine Scheiße, Murray. Wieso sollte ich?«
»Sag du’s mir«, erwiderte er ruhig.
»Fick dich, Murray, das ist echt daneben.«
Murrays Gesicht verdüsterte sich. »Das auch, mein Freund. Hast du vergessen, mit wem du sprichst?«
»Nein, du? Meinst du wirklich, ich würde dich so hintergehen?«
Murray rieb sich über die Stoppeln an seinem Kinn, schüttelte den Kopf. »Nein. Aber es muss einen Grund dafür geben, warum er ausgerechnet mit dir sprechen wollte. Vielleicht kennst du ihn nicht, aber er kennt ihn.«
McCoy stand auf und sah zu, wie zwei Uniformierte eine Reihe von Fotografen hinter die Absperrung zurückdrängten. Krankenwagen fuhren an die beiden am Boden Liegenden heran, die Türen öffneten sich.
»Wo willst du hin?«, fragte Murray.
»Lebt der Junge noch?«
»Kaum. Wenn man das leben nennen will. Der halbe Kopf ist weg. Wer ist er? Hat Nairn dir das nicht gesteckt?«
McCoy ignorierte ihn. »Er ist niemand. Laut Wattie hat er nichts dabei. Keinen Ausweis, keine Hausschlüssel, keine Brieftasche, kein Geld, keine Narben, keine Tätowierungen. Er ist der verfluchte Unsichtbare. Ein goldenes Kruzifix um den Hals. Das war’s.«
Murray lächelte gequält. »Na, dann wissen wir wenigstens, dass es einer von euch ist.«
McCoy ignorierte auch das. »Also, was jetzt?«
»Ich geh da rüber und versuche Ordnung in den ganzen Mist zu bekommen, alles möglichst schnell zu erledigen, damit der Busbahnhof den Betrieb noch vor der Rushhour wiederaufnehmen kann. In der Innenstadt geht schon gar nichts mehr. Die Busse stehen von hier bis nach scheiß Paisley.« Er erhob sich. »Und du, ab mit dir nach Barlinnie. Finde raus, was Nairn treibt. Und dieses Mal lässt du dir ein paar verfluchte Antworten geben. Ich mein’s ernst. Der ist mindestens Mittäter. Setz das Arschloch unter Druck.«
»Hier sind wir schon fertig. Der Typ hat das Mädchen erschossen, dann sich selbst. Was gibt’s da rauszufinden?«