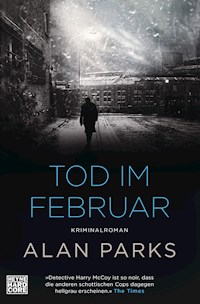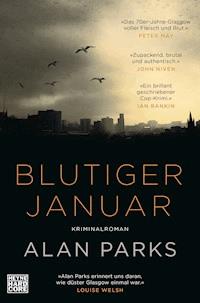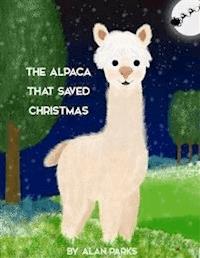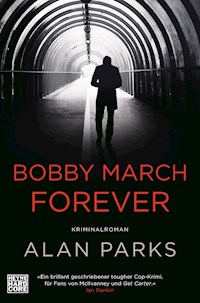
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Harry McCoy-Serie
- Sprache: Deutsch
Glasgow im Juli 1973. Die Stadt leidet unter einer Hitzewelle. Der Drogenhandel boomt. Eines seiner prominentesten Opfer ist Bobby March, der berühmteste Rockstar der Metropole, der mit einer Überdosis tot in einem Hotel gefunden wird. Detective Harry McCoy hat kaum die Ermittlungen aufgenommen, da soll er nebenbei die halbwüchsige Nichte seines Chefs finden , die ihr gutbürgerliches Elternhaus verlassen hat und in der Unterwelt Glasgows abgetaucht ist. Zu allem Überfluss verschwindet ein weiteres junges Mädchen spurlos. Die Stimmung kippt. Die Menschen wollen einen Schuldigen. Doch wie soll McCoy diesen finden, wenn es keine Unschuldigen gibt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Februar 1973: Glasgow scheint außer Rand und Band, als neuartige Drogen eine Welle der Gewalt auslösen. Detective Harry McCoy, der nach einer kurzen Auszeit gerade in den Dienst zurückgekehrt ist, hat gleich alle Hände voll zu tun: Mordopfern werden furchtbare Nachrichten in die Brust geritzt; rivalisierende Banden konkurrieren um die Vorherrschaft auf den Straßen; die Korruption nimmt ungeahnte Formen an, und die Eliten der Stadt kennen keine Gnade, wenn es darum geht, ihre Macht zu sichern. Harry McCoy lässt sich nicht beirren und heftet sich einem gnadenlosen Killer an die Fersen. Doch welche Rolle spielt sein ältester Freund Cooper in diesem schmutzigen Spiel?
Der Autor
Alan Parks studierte an der Universität von Glasgow Philosophie. Nach dem Studium arbeitete er als Creative Director bei London Records und später bei Warner Music, wo er für Acts wie All Saints, New Order, The Streets oder Gnarls Barkley zuständig war. Heute lebt er in Glasgow und London. Nach »Blutiger Januar« ist »Tod im Februar« sein zweiter Roman um Detective McCoy.
Alan Parks
Bobby March forever
Kriminalroman
Aus dem schottischen Englisch
von Conny Lösch
Wilhelm Heyne Verlag
München
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Bobby March Will Live Forever bei Canongate Books Ltd., Edinburgh
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter www.heyne.hardcore.de/facebook
@heyne.hardcore
Copyright © 2020 by Alan Parks
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Markus Naegele
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
unter Verwendung des Originalumschlags von Christopher Gale
Umschlagabbildung: © David Johnson / Trevillion Images;
Figure © Figurestock / Paul Thomas Gooney
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-27538-9V001
www.heyne-hardcore.de
Für Pamela Hunter
und für Dale Barclay
»Züchtige deine Leidenschaften, damit du nicht von ihnen gezüchtigt wirst.«
Epiktet
»So you want to be a rock ’n’ roll star«
The Byrds
Billy an der Anmeldung nimmt den Anruf entgegen. Eine Frau ist am Telefon, atemlos, verängstigt, fast schluchzend sagt sie: »Ich möchte ein Kind vermisst melden.«
Plötzlich ist nichts mehr, wie es war.
Wenn solche Nachrichten eintreffen, schrecken alle an ihren Schreibtischen auf, legen ihre Lottoscheine und halb aufgegessenen Brote beiseite. Diejenigen, die Kinder haben, klappen unter den Tischen ihre Brieftaschen auf, schauen sich die Bilder von Colin, Anne oder der kleinen Jane an – Gott sei Dank sind ihre eigenen nicht verschwunden. Die jüngeren Kollegen machen ernste Gesichter, versuchen, sich möglichst nicht vorzustellen, wie sie ein heulendes Kind aus einem Kohlenkeller oder unter einem Bett hervorziehen, sich vom Chef beglückwünschen lassen und die tränenreichen Dankesbekundungen einer Mutter entgegennehmen.
Die Gläubigen bekreuzigen sich oder sprechen ein stummes Gebet für die Sicherheit des Kindes. Und wer einen solchen Fall schon einmal miterlebt hat, begrüßt das vertraute Grauen, die Angst in der Magengrube und die Erkenntnis, dass Menschen fähig sind, Kindern entsetzlich Grausames anzutun. Vielleicht wäre das vermisste Kind tot inzwischen sowieso besser dran.
Wie ein Kiesel im Wasser ziehen Gerüchte weite Kreise in der gesamten Stadt. Ungeachtet der Nachrichtensperre dringt die Kunde von einem vermissten Kind immer nach draußen. Polizisten kommen nach Hause, bitten ihre Frauen und Freundinnen, es niemandem weiterzuerzählen, aber sie tun es trotzdem. In der Telefonzelle gegenüber der Wache fällt ein Shilling durch den Münzschlitz, ein Reporter beim Daily Record hebt ab, und ein Streifenbeamter hat sich mal wieder zehn Pfund dazuverdient. Es dauert nicht lange, bis die Zeitungsjungen draußen vor der Central Station laut rufen: »Neueste Ausgabe! Alles über das vermisste Mädchen!«
Und ehe man sichs versieht, wird in der Stadt über nichts anderes mehr gesprochen. Die Polizisten versammeln sich in Kirchensälen, lassen sich für die Suche unterweisen, sie reden nur noch über das Mädchen, und auch die Reporter kennen kein anderes Thema, insbesondere wie man an ihre Eltern herankommt. Wetten werden abgeschlossen, wann sie gefunden wird. Darüber quatschen alle Kids in den Hinterhöfen, geflüsterte Gerüchte und Geschichten, angeblich wurde sie in ein Auto gezerrt.
Als es Nacht wird und das Gerede verstummt, gibt es nur noch eine Person, die nicht weiß, worüber ganz Glasgow spricht. Alice Kelly. Sie hat keine Ahnung, dass sie das einzige Stadtgespräch ist. Sie weiß nur, dass ihr Kopf in einem Sack steckt, ihre Hände gefesselt sind und sie sich in die Hose gemacht hat. Und noch etwas weiß Alice. Egal, wie sehr sie nach ihrer Mutter weint, ihre Mutter kann sie nicht hören. Niemand kann sie hören.
16. Februar 1964
Glasgow
Im Zug war es eiskalt, aber das machte ihm nichts aus. Es war der um 18:15 Uhr nach London King’s Cross. Und er saß tatsächlich drin. Tom hatte eine Tüte voll Bierdosen dabei und diese verteilt, als sie die Central Station verließen. Jetzt waren sie am Trinken. Scott, Barry, Jamie und er. Alle hatten die Füße auf die Sitze gelegt, sich die Bäuche mit Pommes vollgeschlagen und schön geraucht. Witze erzählt. So getan, als wären sie gar nicht aufgeregt.
Bobby beugte sich vor und sah noch mal in seiner Tasche nach. Da war er, genauso wie die letzten Male, die er nachgesehen hatte. Der Vertrag – er hatte seinen Vater so lange angebettelt, bis er ihn endlich unterschrieben hatte. Selbst konnte er’s nicht machen, dafür war er noch zu jung, erst siebzehn. Sein Vater hatte gesagt, er sollte erst eine Lehre machen, da würde er regelmäßig Geld bekommen, aber das kam gar nicht infrage. Zwei Wochen lang toben und betteln, dann hatte sein Vater schließlich nachgegeben.
Als er ihn zum ersten Mal gesehen hatte, konnte er’s kaum glauben. Ganz oben stand Parlophone. Wie bei den Beatles. Die Exklusivrechte an der Musik von The Beatkickers. Der kleine Bobby March aus Arden, jetzt saß er im Zug nach London und fuhr zu einer Aufnahmesession bei demselben Label, auf dem die Beatles waren. Tom meinte, es würde schon alles glattgehen, er solle sich keine Sorgen machen, immerhin sei er der Einzige von ihnen, der überhaupt richtig spielen könne.
Er sah sich im Abteil um. Tom hatte nicht ganz unrecht. Jamie spielte einigermaßen Schlagzeug, wenn er sich Mühe gab. Aber Scott beherrschte seinen Bass beim besten Willen nicht, und Barry bekam kaum eine Melodie hin. Aber das war ja nicht das Einzige, worauf es ankam, behauptete Tom. Barry sah gut aus, sehr gut sogar. Und er wusste es. Den Kamm legte er praktisch nie aus der Hand, brachte ständig seine Haare in Ordnung, toupierte sie leicht an für mehr Volumen, trug einen perfekten blonden Pony und immer die richtigen Klamotten. Außerdem hatte er die weißesten Zähne, die Bobby je gesehen hatte.
Die Tür zum Abteil wurde zurückgeschoben, und Tom stand vor ihnen. In Rollkragen und Jeans. Er war ein großer Kerl, über eins achtzig und kräftig gebaut. Früher hatte er als Möbelpacker geschuftet. Jetzt war er der Manager der Beatkickers, hatte ihnen Anzüge und alles Mögliche gekauft. Und sie waren dabei durchzustarten. Er klatschte in die Hände.
»Alles gut, Jungs?«, fragte er.
Sie nickten, hoben jubelnd die Dosen.
Scott senkte das Kinn auf die Brust, rülpste laut. Alle lachten.
»Du Drecksau«, sagte Tom und tat, als wollte er ihm was auf die Ohren geben. Scott drehte sich blitzschnell um, wäre fast vom Sitz gefallen.
»Das hast du davon«, sagte Tom. Dann zeigte er auf Barry. »Du, Kleiner, komm mal kurz mit.«
Bobby nahm einen Schluck von seinem warmen Bier, fragte sich, warum Tom ausgerechnet immer mit Barry reden wollte. Vielleicht gab er ihm noch Tipps für morgen, wegen der Mikros und so. Barry stand auf, folgte Tom durch die Tür. Scott rülpste noch mal. Und wieder lachten alle.
13. Juli 1973
Eins
McCoy sah auf seine Armbanduhr. Viertel nach acht. Der Anruf war gestern Abend um kurz vor sechs reingekommen, also wurde sie jetzt seit ungefähr fünfzehn Stunden vermisst. Viel zu lange, als dass sie sich verlaufen oder bei einer Freundin verquatscht haben könnte. Ein dreizehnjähriges Mädchen verschwand nicht für fünfzehn Stunden, nicht über Nacht, ohne dass etwas entsetzlich faul war.
Er bog in die Napiershall Street ab und fluchte. Jegliche Hoffnung, sich in Ruhe umzusehen, wurde augenblicklich zerschlagen. Der Zirkus war längst in der Stadt. Mütter mit besorgten Mienen und Babys auf den Armen unterhielten sich gedämpft, Kinder bestaunten die Polizeiautos, ein paar bekannte Typen von der Tagespresse hockten auf der Mauer und rauchten, warteten die neuesten Entwicklungen ab. Ein Fotograf von der Evening Times wischte seine Kameralinse mit seiner Krawatte sauber. Direkt vor dem Pub parkten vier oder fünf Streifenwagen und ein Wagen von der Spurensicherung gegenüber. Ein Irrer hatte sich eine Reklametafel mit einem Bibelspruch umgehängt, ging damit auf und ab, und verteilte Traktate. McCoy fluchte leise, überquerte die Straße und hielt auf den Eingang zu.
Die Türen des Woodside Inn waren mit einem Keil fixiert, damit ein bisschen Luft hineinkam. Er trat ein und stellte fest, dass es nicht viel half. Drinnen war es noch heißer als draußen. Ein paar Lichtstrahlen drangen durch die geschlossenen Fensterläden, stachen in den nebligen Dunst und den Zigarettenqualm, die Atmosphäre erinnerte eher an eine Kirche als an eine Kneipe in Maryhill. McCoy brauchte ein paar Sekunden, bis sich seine Augen an das trübe Licht gewöhnt hatten, dann sah er, wie verändert das Woodside wirkte.
Eigentlich war es gar kein Pub mehr, sondern ein provisorisch eingerichteter Polizeistützpunkt. Ungefähr zwanzig Uniformierte hatten ihre Mützen abgesetzt und die Ärmel hochgekrempelt, sie saßen hinten auf den Bänken und ließen sich von Thomson Anweisungen für die Befragung der Nachbarn geben. Eine große Karte der Umgebung – Maryhill, North Woodside, Firhill – lag ausgebreitet auf einem der Tische, die Ecken wurden von kleinen Johnnie-Walker-Wasserkrügen gehalten. Die Karte war in Bereiche eingeteilt, von denen einige bereits durchgestrichen waren. PC Walker, eine junge Polizistin, ging mit einem Tablett voller mit Wasser gefüllter Pintgläser herum, reichte jedem eins. Zwei Männer in Overalls versuchten, die drei marineblauen Telefone auf dem Tresen anzuschließen, während der Wirt auf einem Hocker danebensaß – in der einen Hand eine Kippe, in der anderen ein Bier – und völlig verdattert guckte, als wüsste er nicht, was ihn gerade überfahren hatte.
Die Tür zur Herrentoilette ging auf, und die einzige Person, die McCoy auf keinen Fall hatte sehen wollen, kam heraus und trocknete sich die Hände an einem Papiertuch. Bernie Raeburn in seiner ganzen behäbigen Herrlichkeit. Raeburn gehörte zu den Männern, die sich ein bisschen zu viele Gedanken über ihr Aussehen machten. Pomadige Haare, penibel gestutzter Schnurrbart, silberne Krawattennadel, gewienerte Schuhe. Wahrscheinlich kam er sich wahnsinnig schick vor. In McCoys Augen sah er exakt so aus wie das, was er war: ein Arsch.
Raeburn ließ das Papiertuch in einen Eimer neben einem der Tische fallen und schaute rüber zu McCoy. Schien über dessen Anblick nicht erfreut zu sein. Ganz und gar nicht.
»Was willst du hier?«, fragte er.
»War gerade in der Gegend. Wollte mal schauen, ob ich was tun kann«, erwiderte McCoy.
»Was du nicht sagst«, meinte Raeburn, guckte amüsiert. »Ich denke, wir kommen klar. Ich hab ja meine Jungs hier.«
»Okay.« McCoy widerstand dem Impuls, Raeburn zu sagen, wohin er sich seine »Jungs« schieben konnte. »Schon was Neues?«
»Wir kommen voran«, sagte Raeburn. »Wir kommen voran …«
Er hob den Zeigefinger. Moment mal. Zog sein Jackett aus, strich sich über das hellblaue Hemd. Dann erst war er bereit weiterzusprechen.
»Doch, es gibt tatsächlich etwas, womit du uns helfen könntest, McCoy. Geh zur Wache, sag Billy an der Anmeldung, er soll rundrufen. Alle, die noch nicht in die Ferien gefahren sind, sollen so bald wie möglich wieder zum Dienst erscheinen. Ich brauche Leute für die Befragung der Nachbarn.«
McCoy nickte, blieb ganz ruhig. Verkniff sich den Blick zu den frisch installierten Telefonen auf dem Tresen.
»Und zwar heute noch, hm?«, schickte Raeburn hinterher, schaute zur Tür.
McCoy blieb kurz stehen und überlegte, was er tun sollte. Plötzlich war es ganz still im Pub, er konnte sogar die dicken schwarzen Fliegen an den Fensterscheiben hören. Und wusste, dass alle sie beobachteten, gespannt darauf, was passierte. Es war die zigste Runde im andauernden Kampf zwischen Raeburn und McCoy. Auf der Wache wurden schon Wetten abgeschlossen: Wie lange würde es noch dauern, bis einer dem anderen die Fresse polierte? Die meisten tippten auf ungefähr eine Woche.
McCoy holte tief Luft, lächelte. So herumkommandiert zu werden war fast mehr, als er ertragen konnte. Doch er wusste, wenn er nicht tat, was Raeburn ihm auftrug, würde er eine Abmahnung bekommen, sobald Raeburn das entsprechende Formular in seine Fettfinger bekam. Raeburns Plan war denkbar schlicht. Er machte einfach so lange Druck, bis McCoy endlich ausrastete und ihm einen Vorwand lieferte, ihn abzuschießen. Aber die Genugtuung wollte McCoy dem Arschloch nicht gönnen. Jedenfalls nicht heute.
»Mach ich«, sagte er fröhlich.
Er hatte das Pub längst verlassen, als er seine geballten Fäuste löste. Er zog seine Zigaretten aus der Tasche, zündete sich eine an, dachte an zahlreiche und unterschiedliche Möglichkeiten, Raeburn Schmerzen zuzufügen, als er aufblickte und Wattie vor sich sah.
»Hab gehört, dass du hier bist«, sagte Wattie.
»War bei einem Einsatz in der Nähe. Hab meine Hilfe angeboten, aber offenbar braucht Raeburn keine. Ich soll zur Wache gehen.«
Watties blonde Haare klebten an seinem verschwitzten Kopf. Unter den Achseln seines kurzärmeligen Hemds breiteten sich dunkle Ringe aus. Er wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn und merkte, dass McCoy ihn ansah.
»Hab die Nachbarn abgeklappert, immer die verfluchten Treppen rauf und runter«, sagte er. »Ich schwitze wie ein Glasbläser am Arsch.«
McCoy lachte. »Du lieber Himmel, Wattie, wo hast du den Spruch denn her?«
Wattie grinste. »Hat mein Dad immer gesagt.« Er öffneteden obersten Hemdknopf, lockerte seine Krawatte. »Jetzt begreife ich erst, was er gemeint hat.«
»Dann ist das also das tolle Konzept von Raeburn, dem Großen?«, fragte McCoy. »Unzählige Leute befragen, die einen Scheiß gesehen oder gehört haben, nur damit er’s auf seiner Liste abhaken kann? Der ist wirklich noch dümmer, als ich dachte.«
»Harry, komm schon, ist nicht meine Schuld, dass Raeburn …«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte McCoy. »War bloß Spaß.«
Wattie hatte recht. Es war wirklich nicht seine Schuld. Der Arme saß in der Zwickmühle, und er wusste es. Das musste er dem blöden Wichser lassen. Wie hätte er McCoy besser eins auswischen können, als ihn von der Arbeit am größten Fall des Jahres auszuschließen und Wattie als seine rechte Hand zu verpflichten.
Wattie hielt eine Liste mit Adressen hoch. »Muss noch an ein paar Türen klingeln. Kommst du mit?«
McCoy nickte, und sie zogen über die Maryhill Road los, hielten sich auf der schattigeren Straßenseite.
»Gibt’s was Neues?«, fragte McCoy.
Wattie schüttelte den Kopf. »Nichts, was wir nicht gestern Nacht schon gewusst haben. Alice Kelly ist immer noch verschwunden, und die Hälfte der Glasgower Polizeikräfte schwirrt herum wie die Schmeißfliegen, um sie zu finden.«
»Was sagt die Mutter?«, fragte McCoy, als sie an der Bushaltestelle vor McGovern’s einen Bogen um die Schlange der Wartenden machten.
»Nicht viel. Wenn die Ärmste nicht weint, ist sie fast teilnahmslos. Ihre Schwester ist aus Linlithgow gekommen, sie ist jetzt bei ihr oben. Die Nachbarn nebenan haben das Baby zu sich geholt.« Wattie zog erneut sein Taschentuch heraus, wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Du müsstest mal das Haus sehen, das ist irre. Wie ein verfluchter Heiligenschrein. Celtic, der Papst und scheiß John F. Kennedy.«
McCoy grinste. »Klingt nach einem stinknormalen katholischen Haushalt. So sieht’s vermutlich bei halb Glasgow zu Hause aus.«
»Kann sein«, sagte Wattie. »Aber bei denen war alles damit zugepflastert. Ich hab meinen Tee in einem Becher mit den verfluchten Lisbon Lions drauf gekriegt.«
»Wundert mich, dass du ihn durch deine knirschenden Zähne runterbekommen hast«, sagte McCoy. »Hat sie eine Aussage gemacht?«
Wattie nickte. »Anscheinend war am Morgen alles noch ganz normal. Die Kleine hat ihre Mutter genervt, weil sie Geld für ein Eis wollte. Das Baby hat keine Ruhe gegeben, und die Bettelei hat’s nicht besser gemacht, also hat sie eingelenkt und ihr fünf Pence zugesteckt.«
McCoy schaute über die Straße zurück. »War sie bei Cocozza’s?«
Wattie schüttelte den Kopf. »Sie ist der Nachbarin, die das Baby genommen hat, noch mal begegnet, als sie zur Tür raus ist, und hat gesagt, sie wollte zu Jaconelli’s.«
Sie schauten den Hang hinauf, erkannten in der Ferne die Markise von Jaconelli’s.
»Da oben kostet eine Waffel nur vier Pence, bei Cocozza’s fünf. Wenn sie zu Jaconelli’s geht, hat sie noch einen Penny für was Süßes übrig und kann sich ein Bazooka Joe holen. Die Mutter dachte, sie wollte nur über die Straße zu Cocozza’s. Deshalb hat sie sie überhaupt gehen lassen.«
»Und?«, fragte McCoy, zog seine Zigaretten aus der Tasche. »Lass mich raten. Sie ist nie bei Jaconelli’s angekommen?«
Wattie schüttelte den Kopf. »Nein. Die Nachbarin war die Letzte, die sie gesehen hat. Das Mädchen ist die Maryhill Road rauf, die Nachbarin wieder ins Haus. Und irgendwo zwischen ihrer Wohnung und Jaconelli’s hat sich die Kleine in Luft aufgelöst.«
»Und was sagt Raeburn dazu?«, fragte McCoy, blieb stehen, um sich eine anzuzünden.
Wattie schaute kurz auf seine Adressenliste und die Straße hinauf, dann gingen sie weiter.
»Er denkt, jemand muss sie gesehen haben. Er hat jeden, den er erwischen konnte, mich eingeschlossen, von Tür zu Tür geschickt. Da oben ist die Sechsundvierzig, gestern Abend und heute Vormittag hat niemand aufgemacht.«
»Raeburn stammt aus Govan, der ist in Glasgow geboren und aufgewachsen«, sagte McCoy kopfschüttelnd. »Eigentlich müsste er wissen, dass die Befragung der Nachbarn im ganzen Viertel reine Zeitverschwendung ist.«
Wattie sah ihn an. »Wieso?«
»Weil’s einen Grund gibt, warum keiner aufmacht. Heute ist Fair Friday. Die allermeisten, die gestern noch hier waren, sind heute in die Ferien gefahren. Ihr werdet an die Türen von leeren Wohnungen klopfen. Selbst wenn jemand das Mädchen gesehen hat, kommt er erst in zwei Wochen wieder.«
Wattie guckte gequält. »Mist. Hab ich gar nicht dran gedacht.«
»Na ja, du kommst aus Greenock, du bist entschuldigt. Aber Raeburn müsste das wissen. Die ganze verfluchte Stadt hat zwei Wochen Urlaub.«
Wattie guckte auf seinen Zettel, blieb vor einem Eingang stehen.
»Das ist es. Gestern hat schon jemand angeklopft, aber keine Reaktion. Wir versuchen’s noch mal.«
»Toll«, sagte McCoy. »Bitte sag nicht, dass es die Wohnung ganz oben ist.«
»Du hast Glück«, sagte Wattie, trat in den dunklen Hauseingang. »Erster Stock.«
Sie trotteten die Treppe hinauf. Im Treppenhaus war es kühl und dunkel, nur aus einer der Wohnungen drangen Radiogeräusche. Klang nach Lulu, ausgerechnet.
»Wo ist der Vater?«, fragte McCoy, als Wattie an die Tür klopfte.
»Anscheinend in Belfast. Arbeiten. Seit einer Woche oder so weg.«
Keine Reaktion. Neuer Versuch.
»Hat die Mutter einen Freund?«, fragte McCoy.
»Weiß nicht«, sagte Wattie.
»Solltest du rausfinden. Du weißt genauso gut wie ich, dass es in neun von zehn Fällen der Vater oder der Stiefvater ist.«
Sie klopften wieder. Warteten.
»Hab ich doch gesagt«, sagte McCoy. »Die sind im Urlaub.«
Wattie nickte, schaute auf seinen Zettel.
»Wie viele noch?«, fragte McCoy.
Kurzes Zusammenzählen. »Zwölf.«
Sie gingen die Treppe wieder runter, hörten das Radio jetzt deutlicher. Auf jeden Fall Lulu. »I’m a Tiger«. Sie traten aus dem Haus, zurück in die Hitze und die grelle Sonne.
»So gerne ich dich auch bei deinen Unternehmungen begleiten würde, Wattie, ich hab eigene Befehle. Ich muss zurück zur Wache.«
Wattie guckte zerknirscht. »Harry, du weißt, dass ich das nicht entschieden hab, mit Raeburn zu arbeiten. Ich wollte nicht mal …«
McCoy hob die Hand. »Ich weiß, ich weiß. Mach dir keine Gedanken, ist eine Sache zwischen Raeburn und mir. Und mir ist es egal. Hab’s eigentlich ganz gerne mal ein bisschen ruhiger. Bleib schön dabei. Das ist ein wichtiger Fall, schau halt, was du lernen kannst.«
Wattie grinste. »Und dann erzähle ich’s dir?«
»Hab ich das gesagt? Jetzt zisch ab, bevor Raeburn einen Suchtrupp losschickt.«
Wattie nickte, ging die Straße rauf, blieb stehen und drehte sich um. »Hab ich ganz vergessen: Ich glaube, Raeburn will dich auf die Raubüberfälle ansetzen.«
»Was?«, fragte McCoy entsetzt. »Du machst Witze, oder?«
Wattie grinste. »Dachte ich mir schon, dass du dich freust. Aber immer noch besser als Däumchen drehen.«
»Raubüberfälle sind nichts für mich, absolut nicht. Ich drehe ganz gerne Däumchen.« Plötzlich dämmerte es ihm. »Du meinst doch nicht etwa die Raubüberfälle, an denen Raeburn schon seit zwei Monaten mit dir arbeitet, ohne auch nur das kleinste Stück weitergekommen zu sein? Na toll. Sag ihm vielen Dank, aber kein Bedarf.«
»Ich weiß nicht, ob dir was anderes übrig bleibt«, meinte Wattie. »Was willst du ihm denn sagen?«
McCoy seufzte. Er wusste, dass Wattie recht hatte. Gerade als es kaum noch schlimmer hätte kommen können, war es passiert.
»Richte Detective Inspector Raeburn bitte von mir aus, ich wäre hocherfreut, mein Möglichstes zu tun, um bei den Ermittlungen helfen zu dürfen.«
Wattie grinste. »Vielleicht sag ich’s nicht genau so. Aber die Akten liegen auf meinem Schreibtisch. Schau sie dir an.«
Wattie winkte, ging weiter, guckte auf seinen Zettel. McCoy sah ihm nach, konnte kaum glauben, wie heiß es schon war. Vielleicht sollte er sich ein Taxi zur Wache nehmen, denn er war nicht sicher, ob er den Fußmarsch bei dem Wetter auf sich nehmen wollte. Egal, er würde sowieso niemanden ans Telefon bekommen. Alle, die jetzt Urlaub hatten, waren verreist. Und selbst wenn nicht, würden sie nicht so blöd sein, dranzugehen und sich vorladen zu lassen. Er zog sein Kippenpäckchen raus und merkte, dass er nur noch eine hatte, überquerte die Straße zum Zeitungsladen. Draußen an der Wand lehnte eine Tafel mit einer Zeitung, der Haltedraht kreuzte die Schlagzeile: »SUCHE NACH VERMISSTEM MÄDCHEN«.
Ein Fall ganz nach Raeburns Geschmack. Damit ließen sich Zeitungen verkaufen, die Leute redeten darüber, wollten über alle gruseligen Einzelheiten informiert werden. Schreiende Menschenmengen vor dem Gerichtssaal. In der Pitt Street würde man Druck machen. Je länger das Mädchen vermisst blieb, um so inkompetenter würde die Polizei wirken, und das durften die hohen Tiere nicht zulassen. Alle wollten, dass sie gefunden wurde, so bald wie irgend möglich. Und wenn sie tot war, bis Raeburn sie fand? Dann würde er den Täter fassen müssen. Und zwar schleunigst.
Zwei
McCoy erkannte das Hemd. Es war aus schwarzem, durchsichtigem Stoff mit kleinen silbernen Sternchen drauf. Er erkannte es, weil er es gestern Abend schon gesehen hatte. Nur hatte derjenige, der es trug, da noch auf der Bühne des Electric Garden gestanden und nicht mit einer Nadel im Arm auf einem ungemachten Bett gelegen. Der Rest der Aufmachung war ebenfalls unverändert. Jeans, spitze Cowboystiefel, mehrere Silberkettchen um den Hals und ein paar Stoffbänder an den Handgelenken. Seine Frisur saß noch. Den stachligen blonden Federschnitt würde man auf hundert Meter Entfernung erkennen. Die Frisur, die Hakennase und das breite Grinsen waren seine Markenzeichen. Bobby March – Rockstar.
McCoy war erst fünf Minuten zuvor auf der Wache angekommen, hatte sich von Billy an der Anmeldung die Telefonliste geholt und gerade Sammy Howe anrufen wollen, um ihm zu sagen, dass er seine Ferien in Aviemore vergessen konnte, da hatte sein Telefon geklingelt. Der Hoteldirektor des Royal Stuart Hotel. Ein Todesfall. Und da McCoy der Einzige auf der Wache gewesen war, musste er sich darum kümmern. Eigentlich hatte er einen Geschäftsmann erwartet, der ein Mädchen am Green aufgegabelt hatte und jetzt mit leerer Brieftasche und einem Herzinfarkt tot auf dem Bett lag. Aber hiermit hatte er nicht gerechnet, absolut nicht.
Er versuchte, durch den Mund zu atmen, was nicht viel brachte. Es führte kein Weg dran vorbei: In dem Zimmer stank es. Räucherstäbchen, Schweiß und was auch immer Bobby March gestern Abend gegessen hatte. McCoy ging zum Fenster, öffnete es: Sofort drang der Lärm der Züge auf der Brücke herein, die grelle Sonne schien auf den Clyde. Er blieb kurz stehen und schaute hinaus, versuchte, frische Luft ins Zimmer zu lassen. Ein kleines bisschen half es.
Er drehte sich um. »Wissen sie’s schon?«, fragte er den Hoteldirektor.
»Wer?«
»Die Fans unten«, sagte McCoy.
Auf dem Weg ins Hotel war er an ihnen vorbeigekommen. Vier oder fünf Teenagermädchen und ein Junge mit Glitzer im Gesicht. Alle trugen dieselben Armbändchen, die meisten hatten auch ähnliche Frisuren. Zwei hatten Bobby-March- T-Shirts an, das des Jungen schien selbst gemacht zu sein. Keine Ahnung, wie die ausklinkten, wenn sie’s erfuhren.
»Glaube nicht«, sagte der Hoteldirektor.
McCoy blickte ihn an. Tweedjackett, Bürstenschnauzer und so kerzengerade, als hätte er einen Besenstiel verschluckt. Dem Aussehen nach eher niemand, der Erfahrung mit Rockstars oder Drogentoten hatte. Eher mit Exerzierplätzen und dem Anbrüllen verängstigter Jungs vom National Service.
»Und der Rest der Band?«, fragte McCoy.
»Die sind unten in unseren Luxuszimmern untergebracht«, sagte der Direktor. »Schlafen anscheinend alle noch.« Sein Gesichtsausdruck verriet, was er von solcherart Verhalten hielt.
»Wann hat ihn das Zimmermädchen gefunden?«, fragte McCoy.
»Um ungefähr halb elf. Sie hat ein paarmal angeklopft, gerufen, aber keine Antwort. Sie dachte, der Gast wäre bereits abgereist, das sind die meisten um diese Uhrzeit. Da er nicht reagierte, ist sie mit dem Universalschlüssel rein.«
»Und er hat …«
Der Direktor zeigte aufs Bett. »Genau so dagelegen.«
McCoy schaute erneut zu Bobby March. Erinnerte sich daran, wie er gestern Abend gewesen war, auf der Bühne. Scheiße, um ehrlich zu sein. Vollkommen neben der Spur, er hatte ständig den Text vergessen und die Songs nur zur Hälfte gespielt. McCoy hatte schon gehen wollen, da hatte March sich zur Band umgedreht und genickt.
Als die ersten Töne von »Sunday Morning Symphony« erklangen, hatte Bobby March doch noch ein bisschen aufgedreht, war wieder ganz der Alte gewesen, der beste Gitarrist seiner Generation. Er hatte sich das Mikro geschnappt, gegrinst, die erste Zeile gesungen, und die Zuschauer, einschließlich McCoy, waren total durchgedreht. Sie alle waren gekommen, um genau das zu hören. Wie unter Strom hatte er die ganzen zwölf Minuten, die der Song dauerte, durchgepowert, sich um den Verstand gespielt, sodass man wieder wusste, warum die Rolling Stones ihn gebeten hatten, bei ihnen einzusteigen. Dann hatte er den Song genau auf den Punkt beendet.
Der Saal hatte getobt, alle hatten gestanden, geklatscht, geschrien. March hatte geschwitzt, wirkte wie ausgewrungen, jegliche Energie war verbraucht.
»Der nächste Song ist von unserem neuen Album Starshine!«, hatte er gerufen, und in dem Moment war McCoy gegangen. Das Album hatte er schon gehört – leider.
Die Sache mit den Rolling Stones hatte Bobby March verfolgt. Nach dem Tod von Brian Jones hatten sie ihn gebeten, vorzuspielen. Er war nach Barnes gefahren, hatte bei ein paar Proben im Olympic mitgejammt. Danach hatte Keith Richards einem draußen wartenden Reporter erklärt, in der Besetzung mit March seien sie »die besten Stones, die es je gab«. Dann hatten sie March gebeten, bei ihnen einzusteigen.
Aber Bobby hatte getan, womit niemand, nicht einmal Keith Richards, gerechnet hatte. Er hatte sich bedankt, aber entschieden abgelehnt, weil er lieber seine eigene Karriere vorantreiben wollte. Seinem Hotelzimmer, dem halb vollen Imbisskarton und der Tatsache nach zu urteilen, dass er im Royal Stuart statt im Albany abgestiegen war und im Electric Garden statt im Apollo gespielt hatte, war das möglicherweise nicht die beste Entscheidung gewesen, die Bobby March je getroffen hatte.
»Siebenundzwanzig«, sagte McCoy. »Noch einer.«
Der Hoteldirektor guckte verständnislos.
»Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Die hat’s alle mit siebenundzwanzig erwischt.«
Der Hoteldirektor nickte, hatte immer noch keine Ahnung, wovon McCoy redete.
McCoy hockte sich auf einen der Sessel in der kleinen Sitzecke. Eine akustische Gitarre lehnte an einem Wohnzimmertischchen, die Lederjacke lag auf dem anderen Sessel, eine Ausgabe des Melody Maker und ein überquellender Aschenbecher neben dem Bett. Für March hatten weder Privatjets bereitgestanden, noch hätte er sich aus dem Fenster fliegende Fernseher leisten können. Stattdessen war er in einem Hotel abgestiegen, das seine Einnahmen größtenteils mit Hochzeiten und Freimaurerzusammenkünften verdiente.
Wenn Bobby March sterben musste, dann hatte er’s vermutlich zur richtigen Zeit getan. Tot würde er bestimmt berühmter werden als lebendig. Er hatte zwei großartige Alben aufgenommen, Sunday Morning Symphony 1970 und Postcard From Muscle Shoals 1971. Und zwei großartige Alben waren immer noch besser als reihenweise schlechte. McCoy beugte sich vor. An ein paar Zigarettenstummeln war Lippenstift.
»Keine Freundin?«, fragte er den Direktor.
Der schüttelte den Kopf. »Nur Mr. March.«
McCoy ging zum Bett, sah sich noch einmal um. Er wusste nicht genau, wonach er Ausschau hielt. Lippenstift auf dem Kopfkissen? Ein vergessener Ohrring? Egal was, es war nicht da. Kam ihm komisch vor, dass ein Rockstar alleine im Bett landete.
Aber vielleicht war McCoy auch nur auf die ganzen Geschichten von Sex, Drugs and Rock’n’Roll reingefallen, und die Realität sah anders aus. Er ging ins Badezimmer. Auch dort wusste er nicht genau, was er eigentlich suchte. Eine mit rotem Lippenstift auf den Spiegel geschriebene Botschaft? Er fand nur Rasierzeug, Heuschnupfentabletten und ein Plektrum am Waschbeckenrand. Er steckte es ein. Als Souvenir. Dann ging er zurück ins Zimmer.
Wieder strömte ihm der Gestank entgegen. Durch die Hitze war es unmöglich, ihm zu entkommen. Er konnte nicht mehr viel tun, und allmählich setzte ihm der Anblick des leblosen Mannes auf dem Bett zu. McCoy erklärte dem Hoteldirektor, er würde unten auf die Gerichtsmedizinerin warten, und ließ ihn mit dem Toten allein. Er trat hinaus in den langen Gang. Dort roch es kaum besser. Ein halb aufgegessener Hamburger lag auf einem Tablett vor einem der Zimmer, daneben stand ein Eimer mit Bodenpolitur.
Er hätte dem Hoteldirektor noch sagen sollen, dass er keine Leute von der Presse oder Fotografen reinlassen durfte, aber er hatte es vergessen. Ehrlich gesagt konzentrierte er sich gar nicht richtig auf Bobby March und dessen vorzeitiges Ableben. Ihn beschäftigte viel mehr, dass er als diensthabender Beamter am Tatort eines möglicherweise gewaltsamen Todes fungierte. Sosehr ihm die Musik von Bobby March auch gefallen hatte, Formulare über dessen Todeszeitpunkt ausfüllen und seine nächsten Angehörigen verständigen zu müssen, war das Letzte, worauf er Lust hatte.
Pling, der Fahrstuhl. McCoy stieg ein, drückte den Knopf fürs Erdgeschoss und betrachtete sich selbst im Spiegel an der hinteren Wand. Er musste zum Friseur. Brauchte Urlaub. Er hatte sich sein Jackett über den Arm gelegt, unter den Achseln seines Hemds zeichneten sich dunkle Ringe ab, auf seinem Gesicht lag ein Schweißfilm. Er musste woandershin, raus aus diesem viel zu heißen Fahrstuhl und weg vom Gestank von Bobby Marchs letztem Curry.
Es musste sich etwas ändern. Und zwar schnell.
Drei
Die Fahrstuhltür ging auf, und das Hotelrestaurant kam in seiner ganzen Pracht zum Vorschein. McCoy erinnerte sich, damals bei der Eröffnung in der Zeitung darüber gelesen zu haben. Der Besitzer war im Urlaub auf den Fidschi-Inseln oder so gewesen und hatte daraufhin beschlossen, es Tiki Bar zu nennen und wie ein Südsee-Refugium herzurichten. Jedenfalls war das die Idee gewesen. Die Realität ähnelte eher einer Amateuraufführung von South Pacific. Die Tische waren mit Bambus überdacht, an die Wand war ein weißer Sandstrand gemalt, überall standen Plastikblumen und Kokosnüsse herum.
McCoy verzog das Gesicht und setzte sich. Die Kellnerin schob sich hinterm Tresen hervor, klebte ihren Kaugummi an die Unterseite. Sie trug eine Art Baströckchen und ein Bikinioberteil, dazu einen Blumenkranz um den Hals. Vielleicht hätte das gar nicht so schlecht ausgesehen, wäre sie Polynesierin gewesen oder wenigstens ein bisschen sonnengebräunt – an einem kränklich blassen schottischen Mädchen mit Sommersprossen und herausgewachsener Dauerwelle wirkte das Outfit nicht ganz so vorteilhaft.
»Aloha. Willkommen im South Seas. Darf ich Ihnen einen Cocktail bringen, Sir?«, sagte sie gelangweilt und mit Glasgower Akzent ihren Spruch auf.
»Ein Bier«, sagte McCoy. Der Gedanke an einen Cocktail um die Uhrzeit am frühen Vormittag überforderte sogar ihn.
Sie nickte und zog ab. Ein marineblauer Slip blitzte dabei durch das Baströckchen. Während McCoy auf sein Bier wartete, warf er einen Blick in die Speisekarte. Hühnerbrust in einer Bananen-Sherry-Sauce war offenbar die Spezialität des Hauses. Kein Wunder, dass es hier so leer war.
Das Bier kam, und er nahm einen langen Schluck.
»Mr. McCoy, mit Ihnen hatte ich hier nun wirklich nicht gerechnet.«
Er schaute auf, und Phyllis Gilroy stand vor ihm. Als Zugeständnis an die Hitze hatte die Gerichtsmedizinerin auf ihr gewohntes Tweedkostüm verzichtet und es durch eine hellblaue Hose und eine geblümte Bluse ersetzt. Die ramponierte braune Aktentasche aus Leder hatte sie wie immer dabei. In einer Mischung aus Verwunderung und Entsetzen sah sie sich in dem Restaurant um.
»Mir war gar nicht bewusst, dass die Südsee für ihre Küche berühmt ist«, sagte sie.
»Ich hab mir die Speisekarte angesehen. Glauben Sie mir, sie ist es nicht.«
»Das ist doch gar kein Fall für jemand wie Sie, oder? Eine Überdosis?« Und dann dämmerte es ihr. »Sagen Sie’s nicht. Raeburn?«
McCoy nickte, und sie nahm ihm gegenüber Platz. Die Kellnerin tauchte auf. Gilroy bestellte eine Cola und wartete, bis die junge Frau gegangen war, bevor sie fortfuhr.
»Haben Sie mit Murray darüber gesprochen?«, fragte sie.
McCoy nickte. »Er kann nichts machen. Er ist noch die nächsten sechs Monate bei Central – oder jedenfalls so lange, bis die dort einen anderen gefunden haben.«
»Er musste schließlich nachgeben, die haben nicht lockergelassen. Aber jetzt sind es nur noch sechs Monate, das ist nicht das Ende der Welt.«
»Sind Sie sicher? Perth?«, fragte er. »Ich war da mal einen Tag. Hat mir gereicht.«
»Auch wieder wahr.« Sie zögerte. »Ich weiß, eigentlich steht mir das nicht zu, aber meine zum Glück wenigen Erfahrungen mit Bernard Raeburn hätten mich nicht vermuten lassen, dass er als Vertretung infrage kommt. Besonders nicht in dem Fall des vermissten Mädchens. Wie um Himmels willen ist es denn dazu nur gekommen?«
McCoy zuckte mit den Schultern. »Ich hab noch nicht genug Dienstjahre zusammen, Thomson hat’s nicht drauf, Reid wird in drei Monaten pensioniert. Die haben jemanden gebraucht, der Murray vertritt, und Raeburn hat seit Jahren auf eine Beförderung gewartet. Anscheinend hat sich das viele Händeschütteln und Arschkriechen bei den Logen-Zusammenkünften ja doch endlich ausgezahlt.«
Die Kellnerin tauchte wieder auf und stellte die Cola ab, nuschelte dazu »Aloha«. McCoy kramte in seiner Tasche nach Kleingeld. »Geht auf mich.«
Gilroy nahm einen großen Schluck, sah dem Baströckchen auf seinem Weg bis hinter den Tresen nach. »Ausgerechnet in Glasgow. Außergewöhnlich.«
McCoy nahm noch einen Schluck, beobachtete die Kellnerin, die den Kaugummi wieder unter dem Tresen hervorpulte und in den Mund steckte.
»So kann man’s auch nennen.«
»Wobei die Bekleidung des Personals endlich mal angemessen ist«, sagte Gilroy. »Heute Morgen um neun hatten wir schon zwanzig Grad, unglaublich.«
McCoy lächelte. »Ich hätte gedacht, Sie sind das gewohnt.«
Sie lächelte zurück. »Wohl kaum. Ich war erst drei, als wir aus Indien weg sind. Ich kann mich nur noch an Sonnenstrahlen zwischen grünen Blättern und Feigen auf dem Gartenweg erinnern.« Sie zeigte nach oben. »Er war berühmt, habe ich gehört?«
McCoy nickte. »Bobby March. Gitarrist. Sagen wir mal, seine Glanzzeit hatte er hinter sich. Aber früher war er echt gut. Richtig gut. Wenn man glauben darf, was man so hört, hing er seit Jahren an der Nadel. Sieht aus, als hätte er einfach Pech gehabt.«
Sie nickte. »Wie so häufig in diesen Fällen. Gibt’s sonst was Neues?«
Mehr musste sie nicht sagen. Die ganze Stadt schien auf Neuigkeiten über Alice Kelly zu warten, gute oder schlechte.
McCoy schüttelte den Kopf. »Nichts. Aber bei der derzeitigen Lage würde ich es wohl als Letzter erfahren.«
Gilroy rutschte gereizt auf ihrem Sitz herum. »Na ja, ich finde das absurd. So ein Fall, und Sie sitzen hier, während dieser Idiot Raeburn die Verantwortung trägt …«
McCoy zuckte mit den Schultern, er versuchte, weniger genervt zu klingen, als er war. »Ich kann nichts dagegen tun. Er hat mehr als deutlich gemacht, dass er weniger von mir hält als von der Scheiße unter seinen Schuhen. Offenbar komme ich am besten zum Einsatz, wenn ich Protokolle über tote Junkies schreibe. Könnte trotzdem schlimmer sein. Er hätte mich ja auch zum Opferschutz abschieben können.«
»Woher kommt eigentlich die Feindschaft?«, fragte sie. »Ich hab’s nie ganz verstanden.«
McCoy seufzte und erzählte die Geschichte. »Kurz nachdem ich angefangen hatte, war ich drei Monate bei Eastern, Raeburn war mein Partner. Er war genau wie die anderen auf der Wache da. Die waren alle korrupt, haben Beweise gefälscht und sind grundsätzlich den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Aber das war nicht meine Vorstellung von Polizeiarbeit. Raeburn hat es persönlich genommen, als ich um meine Versetzung gebeten hab. Und jetzt hat er mich auf dem Kieker.«
Sie nickte. »Verstehe. Leider wundert mich das in Bezug auf Mr. Raeburn nicht im Geringsten.«
Außerdem war da noch die Sache mit Raeburn und Stevie Cooper. Im Laufe der Zeit hatte Raeburn immer mehr Schmiergelder kassieren wollen, damit er in Bezug auf Coopers Sauna in Tollcross »ein Auge zudrückte«, aber in diese Geschichte wollte McCoy seine Kollegin lieber nicht einweihen. Raeburn hatte nicht lockergelassen, jede Woche Razzien angeordnet, bis Cooper schließlich so genervt gewesen war, dass er den Laden einfach dichtgemacht hatte und weggezogen war. Vorher hatte Raeburn immerhin zwanzig Pfund pro Woche dort eingenommen. Doch jetzt bekam er einen feuchten Scheiß, und das alles dank McCoys gutem altem Freund Cooper. Kein Wunder, dass er ihn nicht ausstehen konnte.
Gilroy grinste, offenbar war ihr gerade etwas eingefallen. »Was machen Sie heute Abend?«
McCoy schaute auf. »Heute Abend? Nichts. Der einzige Vorteil an der Sache ist, dass ich keine Überstunden machen muss.«
»Ausgezeichnet. Ich gebe heute Abend ein Essen und würde mich freuen, wenn Sie’s einrichten könnten. Wer weiß, vielleicht muntert Sie ein geselliger Abend ja ein bisschen auf. Zwischen halb acht und acht?«
McCoy nickte, sein Mut verließ ihn. Sehenden Auges war er in das Schlamassel hineinspaziert. Und jetzt hatte er keine Ausrede mehr. Ein geselliger Abend hätte ihn wahrscheinlich wirklich aufgemuntert, aber ein Abend bei Phyllis Gilroy war nicht unbedingt das, was er darunter verstand. Sogar alles andere als das.
Gilroy erhob sich, nahm ihre Tasche. »Achtung, Mr. March, ich komme. Bis später, McCoy.«
McCoy sagte auf Wiedersehen, sah sie zum Fahrstuhl gehen und auf den Knopf drücken. Wie hatte er sich da bloß wieder hineinmanövriert?
Ihre Abendessen waren berühmt. Sie gab jede Woche eins, versammelte alle, die in Glasgow etwas hermachten. Zweifellos würden sie ihn alle anstarren beim Small Talk über Dinge, von denen er nie etwas gehört hatte, und sich fragen, was er dort eigentlich zu suchen hatte. Und er würde bei der Hitze einen verfluchten Anzug und eine Krawatte tragen müssen. Er trank sein Bier aus und stand auf. Erst vor fünf Minuten hatte er noch geglaubt, sein Selbstmitleid könnte kaum größer sein. Da sah man mal wieder, wie man sich irren konnte.
Die vier oder fünf Fans vor der Tür hatten sich auf dem Bürgersteig niedergelassen, hielten sich an den Händen und sangen »Sunday Morning Symphony«. Machten nicht den Eindruck, als hätten sie die Neuigkeiten schon vernommen, aber lange konnte es nicht mehr dauern. Nachrichten wie diese drangen schnell nach draußen: Zimmermädchen, Barkeeper, Hotelpagen. Lieber schnell weg, bevor das allgemeine Geheule anfing und die Presse eintraf.
Der Junge mit dem Glitzer im Gesicht blickte auf. »Ist er dadrin, Mister?«
McCoy nickte, ging die Jamaica Street hinunter. Sollte ihnen doch lieber jemand anders die Botschaft überbringen.
Vier
Nach einem Whisky, einem Bad und einer Rasur spazierte McCoy in Unterhose durch die Wohnung, trank ein großes Glas Leitungswasser. Die Fenster standen weit offen, aber es war ihm egal. Wenn sich jemand für seinen kaum bekleideten Anblick interessierte, dann war ihm sowieso nicht mehr zu helfen. Es herrschten immer noch um die einundzwanzig Grad, nicht der geringste Windhauch, weshalb er seine Ausgehklamotten lieber erst in allerletzter Sekunde anzog. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Sollte er etwas mitbringen? Das machte man doch so bei vornehmen Dinnerpartys im West End. Aber was? Pralinen? Blumen? Eine Flasche schlechten Wein? Einen teuren konnte er sich nicht leisten.
Er überlegte, ob er Susan fragen sollte, nahm sogar den Telefonhörer in die Hand, legte dann aber doch wieder auf. Seit sie den Studienplatz in Manchester bekommen hatte, lief es nicht mehr so gut zwischen ihnen. Sie rief immer seltener an, und sein Wochenendausflug da runter war eher unangenehm gewesen. Ihre neuen Uni-Freunde wussten nicht, was sie von einem Glasgower Polizisten halten sollten. Beide hatten sie versucht, das betretene Schweigen auszufüllen, so getan, als sei alles spitzenmäßig, so wie vorher hier. Aber beide wussten, dass es mehr oder weniger vorbei war. Anscheinend war er doch nur so was wie eine Affäre gewesen, zur richtigen Zeit zur Stelle, nicht mehr und nicht weniger. Er musste es jetzt einfach mit Fassung tragen und weitermachen.
Er zog sein Hemd an, knöpfte es zu und stieg in die Hose. Dann sah er sich um, fand aber nichts, was sich als Mitbringsel eignete. Die halbe Flasche Grant’s auf dem Kaminsims schien nicht ganz das Richtige, und inzwischen hatten auch die Läden schon geschlossen. Er würde mit leeren Händen kommen müssen. Er betrachtete sich im Spiegel, band dabei die Krawatte, sein Gesicht war rot von der Sonne, die Sommersprossen auf seiner Nase kamen jetzt richtig raus. Er schlüpfte in seine Schuhe und das Jackett, nahm die Schlüssel vom Bücherregal und zog die Wohnungstür hinter sich zu.
War kein weiter Weg zu Phyllis Gilroy, nur die Straße runter bis ans Ende und noch ein Stück weiter. Die Veränderung war aber spürbar, kaum dass er oben am Hang angekommen war. Plötzlich trugen die Kinder auf der Straße nicht mehr die abgetragenen Sachen ihrer älteren Geschwister. Ihre Fahrräder sahen neu aus, glänzten. Sogar ihr Akzent klang anders, weicher, vornehmer. Die Schlange vor dem Eiswagen war wie ein ordentliches Krokodil, das sich träge vorwärtsbewegte, aber es gab kein Gerangel wie unten in der Siedlung. Das hier war Hyndland, keine Frage.
Beaumont Gate 6 war ein hohes Townhouse aus rotem Sandstein. Ein Haus, das nach altem Geld und Privilegien stank. Vier Stockwerke und ein Keller, vorne ein Garten voller stachliger Sträucher, die Haustür mit Buntglaseinsatz, der eine Highland-Landschaft zeigte. Er drückte auf die Klingel und wartete. Überlegte, dass er, wenn er sich vor halb zehn loseisen konnte, noch rechtzeitig ins Victoria käme, um sich wie fast jeden Freitag mit den anderen einschließen zu lassen. Dann hörte er Schritte, und die Tür ging auf.
»Harry! Ausgezeichnet. Ich freue mich, dass Sie’s einrichten konnten«, sagte Phyllis und strahlte ihn an.
Hose und Bluse waren jetzt ersetzt durch ein weißes Kleid mit großen roten Blumen. Kurz glaubte er, sie habe sich am Kopf gestoßen, aber dann begriff er, dass sie einen Turban aus demselben Stoff trug.
»Tut mir leid, ich hab nichts mitgebracht …«
»Seien Sie nicht albern, wir haben genug Wein, um ein Schlachtschiff zu versenken!« Sie hielt die Tür weit auf. »Treten Sie ein!«
Er folgte Phyllis durch die Diele und die Treppe hinunter. Geplauder und Gelächter drangen nach oben, dann stand er in einer Kellerküche, die ungefähr doppelt so groß war wie seine gesamte Wohnung. Ein großer Holztisch in der Mitte war mit einem Patchworktuch bedeckt, auf dem mehrere Kerzen standen, darüber war eine Art Metallgestell befestigt, an dem Kupferpfannen hingen. Die Wand gegenüber wurde fast vollständig von einem Gemälde eingenommen, das zwei kleine Kinder mit roten Haaren und Sommersprossen zeigte, unregelmäßig darauf verteilt klebten Worte und Zeitungsfetzen. An einer Tafel neben dem Bild waren altmodische Glöckchen angebracht, daneben Schildchen mit den Bezeichnungen der Räume über ihnen. Damit man seine Diener rufen konnte, ohne den Arsch heben zu müssen.
Im Hintergrund lief leise Musik. Ausgerechnet »Sunday Morning Symphony«. Sechs Personen saßen vor gefüllten Weingläsern an dem Tisch, sie blickten alle auf, als er eintrat.
Phyllis legte ihm beide Hände auf die Schultern. »Alle mal herhören! Das ist ein Kollege und, so hoffe ich, auch ein Freund, Harry McCoy. Er hatte heute Abend noch nichts vor und war so freundlich, meine Einladung anzunehmen.«
Phyllis zeigte auf den Tisch.
»Harry, das sind Jack und Eden Coia.« Ein winziges, schon etwas älteres Paar lächelte ihn an. »Edwin und John links«, fuhr sie fort. Ein älterer Mann mit Brille und ein jüngerer. Sie machte weiter, zeigte auf den am weitesten entfernten Platz. »Professor Hobbs ganz am Ende.« Kahl, fett, rot im Gesicht. Phyllis nickte zu einem freien Stuhl. »Und neben Ihnen sitzt Mila de Ligt.« Jung, blond, Jeans und ein kragenloses Männerhemd. Sie blickte auf und winkte.
»Also«, sagte Phyllis, während sie ihn zu seinem Platz begleitete, »wie Sie sehen, sind wir heute Abend in der Küche. Hier ist es ein bisschen kühler und weniger förmlich, also viel Spaß. Weiß oder rot?«
Er hatte erst seit wenigen Minuten dort gesessen, gerade so ein halbes Glas Rotwein getrunken, als die unvermeidliche Frage gestellt wurde.
»Harry, Phyllis hat uns erzählt, Sie sind Polizist?« Hobbs sprach »Polizist« so aus, als wäre ihm der Begriff vollkommen fremd.
Harry nickte.
Hobbs zeigte mit der Zigarette auf den Plattenspieler.
»Phyllis meinte auch, Sie waren heute dort?«
»Wir beide«, sagte Phyllis. »Ich dachte, ich versuch’s mal mit seiner Musik, ist ja das Mindeste, was ich tun kann. Hab die Platte auf dem Nachhauseweg gekauft. Gefällt mir ganz gut«, sagte sie, stellte eine große Platte mit Brot, Käse und Oliven auf den Tisch. »War die letzte bei Woolworths.«
»Tote Rockstars heute, Bankräuber morgen. Ich kann mir vorstellen, Sie führen ein aufregendes Leben«, sagte Hobbs und spießte ein Stück Brie mit dem Messer auf.
McCoy wollte gerade ein Stück Cheddar zum Mund führen, als er merkte, dass sich der gesamte Tisch zu ihm umgedreht hatte. Er ließ den Käse wieder sinken.
»Kann sein«, sagte er. »Aber eigentlich ist es ein ganz normaler Job. Manches ist interessant, anderes stinklangweilig.«
»Und das mit dem kleinen Mädchen?«, fuhr Hobbs fort.
McCoy nickte, musste nicht erst fragen, wen er meinte.
»Ich mag gar nicht dran denken, was die arme Mutter durchmacht«, sagte Eden, schüttelte den Kopf. »So eine tragische Geschichte.«
Hobbs sah ihn erwartungsvoll an. »Sie müssen doch was wissen.«
»Nicht mehr als Sie«, antwortete McCoy ruhig.
»Das fällt mir schwer zu glauben«, sagte Hobbs, schaute sich in der Runde nach Unterstützern um. »An welcher Theorie arbeiten Sie derzeit?«
»Ich arbeite an gar keiner Theorie«, sagte McCoy. Allmählich wurde er gereizt. Selbst wenn er etwas über Alice Kelly wüsste, würde er es diesem fetten Arschloch bestimmt nicht auf die Nase binden, auch wenn Hobbs noch so sehr glaubte, ein Recht auf Informationen zu haben.
Hobbs lachte. »Also, das klingt aber nicht sehr vielversprechend! Darf ich fragen, warum nicht?«
»Polizeiangelegenheiten sind vertraulich, Phillip. Wie Sie sehr wohl wissen«, sagte Phyllis und rettete McCoy. »Hör auf, unseren Gast zu drangsalieren. Das ist hier ein Dinner, kein Verhör. Also wer möchte Gazpacho? Ich fand den Gedanken an eine heiße Suppe bei dieser Hitze unerträglich.«
McCoy saß eine Weile da, aß – trank? – seine Gazpacho und versuchte, sich nicht noch mehr zu ärgern. Er hätte es wissen müssen und zu Hause bleiben sollen. Als er den Löffel ablegte, beugte sich Edwin über den Tisch zu ihm.
»Keine Sorge. Phillip Hobbs ist ein Arsch. Schon immer gewesen. Und er wird immer einer bleiben«, sagte er leise und grinste.
Danach wurde es ein bisschen netter. Edwin, der offenbar Dichter war, entpuppte sich als sehr witzig. Ein frecher kleiner Mann mit schwarzem Humor. Sein Freund verdrehte permanent die Augen, während Edwin erzählte, welchen Ärger sie sich bei einer gemeinsamen Griechenlandreise eingehandelt hatten.
Mila sagte nicht viel. Einen Glasgower Akzent zu verstehen war so schon nicht leicht, und vermutlich fiel es ihr als Holländerin umso schwerer. Trotzdem lächelte sie und versuchte mitzureden. Er lauschte halb einer Diskussion zwischen Mrs. Coia und Edwin über die Bedeutung öffentlicher Räume im Rahmen der Stadtplanung, als Mila sich zu ihm herüberbeugte und flüsterte.
»O Gott, ist das öde.«
Er lachte, damit hatte er nicht gerechnet. Er drehte sich zu ihr um, und sie lächelte ihn an.
»Ich mag Phyllis, aber sie hat ein paar echt langweilige Freunde«, sagte sie.
»Und gehöre ich dazu?«, fragte McCoy.
Sie rümpfte die Nase. »Da bin ich noch nicht sicher. Phyllis meinte, du könntest mir vielleicht helfen.«
»Und wie?«, fragte McCoy.
Sie zündete sich eine Zigarette an, blies den Rauch von ihm weg, hielt eine teuer aussehende Kamera hoch.
»Ich bin Fotografin und habe den Auftrag, für eine Wohltätigkeitsorganisation namens Shelter arme Menschen in Glasgow zu dokumentieren. Leute, die in schlimmen Wohnverhältnissen leben oder auf der Fahrbahn …«
»Auf der Straße«, sagte McCoy. »Wir sagen ›auf der Straße‹.«
Sie lächelte. »Verzeihung, die auf der Straße leben. Phyllis dachte, du könntest mir vielleicht ein paar Leute vorstellen.«
McCoy seufzte. Er hatte es ein bisschen satt, als offizieller Repräsentant aller Glasgower Penner gehandelt zu werden. Eigentlich hatte er keine Lust, bei der Hitze mit Mila durch Glasgow zu latschen und Charlie mit dem Kinderwagen zu suchen, egal, wie gut sie aussah.
»Ist zurzeit schlecht«, sagte er. »Ich muss arbeiten, wir sind momentan ziemlich unterbesetzt. Aber ich kenne jemanden, der das machen kann. Ein Freund namens Liam. Der ist genau der Richtige. Ich mach euch gerne miteinander bekannt.«
»Ist er Sozialarbeiter?«, fragte Mila. »Oder arbeitet er für eine Wohltätigkeitsorganisation?«
»Nicht direkt«, wich McCoy aus, der ihr nicht verraten wollte, dass er Liam das letzte Mal bewusstlos auf einem Lüftungsgitter hinter dem St. Enoch Hotel gesehen hatte. »Aber er kennt Glasgow, die ganze Stadt. Er ist dein Mann, glaub mir.«
»Danke«, sagte sie. »Das würde mir sehr helfen.«
Er wollte Mila gerade fragen, warum diese Wohltätigkeitsorganisation ausgerechnet eine Holländerin beauftragt hatte, Fotos in Glasgow zu schießen, als er schwere Schritte auf der Treppe hörte. Er blickte auf, und der Letzte, den er zu sehen erwartet hätte, kam auf sie zu. Chief Inspector Murray. Er trug einen neuen Anzug, hatte eine neue Frisur und eine große Reisetasche dabei, dazu grinste er breit und wirkte mit seiner Umgebung sehr vertraut.
»Da draußen ist es immer noch unerträglich heiß«, sagte er, zog sein Jackett aus und hängte es über den letzten freien Stuhl. »Hab ich das Essen verpasst?«
Er setzte sich, und Phyllis holte ihm einen Teller. »Ich denke, du kennst alle hier, Hector? Oh, das ist Mila – eine befreundete Fotografin, zu Besuch aus Rotterdam. Ich habe im letzten Jahr im Urlaub dort ein paar ihrer Bilder gekauft.«
Sie nickten einander zu, und Murray lud sich Essen auf den Teller, während Phyllis ihm ein großes Glas Rotwein einschenkte.
McCoy blieb nichts anderes übrig, als staunend zuzusehen. Murray mochte doch gar keinen Wein. Und trug Anzüge nur, wenn er unbedingt musste. Soweit McCoy wusste, würde er lieber tot umfallen, als an einer Dinnerparty teilzunehmen. Aber er war hier, futterte fröhlich und erkundigte sich bei Edwin nach dessen Griechenlandurlaub. Und lachte mit Mrs. Coia. McCoy fiel nur eine einzige Erklärung ein: Phyllis und er waren zusammen. Er wusste, dass sie befreundet waren, aber nicht mehr. Zeigte mal wieder, wie wenig Ahnung er hatte. Anscheinend stand ihm die Verwunderung ins Gesicht geschrieben.
»Was gibt’s zu grinsen?«, fragte Murray, zeigte mit der Gabel auf ihn.
»Nichts«, sagte McCoy. »Gar nichts.«
Erst nach dem Kaffee stand Murray auf. »Phyllis, entschuldigst du uns für zehn Minuten? Die Arbeit ruft.«
Er nickte McCoy zu, und McCoy stand auf und folgte ihm nach oben. Sie landeten in einem großen Wohnzimmer – ein Flügel in der Mitte, dunkle Holzvertäfelung –, wo es nach Wachspolitur roch. Ein ernst wirkender Mann mittleren Alters mit edwardianischem Schnurrbart schaute von einem riesigen Porträt über dem Kamin auf sie herunter. In kleinen Buchstaben stand »Sir Phillip Gilroy« auf dem Rahmen.
Murray schob eine schlafende rote Katze von einem Kissen und machte es sich in einem Ledersessel bequem, zeigte auf einen weiteren gegenüber.
»Wie lange läuft das denn schon?«, fragte McCoy, setzte sich und versuchte, sein Grinsen abzustellen.
»Würde es dich was angehen, würde ich’s dir vielleicht sagen«, entgegnete Murray.
Plötzlich fiel McCoy etwas ein. »Weiß Janet Bescheid?«, fragte er.
Murray nickte. Seine Miene verriet nichts.
»Und?«, fragte McCoy.
»Und sie hat kein Problem damit. Sie lebt jetzt in Peebles. Mit ihrem Freund.«
McCoy wollte nach dem Freund fragen, verkniff es sich aber.
»So weit, so gut«, sagte Murray. Er sah sich nach seiner Pfeife um. Anscheinend war dieser Teil des Gesprächs beendet.
»Wie schlägt sich Raeburn, das blöde Arschloch?«
McCoy zuckte mit den Schultern.
»Er schließt dich immer noch aus, oder?«
»Klar, ich darf nirgendwo mit nichts was zu tun haben«, sagte McCoy.
»Sein Problem. Raeburn wird sehen, was er davon hat. Er muss das kleine Mädchen finden, und zwar schnell. Der Blödmann sollte auf jede Hilfe zurückgreifen, die er kriegen kann.« Er zog seine Pfeife aus der Tasche, klopfte sie an seinem Schuhabsatz aus, woraufhin es Asche in den Kaminrost regnete.
»Ich kann’s nicht ändern«, sagte McCoy. »Wie läuft es denn in Perth?«
»Ich überlebe, zähle aber die Tage, bis ich wieder wegdarf.« Murray lehnte sich in seinem Sessel zurück, betrachtete McCoy. »Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich hier bin. Ich wollte mit dir reden.«
»Ach ja? Worüber denn?«, fragte McCoy argwöhnisch.
»Erinnerst du dich an John?« Murray tastete seine Hosentaschen ab. Die Suche nach Streichhölzern hatte begonnen.
»Deinen Bruder John?«, fragte McCoy.
Murray nickte, gab die Suche auf und griff nach dem Bronzefeuerzeug auf dem Beistelltischchen. Zündete seine Pfeife damit an.
»Was ist mit ihm? Was hat er angestellt?«, fragte McCoy.
Murrays Gesicht tauchte hinter einer Wolke aus bläulichem Rauch auf.
»John? Gar nichts. Er ist rein wie frisch gefallener Schnee, unser John. Es geht um seine Tochter Laura. Sie ist wieder ausgerissen.«
McCoy lauschte, während Murray ihm dieselbe alte Geschichte erzählte. Laura war fünfzehn, verstand sich nicht mit ihren Eltern, war ein paarmal betrunken nach Hause gekommen, hatte sich mit Jungs herumgetrieben und die Schule geschwänzt.
»Weiß nicht, ob das was Besonderes ist für eine Fünfzehnjährige«, sagte McCoy.
»Jetzt schon. Sie ist seit zwei Nächten weg, und John und Shelia sind außer sich vor Angst.«
Er beugte sich vor, griff nach hinten und zog seine Brieftasche aus der Hose, klappte sie auf und reichte McCoy ein Foto. Musste wohl bei einer Familienfeier aufgenommen worden sein. Sah aus wie ein Restaurant oder ein Hotel. Laura war ein gut aussehendes Mädchen mit großen dunklen Augen und langen braunen Haaren. Sie stand ein kleines Stück vom Rest der Familie entfernt – nicht weit, aber weit genug, um anzuzeigen, dass sie lieber sonst wo wäre als dort bei ihrer Mum, ihrem Dad und ihrem kleinen Bruder. Anhand des Fotos hätte McCoy sie auf achtzehn oder neunzehn geschätzt, nicht auf fünfzehn.
»Ich kapier’s nicht«, sagte McCoy. »Wieso die ganze Heimlichtuerei? Wieso läuft das nicht über die Wache? Sie ist erst fünfzehn, die suchen sie doch. Ganz besonders, wo sie die Nichte vom Chef ist. Hat dein Bruder sie denn vermisst gemeldet?«
Murray zuckte mit den Schultern, wirkte ein bisschen schuldbewusst. »Offiziell nicht.«
»Warum nicht?«, fragte McCoy. »Wo ist das Problem?«
Murray seufzte. »John ist stellvertretender Vorsitzender des Glasgow Council. Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist die Titelseite der Evening Times, vollgepflastert mit dem Bild seiner Ausreißertochter. Und unter uns beiden: Nächstes Jahr will er sich ins Parlament wählen lassen. Glasgow West will ihn aufstellen. Alles schon beschlossene Sache. Er will sich durch Lauras Verhalten nicht seine Chancen vermasseln lassen.«
»Der feine Herr«, sagte McCoy.
Murray guckte resigniert. »Ein Blödmann ist er, immer schon gewesen. Wenn er nicht mein Bruder wäre, würde ich nicht mal die Straße überqueren und ihn anpissen, auch wenn er in Flammen stünde.« Er blies eine weitere Rauchwolke aus, wedelte sie weg. »Musste mich sehr beherrschen, ihm nicht zu sagen, dass er sich selbst um seinen Scheiß kümmern soll, aber ich mag Laura. Ich will auf keinen Fall, dass ihr was zustößt.«
»Vielleicht übernachtet sie einfach bei einer Freundin, um ihren Eltern einen Schrecken einzujagen?«