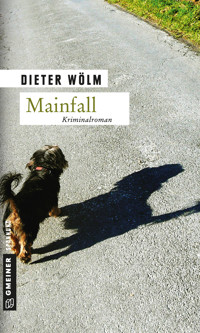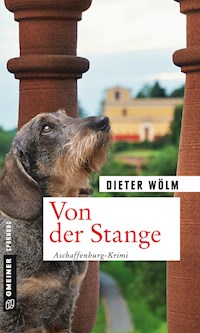Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Rotfux
- Sprache: Deutsch
Aschaffenburg in Aufruhr! Im Pompejanum wird eine nackte Frauenleiche gefunden. Ein Stern wurde ihr in Brust und Bauch geritzt, sechs tote Katzen flankieren das grausame Szenario. Kurz darauf erfolgt ein Mordanschlag auf ihren Sohn. Er überlebt, wird aber immer wieder bedroht. Wer steckt dahinter? Satanisten, wie die Presse vermutet? Oder gibt es eine Verbindung zur Aschaffenburger Textilindustrie? Kommissar Rotfux ermittelt in verschiedene Richtungen, bis ein weiterer Mord geschieht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Wölm
Blutstern
Kriminalroman
Zum Buch
Rätselhafte Zeichen Im Aschaffenburger Pompejanum wird eine Frauenleiche gefunden. Ihr wurde ein Stern in die Haut geritzt. Sechs tote Katzen liegen im Kreis um sie herum, ein Pentagramm aus Katzenblut ist auf den Mosaikfußboden gemalt. Zwei Wochen nach dem Mord fällt Thomas Drucker, der Sohn der Toten, fast einem Anschlag zum Opfer. Er überlebt, wird aber weiterhin verfolgt, sogar auf einer Geschäftsreise in Kenia kann er sich nicht sicher fühlen. Wer steckt dahinter? Satanisten, wie die Presse vermutet? Gibt es Bezüge zur Aschaffenburger Textilindustrie, in welcher der Verfolgte als Marketingleiter arbeitet? Spielt der frühere Partner seiner Freundin eine Rolle? Oder melden sich die Schatten der Vergangenheit von Druckers Mutter? Denn die Tote hatte ihrem Sohn nie etwas über seinen Vater erzählt … Kommissar Rotfux ermittelt in verschiedene Richtungen. Dann geschieht ein weiterer Mord: Wieder wurde dem Opfer ein Stern in den Körper geschnitten und ein blutiges Pentagramm ist auf den Boden gezeichnet.
Dieter Wölm, geboren 1950, war viele Jahre in der Wirtschaft tätig, unter anderem als Marketingleiter eines großen deutschen Versandhauses. Danach schlug er eine wissenschaftliche Karriere ein und war als Professor für Marketing an der Hochschule Aschaffenburg tätig. Beide Positionen erforderten Kreativität, die er inzwischen auch beim Krimischreiben auslebt. Mit Kommissar Rotfux und seinem Dackel Oskar hat Dieter Wölm ein liebenswertes Ermittlerteam geschaffen, das nicht nur Hundefreunde begeistert. Man merkt es seinen Büchern an, dass er selbst einen Dackel besitzt, der ihn inspiriert und auch im wahren Leben Oskar heißt.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: René Stein
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © pennylayn / sxc.hu
ISBN 978-3-8392-4072-4
1
Otto Oberwiesner wurde durch das Bimmeln seines Telefons aus dem Schlaf gerissen. Er tastete schlaftrunken nach dem Hörer und fragte sich, welcher Idiot ihn am Neujahrstag in aller Herrgottsfrühe anrief.
»Oberwiesner«, brummte er mürrisch in die Sprechmuschel.
»Otto, entschuldige, hier Rudolf … Wir haben einen Mord im Pompejanum, grausige Sache, ich muss dich bitten zu kommen.«
»Im Pompejanum?«
»Ja, wurde mir gerade gemeldet. Eine Frau liegt dort. Splitternackt und übel zugerichtet.«
Oberwiesner begann zu begreifen. Mord am Neujahrstag. Und das in Aschaffenburg, ausgerechnet in seinem Revier.
»Klar Chef, ich komme. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig.«
»Ach ja, Otto, und natürlich noch alles Gute für 2012«, sagte Rudolf Rotfux. »Tut mir leid, dass dieses Jahr so scheußlich beginnt.«
»Jaja, schon gut. Wünsche ich dir auch, Rudolf. Ist schließlich unser Job. Da kann man nichts machen.«
Oberwiesner kannte Kommissar Rudolf Rotfux seit über 20 Jahren. Sie waren per Du und hatten manchen Fall gemeinsam geklärt, aber an einen Mordfall, der am Neujahrstag gemeldet wurde, konnte sich Oberwiesner nicht erinnern. Er stellte sich kurz unter die Dusche, wobei er die Duschkabine mit seinen drei Zentnern fast völlig ausfüllte und sich beim Abseifen mehrmals die Ellenbogen an den Glasscheiben der Kabine stieß. Dann rasieren, Haare föhnen, anziehen, ein schneller Kaffee und wenig später saß er in seinem dunkelgrünen Passat auf dem Weg zum Pompejanum. Die Feuerwehrzufahrt von der Pompejanumstraße war geöffnet, zwei Streifenwagen standen quer vor der nachgebauten römischen Villa, rot-weiße Absperrbänder hielten einige Schaulustige auf Distanz, die sich sofort eingefunden hatten. Rotfux kam ihm entgegen.
»Ich hoffe, du hast gut gefrühstückt, Otto. Auf nüchternen Magen hält man das nicht aus …«
»So schlimm?«
»Noch schlimmer. Kann mich nicht erinnern, so etwas Scheußliches schon mal gesehen zu haben. Der junge Seidelmann hat uns gleich vor die Tür des Pompejanums gekotzt.«
Donnerwetter, so kannte Oberwiesner Kommissar Rotfux gar nicht. Normalerweise war er gelassen, freundlich, ließ sich nicht leicht aus der Ruhe bringen, doch heute …
»Komm mit«, sagte der Kommissar und ging voraus. »Hier, sieh mal, die Tür wurde aufgebrochen.« Er deutete auf die hölzerne Eingangstür des Pompejanums, deren olivgrünes Holz in Höhe des Schlosses gesplittert war, wahrscheinlich, weil die Tür mit einem Brecheisen aufgehebelt wurde.
Oberwiesner schüttelte den Kopf. »Weshalb haben der oder die Täter sich solche Mühe gegeben, nur um hier jemand umzubringen?«, dachte er laut nach.
»Das wirst du gleich sehen, Otto. Zieh dir mal die Plastikschuhe über.«
Sie traten in den Vorraum des Atriums und Oberwiesner blieb fast das Herz stehen.
»Mein Gott«, murmelte er und hielt sich für einen Moment an dem metallenen Absperrgitter fest, welches den Vorraum vom Atrium trennte. Auf dem Mosaikfußboden lag eine nackte Frau, verkehrt herum auf ein Holzkreuz gebunden, bleich und blutleer wie eine Wachsfigur. Man hatte ihr ein sternförmiges Symbol in Brust und Bauch geritzt, zudem war sie über und über mit Blut bespritzt. Sechs tote schwarze Katzen waren genau im Kreis um das Holzkreuz gelegt, als ob sie die Tote bewachen sollten.
»Wahnsinn«, stammelte Oberwiesner.
Sie gingen durch das Kassenhaus, das frühere Zimmer des Atriumswärters, und traten in die großzügige Säulenhalle. Durch das Glaspyramidendach des Atriums fiel die Sonne und warf schillernde Lichtflecken auf den Boden. Die wunderschöne Kassettendecke mit ihren sternförmigen Ornamenten stellte einen seltsamen Gegensatz zum grausigen Geschehen dar, welches sich hier abgespielt haben musste.
Der junge Seidelmann begrüßte Oberwiesner. »Noch alles Gute für 2012«, sagte er leise.
Oberwiesner hatte den Eindruck, dass er gegen das Würgen ankämpfte. »Danke! Ebenfalls. Ist ja eine schöne Bescherung …«
»Kann man wohl sagen.«
Oberwiesner schätzte, dass die Frau so um die 50 sein musste, gute Figur, noch straffe Brüste, rot lackierte Nägel, hübsches Gesicht, jetzt völlig entstellt, den Mund wie zu einem Schrei geöffnet, die Augen weit aufgerissen, als ob sie ihren Mörder noch voller Schrecken angesehen hatte.
»Warum sie die Frau auf das Holzkreuz gebunden haben?«, murmelte Rotfux. »Und der blutrote Stern auf dem Mosaikfußboden, die sechs schwarzen Katzen … Was soll das alles?«
»Mhhm«, brummte Oberwiesner. »Sieht irgendwie nach Ritualmord aus oder ein Verrückter hat hier seinen sexuellen Fantasien freien Lauf gelassen. Einfach Wahnsinn.«
»Weiß man, wer sie ist?«, fragte er.
»Laut Ausweis heißt die Tote Ilona Drucker«, antwortete Kommissar Rotfux. »Wir haben Handtasche und Kleider säuberlich aufgeräumt in einem Nebenraum des Atriums gefunden. Ihr Ausweis und sogar Geld steckten noch in der Handtasche. Gerda versucht gerade herauszufinden, ob sie Angehörige hatte.«
Gerda Geiger war die Kollegin aus dem Bereich der Spurensicherung. Rotfux hatte ihr den Auftrag erteilt, Angehörige zu ermitteln.
»Also weder Raubmord, noch Interesse daran, die Identität der Toten zu verheimlichen. Seltsam, seltsam«, wunderte sich Oberwiesner.
»Kann man wohl sagen«, murmelte Rotfux.
Anschließend wurde der Kommissar geschäftig. Es schien, als ob ein Knoten in ihm geplatzt war. Er gab Kommandos und wies seine Beamten an, alles genauestens zu untersuchen.
»Fingerabdrücke, Haare, Hautschuppen … Nichts übersehen! Alles kann von Bedeutung sein. Die Leiche wird nachher in die Gerichtsmedizin gebracht. Bin gespannt, ob sie noch lebte, als sie das mit ihr veranstaltet haben.«
»Wahrscheinlich«, sagte Oberwiesner leise. »Wenn du siehst wie hoch das Blut an die Wand und an die Säulen gespritzt ist. Die muss noch gelebt haben, während man auf sie eingestochen hat.«
Als Kommissar Rotfux das Pompejanum verließ, kam ihm Gerda Geiger mit einem jungen Mann entgegen. Ihre blonden Haare quollen unter ihrer Mütze hervor, ihre Lippen waren wie üblich dunkelrot geschminkt. Sie sah blass aus, leichenblass sogar. Hatte wahrscheinlich lange ins neue Jahr hineingefeiert und war von Rotfux aus dem Bett geholt worden.
»Hallo, Frau Geiger«, begrüßte er sie, »haben Sie jemanden ausfindig machen können?«
Gerda Geiger deutete auf den Mann, der neben ihr ging und etwa 30 Jahre alt sein mochte.
»Vermutlich ja. Das ist Thomas Drucker, wahrscheinlich der Sohn der Toten.«
Rotfux sah ihn an. »Das wird schwer für Sie, Herr Drucker. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Ich muss Sie leider bitten, uns zu sagen, ob die Tote Ihre Mutter ist.«
Während der Kommissar sprach, fiel ihm wenige Schritte entfernt, hinter dem rot-weißen Absperrband, der ›Maulaff‹ auf. Nicht der schon wieder, dachte er. Rotfux hatte den vorwitzigen Gaffer in einem Wutanfall einmal Maulaff genannt, seitdem kannte ihn jeder unter diesem Namen. Er konnte den alten Mann in seinem tannengrünen Lodenmantel mit den glänzenden Metallknöpfen nicht leiden. Gierig hing dieser hinter dem Absperrband, wie üblich einen schwarzen Filzhut tragend, und starrte sich die Augen aus dem Kopf. Wie immer war sein viel zu großer Mund in Bewegung und verbreitete seine Vermutungen unter den Schaulustigen. Die Streifenpolizisten wussten, dass der Alte dem Kommissar mit seiner Gafferei auf die Nerven ging, und versuchten ihn auf Abstand zu halten.
»Ich hoffe nicht, dass es meine Mutter ist, mein Gott, ich hoffe nicht«, stammelte Thomas Drucker. »Gestern habe ich sie noch besucht. Alles war normal, nichts Besonderes, ich hoffe nicht, mein Gott, ich hoffe nicht …«
Der junge Mann war völlig außer sich. Rotfux sah, dass er zitterte. Zu dünn angezogen war er für die Kälte am Neujahrstag, welche auch von den ersten Sonnenstrahlen, die auf die Terrasse vor der römischen Villa fielen, nicht vertrieben werden konnte.
Rotfux ließ sich den Ausweis der Toten bringen.
»Hier, sehen Sie, sie heißt Ilona Drucker. Ist das der Ausweis Ihrer Mutter?«
Thomas Drucker starrte den Ausweis entsetzt an. Im nächsten Augenblick begann er zu schwanken und wäre fast auf den Boden geknallt, hätte ihm Kommissar Rotfux nicht beherzt unter die Arme gegriffen und ihn gestützt.
»Mist«, entfuhr es Rotfux, »das war wohl zu viel für ihn.«
Gerda Geiger und zwei Polizisten packten sofort mit an. Sie trugen Thomas Drucker in die Säulenhalle im hinteren Teil des Pompejanums und legten ihn auf den Boden.
»Beine hoch«, sagte Rotfux, »und ruft einen Arzt. Der junge Mann braucht Hilfe.«
Wenig später trat Dr. Becker zu ihnen. Auch er hatte Plastiküberzüge über den Schuhen, die sie alle trugen, um keine Spuren zu verwischen.
»Schöne Bescherung«, begrüßte ihn Rotfux. »Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Und alles Gute natürlich noch für 2012!«
Die beiden Männer schüttelten sich kurz die Hand. Rotfux kannte Dr. Becker von verschiedenen Einsätzen. Er war Notarzt am Aschaffenburger Klinikum und ihm mehrfach begegnet. Als er sich über Thomas Drucker beugte, kam dieser langsam wieder zu sich.
»Hallo, hören Sie mich?«, fragte er ihn und tätschelte seine Wange.
»Ja, wo bin ich?«
»Es ist alles in Ordnung, ich bin Dr. Becker. Sie sind ohnmächtig geworden. Wir nehmen Sie am besten ins Klinikum mit. Dort können Sie sich erholen …«
»Die Tote ist seine Mutter«, flüsterte Rotfux. »Das war alles zu viel für ihn.«
Dr. Becker warf einen Blick in Richtung der toten Frau auf ihrem Holzkreuz. »Ja, scheußlich. Ich bekomme ja einiges zu sehen, bei Unfällen zum Beispiel, aber so etwas hätte ich mir nicht vorstellen können.«
Der junge Mann begann zu schluchzen. »Ja, ich verstehe das nicht, gestern war ich noch bei ihr, alles war normal, ich verstehe das nicht …«
Er zitterte wieder und Dr. Becker sah Thomas Drucker besorgt an.
»Wir müssen ihn stabilisieren, sagte er zu Rotfux, »heute Nachmittag oder besser morgen können Sie ihn befragen.«
Es lag etwas Vorwurfsvolles in diesem Hinweis. Rotfux war klar, dass er im Moment von Thomas Drucker nichts mehr erfahren konnte. Er sah noch zu, wie sie ihn auf eine Trage legten und zum Rettungswagen brachten.
»Gute Besserung, Herr Drucker«, verabschiedete er sich von ihm.
Noch am Nachmittag des Neujahrstages besuchte Kommissar Rotfux den Sohn der Ermordeten im Klinikum.
»Mein herzliches Beileid, Herr Drucker!«, begrüßte er ihn. »Es tut mir leid, dass ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen muss.«
Thomas Drucker lag im Bett. Eine Infusionsflasche hing silbern glänzend über ihm, aus der Tropfen für Tropfen eine Flüssigkeit durch eine Plastikkanüle in seinen Arm floss.
»Ich konnte noch nichts essen«, erklärte er dem Kommissar, nachdem er dessen verwunderten Blick sah. »Sie führen mir eine Nährlösung zu, damit ich zu Kräften komme. Morgen darf ich vermutlich wieder nach Hause.«
»Wo wohnen Sie denn?«
»Am Floßhafen, wo ich eine Mansardenwohnung habe. Stammt aus meiner Studentenzeit. Mit Blick auf den Main, wirklich sehr schön.«
»Haben Sie hier in Aschaffenburg studiert?«
»Ja, BWL. Die Hochschule hat einen sehr guten Ruf. Schneidet hervorragend bei allen Rankings ab.«
»Davon habe ich gehört«, sagte Rotfux. »Der Oberbürgermeister lobt die Hochschule über den grünen Klee. Scheint ganz begeistert zu sein. Und inzwischen haben Sie Ihr Examen?«
»Ja, seit vier Jahren. Arbeite als Marketingleiter bei Flieger-Moden.«
»Alle Achtung, mein Glückwunsch! Ist eine sehr solide Firma. Ich kenne den Firmengründer, den alten Johann Flieger.«
Rotfux war stolz über seine Kontakte und wurde auf dem Besucherstuhl etwas größer. Dann kam er zum eigentlichen Thema. »Sie sagten, Sie haben Ihre Mutter gestern noch besucht, Herr Drucker. Wann war das?«
»Am Nachmittag, so gegen 15 Uhr.«
»Und da fiel Ihnen nichts auf?«
»Nein, nichts, alles war wie sonst. Sie bot mir etwas zu trinken an und ich erzählte ihr, dass ich den Silvesterabend mit Sabine verbringen würde.«
»Sabine?«
»Ja, mit Sabine Flieger, das ist meine Freundin. Habe sie während des Studiums kennengelernt. Hat ebenfalls in Aschaffenburg studiert.«
»Ach, ist ja interessant«, murmelte Rotfux, »und sie hat Ihnen die Stelle bei Flieger-Moden besorgt?«
»Nein, überhaupt nicht! Das hatte damit nichts zu tun. Wir haben unsere Beziehung während des Studiums geheim gehalten. Weder ihre Eltern noch Mitarbeiter der Firma sollten davon wissen.«
Thomas Drucker hatte sich im Bett aufgerichtet, während er sprach. Seine Wangen glühten und Rotfux merkte, wie sehr den jungen Mann der Gedanke aufregte, er sei über die Beziehung zu seiner Freundin in die Firma Flieger-Moden eingetreten.
»Wieso sollte es denn niemand wissen?«, fragte Rotfux.
»Das ist eine längere Geschichte. Sabine hatte damals einen Freund, den ihre Eltern sehr schätzten: Alexander Leitner. Sie kennen vielleicht die Firma Leitner-Moden …«
»Klar, kennt doch jeder in Aschaffenburg«, brummte Rotfux.
»Alexander ist der Sohn der Inhaberfamilie. Das hätte natürlich gut gepasst mit Sabine und Alexander. Ihre Eltern waren begeistert davon, doch zum Glück hat sie sich in mich verliebt. Den Rest können Sie sich denken: Sabine hatte Angst, es ihren Eltern zu sagen. Da haben wir unsere Liebe zuerst geheim gehalten, bis ich mein Examen hatte und in der Firma beschäftigt war. Habe mich ganz normal beworben und hatte Glück.«
»Und Sabines Eltern wissen immer noch nichts?«
»Doch, doch, inzwischen hat sie es ihnen gesagt. Waren natürlich nicht begeistert, aber sie lassen uns wenigstens in Ruhe.«
»Wissen Sie, wo Ihre Mutter den Silvesterabend verbracht hat?«, kam der Kommissar wieder zum eigentlichen Thema zurück.
»Nein, keine Ahnung. Ich kann mir das Ganze nicht erklären. Ich dachte, sie wäre zu Hause, so wie in den letzten Jahren, und würde fernsehen. Um Mitternacht habe ich sie angerufen, bin ewig nicht durchgekommen, das Netz war total überlastet.«
»Und dann haben Sie aufgegeben?«
»Ja. Ich war mit Sabine im V3. Musik, Stimmung, total voll – ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können … irgendwann habe ich es aufgegeben und mir vorgenommen, sie am Neujahrstag anzurufen.«
»Können wir Ihren Vater benachrichtigen? Gibt es sonst Verwandtschaft?«
»Ich habe keinen Vater«, antwortete Thomas Drucker sehr leise und irgendwie traurig.
»Na, Sie werden sicher einen Vater haben«, lachte Rotfux, dann merkte er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er schob schnell hinterher: »Sie meinen bestimmt, dass Sie ihren Vater nicht kennen.«
»Ja, er hat sich aus dem Staub gemacht. Jedenfalls hat mir Mutter nie etwas Konkretes über ihn gesagt. Und jetzt ist sie tot, mein Gott, jetzt kann sie nichts mehr sagen …«
Thomas Drucker wurde von einem Weinkrampf überwältigt und lag heulend im Bett.
»Können Sie sich einen Grund für den Mord denken? Hatte Ihre Mutter Feinde, gibt es etwas zu erben, haben Sie sonst eine Idee?«
»Keine Ahnung«, schluchzte Thomas Drucker. »Wir waren arm, sie musste sich mit mir durchschlagen, hat Gelegenheitsjobs angenommen, viele Jahre bei der Caritas gearbeitet, in der Altenpflege, wirklich … keine Ahnung.«
»Am Tatort haben wir sechs tote schwarze Katzen gefunden, Ihre Mutter war auf ein Holzkreuz gebunden. Können Sie sich darauf einen Reim machen? Verkehrte Ihre Mutter in mystischen Zirkeln, war sie irgendwie seltsam in letzter Zeit?«
Thomas Drucker wurde durch einen erneuten Weinkrampf geschüttelt. Er schien nicht mehr in der Lage zu sein, überhaupt noch zu antworten.
Rotfux bereute es, dass er diese scheußlichen Details angesprochen hatte. Er erhob sich und gab dem jungen Mann die Hand. »Tut mir schrecklich leid für Sie, Herr Drucker«, sagte er. »Nun ruhen Sie sich erst mal aus. Hier, mein Kärtchen, falls Ihnen noch etwas einfällt. Wenn Sie wieder auf den Beinen sind, können wir ja nochmals sprechen.«
2
Der weiße Sarg stand in der Aussegnungshalle auf dem Aschaffenburger Altstadtfriedhof, genau inmitten des Kreises, der dort auf dem hellen Boden um das Symbol des Kreuzes gezogen war. Thomas Drucker hatte es so gewollt. Weiß sollte der Sarg seiner Mutter sein, weiß wie die Unschuld, als Gegensatz zu dem grausamen Mord, dem sie zum Opfer gefallen war. Über dem Sarg wölbte sich ein Bukett aus roten Rosen, das ihn fast ganz bedeckte. Zwei dicke Kerzen brannten rechts und links zwischen den Grünpflanzen, die zur Dekoration aufgestellt waren.
In der Nacht hatte es geschneit. Auf dem Dach der Aussegnungshalle lag eine zarte weiße Decke und auf dem kleinen Kreuz, welches ganz vorne auf dem Dachfirst thronte, türmte sich ein weißes Käppchen aus Schnee. Sabine wartete neben Thomas. Ihren blonden Pferdeschwanz hatte sie unter einer dicken schwarzen Wollmütze versteckt, ihr hübsches schmales Gesicht sah blass aus, ein auf Taille geschnittener Fellmantel betonte ihre schlanke Figur, ihre langen Beine steckten in schwarzen Lederstiefeln. Sie litt mit Thomas und drückte ihm unauffällig die Hand.
Die Trauergemeinde war klein. Thomas selbst hatte keine Verwandtschaft. Einzig die alte Maria Beletto war gekommen, seine ›Oma‹. Zumindest nannte er sie so. Seit er denken konnte, war sie da gewesen, von seinen ersten Kindertagen an. Auch wenn er den Grund nicht kannte, sie war für seine Mutter eine Art Familienersatz in Aschaffenburg gewesen, nachdem ihre eigenen Eltern sehr früh verstorben waren.
»Schön, dass Sie gekommen sind«, begrüßte Thomas Drucker den Vater von Sabine. Er freute sich aufrichtig über dessen Anteilnahme, nachdem das Verhältnis zu Sabines Eltern immer noch angespannt war. Bernhard Flieger war 65, groß und schlank, hatte volle graue Haare, sah für sein Alter sehr gut aus und wirkte in seinem schwarzen Wintermantel wie ein offizieller Vertreter der Firma Flieger-Moden auf der Trauerfeier. Er drückte seiner Tochter einen scheuen Kuss auf die Wange und stellte sich neben sie. Maria Beletto trat unwillkürlich einen Schritt zur Seite. Fast schien es so, als ob sie sich vor diesem vornehmen Herrn fürchtete.
Anschließend begrüßten einige ehemalige Studienfreunde Thomas, danach erschien seine Sekretärin, Stefanie Bauer. Sie war deutlich älter als er und bereits seit einigen Jahren in der Firma beschäftigt. Er konnte sich auf sie verlassen. Er hatte sie als Sekretärin von Bernhard Flieger übernommen, der sie loswerden wollte, um eine jüngere bei sich einzustellen. Sie sah gut aus, war aber mit den Jahren kräftiger geworden. Als sie ihm ihr Beileid aussprach, merkte er, dass sie es wirklich aufrichtig meinte. Sie fuhr sich mit einem Taschentuch über ihre feuchten Augen.
»Einfach unbegreiflich für mich«, sagte sie leise und stellte sich zu den Trauernden neben den Sarg.
Einige Unbekannte stießen zur Trauergemeinde, wahrscheinlich Schaulustige, die von dem Mord im Pompejanum in der Zeitung gelesen hatten. Von Anfang an waren Kommissar Rotfux und seine Leute in der Nähe und beobachteten aufmerksam das Geschehen. Als die Glocken bereits läuteten, eilten Alexander Leitner und sein Vater über den breiten Zugangsweg auf die Aussegnungshalle zu. Sabine stieß Thomas Drucker in die Seite.
»Sieh mal, wer da kommt«, flüsterte sie.
»Ja, unglaublich.«
Mit allem hätte er gerechnet, nur damit nicht. Er erinnerte sich an die Schlägerei mit Alexander, als sie sich wegen Sabine geprügelt hatten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ausgerechnet Alexander ihm aufrichtig sein Beileid aussprechen wollte. Wahrscheinlich sollte das Ganze eine Provokation sein. Vielleicht wollte er sich an seinem Schmerz erfreuen oder sich wieder an Sabine heranschleichen.
Nachdem der Priester mit der Predigt begonnen hatte, wurde der Wind heftiger und blies die Schneeflocken zwischen den beiden Säulen der offenen Aussegnungshalle hindurch bis zum Sarg. Die roten Rosen wurden mit einem weißen Flaum überzogen, die Trauergäste schlugen ihre Mantelkragen hoch und der Priester sprach lauter, um gegen den Wind anzukommen. Thomas Drucker konnte sich nicht mehr konzentrieren, er hörte nur einzelne Wortfetzen der Predigt und der Gebete.
»… wie auch wir vergeben unseren Schuldigern …«, sagte der Priester.
Niemals werde ich vergeben, dachte Thomas Drucker.
»… sondern erlöse uns von dem Bösen …«
Ja, erlöse uns, erlöse uns, dachte Thomas Drucker und fixierte mit seinem Blick diesen Alexander Leitner, der ihm gegenüber stand und seine Augen nicht von Sabine lassen konnte.
Nach dem letzten Gebet hoben die Friedhofsdiener den Sarg auf einen fahrbaren Wagen und schoben ihn zur vorgesehenen Grabstätte. Der Priester schritt direkt dahinter, es folgten Sabine und Thomas, daneben Maria Beletto, danach die restliche Trauergemeinde. Sie gingen am Kriegerdenkmal vorbei, durch die endlose Reihe der Grabsteine für die gefallenen Soldaten, welche Schneehäubchen trugen. Die Äste der Trauerbirken schwankten im Wind, als wollten sie die weiße Decke abschütteln, die auf ihnen lag. Am Ende der breiten Allee bog der Trauerzug nach links ab, hinein in einen schmaleren Weg, wo unter einer kräftigen Buche das frisch ausgehobene Grab lag. Kalt und abweisend glotzte sie das dunkle Loch an, dessen Ränder mit Schnee überzuckert waren. Die Friedhofsdiener ließen den Sarg in die Tiefe. Er schwankte bedrohlich und schlug unten unsanft auf. Tomas Drucker stieß die kleine Schaufel in die Erde und schickte seiner Mutter seinen letzten Gruß, der auf den Sarg polterte. Sabine warf ein Blumensträußchen. Maria Beletto stand lange am Grab und schien sich gar nicht trennen zu können, die anderen verbeugten sich jeweils kurz und warfen Erde oder Blumen.
Nach der Trauerfeier wartete Kommissar Rotfux am Friedhofsausgang.
»Entschuldigen Sie, Herr Drucker, darf ich Ihnen eine Frage stellen?«
»Ja, bitte.«
»Können Sie sich erklären, warum Alexander Leitner gekommen ist? Sie hatten mir in der Klinik von ihm erzählt.«
»Woher soll ich das wissen, Herr Kommissar?«, platzte es aus Thomas heraus. »Ich habe mich das auch gefragt, aber leider keine Ahnung!«
»Mhhm«, brummte Rotfux, »nun ja, wir werden ja sehen. Ich dachte, dass es seltsam ist …«
Der Kommissar reichte Sabine Flieger und Thomas Drucker die Hand und verließ sie in Richtung Oberwiesners dunkelgrünem VW Passat.
»Hast du den anderen gesagt, dass wir uns noch zu einer Besprechung im Kommissariat treffen?«, fragte Rotfux, als er in den Wagen einstieg.
»Ja, Chef, habe ich.«
Sie wendeten vor der Friedhofsgärtnerei, fuhren durch die Lamprechtstraße in Richtung Main und von dort über die Willigisbrücke zum Kommissariat im Stadtteil Nilkheim.
»War eine seltsame Trauerfeier«, sagte Rotfux.
»Ja, komisch. Der Sohn der Toten hat ständig Alexander Leitner angestarrt und der wiederum schien nur Augen für Sabine Flieger zu haben.«
»Was uns aber in unserem Mordfall irgendwie nicht weiterbringt«, murmelte Rotfux in Gedanken. »Vor allem fehlt uns bisher ein Motiv für den Mord. Die Tote war nicht reich, von krummen Geschäften oder Affären ist bisher nichts bekannt, und in mystischen Zirkeln scheint Ilona Drucker nicht verkehrt zu haben.«
»Bisher also keine heiße Spur.«
»Nein, leider nicht. Wir müssen gleich nochmals alles genau durchgehen, vielleicht kommen wir auf eine Idee.«
Als Rotfux und Oberwiesner das Besprechungszimmer im Kommissariat betraten, waren die anderen schon da. Seltsam feierlich sahen sie aus in ihren schwarzen Kleidern. Otto Oberwiesner wirkte in seinem Anzug und dem dunklen Hemd sehr ungewöhnlich, da er ansonsten stets ein kariertes Hemd trug.
»Frau Geiger, zunächst zu den Fakten«, begann Rotfux die Besprechung, »haben Sie inzwischen den Bericht von der Rechtsmedizin?«
Gerda Geiger sah gut aus in ihrem schwarzem Pulli, über den ihre blonden Haare locker fielen. Wie so oft waren ihre Lippen dunkelrot geschminkt und sie lächelte Rotfux mit ihren blauen Augen an.
»Ja, ist heute Vormittag eingegangen«, sagte sie.
»Und? Irgendwelche Überraschungen?«
»Eigentlich nicht. Todeszeitpunkt zwischen Mitternacht und 1 Uhr am Neujahrstag. Todesursache waren die Stiche in die Brust, vor allem einer, welcher die Aorta getroffen hat. Die Rechtsmedizinerin sagt, Ilona Drucker habe noch gelebt, als man auf sie eingestochen hat.«
»Mhhm«, brummte Rotfux, »das würde die enormen Blutspritzer an Säulen und Wänden im Pompejanum erklären.«
»Das Pentagramm auf Brust und Bauch wurde ihr vermutlich in den Körper geschnitten, bevor sie getötet wurde, also bei vollem Bewusstsein«, fuhr Gerda Geiger fort. »Die sechs schwarzen Katzen sind etwa um Mitternacht getötet worden. In ihrem Fell fanden sich Faserspuren eines Jutesackes, in dem die Tiere vermutlich zum Tatort transportiert wurden.«
»Und sonst? Fingerabdrücke, Haare, DNA-Spuren?«, fragte Rotfux.
»Leider keinerlei Fingerabdrücke, weder am Holzkreuz noch anderswo. Kein Sperma, keine Anzeichen einer Vergewaltigung.«
»Immerhin ist der Todeszeitpunkt interessant«, dachte Rotfux laut nach. »Sie wurde vermutlich getötet, als über Aschaffenburg das Silvesterfeuerwerk tobte. Kein Mensch konnte ihre Schreie hören. Das war sehr genau geplant. Danke, Frau Geiger, für Ihren Bericht!«
Gerda Geiger freute sich über das Lob ihres Chefs und lehnte sich wieder entspannt in ihrem Stuhl zurück. Schon die ganze Zeit rutschte allerdings der junge Peter Seidelmann unruhig auf seinem Platz hin und her.
»Was gibt’s, Herr Seidelmann? Haben Sie weitere Erkenntnisse?«, sprach ihn Rotfux an.
»Ich habe mich über Satanismus informiert, Herr Kommissar. Es ist irre, was ich alles gefunden habe«, sprudelte Seidelmann voller Begeisterung.
»Na, dann lassen Sie mal hören.«
»Es gibt in Deutschland tatsächlich mehrere Tausend Anhänger Satans. Die Zahlen, die ich gefunden habe, schwanken zwischen 7.000 und 20.000. Es existieren verschiedene Richtungen, aber viele orientieren sich an der Satanischen Bibel von La Vey. In Kalifornien ist die ›Church of Satan‹ sogar als Kirche anerkannt. Sie haben eigene Gebote, eigene Symbole, alles …«
»Ist ja interessant«, brummte Rotfux. »Und was sind das für Symbole?«, wollte er wissen.
»Sie werden es nicht glauben, genau die Zeichen, die wir beim Mord im Pompejanum gefunden haben. Das Pentagramm, der umgekehrte fünfzackige Stern, ist das bekannteste Symbol. Auch die Zahl 666 wird als satanisches Zeichen verstanden, deshalb wohl die sechs toten Katzen neben den zwei Mal sechs Säulen des Atriums. Zudem wird gern Tier- oder sogar Menschenblut verwendet. Ich habe Berichte im Internet gefunden, dass Satanisten Babys gegessen hätten. Diese Berichte sind allerdings zweifelhaft. Da wird von den Medien viel aufgebauscht, jedoch Blutopfer mit Tieren gibt es auf jeden Fall.«
»Womöglich haben wir es bei unserem Fall mit einem Menschenopfer zu tun«, sagte Rotfux leise.
»Unglaublich, was es in Deutschland alles gibt«, murmelte Oberwiesner.
»Es existieren noch mehr Symbole, zum Beispiel das umgekehrte Kreuz«, fuhr der junge Seidelmann fort.
»Deshalb war sie auf dieses umgedrehte Holzkreuz gebunden«, sagte Gerda Geiger. »Ist ja absolut scheußlich. Wer bloß auf solche Ideen kommt?«
»Zum Teil zeigt sich im Satanismus eine Protestbewegung gegen überkommene Werte der Gesellschaft«, antwortete Seidelmann, der von diesem Thema regelrecht begeistert schien. »Die Satanisten propagieren das Animalische im Menschen und sehen den Menschen als das bösartigste aller Tiere. Deshalb kommt auch ritueller Missbrauch vor, sozusagen als Zeichen völliger Entfesselung.«
»Gibt es denn solche Satanisten in Aschaffenburg?«, fragte der Kommissar.
»Darüber habe ich leider nichts gefunden«, sagte Seidelmann. »Die wahren Satanisten geben sich nicht zu erkennen. Es gibt zwar junge Leute, die in schwarzen Klamotten und mit Satanssymbolen herumlaufen, aber das sind keine wirklichen Satanisten.«
»Also tappen wir trotz all der Informationen ziemlich im Dunklen«, brummte Rotfux. »Gibt es sonst noch Hinweise?«
»Eine Kleinigkeit hätte ich noch«, meldete sich Otto Oberwiesner zu Wort. »Wir haben im Pompejanum einen Knopf gefunden, vermutlich von einer Bluse. An der Bluse des Opfers fehlte aber keiner.«
»Ist ja interessant, Otto. Das müssen wir im Auge behalten. Vielleicht lässt sich der Knopf irgendwann den Tätern zuordnen. Alles scheint auf einen satanischen Hintergrund zu deuten. Wir müssen nochmals überprüfen, ob die Tote irgendwie mit solchen Kreisen zu tun hatte. Otto, du nimmst dir das Thema bitte zusammen mit Herrn Seidelmann vor. Vielleicht gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die wir übersehen haben.«
3
Es war fast 21 Uhr, als Thomas Drucker die Firma verließ. Er hatte länger gearbeitet, da durch den Tod seiner Mutter einiges liegen geblieben war. Der Pförtner, der am Haupteingang in seinem Glaskasten saß, grüßte freundlich. Er war es gewohnt, dass Thomas als einer der Letzten ging.
Auf dem Firmenparkplatz standen nur noch wenige Fahrzeuge. Die Reklameschrift ›Flieger-Moden‹ warf ein blaues Licht über die verbliebenen Wagen. Müde ging er auf seinen dunkelroten VW Golf zu. Er wunderte sich, dass zwei Plätze weiter ein pechschwarzer Leichenwagen parkte. Einen solchen hatte er hier noch nie gesehen. Doch er war zu erschöpft, um sich darüber weitere Gedanken zu machen.
Er entriegelte seinen Golf mit der Fernbedienung, die Türknöpfe sprangen hoch, er wollte die Fahrertür öffnen, als ihn ein schwerer Schlag in die Kniekehlen traf, der ihm förmlich die Beine wegriss. Er fiel nach hinten und schlug mit dem Rücken auf dem Parkplatz auf. Mist, dachte er, versuchte sich zu konzentrieren, wollte schreien, aber bevor er den Mund aufmachen konnte, wurde ihm dieser mit einem Knebel gestopft. Zwei Männer mit schwarzen Kapuzen packten ihn, schleppten ihn zum Leichenwagen, banden ihm Arme und Beine zusammen, öffneten die hintere Klappe des Leichenwagens, zogen einen Sarg ein Stück weit heraus, sahen sich prüfend auf dem Parkplatz um, hoben ihn hoch und ließen ihn in den Sarg gleiten. Er tobte zwar und wand sich in seinen Fesseln, aber es half ihm nicht. Kurz darauf hatten sie den Deckel auf den Sarg gelegt und begannen, die Schrauben anzuziehen.
Es war das Schlimmste, was er bisher erlebt hatte: Dieses Gefühl der Beklemmung, dieses Gefühl, in einem Sarg zu liegen und keine Luft mehr zu bekommen, dieses Gefühl, irgendwelchen Verbrechern völlig hilflos ausgeliefert zu sein. Er versuchte ruhiger zu werden, atmete ganz leise, wollte Luft sparen, merkte, dass das Auto anfuhr, vom Parkplatz rollte und rechts abbog, Richtung Zentrum.
Wo sie mich wohl hinbringen?, fragte er sich.
Obwohl der Sarg mit Stoff ausgeschlagen war, lag er sehr hart. Für Lebende zu unbequem, dachte er. Wie lang er noch leben durfte? Was sie mit ihm vorhatten? Sie konnten jetzt mit ihm machen, was sie wollten. Auf die Idee, einen Leichenwagen zu kontrollieren, kam sicher niemand. ›Dürfen wir mal bitte in den Sarg schauen?‹ Auf die Idee würde kein Polizist kommen. Also konnten sie ihn bringen, wohin sie wollten. Keiner würde Verdacht schöpfen. Und Sabine, seine Freundin, war es gewohnt, dass er abends spät nach Hause kam. Sie würde so schnell nicht unruhig werden. Das Handy hatten sie ihm abgenommen, bevor sie ihn in den Sarg gehoben hatten, das waren offensichtlich Profis, mit denen nicht zu spaßen war. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als ruhig liegen zu bleiben und zu warten, was als Nächstes passierte.
Irgendwann fuhr der Wagen langsamer. Er hörte ein automatisches Garagentor, merkte, wie sie nach unten in eine Tiefgarage fuhren und endgültig hielten. Endstation, dachte er.
Vielleicht waren sie zum Krematorium beim Waldfriedhof gefahren und würden ihn dort bei lebendigem Leibe verbrennen. Die seltsamsten Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Er hörte, dass sie die hintere Klappe des Leichenwagens öffneten, spürte, dass sie den Sarg ein Stück weit aus dem Auto zogen, vernahm das Geräusch der sich drehenden Schrauben. Im nächsten Augenblick wurde der Deckel vom Sarg genommen und das Neonlicht der Garage traf ihn wie eine Keule.
»Los, schnell jetzt«, hörte er einen der Männer mit den schwarzen Kapuzen sagen. Sie packten ihn und hoben ihn aus dem Sarg. Auf seinen gefesselten Beinen konnte er sich kaum halten.
»Schnell, in den Ausstellungsraum, dort wartet sie«, sagte der größere der beiden Männer.
Sie zerrten ihn zu einer dieser grauen Metalltüren, die für solche Tiefgaragen typisch sind. Dahinter lag ein langer Gang, der zu einem Ausstellungsraum führte. Sie mussten ihn in den Keller eines Bestattungsinstituts transportiert haben, jedenfalls standen reihenweise Särge in verschiedensten Ausführungen an den Wänden aufgereiht. Im Vorbeigehen sah er die Preise. Bis zu 20.000 Euro konnte man hier für einen Sarg ausgeben. In der Mitte des Raumes, zwischen all den Särgen, stand ein Tisch, eher eine Bahre, auf der vielleicht die Toten für die Bestattung vorbereitet wurden.
»Da seid ihr ja endlich«, sagte eine Frau, die neben der Bahre wartete. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Sie mochte um die vierzig sein, hatte rotblonde Haare, ihre Haut war hell und glatt. Kalte graue Augen sahen ihn durch eine dunkle Maske an und es lief ihm eiskalt den Rücken herunter.
»Bindet ihn auf den Tisch«, sagte sie.
Ihre Stimme klang unerbittlich, als sei sie es gewohnt, Befehle zu erteilen. Ihr dunkles, eng geschnittenes Kostüm endete in einem Stehkragen, ihre schlanken Beine steckten in Lackstiefeln.
»Na los, nun macht schon, wir haben nicht unendlich Zeit«, trieb sie die beiden Männer mit ihren Kapuzen an.
Der Ausstellungsraum wurde allein durch Kerzen beleuchtet. Zwei standen neben der Bahre, dicke Kerzen auf hohen Ständern, so wie er sie als Altarkerzen aus der Kirche kannte.
Er versuchte zu schreien, allerdings ohne Erfolg. Durch den Knebel, der noch in seinem Mund steckte, drang nur ein gurgelndes Röcheln nach außen. Die beiden Männer waren rücksichtslos, brutal, achteten nicht darauf, ob sie ihm weh taten. Schuhe aus, Socken aus, an Armen und Beinen noch gefesselt, schnallten sie ihn mit zwei Ledergurten auf die Bahre. Ihm war kalt. Er merkte, dass sich eine Gänsehaut an seinen Armen bildete, die noch stärker wurde, als die schwarz maskierte Lady um die Bahre herum ging und ihn genauestens betrachtete.
»Sieht eigentlich gut aus«, sagte sie, »warum sie ihn wohl loswerden wollen?«
Sie strich ihm mit ihren weißen Seidenhandschuhen über die Wange und lächelte. »Eigentlich schade«, sagte sie, »doch sie haben gut bezahlt, also müssen wir den Auftrag erledigen.«
Er fragte sich, um welchen Auftrag es ging, hatte Angst, panische Angst. Loswerden wollten sie ihn. Aber wer waren ›sie‹? Vor zwei Wochen war seine Mutter im Pompejanum ermordet worden. War jetzt er dran?
»Wir werden ihm noch ein paar schöne Stunden bereiten«, sagte die Lady. »Sterben kann schön sein, wenn man es richtig ausführt.«
Er begann zu zittern und sie genoss es offensichtlich. Er wunderte sich, dass sie hier den Ton angab, doch als er die beiden Kapuzenmänner unterwürfig ein Stück abseits stehen sah, wusste er, dass hier nur sie etwas zu sagen hatte.
»Du brauchst keine Angst zu haben, es wird nicht schlimm für dich sein. Wir beherrschen unser Handwerk.«
Das tröstete ihn wenig. Er dachte an Sabine, verabschiedete sich in Gedanken von ihr, dachte an seine Mutter, die ihn alleine groß gezogen hatte. Seinen Vater hatte er nie gekannt, der hatte sich aus dem Staub gemacht. Oh Herr, bitte hilf mir, betete er in der Stille.
»Er ist bestimmt ein Genießer, so wie er aussieht«, sagte die maskierte Lady. »Wir werden ihm einen guten Tropfen servieren. Los, nehmt ihm den Knebel raus.«
Die beiden Männer, welche respektvoll Abstand gehalten hatten, gehorchten und traten an die Bahre.
»Hilfe«, schrie er sofort aus Leibeskräften. »Hilfe, Hilfe, Hilfe …«
Allerdings kam keine Hilfe. Stattdessen zog seine Peinigerin eine Lederpeitsche aus ihrem rechten Stiefelschaft und peitschte auf ihn ein, genau dorthin, wo es am meisten schmerzte.
»Wirst du wohl aufhören zu schreien«, sagte sie leise. »Es hört dich hier niemand. Wenn du weiter plärrst, schlagen wir dich grausam mit der Peitsche tot. Also nimm dich zusammen. Wir werden es bestimmt richtig machen.«
Was konnte man da richtig machen? Wie es aussah, wollten sie ihn töten. Da konnte man nichts ›richtig‹ machen!
»Man kann sehr grausam sterben«, sagte sie, als ob sie seine Gedanken gelesen hätte. »Manche verfaulen bei lebendigem Leib, andere ersticken jämmerlich, aber du hast Glück, unsere Auftraggeber haben nicht gespart, haben für dich einen schönen Tod bestellt. Das ist natürlich nicht billig, dafür angenehm. Du solltest es genießen, mein Lieber, statt hier blöde rumzuschreien.«
Sie strich mit der Peitsche über seinen Hals, über seine Brust. Er wurde ganz still und sagte nichts mehr.
»Hast du noch einen besonderen Wunsch?«, fragte sie.
»Einen besonderen Wunsch?«
»Ja, einen besonderen Wunsch. Willst du einen letzten Abschiedsgruß übermitteln, jemand um Verzeihung bitten, ein Geheimnis verraten …?«
Er begann fieberhaft nachzudenken. Klar, Sabine hätte er gerne eine Nachricht zukommen lassen, allerdings müsste er dann ihre Adresse preisgeben, und womöglich …
»Nein, ich will leben, sonst habe ich keine Wünsche«, sagte er.
»Das ist das Einzige, was wir nicht erfüllen können. Unsere Auftraggeber haben einen letzten Wunsch für dich mitgebucht, wenn du ihn nicht beanspruchen willst, verfällt er eben.«
Sie strich ihm mit der Peitsche über die Fußsohlen und er merkte, wie es kitzelte.
Noch lebe ich, dachte er. Noch will ich kämpfen.
»Kann ich mich freikaufen? Ich bezahle mehr als eure Auftraggeber.«
Sie lächelte. »Das kannst du nicht.«
»Warum nicht?«
»Sie haben sehr viel bezahlt.«
»Aber wenn ich mehr bezahle?«
»Das kannst du nicht. Wir sind seriöse Partner.« Sie lächelte und strich ihm mit der Peitsche über die Beine.
»Ich kann Geld aufnehmen, ich habe eine reiche Freundin, ich kriege das Geld irgendwie zusammen«, stammelte er und wand sich auf der Bahre.
Sie genoss ihre Macht über ihn. »Tut mir leid«, sagte sie, »das ist nicht vorgesehen. Ich muss mich an die Regeln halten.«
Der harte Holztisch drückte ihn am Rücken, sein linkes Bein war inzwischen durch die Fesselung eingeschlafen, sein rechtes Auge zuckte nervös.
»Nun entspanne dich, mein Lieber«, sagte sie. »Du willst sicher sterben wie ein Mann und nicht wie eine jammernde Memme.«
»Mir ist es egal, wie ich sterbe. Ich will überhaupt nicht sterben, bin noch zu jung, will noch leben!«
Sie lächelte. Sie hatte ein überirdisches Lächeln. Thomas Drucker hatte den Eindruck, es gäbe für sie nichts Schöneres, als andere zu töten. Sie erhob die Peitsche und schlug ihm mit voller Wucht auf die Brust.
»Nun ergib dich endlich in dein Schicksal«, sagte sie. »Für dich ist ein schöner Tod vorgesehen. Genieße ihn!«
Sie ging um die Bahre herum, bückte sich und brachte eine Flasche Wodka zum Vorschein.
»Hier, trink einen Schluck, mein Freund«, sagte sie. »Das macht alles viel leichter.«
Er presste die Lippen aufeinander, wollte nicht trinken, aber sie kam näher, er sah ihre kalten grauen Augen, roch ihr Parfüm. Sie hielt ihm die Nase zu, bis er nach Luft schnappte. Dann schob sie schnell die Flasche in seinen Mund, der Wodka floss in ihn hinein, bis der Wodka ihm aus dem Mund lief, seitlich über seine Wange, am Hals hinunter, auf den Holztisch.
»Wirst du wohl trinken«, schimpfte sie und schlug ihm mit der Peitsche zwischen die Beine. »Das ist ein guter Tropfen, den lässt man nicht auf den Tisch rinnen!«
Sie flößte ihm mehr Wodka ein und er bemühte sich zu schlucken, denn er sah keinen anderen Ausweg mehr. Vielleicht war es das Beste, ihr nachzugeben. Gefesselt hatte er gegen die beiden Männer mit ihren schwarzen Kapuzen ohnehin keine Chance. Er dachte wieder an Sabine, sah sie vor sich, in seiner kleinen Wohnung unter dem Dach, wo sie sich geliebt hatten und wo sie sicher auf ihn wartete und vielleicht noch nicht einmal ahnte, dass er heute nicht mehr kommen würde. Er merkte, dass der Wodka Wirkung zeigte. Es wurde ihm leichter ums Herz. Manche starben früh, manche starben spät. Keiner hatte das in der Hand. Gut, er hätte gern noch gelebt, aber wenn es jetzt sein sollte …
»Sie haben eine gute Sorte für dich gebucht. Du wirst keine Kopfschmerzen bekommen«, lachte sie.
Fast wurde sie ihm sympathisch, obwohl sie älter war als er. Dreißig war er vor wenigen Wochen geworden, hatte groß mit Sabine und seinen Freunden gefeiert. Sie wollten sich verloben, wollten in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Und jetzt? Alles vorbei?
Die beiden Männer beobachteten die Zeremonie still. Sie hielten Abstand und ließen die Maskierte ihr Werk verrichten. Die hatte inzwischen eine zweite Flasche unter dem Tisch hervorgeholt und gab Thomas weiter zu trinken. Er lag ergeben auf der Bahre, trank Schluck für Schluck und spürte, wie eine tiefe Müdigkeit in seine Glieder zog.
»Na, geht’s inzwischen besser?«, fragte sie.
»Es geht so«, antwortete er. »Doch ich möchte leben!«
»Du Dummerchen«, sagte sie und strich ihm mit der Peitsche über die Augen. Sie tat das zärtlich, fast, als habe sie sich in ihn verliebt.
»Ich schätze meine Opfer«, flüsterte sie, »nur so kann man ihnen den guten Tod geben.«
Guter Tod?, dachte er. Kann der Tod gut sein?
Er schlief jetzt fast, spürte den harten Tisch nicht mehr unter sich, spürte kaum noch die Peitsche, mit der sie ihn hier und da berührte. Er sah die Kerzen rechts und links neben der Bahre, die stark heruntergebrannt waren. Er sah die beiden Männer mit ihren Kapuzen wie in weiter Ferne.
»Bist du bereit?«, fragte sie ihn.
»Ja, ich bin bereit«, sagte er.
Er konnte sie kaum noch erkennen. Sie schien auf einmal jünger zu sein, nahm das Gesicht von Sabine an.
»So ist es gut«, sagte sie, »du hast es begriffen. Du wirst den Tod lieben. Bald kommt er zu dir, bald wird er dich erlösen.«
Die Kerzen flackerten. Er wusste nun, warum in Kirchen Kerzen brannten. Er sah die Decke der Sixtinischen Kapelle über sich, sah das Werk Michelangelos, das er mit Sabine in Rom bewundert hatte, in Rom, beim Papst, der aus dem Fenster winkte. Ihm war er jetzt ganz nah, nun konnte der Tod kommen. Er hatte keine Angst mehr vor ihm, begrüßte ihn als seinen Bruder, der ihn mitnahm in eine andere Welt, wo ewiger Frieden herrschte.
»Er ist so weit«, sagte sie leise. »Legt ihn in den Sarg. Ihr wisst was zu tun ist. Alles wie besprochen.«
Er spürte, dass sie seine Fesseln und die Ledergurte lösten und ihn wegtrugen. Er sah die Maskierte noch winken, doch sie kam nicht mit. Sie stand zwischen den Kerzen wie ein blasser Engel und sah ihm nach.
Die beiden Männer sprachen nichts. Sie trugen ihn zum Leichenwagen in der Tiefgarage und legten ihn in den Sarg. Er träumte, glaubte mit einer Kutsche zu fahren, die weite Strecke zum Paradies, durch Scharen von Engeln, die auf ihren Wolken saßen und ihn freundlich winkend begrüßten.