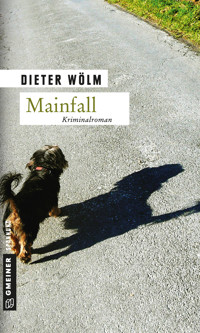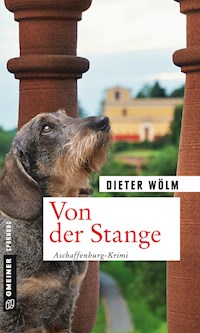
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Rotfux
- Sprache: Deutsch
Die Tochter eines Aschaffenburger Versandhausmillionärs wird entführt. Im Erpresserschreiben wird verlangt, keine Billigmode mehr aus Bangladesch und Pakistan anzubieten. Kurze Zeit später verschwindet eine weitere junge Frau. Von ihr werden in der Nähe der Aschaffenburger Hochschule ein Turnschuh und etwas Blut gefunden. Kommissar Rotfux und sein Dackel Oskar haben alle Hände voll zu tun. Als Rotfux glaubt, dass es schlimmer nicht mehr kommen kann, wird der Versandhausinhaber Thomas Herder selbst vermisst gemeldet …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Wölm
Von der Stange
Aschaffenburg-Krimi
Zum Buch
Entführungskarussell Die Tochter eines Aschaffenburger Versandhausmillionärs wird nach dem Besuch bei ihrem Freund auf dem Heimweg entführt. Erst die Nürnberger Tauchstaffel der Polizei entdeckt das Fahrrad, die Handtasche und das Handy der Vermissten im Main. In einem Erpresserschreiben wird verlangt, keine Billigmode mehr aus Bangladesch und Pakistan anzubieten. Kurze Zeit später verschwindet eine weitere junge Frau, die Tochter eines Aschaffenburger Pizzeria-Inhabers. Von ihr werden in der Nähe der Hochschule ein Turnschuh und Blut gefunden. Haben die Vermisstenfälle etwas mit der Hochschule Aschaffenburg zu tun, da beide junge Frauen dort in derselben Studiengruppe studierten? Hat die italienische Mafia ihre Finger im Spiel, an die der Pizzeria-Inhaber Frederico Lombardi früher bezahlen musste? Oder sind die Geschäfte mit Billigmode des Versandhauses Herder der Grund? Kommissar Rotfux und sein Dackel Oskar haben alle Hände voll zu tun. Doch dann wird auch noch der Versandhausinhaber Thomas Herder selbst vermisst gemeldet. Aschaffenburg steht Kopf …
Dieter Wölm, geboren 1950, war viele Jahre in der Wirtschaft tätig, unter anderem als Marketingleiter eines großen deutschen Versandhauses. Danach schlug er eine wissenschaftliche Karriere ein und war als Professor für Marketing an der Hochschule Aschaffenburg tätig. Beide Positionen erforderten Kreativität, die er inzwischen auch beim Krimischreiben auslebt. Mit Kommissar Rotfux und seinem Dackel Oskar hat Dieter Wölm ein liebenswertes Ermittlerteam geschaffen, das nicht nur Hundefreunde begeistert. Man merkt es seinen Büchern an, dass er selbst einen Dackel besitzt, der ihn inspiriert und auch im wahren Leben Oskar heißt.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Weinmordrache (2017)
Blutstern (2013)
Mainfall (2011)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © kisscsanad / stock.adobe.com
und © felix_w / pixabay.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6204-7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Kommissar Rotfux kuschelte mit seinem Dackel Oskar auf dem weichen Berberteppich, den er von einer Reise nach Marokko mitgebracht hatte. Er streichelte dem Hund über den Rücken, kraulte ihn hinter den Ohren und verstrubbelte ihm seinen hellen, flauschigen Bart, der sich vom dunkleren, saufarbigen Fell abhob. Durch das große Wohnzimmerfenster waren der Main und die Uferpromenade zu sehen. Einige Aschaffenburger genossen noch ihren Abendspaziergang, teilweise mit Hund an der Leine oder mit Partnerin am Arm.
»Ach, Oskar«, seufzte der Kommissar, »heute würde ich am liebsten nicht mehr an die Hochschule gehen, sondern gemütlich bei dir bleiben.«
Der Rauhaardackel legte seinen Kopf flach auf den Teppich und sah Rotfux schräg von unten mit seinen dunkelbraunen Augen an. Was er mir wohl sagen will, fragte sich Rotfux. Er hing sehr an dem Hund, ganz besonders, seit ihn seine Freundin Caroline verlassen hatte. Der Dackel gab ihm das Gefühl, nicht allein zu sein. Er begleitete ihn tagsüber ins Kommissariat, ging mit ihm nach dem Dienst spazieren und nachts schlief er in seinem Körbchen direkt neben dem Bett von Kommissar Rotfux. Caroline mochte den Dackel auch. Aber dann hatte sie sich einem anderen an den Hals geworfen, einem Professor für Rechnungswesen der Hochschule. Zuerst merkte es Rotfux gar nicht. Irgendwann fiel ihm auf, dass Caroline seltener bei ihm übernachtete. Er dachte, sie hätte viel Arbeit, müsste sich intensiver auf ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule vorbereiten. Bis sie ihm eines Tages unter Tränen gestand, sie habe sich in einen anderen verliebt. Rotfux konnte es zuerst gar nicht glauben. Sie waren fast drei Jahre zusammen gewesen, hatten über Kinder gesprochen, sich die Zukunft ausgemalt. Gut, er musste zugeben, dass Caroline hauptsächlich über Kinder gesprochen hatte und er sich damit noch Zeit lassen wollte. Vielleicht war das sein Fehler gewesen, vielleicht hätte er stärker auf ihre Wünsche eingehen sollen, aber das war nun ohnehin zu spät. Er spürte die Wärme des Dackels an seinem Bein und fühlte eine tiefe Geborgenheit durch die Anwesenheit des Hundes.
»Du bist mein Bester! Gut, dass wir zusammenhalten«, sagte Rotfux leise und kraulte ihn an der Brust zwischen den vorderen Beinchen. Der Dackel streckte sich und rollte sich zufrieden auf dem flauschigen Berberteppich zusammen.
Es behagte Rotfux absolut nicht, noch an die Hochschule zu müssen. Doch der Präsident der Hochschule hatte ihn höchstpersönlich zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, zum Thema »Ausbeutung in der Textilindustrie«. Er kannte den Präsidenten und konnte ihm schlecht etwas abschlagen. Außerdem war dieses Thema im Grunde von dienstlichem Interesse, denn Aschaffenburg und seine Umgebung bildeten ein Zentrum der deutschen Textilindustrie, auch wenn inzwischen überwiegend im Ausland produziert wurde. Deshalb gab es schon mehrfach Aktionen gegen Bekleidungshersteller, ganz besonders nach der schrecklichen Tragödie, die sich 2013 in Bangladesch abgespielt hatte. Seitdem griffen immer wieder Greenpeace-Aktivisten und andere Gruppierungen Bekleidungsproduzenten und -händler an und warfen ihnen vor, daran mit schuld zu sein.
Kommissar Rotfux gab sich einen Ruck, machte sich kurz frisch, zog Jackett und Krawatte an und verabschiedete sich von seinem Dackel.
»Oskar, bleib«, sagte er, »komme wieder.«
Diese Sätze kannte der Hund und wusste, dass sein Herrchen wiederkommen würde. So konnte ihn Rotfux problemlos mehrere Stunden alleine lassen, ohne dass er bellte. Die Aula der Hochschule war schon gut gefüllt, als Rotfux dort eintraf. Er ging durch den Mittelgang nach vorne und begrüßte den Präsidenten.
»Schön, dass Sie es möglich machen konnten, Herr Kommissar«, freute der sich. Er war wie immer schick gekleidet und seine kurzen dunklen Haare und die markante Nase gaben ihm etwas Nachdrückliches.
»Das Thema ›Ausbeutung in der Textilindustrie‹ interessiert mich. Bin gespannt, was es Neues gibt«, antwortete Rotfux.
»Wir haben in der ersten Reihe für Sie reserviert. Frau Berendt wird Ihnen den Platz zeigen.«
Er begrüßte die Sekretärin des Präsidenten, die ihn zu seinem Platz führte. Rotfux wollte sich gerade setzen, als er drei Stühle rechts von sich Caroline mit ihrem Neuen sah. Das hat mir gerade noch gefehlt, zum Glück sitzen sie nicht direkt neben mir, dachte er. Er zwang sich, zu Caroline zu gehen, gab ihr kurz die Hand, wünschte einen schönen Abend und ging dann wieder zu seinem Platz. Ihren neuen Freund hatte er geflissentlich übersehen. Mit dem wollte er nun wirklich nichts zu tun haben. Neben Rotfux saß eine flotte Professorin, wie er an ihrem Namensschild erkannte. Sie war noch jung, vielleicht knapp über 30, und als sie hörte, dass Rotfux Kommissar war, wurde sie ziemlich gesprächig. Klar, Rotfux war mit seinen 46 Jahren einer der begehrtesten Junggesellen Aschaffenburgs, auch wenn er momentan die Trennung von Caroline noch nicht ganz überwunden hatte.
Ein Student trat ans Mikrofon, ein stattlicher junger Mann mit kurz geschnittenen schwarzen Haaren, etwa 1,90 groß, der durch seine sportliche Frisur und den durchtrainierten Körper dynamisch wirkte. Er stellte sich als Bastian Helferich, derzeitiger Leiter von Economics Aschaffenburg, vor, einer studentischen Vereinigung zur Förderung der Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft. Nach einer kurzen Begrüßung und Nennung des Themas bat er die Teilnehmer der Diskussion aufs Podium:
Zuerst Samuel Schulte, einen Greenpeace-Aktivisten, fast 2 Meter groß, mit blonden lockigen Haaren, ein schlaksiger Kerl, in Jeans und Sweat-Shirt, der an der Hochschule Betriebswirtschaft studierte. Als er das Podium betrat, gab es Applaus aus dem Publikum. Einige hielten Transparente in die Höhe, auf denen ›Schluss mit der Ausbeutung‹ oder ›Weg mit der Modemafia‹ zu lesen war. Der scheint seine Hausmacht mitgebracht zu haben, dachte Rotfux.
»Ist ein guter Student«, flüsterte die Professorin neben ihm, »ich kenne ihn aus meinen Veranstaltungen.«
Als Nächster wurde Thomas Herder aufs Podium gebeten, ein stattlicher Mann von etwa 55 Jahren, Inhaber eines der größten Versandhäuser Deutschlands und gleichzeitig Vorsitzender der CSU in Aschaffenburg. Als er aufs Podium kam, wurde spärlicher Applaus durch Pfiffe und Buh-Rufe übertönt.
»Bitte bleibt fair«, griff sofort Bastian Helferich ein, »wir danken Ihnen sehr, Herr Herder, dass Sie gekommen sind.«
Thomas Herder nahm es gelassen.
»Ich wusste schon, dass ich mich hier in die Höhle des Löwen begebe«, lachte er.
Im flotten dunklen Anzug, mit blonden Haarlocken im Nacken wirkte er wie ein Aushängeschild der Modebranche und Rotfux fiel auf, dass ihn seine Nachbarin auffallend musterte. Nach ihm betrat Max Seidel das Podium, etwa 45 Jahre alt, ein Aktivist von den Grünen, und es gab wieder Applaus unter den Studenten. Korpulent, mit rundlichem Gesicht, Stirnglatze und Hängebacken wie ein Hamster, wirkte er nicht gerade dynamisch, schien aber als Stadtrat der Grünen für seine Meinung bekannt zu sein. Er watschelte in Gesundheitssandalen und Schlabberjeans über das Podium und setzte sich neben den gestylten Thomas Herder. Die beiden passen wie die Faust aufs Auge, dachte Rotfux. Schließlich wurde Julian Horn von der SPD aufs Podium gebeten, ein schlanker Typ mit längeren dunklen Haaren, Lederjacke, ausgewaschenen Jeans, der mit seiner Nickelbrille, welche auf seiner spitzen Nase saß, irgendwie alternativ aussah. Er gab allen Teilnehmern die Hand und setzte sich auf den letzten freien Platz neben Thomas Herder. Eine sehr interessante Gesprächsrunde haben die Studenten zusammengestellt, dachte Rotfux, und er war froh, doch zu der Veranstaltung gegangen zu sein.
»Wird sicher spannend«, flüsterte er seiner Nachbarin zu.
Nach einer Betrachtung der aktuellen Situation der Textilindustrie prallten die Meinungen hart aufeinander. Insbesondere Thomas Herder wurde von den anderen Diskutanten angegriffen.
»Sie sind verantwortlich für den Tod von Tausenden Textilarbeitern in Bangladesch, in Pakistan, in Kambodscha, in China … Es sind Fabriken eingestürzt, es hat Brände gegeben, die Arbeiter und Arbeiterinnen werden gehalten wie die Sklaven, wenn sie schwanger sind, entlässt man sie. Der bekannteste Fall ist der Einsturz des Fabrikgebäudes in Bangladesch am 24. April 2013, bei dem mehr als 1.100 Menschen getötet wurden, aber das ist nur die Spitze des Eisberges. In Pakistan hat eine Fabrik in Karatschi gebrannt und es sind 260 Arbeiter und Arbeiterinnen umgekommen. Die chinesische Textilindustrie vergiftet die Umwelt. Wollen Sie das alles nicht sehen?«, sagte Samuel Schulte von Greenpeace vorwurfsvoll.
Er hatte laut und etwas erregt gesprochen und donnernder Applaus unterstützte den Redner. Thomas Herder blieb ruhig und gefasst.
»Selbstverständlich bedauere ich all diese Vorfälle«, sagte er. »Aber mit Ihrer pauschalen Kritik machen Sie es sich etwas einfach. Sollen wir keine Textilien mehr aus diesen Ländern beziehen? In Bangladesch gibt es etwa 5.000 Textilfabriken, dort arbeiten zu 90 Prozent Frauen. Es ist ein bitterarmes Dritte-Welt-Land. Alternativen haben die Menschen dort nicht, damit verlören viele ihre einzige Erwerbsquelle.«
»Aber so kann es doch nicht weitergehen!«, mischte sich Max Seidel von den Grünen polternd ein.
»Es geht ja auch nicht so weiter«, konterte Thomas Herder. »Wir machen zum Beispiel beim Textilbündnis der Bundesregierung mit, das für bessere Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern sorgen soll. Auch Adidas, H&M und viele andere Firmen sowie die Spitzenverbände der Textilindustrie sind Mitglieder. Wir können froh sein, dass unser Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sich dafür starkgemacht hat!«
Er sagte das mit gewissem Stolz und jeder wusste, dass Gerd Müller bei der CSU war.
»Herr Müller sollte sich schämen«, fiel ihm Max Seidel ins Wort. »Der hat die ursprüngliche Version so abgespeckt, dass sie nichts mehr bringt!«
»Ich bitte Sie, mit Ihren Parolen sind Sie groß, aber was wollen Sie effektiv tun?«, wehrte sich Thomas Herder. »Vergessen Sie nicht, dass wir auch die Verantwortung für unsere mehr als tausend eigenen Mitarbeiter haben. Ginge es nach Ihren Sprüchen, könnten wir die Firma vermutlich bald schließen. Und dann? Haben Sie dann Arbeit für die Menschen? Der Konkurrenzkampf in der Branche ist hart. Es dürfte ja selbst Ihnen nicht entgangen sein, dass inzwischen einige große Versandhäuser ihre Pforten geschlossen haben. Ich sage nur: Neckermann, ganz in der Nähe …«
Thomas Herder, der die ganze Zeit sehr sachlich gesprochen hatte, waren jetzt seine Emotionen anzumerken. Er schien sich über Max Seidel zu ärgern.
»Es tobt ein harter Preiskampf, und die Leute kaufen nun mal dort, wo sie die Ware am billigsten erhalten«, fügte er noch hinzu, »da kann nicht eine einzelne Firma die Preise erhöhen und sich selbst in den Konkurs treiben. Sie werden es leider nicht schaffen, den Kunden beizubringen, sie sollten auf Billigtextilien verzichten. Bei einer Umfrage oder auch einer solchen Diskussion sagen sie das vielleicht, aber am Ende stimmen sie mit dem Geldbeutel ab.«
Sofort mischte sich Julian Horn von der SPD ein, der bisher wenig gesagt hatte.
»Aber das rechtfertigt nicht alles! Nach neuesten Berichten zum Beispiel der BBC werden Zigtausende syrische Flüchtlinge in der türkischen Textilindustrie eingesetzt, sogar Kinder. Mehr als 12 Stunden sollen sie nähen, bügeln, bleichen für die großen Modegiganten, bei geringem Lohn und unter unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen.«
Thomas Herders Nerven schienen allmählich blankzuliegen.
»Herr Horn, nun mal langsam. Machen Sie mich bitte nicht für alle Missstände auf dieser Welt verantwortlich! Natürlich lehne ich Kinderarbeit ab und diese Gerüchte müssen geprüft werden. Aber in der Türkei gibt es etwa 3 Millionen syrische Flüchtlinge. Viele davon erhalten keine Unterstützung, sondern sind auf sich selbst angewiesen. Sie sind wahrscheinlich froh, wenn sie in der Textilindustrie arbeiten können. Oder wollen Sie diese 3 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland holen?«
»Frau Merkel hat doch gesagt, wir schaffen das …«, polterte Julian Horn dazwischen.
Der Saal tobte. Applaus und Pfiffe waren zu hören.
»Meine Herrn, ich glaube, wir kommen etwas vom Thema ab«, griff Bastian Helferich geschickt ein. »Über das Thema Flüchtlinge sollten wir vielleicht bei anderer Gelegenheit diskutieren.«
»Wieso, wenn sie in der Textilindustrie beschäftigt werden …«, wehrte sich Julian Horn.
»Also, Herr Horn«, konterte Thomas Herder, »Sie werden lachen, wir haben sogar inzwischen einige Flüchtlinge in unserem Versandhaus angestellt, selbstverständlich entsprechend der hiesigen Standards. Aber für die Situation in der Türkei können Sie mich nun wirklich nicht verantwortlich machen!«
Die Diskussion ging noch eine Zeitlang hin und her, ohne dass sich die Standpunkte wesentlich annäherten. Schließlich brachte Samuel Schulte von Greenpeace noch Papst Franziskus ins Spiel.
»Sogar der Papst prangert die Zustände in der Textilindustrie an. Er hat in der Stadt Prato in der Toskana gegen Ausbeutung und Korruption gepredigt. In der Stadt leben offiziell gemeldet 19.000 Chinesen, die dort in Textilfabriken schuften. Tatsächlich sollen es zwischen 30.000 und 50.000 sein. Da sie in Italien arbeiten, tragen die von ihnen genähten Kleidungsstücke das Label ›Made in Italy‹.«
Thomas Herder sagte dazu nichts. Er schien es allmählich sattzuhaben, sich gegen die Missstände im Rest der Welt verteidigen zu müssen. Samuel Schulte hingegen sah seine Stunde gekommen. Er stand auf, was bei seiner Größe beeindruckend wirkte.
»Wir müssen ein Zeichen setzen!«, rief er. »Ich fordere euch alle zu einer Demonstration gegen die Ausbeutung in der Textilindustrie auf. Morgen um 11 Uhr vor der Einfahrt des Versandhauses Herder in Aschaffenburg! Die Presse wird auch da sein.«
Bastian Helferich schaltete ihm das Mikrofon ab.
»Mit diesem Aufruf zur Demonstration haben die Economics der Hochschule nichts zu tun«, sagte er sehr nachdrücklich. »Wir wollten hier die verschiedenen Gesichtspunkte diskutieren, vertreten aber nicht eine bestimmte Richtung.«
»Lassen Sie uns vernünftig bleiben«, ergriff Thomas Herder nochmals das Wort. »Ich kann Sie nicht hindern, zu demonstrieren. Sollten Sie allerdings unsere Mitarbeiter bedrohen oder Arbeitsabläufe stören, wäre ich gezwungen, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.«
Bastian Helferich beendete die Podiumsdiskussion. Er wies noch auf den nächsten Veranstaltungstermin hin, bedankte sich für die Unterstützung der Hochschule und des Präsidenten und wünschte allen einen guten Nachhauseweg.
»War eine heiße Diskussion«, bemerkte die Nachbarin von Rotfux. »Herr Helferich hat das wirklich gut gemeistert, bis auf das Ende vielleicht, da hätte er Greenpeace schneller das Wort abschneiden müssen.«
»Das denke ich auch. Wird morgen sicher spannend bei der Demonstration.
»Werden Sie hingehen?«, fragte sie.
»Ich denke schon, im Grunde von Amts wegen. Sollte es Probleme oder Ausschreitungen geben, ist es gut, wenn die Polizei von Anfang an vor Ort ist.«
Rotfux taxierte die Professorin inzwischen genauer. Sie hatte blonde lange Haare, blaue Augen, ein hübsches schmales Gesicht, eine gute Figur mit kräftigen Brüsten, trug erstaunlicherweise keinen Ring und schien irgendwie an ihm interessiert zu sein. Also wagte er es:
»Haben Sie Lust, noch etwas zu trinken? Wir könnten noch kurz in den Hofgarten gehen. Natürlich nur, wenn Sie Zeit haben.«
Sie zögerte. Dann lächelte sie.
»Ja, gut, aber es darf nicht zu spät werden. Ich habe morgen um 8.00 Uhr Vorlesung.«
»Prima, freue mich, will nur noch kurz Herrn Herder hallo sagen.«
Rotfux ging zum Podium und begrüßte Thomas Herder.
»Hallo, grüß dich, hast dich wacker geschlagen«, sagte er.
»Na ja, bei dem Thema kannst du nicht gewinnen. Ist leider sehr kontrovers und die Leute verstehen die wirtschaftlichen Zwänge nicht.«
»Ich fand’s jedenfalls sehr interessant. Mach’s gut. Und Gruß zu Hause!«
Schnell verabschiedete Rotfux sich, um seine neue Begleitung nicht warten zu lassen.
»Sind Sie mit dem Auto da oder zu Fuß?«, fragte er.
»Zu Fuß. Ich komme aus Frankfurt und fahre mit der Bahn. Muss nachher schauen, wann ein geschickter Zug fährt.«
»Oh, dann nehmen wir mein Auto und ich fahre Sie anschließend zum Bahnhof.«
Wenn Caroline sich einen Professor angeln konnte, kann ich das umgekehrt auch, dachte Rotfux. Sie gingen zu seinem Auto und fuhren zum Restaurant Hofgarten. Viel los war nicht mehr und so fanden sie einen schönen Tisch an der Fensterfront.
»Sie kennen Herrn Herder? Sind sogar per Du mit ihm …«
Aha, sie hat uns belauscht, dachte Rotfux. Scheint echt an mir interessiert zu sein …
»Ja, ich kenne ihn aus dem Dackelclub. Deshalb sind wir auch per Du. Dort geht es etwas rustikaler zu.«
»Oh, Sie haben einen Dackel …«
»Ja, er heißt Oskar.«
»Ich liebe Dackel. Wir hatten in der Familie einen. Er hieß Stricki.«
Sie lachte und sah sehr glücklich aus.
»Sie können mir ja gelegentlich Ihren Dackel vorführen. Würde mich freuen«, sagte sie.
Rotfux kam sich vor, als hätte sie ihn gerade aufgefordert, ihr seine Briefmarkensammlung zu zeigen.
»Gern«, antwortete er, »aber meistens habe ich erst abends Zeit oder am Wochenende natürlich, aber da werden Sie in Frankfurt bei Ihrer Familie sein.«
»Ich habe keine Familie. Wohne nur wegen meiner Mutter in Frankfurt. Die besuche ich gelegentlich.«
»Und Ihr Vater?«
»Ist leider schon lange tot, schon vor 10 Jahren verstorben.«
»Oh, tut mir leid.«
Es kam Rotfux vor, als wollte sie ihr Leben und ihre Träume und Wünsche vor ihm ausbreiten. Sie sprach unentwegt, aß nebenbei eine italienische Vorspeise, zu der er sie überredet hatte, und erzählte ihm, dass sie erst 6 Monate hier sei und viel zu tun habe, da sie alle Vorlesungen neu vorbereiten müsse. Er sah, dass sie hübsch war, ihre Zähne schimmerten weiß im Licht der Lampen, ihre blauen Augen sahen verträumt aus, wenn sie ihn ansah. Ihre rot lackierten Nägel wirkten perfekt zu ihren schmalen Händen, die bestimmt sehr zärtlich sein konnten. Bald trank sie das zweite Glas Rotwein und aß eine Pizza, obwohl sie ursprünglich überhaupt nichts essen wollte.
»Das ist der schönste Abend, seit ich hier bin«, schwärmte sie.
»Aber Sie werden doch auch mit den Kollegen mal weggehen …«
»Eher weniger, alle sind beschäftigt, jeder wohnt woanders, die Vorlesungszeiten sind unterschiedlich, man sieht sich wenig und …«, sie zögerte, »… manchmal denke ich, als Professorin haben die Männer Angst vor einem.«
»Du wirst hoffentlich nicht beißen«, lachte Rotfux. Er war wie automatisch zum du übergegangen und als er es merkte, war es zu spät.
»Oh, entschuldigen Sie, wir sind ja nicht per Du …«
»Schon okay, ich heiße Michelle …«
»Ich Rudolf, aber die meisten sagen Rudi.«
Rotfux fand, Michelle sei ein zärtlicher Name. Man konnte ihn auf der Zunge zergehen lassen, konnte ihn ins Ohr hauchen, … aber er sagte nichts. Wäre wohl zu aufdringlich gewesen, gleich am ersten Abend.
Sie unterhielten sich über alles Mögliche. Rotfux schwärmte von seinen Reisen und sie erzählte ihm, dass sie schon in Brasilien gewesen war. Damit hatten sie für den Rest des Abends ihr gemeinsames Thema gefunden. Plötzlich zog sie ihr Smartphone aus der Handtasche und prüfte die Bahnverbindungen.
»Tut mir leid, Rudi, ich müsste los. Mein Zug fährt in 15 Minuten.«
Rotfux zahlte, sie eilten zu seinem Wagen und er fuhr sie zum Parkhaus im Hauptbahnhof. Es war reizvoll, ihre hübschen Beine im Fußraum neben sich zu sehen. Passte alles, die Größe, die Art, ihr Lachen, einfach alles.
»War ein netter Abend«, sagte er. »Eigentlich hatte ich gar keine Lust auf die Veranstaltung.«
»Mir ging es genauso. Vielen Dank!«
Sie hauchte ihm ein Küsschen auf die Wange, als sie das sagte, und er musste sich schwer beherrschen, auf die Straße zu sehen. Als sie vor dem Bahnhof ankamen, war es schon drei Minuten vor Abfahrt des Zuges.
»Für das Parkhaus wird es zu knapp. Lass mich einfach hier raus, ich schaffe das schon. Und melde dich mal. Alle Angaben auf der Homepage der Hochschule«, lachte sie.
»Klar. Gute Nacht!«
»Danke ebenfalls. Gute Nacht!«
Er sah sie durch die gläsernen Eingangstüren des Hauptbahnhofes verschwinden und startete wie benommen sein Auto. Das war ein Abend! Nie hätte er sich träumen lassen, an der Hochschule eine Frau kennenzulernen, sogar eine Professorin. Jetzt aber nach Hause zu Oskar! Der wartete sicher schon, der Arme. Sie hatte gesagt, sie mochte Dackel, das war ermutigend …
2
Nicole verabschiedete sich von ihrem Freund Tobias. Sie war todmüde und etwas angeheitert. Den ganzen Abend war sie bei ihm gewesen. Zuerst hatten sie gekocht, er kochte verführerisch gut, dann sich geliebt, anschließend noch einen Film geschaut und nebenbei eine Flasche Rotwein geleert.
»Soll ich dich nicht doch nach Hause bringen?«
»Nein, Tobi, du hast zu viel getrunken und unten steht mein Fahrrad vor dem Haus. Ich schaff das schon …«
»Aber es ist schon 2 Uhr nachts, kein Mensch mehr unterwegs …«
»Ein paar werden schon noch auf dem Heimweg sein«, lachte sie. »Jetzt mach kein Drama draus! Ich fahre ja nur ein kurzes Stück.«
Sie drückte ihm einen Kuss auf den Mund, zog ihre Jacke über und schob sich hinaus in den Flur. Er sah ihr durch den Türspalt nach, sie winkte ihm, dann verschwand sie über die Treppe nach unten. Sie hatte Tobias vor 6 Monaten an der Hochschule kennengelernt. Er studierte BWL wie sie und war ihr in einem Seminar aufgefallen. Seitdem waren sie zusammen und unzertrennlich. Sie öffnete das schwere Kettenschloss an ihrem Fahrrad. Ihre Finger waren kalt und sie wünschte sich nach Hause. Sie zog ihren Schal enger um den Hals und setzte sich aufs Fahrrad. Über die Würzburger Straße fuhr sie Richtung Innenstadt. Ein einsames Auto folgte ihr, der Fahrer schien sie im Lichtkegel der Scheinwerfer zu beobachten. Warum überholt er mich nicht, der Idiot, dachte sie. Schließlich fuhr sie auf dem markierten Fahrradweg und er hatte genug Platz zum Überholen. Sie war froh, als er endlich an ihr vorbeizog. Die Straßenlaternen sorgten für bizarre Schatten. Manchmal sah sie ihren Schatten vor sich, dann huschte er an ihr vorbei und war hinter ihr, bis sich das Spiel bei der nächsten Laterne wiederholte. Die Kälte kroch ihr unter die Jacke, ihre Handtasche hatte sie quer über die Schulter gehängt, die Mütze tief in die Stirn gezogen. Rechts schimmerte der Hofgarten durch die Bäume, oberhalb der Mauerbrüstung lag der Park Schöntal, die Sandkirche mit ihrem markanten Torbogen ragte am Eingang zur Fußgängerzone in den dunklen Nachthimmel. Am Kreisverkehr bog sie in die Wermbachstraße ab. Rechter Hand leuchtete das Kreuzsymbol des Bestattungsinstituts Leo Kraus oben am Gebäude mit einem Hinweis im Schaufenster: ›Tag und Nacht dienstbereit‹. Der Tod kennt keine Stunde, dachte sie. Das Institut war ihr irgendwie unheimlich, mit dem Tod wollte sie nichts zu tun haben. Sie sah bald den spitzen Turm der Stiftskirche oberhalb der Dächer und bog schnell in die Löherstraße ein. Vorbei an »Omas Kartoffeltopf«, steuerte sie auf das Hotel »Wilder Mann« zu, dessen gelbliche Flaggen sich oberhalb des Parkplatzes vom dunklen Nachthimmel abhoben. Wenig später war sie am Main. Dunkel lag der Fluss im Mondlicht, Bäume und Büsche spiegelten sich mit ihren zarten Frühlingsblättchen im Wasser, besonders wenn sie von Laternen beleuchtet wurden. Auf der Promenade war niemand mehr unterwegs, nur einige Enten kuschelten am Ufer, die Köpfe unter den Flügeln. Nicoles Vater hatte ihr verboten, nachts diesen Mainuferweg zu fahren, aber sie mochte das Plätschern des Mains, den Geruch feuchter Luft, das Säuseln des Windes in den Bäumen unterhalb des Schlosses, das seine Türme, gelblich beleuchtet, in den Nachthimmel reckte. Bald habe ich es geschafft, dachte sie. Noch am Schloss vorbei in Richtung Pompejanum, das sich orangegelb im Main spiegelte, dann den kleinen Weg rechts ab zum Ziegelberg, wo ihre Familie in einer Villa mit Blick über den Main wohnte. Ihr Vater machte sich immer Sorgen um sie. Er hatte Angst, dass ihr etwas passieren könnte, zumal sie reich waren und eines der größten Versandhäuser Deutschlands besaßen. Er hatte ihr ans Herz gelegt, stets vorsichtig zu sein. Generell war er misstrauisch. Ihren Freund Tobias hatte er inzwischen zwar akzeptiert, aber trotzdem zu bedenken gegeben, dass er es vielleicht nur auf ihr Geld abgesehen haben könnte. Obwohl Tobias aus einer guten Familie kam, die selbst eine Firma für alle Arten von Kerzen und Teelichtern besaß und damit weltweit bekannt war, verschwanden seine Zweifel nicht. Unterhalb des Schlosses wurde der Weg enger. Am Ufer wuchsen hohe Büsche, die frisch ausgetrieben hatten, und rechter Hand stieg die Mauer steil in die Höhe. Etwas unheimlich war es Nicole schon, aber was sollte schon sein? … Wer sollte hier auf sie warten? Sie trat kräftiger in die Pedale. Ein Käuzchen rief von der Maininsel herüber. Du hast mir gerade noch gefehlt, dachte sie. Der Wind säuselte in den zarten Blättern, ein Rabe flog krächzend auf, dann hatte sie die Engstelle hinter sich. Rechts legte sich die Stadtmauer wehrhaft um die Häuser. Nur das Theoderichstor, an dem die schlimmsten Hochwasser der vergangenen Jahrhunderte im Sandstein markiert waren, gewährte Einlass in die Stadt. Der Biergarten am Mainufer schlummerte mit seinen Holzbänken still vor sich hin und Nicole steuerte auf die Stelle zu, an der man am Tag die Boote zu Wasser ließ oder aus dem Fluss holte. Sie wunderte sich, dass dort ein dunkler Lieferwagen stand. Ein komischer Parkplatz, dachte sie. Wenn sie hier parken wollte, dann doch nicht so nah am Wasser. Sie fuhr im leichten Bogen um das Fahrzeug, bemerkte plötzlich einen dunklen Schatten, erschrak zu Tode, spürte, dass eine Decke über sie geworfen wurde, verhedderte sich darin und stürzte.
»Seid ihr verrückt?«, rief sie, wobei die Decke ihre Stimme stark dämpfte, so dass kaum etwas zu hören war.
Im nächsten Augenblick wurde sie mitsamt der Decke von kräftigen Händen gepackt und ins Auto gezerrt. Sie schrie jämmerlich, was aber unter der Decke schlecht zu hören war. Sie rissen ihr die Handtasche weg, banden ihr die Beine zusammen, zogen ihr eine schwarze Haube über den Kopf und fesselten ihre Hände. Eingeschnürt wie eine Mumie kam sie sich vor. Sie hörte, wie sie ihr Fahrrad in den Main warfen.
»Das Handy hinterher«, sagte eine Stimme mit einem fremdländischen Akzent, »damit sie uns nicht orten können. Und nimm den Ausweis aus der Tasche, den brauchen wir noch.«
Nicole war es kalt, eiskalt. Sie zitterte und wusste nicht, ob es vor Kälte oder vor Angst war. Sie begriff das nicht. Wer hatte wissen können, dass sie hier vorbeikam? Wer sollte sie entführen wollen?
»Ich habe kein Geld dabei … Lasst mich!«
Ein Schlag in ihr Gesicht war die Antwort.
»Halt die Klappe!«
Sie war in diesem Moment froh, dass ihr Kopf unter dieser schwarzen Haube steckte, die den Schlag wenigstens abgemildert hatte. Sie lag auf dem kalten Boden des Lieferwagens, hörte, wie die Schiebetür verschlossen wurde und das Fahrzeug startete. Alles war blitzschnell gegangen, hatte nur wenige Minuten gedauert, und vermutlich hatte es kein Mensch beobachten können.
Oh mein Gott, dachte sie. Sie war nicht fromm, aber dieser Gedanke stellte sich automatisch ein und war Ausdruck der tiefen Verzweiflung, die sich in ihr breitmachte. Sie hatte das Gefühl, dass sie durch das Theoderichstor über Kopfsteinpflaster in die Stadt fuhren, irgendwann bogen sie links ab, vermutlich auf die Hanauer Straße. Das Autoradio schmetterte flotte Melodien durch die Nacht. Ihre Entführer sprachen nichts. Sie schienen genau zu wissen, wo sie mit ihr hinwollten. Nach einiger Zeit wurde die Fahrt schneller. Ihre gefesselten Beine schmerzten, sie lag total unbequem, versuchte, sich etwas zurechtzurutschen, was aber wenig brachte, da die Halterungen der Sitzbänke im Weg waren.
»Hat doch gut geklappt«, hörte sie von vorne. »Ist pünktlich erschienen.«
Was das sollte? Woher konnten sie wissen, wann sie kam? Das hatte nur Tobias gewusst. Und ihre Stiefmutter vielleicht, der hatte sie eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass sie bald kommen würde, aber die lag um diese Zeit bestimmt im Bett und hatte die Nachricht vermutlich noch nicht einmal gelesen. Die Banditen mussten sie beobachtet haben, spekulierte sie. Vielleicht war es eine Bande, der sie in die Hände gefallen war, und sie hatten die Wohnung von Tobias observiert. Der Lieferwagen verlangsamte das Tempo, bog rechts ab und sie spürte, dass sie im Kreis fuhren. Autobahnauffahrt, schoss es ihr durch den Kopf. Sie fuhren nach Frankfurt oder Hanau, jedenfalls in diese Richtung. Sie hörte die 3-Uhr-Nachrichten, konnte sich aber nicht konzentrieren. Ihr Körper schmerzte und Gedanken tanzten in ihrem Kopf. Hatte ihr Vater doch recht gehabt. Er würde toben, wenn er von der Entführung hörte. Warum hatte sie sich nicht von Tobias nach Hause bringen lassen, obwohl er es anbot? Jetzt lag sie in diesem Lieferwagen und ahnte nicht, was sie mit ihr vorhatten. Längst wusste sie nicht mehr, in welche Richtung sie fuhren. Sie waren mehrfach abgebogen, langsamer und schneller gefahren, bis sie sich ganz langsam durch kleinere Straßen bewegten, wahrscheinlich in einer Stadt oder einem Dorf. Schließlich ging es bergauf. Nicole wurde gegen die Halterungen der Sitze gepresst. Alles tat ihr weh.
»Bald haben wir es«, hörte sie von vorne. »Eigentlich schade um das Püppchen.«
Die Angst krallte sich in ihrem Nacken fest. Was dieses »eigentlich schade« bedeutete? Wollten sie sie ermorden? Aber dann hätten sie doch nicht diese weite Fahrt unternehmen müssen … Das Auto quälte sich inzwischen einen Feld- oder Waldweg entlang. Es schwankte mal nach rechts und mal nach links und holperte durch tiefe Schlaglöcher. Endlich bremsten sie abrupt und blieben stehen. Einer der Männer zerrte sie aus dem Auto. Da sie gefesselt war, fiel sie sofort zu Boden.
»Hilf mir mal mit den Beinen. Sie kann selber laufen.«
Sie spürte, dass sie ihr die Fesselung an den Beinen entfernten.
»So, hoch jetzt, lauf!«
Sie versuchte aufzustehen, aber es klappte nicht. Ihre Beine waren wie abgestorben und gehorchten ihr nicht.
»Na, wird’s bald, auf geht’s!«
Einer der Männer packte sie unter den Armen und zog sie nach oben. Mühsam versuchte sie, sich auf den Beinen zu halten, aber sie sackte wieder in sich zusammen.
»Scheiße, die kann nicht gehen. Komm, pack an!«
Sie spürte, wie sie ihr rechts und links unter die Arme griffen und sie über eine steile Treppe nach oben schleiften.
»So ist’s gut, gleich haben wir’s.«
Es roch nach frischem Weinlaub und Trauben. Sie kannte diesen Geruch vom Weingut ihres Vaters. Der legte sein Geld überall an, besaß das Versandhaus, ein Weingut, eine Druckerei, eine Kleiderfabrik, aber was nützte das jetzt. Sie konnte nichts sehen unter ihrer schwarzen Kapuze und war ihnen hilflos ausgeliefert.
»Was wollt ihr? Soll ich mit meinem Vater sprechen?«, versuchte sie es.
Schallendes Gelächter war die Antwort. Sie konnte nichts sehen, wusste nicht, ob es zwei oder drei waren, aber zwei bestimmt.
»Wenn ihr Geld wollt, kann ich mit meinem Vater reden«, nahm sie einen zweiten Anlauf.
Wieder Gelächter.
»Mach dir keine Gedanken, Püppchen. Wir haben einen Auftrag und den führen wir aus.«
Was konnte das für ein Auftrag sein? Wer sollte sie beauftragt haben? Gedanken wirbelten durch ihren Kopf.
»So, jetzt rein.«
Sie hörte das Knarren einer Tür, merkte, dass sie in einen Raum gebracht wurde, versuchte, sich auf den Beinen zu halten, fiel aber wieder hin.
»Na, du kannst es wohl nur im Liegen?«
Einer griff ihr brutal zwischen die Beine und sie fürchtete, dass er über sie herfallen würde.
»Sieht nett aus, die Kleine. Wir könnten unseren Spaß haben«, lachte der mit der dunklen Stimme.
Dann war es ganz ruhig. Eine Zeitlang sagten sie nichts. Sie merkte, wie einer zur Toilette ging. Sein kräftiges Furzen war auch im Zimmer zu hören. Alles sehr hellhörig hier, dachte sie.
»Komm, wir binden sie aufs Bett«, sagte er, als er zurückkam.
Sie hoben sie hoch und ließen sie auf ein Bett fallen. Einerseits war das angenehmer, als auf dem kalten Boden zu liegen, aber sie fühlte sich jämmerlich hilflos und wand sich in ihren Fesseln.
»Die Beine binden wir am Bettgestell fest.«
Sie merkte, wie sie ihr die Beine breit auseinanderspreizten und sie rechts und links am Bettgestell festbanden.
»So magst du’s sicher«, lachte der mit der dunklen Stimme.
Er griff ihr wieder in den Schritt und streichelte über ihre Brüste. Sie fand es widerlich, hätte sich am liebsten übergeben, aber sie beherrschte sich und ließ sich nichts anmerken. Anschließend überprüften sie die Fesseln an ihren Händen und banden ihr auch die Arme rechts und links am Bettgestell fest. Wie gekreuzigt musste sie aussehen und es war ziemlich unbequem, so breitbeinig und breitarmig auf dem Bett zu liegen.
»Lass dir die Hände küssen, Püppchen«, lachte der mit der tiefen Stimme.
Sie spürte seine feuchten Lippen auf ihrer rechten Hand und ekelte sich davor. So weit war es nun gekommen. Ach, hätte sie doch auf ihren Vater gehört! Sie hatte den Eindruck, dass sie Fotos von ihr machten. Jedenfalls hörte sie das Summen eines Handys oder einer Kamera. Schließlich steckten sie ihr einen Knebel in den Mund und umwickelten ihn mit Klebeband. Dabei passten sie auf, dass die schwarze Kapuze über ihren Augen blieb und sie nichts sehen konnte.
»Damit du nicht schreien kannst, Püppchen. Es wird dich niemand hören. Spar dir deine Kräfte und schlaf ein wenig. Es ist spät genug.«
Sie wollte noch etwas sagen, aber es gelang ihr nicht. Durch den Knebel und das Klebeband drang nur ein jämmerliches Geräusch, das man nicht verstehen konnte.
»Hab dich nicht so, Kleines. Wenn man reich ist, muss man leiden! Bleib einfach liegen und ruh dich aus. Morgen kommen wir wieder. Wir werden noch unseren Spaß zusammen haben …«
Mit diesen Worten verließen sie den Raum. Sie hörte, wie sie einen Riegel vorschoben, hörte den Schlüssel im Schloss, ihre Schritte auf den Treppenstufen und nach einigen Minuten den Motor des Lieferwagens. Dann war es ganz still, kurze Zeit jedenfalls. Ihre Sinne waren bis aufs Äußerste angespannt. Das Blut pochte in ihren Adern. Bald vernahm sie eine Mücke, die durch den Raum summte. Etwas krabbelte am Boden oder an der Wand. Klar, sie mussten hier in der freien Natur sein, im Wald oder in einem Weinberg, da gab es Insekten aller Art und sie waren sicher auch in diesem Haus oder dieser Hütte. Was sollte sie tun? Schreien war zwecklos. Bewegen konnte sie sich nicht. Sie versuchte, die Hände frei zu bekommen, aber es war aussichtslos. So konnte sie nur still liegen bleiben und hoffen, dass die Männer morgen wirklich wiederkämen, obwohl sie sich fragte, welche Art von Spaß sie meinten, den sie dann mit ihr haben wollten. Sie versuchte zu schlafen, aber es gelang ihr nicht, obwohl es bestimmt schon 4 Uhr morgens sein musste. Sie lag ganz still da und Fragen über Fragen wirbelten durch ihren Kopf. Was wollten sie? Wie konnte sie sich retten? Bestimmt wollten sie Lösegeld erpressen, eine andere Erklärung konnte sie nicht finden. Vater hatte recht gehabt: Sie war immer in Gefahr gewesen, aber sie hatte es nicht wahrhaben wollen, war leichtfertig bei Dunkelheit mutterseelenallein über die Mainpromenade geradelt und das, obwohl sie alle von den schrecklichen Vergewaltigungen in Freiburg gehört hatten, wo zwei junge Frauen ums Leben gekommen waren. Sie hätte sich ohrfeigen können für ihre Dummheit und Unbekümmertheit! Sie liebte ihren Vater. Seit die Mutter verstorben war, war er ihre wichtigste Bezugsperson. Auch wenn er streng war, liebte sie ihn über alles. Ihn und Bruno, ihren Rauhaardackel. Vater hatte ihr den Hund geschenkt, nachdem Mutter verstorben war. Sie sah den süßen Dackel vor sich, wünschte sich so sehr zu ihm, dass ihre Fesseln noch mehr schmerzten. Er lag sicher in seinem Körbchen und ahnte von dem ganzen Unheil nichts. Erst morgen früh würde er sie vermissen, suchend durch die Wohnung streifen, an allen Ecken schnüffeln, aber sie nicht finden. Oh Bruno, seufzte sie innerlich und spürte den Knebel im Mund, der sie beim Atmen störte. Sie sandte ein Gebet zum Himmel und wünschte sich, wieder bei ihren Lieben zu sein. Ihre Stiefmutter schloss sie darin ein, obwohl sie diese nicht wirklich mochte. Vater hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter geheiratet, aber sie war 20 Jahre jünger als er, ein ehemaliges Model. Sie war zwar schön, aber nur äußerlich. Nie hatte sie Zugang zu ihrem Herzen gefunden, und das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Auch Bruno mochte sie nicht. Zweimal hatte er sie schon gebissen. Sie war in hysterisches Kreischen verfallen, verlangte, dass Bruno eingeschläfert würde, aber Vater ließ sich nicht erweichen, sondern hielt zu dem Dackel.
Ihr Großvater Wolfgang mochte den Hund auch. So waren sie und ihr Vater und der Großvater ein verschworenes Trio und sie war sich sicher, dass die beiden sie retten würden, falls es irgend möglich war …
Nach ein paar Stunden, die sie regungslos auf dem Bett lag, meldete sich ihre Blase. Mein Gott, ich werde mir in die Hose pinkeln, dachte sie. Sie war gefesselt und konnte nichts machen. Verzweifelt zerrte sie an den Stricken, aber es war aussichtslos. Draußen musste es schon hell sein, denn es schimmerte etwas Licht durch Ritzen rechts und links von den Fensterläden. Sie lag da und wünschte sich sehnlichst eine Toilette. So klein war der Mensch und so klein waren plötzlich ihre Wünsche. Sie sehnte die Banditen herbei oder irgendeinen Menschen. Sie schrie ihren Schmerz in ihren Knebel, aber nur ein jämmerlich leises Geräusch drang hindurch, das außerhalb dieser Hütte bestimmt niemand hören konnte. Das rechte Bein war ihr eingeschlafen. Sie versuchte es zu bewegen, damit es nicht abstarb. Noch nie hatte sie sich so übel gefühlt wie jetzt. Sie verlor das Gefühl für die Zeit, hatte den Eindruck, seit Tagen nicht auf der Toilette gewesen zu sein, versuchte aber immer noch, ihren Drang zurückzuhalten, auch wenn sie es fast nicht mehr schaffte. Irgendwann hörte sie Schritte. Da kommt jemand, dachte sie. Sie versuchte wieder zu schreien, aber es drang nichts durch den Knebel. Wenig später drehte sich der Schlüssel im Schloss und die Tür zur Hütte öffnete sich.
»Hallo, Püppchen«, hörte sie den mit der tiefen Stimme, der sie auf die rechte Hand geküsst hatte.
Unter ihrer dunklen Maske konnte sie nichts sehen.
»Ich muss zur Toilette«, schrie sie verzweifelt, doch der Knebel ließ nichts durch.
»Wir werden unseren Spaß haben, Püppchen. Aber zuerst mal zur Toilette. Wirst wahrscheinlich müssen. Bin ja kein Unmensch.«
Gott sei Dank, dachte sie, er hat es kapiert, und sie spürte, dass er ihre Fesseln löste. Die Hände band er ihr sofort wieder zusammen. Dann führte er Nicole zur Toilette. Es musste ein derbes Plumpsklo sein, jedenfalls roch es streng. Er zog ihr die Hose nach unten und setzte sie auf das Holzbrett mit dem Loch. Sie sah nichts, aber sie spürte das derbe Holz unter sich und merkte, dass ihr Hintern in diesem ausgesägten Loch hing. Wie eine Erlösung kam ihr das Geräusch ihres Urins vor, der sich kräftig in die Tiefe des Plumpsklos ergoss.
»Gut jetzt?«, fragte ihr Peiniger.
Sie nickte. Er tupfte sie mit Papier unten ab und konnte es nicht lassen, sie zwischen den Beinen zu befummeln. Sie wehrte sich, aber das schien ihn nur anzuspornen.
»Wir werden viel Spaß haben, Püppchen.«
Endlich ließ er von ihr ab. Vielleicht wollte er sie auf die Folter spannen, war ein übler Sadist, der ihr vor Augen führte, wie machtlos sie war. Zurück im Hauptraum, warf er Nicole wieder auf das Bett und fesselte zuerst ihre Beine.