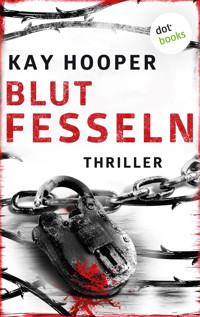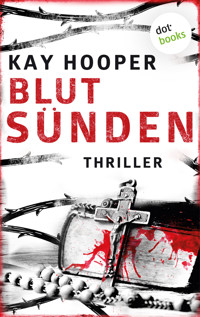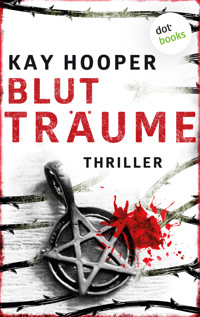
5,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Noah Bishop & HAVEN
- Sprache: Deutsch
Die Jagd beginnt … jetzt: Der actiongeladene Mystery-Thriller »Blutträume« der New-York-Times-Bestsellerautorin Kay Hooper als eBook bei dotbooks. Wenn Monster dich in deinen Träumen verfolgen – und im wahren Leben … Auf den ersten Blick würde niemand vermuten, welche schwere Bürde auf der jungen Dani lastet: Sie kann in verstörenden Visionen die Zukunft sehen. Das macht sie zur perfekten Rekrutin für die geheime FBI-Einheit des Special Agents Noah Bishop, der jene Bedrohungen jagt, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen. Aber wird Dani wirklich in der Lage sein, einen rätselhaften Killer zu finden, den scheinbar nichts und niemand stoppen kann? Und wie soll sie Bishop sagen, dass sie dabei immer wieder dasselbe Bild vor Augen hat: den Tod seiner geliebten Frau … »Fans von Serienkiller-Büchern und der TV-Show ›Criminal Minds‹ werden diesen Thriller lieben.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Blutträume« von New-York-Times-Bestsellerautorin Kay Hooper ist der erste Band ihrer actiongeladenen Blood-Trilogie. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn Monster dich in deinen Träumen verfolgen – und im wahren Leben… Auf den ersten Blick würde niemand vermuten, welche schwere Bürde auf der jungen Dani lastet: Sie kann in verstörenden Visionen die Zukunft sehen. Das macht sie zur perfekten Rekrutin für die geheime FBI-Einheit des Special Agents Noah Bishop, der jene Bedrohungen jagt, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen. Aber wird Dani wirklich in der Lage sein, einen rätselhaften Killer zu finden, den scheinbar nichts und niemand stoppen kann? Und wie soll sie Bishop sagen, dass sie dabei immer wieder dasselbe Bild vor Augen hat: den Tod seiner geliebten Frau …
»Fans von Serienkiller-Büchern und der TV-Show ›Criminal Minds‹ werden diesen Thriller lieben.« Booklist
Über die Autorin:
Kay Hooper, geboren 1958 in Kalifornien, wuchs in North Carolina auf und studierte später Literaturgeschichte. Noch während sie an der Universität war, begann sie zu schreiben. Nach ersten Erfolgen als Autorin von Liebesromanen entdeckte sie das Spannungsgenre für sich und eroberte unter anderem mit ihren paranormalen Thrillern über die geheime FBI-Einheit des Agenten Noah Bishop immer wieder die Bestsellerliste der New York Times. Neben dem Schreiben engagiert sich Kay Hooper für den Tierschutz.
Mehr Informationen über die Autorin finden sich auf ihrer Website: www.kayhooper.com
Bei dotbooks veröffentlichte Kay Hooper die Blood-Trilogie mit den Einzelbänden »Blutträume«, »Blutsünden« und »Blutfesseln«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Blood Dreams« bei Bantam Dell, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Kay Hooper
This translation is published by arrangement with Bantam Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2013 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung verschiedener Bildmotive von shutterstock/Print Net, lumyai I sweet, Marben, KPPWC
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-98690-009-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Blutträume« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kay Hooper
Blutträume
Die Blood-Trilogie: Noah Bishop & HAVEN 1Thriller
Aus dem Amerikanischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Prolog
Der wahr gewordene Albtraum, dachte Dani.
Die Vision.
Blutgeruch drehte ihr den Magen um, dichter beißender Rauch brannte ihr in den Augen, und was so lange Zeit eine verschwommene, traumartige Erinnerung gewesen war, wurde nun zu greller, erstickender Realität. Einen Augenblick lang war sie wie gelähmt.
Alles wurde wahr.
Trotz allem, was sie getan hatte, allem, was sie zu tun versucht hatte, trotz aller Warnungen war wieder alles …
»Dani?« Wie von ungefähr tauchte Hollis neben ihr auf, die Waffe gezogen, die blauen Augen durchdringend, obwohl sie gegen den Rauch zusammengekniffen waren. »Wo ist es?«
»Ich ‒ ich kann nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich…«
»Dani, du bist alles, was wir haben. Du bist alles, was sie haben. Ist dir das klar?«
Dani rang verzweifelt um Kraft, auch wenn sie sich ganz und gar nicht sicher war, diese Kraft zu besitzen, und erwiderte: »Hätte doch nur jemand auf mich gehört, als es darauf ankam!«
»Hör auf, zurückzublicken. Das hat keinen Sinn. Nur das Jetzt zählt. In welche Richtung, Dani?«
So schwer es ihr auch fiel, musste Dani sich zwingen, sich auf den Blutgeruch zu konzentrieren, den keiner der anderen riechen konnte, wie sie wusste. Eine Blutspur, mehr hatten sie nicht. Sie musste würgen, dann zeigte sie nach vorne. »Da entlang. Nach hinten. Aber …«
»Aber was?«
»Nach unten. Tiefer. Da ist ein Untergeschoss.« Treppen. Sie erinnerte sich an eine Treppe. Stufen, die sie hinabgegangen war. Hinab in die Hölle.
»Ist auf den Plänen aber nicht verzeichnet.«
»Ich weiß.«
»Ziemlich ungünstige Stelle, um in einem brennenden Gebäude eingeschlossen zu sein«, stellte Hollis fest. »Das Dach könnte über uns einstürzen. Ohne Weiteres.«
Bishop tauchte ebenso unvermittelt aus dem Rauch auf wie zuvor Hollis, die Waffe in der Hand, mit versteinerter Miene und gequältem Blick. »Wir müssen uns beeilen.«
»Ja«, antwortete Hollis. »Ist uns klar. Brennendes Gebäude. Wahnsinniger Mörder. Das Gute dem Bösen stark unterlegen. Verfahrene Situation.« Wortwahl und Ton waren flapsig, doch der Blick, mit dem sie ihn ansah, war angespannt und prüfend.
»Du hast ›mögliches Opfer in der Gewalt eines wahnsinnigen Mörders‹ vergessen«, ergänzte ihr Boss in nüchternem Ton.
»Niemals. Dani, hast du den Keller gesehen oder erahnst du ihn?«
»Die Treppe. Ich hab sie gesehen.« Das Gewicht auf ihren Schultern fühlte sich an, als lastete die ganze Welt auf ihr. Also war es vielleicht das, was sie so niederdrückte. Oder … »Und jetzt spüre ich … Er ist noch tiefer. Er ist unterhalb von uns.
»Dann suchen wir nach einer Treppe.«
Dani musste husten. Sie versuchte nachzudenken, sich zu erinnern. Doch erinnerte Träume waren etwas so Vages, nicht Greifbares. Sogar Visionsträume waren das manchmal, und sie konnte sich einfach nicht sicher sein, dass ihre Erinnerungen korrekt waren. Da ihr nur allzu bewusst war, dass kostbare Zeit verstrich, sah sie auf ihre Armbanduhr, dieses klobige digitale Ding, das ihr anzeigte, dass es 14 Uhr 47 am Dienstag, dem 28. Oktober war.
Seltsam. Sie trug nie eine Uhr. Wieso also jetzt? Und warum eine, die so … fremdartig an ihrem schlanken Handgelenk wirkte?
»Dani?«
Sie schüttelte die momentane Verwirrung ab. »Die Treppe. Nicht da, wo man sie vermuten würde«, brachte sie schließlich heraus und hustete erneut. »Sie ist in einem kleinen Raum oder einem Büro. So was in der Art. Kein Flur. Flure …« Vor ihr blitzten endlose, gesichtslose Korridore auf, hell erleuchtet…
»Was denn?«
Das Bild vor ihrem inneren Auge verschwand so schnell, wie es aufgetaucht war, und Dani tat es als unwichtig ab, da es durch eine absolute Gewissheit ersetzt wurde. »Mist. Der Keller ist geteilt. Durch eine massive Wand. Zwei große Räume. Zugänglich vom Erdgeschoss aus über zwei verschiedene Treppen, eine an jeder Seite des Gebäudes, im hinteren Teil.«
»Was ist das denn für ein hirnrissiger Bauplan?«, beschwerte sich Hollis.
»Falls wir hier lebend herauskommen, kannst du ja den Architekten fragen.« Der Blutgeruch war fast überwältigend, und Dani bekam Kopfschmerzen. Sehr starke. Flure. Nein, keine Flure, zwei getrennte Räume, unterschiedliche Seiten … Nie zuvor war sie ohne Pause derart an ihre Grenzen gegangen, und vor allem nicht mit solcher Intensität.
Dann fragte Bishop: »Sie wissen nicht, auf welcher Seite sie sind?«
»Nein. Tut mir leid.« Ihr war, als würde sie sich ständig bei diesem Mann entschuldigen, seit sie ihn kannte. Zum Teufel, das tat sie ja auch.
Hollis runzelte die Stirn. An Bishop gewandt, sagte sie: »Na toll. Wunderbar. Du bist paragnostisch blind, der Sturm hat alle meine Sinne verwirrt, und wir sind in einem riesigen, brennenden Gebäude ohne einen verdammten Grundriss.«
»Deswegen ist Dani ja hier.« Seine bleichen, wachsamen Augen waren auf ihr Gesicht gerichtet.
Dani kam sich absolut unzulänglich vor. »Ich ‒ ich weiß nicht … Ich weiß nur, dass er irgendwo da unten ist.«
»Und Miranda?«
Der Name versetzte ihr einen seltsamen kleinen Schock, und einen Herzschlag lang hatte sie das wirre Gefühl, dass etwas nicht stimmte, nicht zusammenpasste. Doch sie hatte eine Antwort für ihn. Gewissermaßen. »Sie ist nicht ‒ tot. Noch nicht. Sie ist der Köder, das wissen Sie. Sie war schon immer der Köder, um Sie anzulocken.«
»Und Sie«, ergänzte Bishop.
Darüber wollte Dani nicht nachdenken. Brachte es aus Gründen, die sie nicht erklären konnte, auch nicht fertig. »Wir müssen gehen. Sofort. Er wird nicht warten, diesmal nicht.« Und er ist nicht der Einzige.
Das Gespräch hatte nur ein paar Minuten gedauert, dennoch war der Rauch dichter geworden, das Knistern des Feuers lauter, die Hitze noch intensiver.
Voll Bitterkeit stellte Hollis fest: »Wir richten uns nach seinem Zeitplan, wie früher schon, wie immer, wir werden mitgeschleppt, ohne Gelegenheit zu haben, innezuhalten und nachzudenken.«
Bishop machte kehrt und ging in Richtung der südlichen Ecke des Gebäudes. »Ich übernehme diese Seite. Ihr zwei geht zur östlichen Ecke.«
Dani überlegte, ob auch er sich vom Instinkt leiten ließ, fragte Hollis jedoch nur: »Auch wenn er die Gelegenheit hätte, würde er sie nicht ergreifen, oder? Innezuhalten und nachzudenken, meine ich.«
»Falls das hieße, eine Minute auf dem Weg zu Miranda zu verlieren? Nie im Leben. Das allein würde schon reichen, aber er gibt sich obendrein auch noch die Schuld an diesem Schlamassel.«
»Er konnte nicht wissen …«
»Doch. Konnte er. Hat er vielleicht sogar. Deshalb glaubt er ja, es sei seine Schuld. Komm, gehen wir.«
Dani folgte ihr, doch sie konnte sich die Frage nicht verkneifen: »Glaubst du, dass es seine Schuld ist?«
Hollis blieb kurz stehen, sah über die Schulter zurück, und ihr Blick war hart und blank. »Ja. Glaube ich. Er hat einmal zu oft Gott gespielt. Und wir zahlen den Preis für seine Überheblichkeit.«
Dani folgte der anderen Frau, und ihre Kehle war wie zugeschnürt, obwohl der Rauch im hinteren Teil des Gebäudes nicht ganz so dicht war. Sehr schnell fanden sie in einem Raum, der einst ein kleines Büro gewesen sein könnte, eine Tür, die sich leicht und geräuschlos zu einem Treppenhaus öffnen ließ.
Das Treppenhaus war beleuchtet.
»Bingo«, flüsterte Hollis.
Dani hätte lieber gewartet, bis Bishop die andere Seite des Gebäudes erkundet hatte, doch ihr Instinkt und die Hitzewogen in ihrem Rücken sagten ihr, dass sie einfach keine Zeit dazu hatten.
Hollis packte ihre Waffe mit beiden Händen und warf Dani einen raschen Blick zu. »Bereit?«
Dani verschwendete keine Energie darauf, sich zu fragen, wie auch nur irgendjemand auf dieser Welt für so etwas bereit sein konnte. Stattdessen konzentrierte sie sich auf die einzige Waffe, die ihr zur Verfügung stand ‒ die in ihrem schmerzgeplagten Kopf ‒, und nickte.
Hollis hatte nur einen Schritt gemacht, als hinter ihnen ein donnerndes Getöse losbrach und eine fast unerträgliche Hitzewoge drohte, sie in das Treppenhaus zu schleudern.
Das Dach stürzte ein.
Sie sahen sich an, und dann sagte Hollis emotionslos: »Mach die Tür hinter uns zu.«
Dani nahm all ihren Mut zusammen, und wenn ihre Antwort nicht so abgeklärt klang wie die der anderen Frau, war sie zumindest ruhig.
»Okay«, sagte sie, schloss die Tür hinter sich, und sie begannen den Abstieg in die Hölle.
Kapitel 1
Dienstag, 7. Oktober
»Du hattest letzte Nacht wieder diesen Traum, nicht wahr?«
Dani hielt den Blick so lange auf ihre Kaffeetasse gesenkt, bis das Schweigen unerträglich wurde und sie zu ihrer Schwester aufsah. »Ja. Hatte ich.«
Paris setzte sich ihr gegenüber an den Tisch, die eigene Kaffeetasse in den Händen. »Denselben wie zuvor?«
»So ziemlich.«
»Also nicht denselben. Was war anders?«
Darauf hätte Dani lieber nicht geantwortet, doch sie kannte ihre Schwester zu gut, um sich gegen etwas Unvermeidliches zur Wehr zu setzen. Eine entschlossene Paris war so wenig aufzuhalten wie die Flut. »Er enthielt eine Zeitangabe. Vierzehn Uhr siebenundvierzig am achtundzwanzigsten Oktober.«
Paris drehte sich zum Wandkalender um, der mit South-Park-Magnetfiguren am Kühlschrank befestigt war. »Der achtundzwanzigste? Dieses Jahr?«
»Ja.«
»Das ist heute in drei Wochen.«
»Ist mir auch schon aufgefallen.«
»Dieselben Personen?«
Dani nickte. »Dieselben Leute. Dieselbe Unterhaltung. Dasselbe brennende Lagerhaus. Dasselbe hoffnungslose Gefühl.«
»Bis auf die Zeitangabe war alles genau gleich?«
»Es ist nie genau gleich, das weißt du. Manches davon hat wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung, und ich habe keine Ahnung, was wörtlich zu nehmen ist und was nicht. Ich weiß nur, was ich sehe, und es gibt immer kleine, manchmal seltsame Änderungen. Hin und wieder ein anderes Wort, eine andere Geste. Ich glaube, die Waffe von Hollis war nicht dieselbe wie zuvor. Und Bishop trug diesmal eine schwarze Lederjacke. Letztes Mal war es eine dunkle Windjacke.«
»Aber es sind immer dieselben Leute. Diese zwei Menschen sind immer Teil des Traumes?«
»Immer.«
»Leute, die du nicht kennst.«
»Leute, die ich nicht kenne ‒ bisher.« Einen Moment lang blickte Dani stirnrunzelnd in ihren Kaffee, schüttelte den Kopf und erwiderte dann den unverwandten Blick ihrer Schwester. »Im Traum habe ich das Gefühl, die beiden sehr gut zu kennen. Ich verstehe sie auf eine Art und Weise, die schwer zu erklären ist.«
»Vielleicht weil auch sie Paragnosten sind.«
Dani zog die Schultern hoch. »Mag sein.«
»Und es endete …«
»Wie es immer endet. Daran ändert sich nie etwas. Ich schließe die Tür hinter uns, und wir gehen die Treppe hinunter. Ich weiß, dass das Dach einstürzt. Ich weiß, dass wir nicht auf demselben Weg hinauskommen können, auf dem wir hereinkamen. Ich weiß, etwas Fürchterliches und Böses wartet in diesem Keller auf uns, und dass es eine Falle ist.«
»Aber du gehst trotzdem da hinunter.«
»Mir scheint keine andere Wahl zu bleiben.«
»Oder du hast deine Wahl vielleicht schon getroffen, bevor du das Gebäude überhaupt betreten hast«, erwiderte Paris. »Vielleicht triffst du die Wahl gerade jetzt. Das Datum. Wo hast du es gesehen?«
»Auf einer Armbanduhr.«
»An deinem Handgelenk? Keine von uns beiden kann eine Uhr tragen.«
Noch immer widerstrebend ergänzte Dani: »Und es war nicht die Art von Uhr, die ich tragen würde, auch wenn ich es könnte.«
»Was denn für eine?«
»Sie sah … militärisch aus. Groß, schwarz, digital. Jede Menge Knöpfe, verschiedene Displays. Sah aus, als könnte sie die Zeit in Peking angeben und dazu noch Längen- und Breitengrad. Was weiß ich, vielleicht könnte sie Sanskrit ins Englische übersetzen.«
»Was könnte das bedeuten?«
Dani seufzte. »Mit einem Jahr Psychologie im Kopf denkst du natürlich, dass alles etwas bedeuten muss.«
»Wenn es um deine Träume geht, ja, da hat alles eine Bedeutung. Das wissen wir beide. Komm schon, Dani. Wie oft hast du jetzt denselben Traum gehabt?«
»Ein paar Mal.«
»Ein halbes Dutzend Mal, soweit ich weiß ‒ und ich wette, du hast mir nicht jedes Mal davon erzählt.«
»Ach?«
»Dani.«
»Schau, es spielt keine Rolle, wie oft ich diesen Traum hatte. Es spielt keine Rolle, weil es keine Vorahnung ist.«
»Netter Versuch.«
Dani stand auf und brachte ihre Kaffeetasse zum Spülbecken.
»Tja, war schließlich nicht dein Traum.«
Paris drehte sich auf dem Stuhl zu ihr um, blieb aber sitzen. »Dani, bist du deshalb hierher nach Venture gekommen? Nicht, damit ich mich während dieser unschönen Scheidungsgeschichte an deiner Schulter ausweinen kann, sondern wegen dieses Traums?«
»Ich weiß gar nicht, wovon du redest.«
»Und ob du das weißt.«
»Paris …«
»Ich will die Wahrheit wissen. Zwing mich nicht, sie selbst herauszufinden.«
Dani lehnte sich mit dem Rücken an die Arbeitsplatte und musste sich erneut eingestehen, dass es ihr nie gelingen würde, ihrer Schwester die Wahrheit zu verheimlichen, jedenfalls nicht lange.
Zum Teil lag es natürlich an diesem Zwillingsphänomen.
Paris trug ihr leuchtend kupferrotes Haar in letzter Zeit ein bisschen kürzer ‒ sie nannte es ihre Scheidungswiedergeburt und sie war etwas zu dünn, doch davon abgesehen hatte Dani das Gefühl, in einen Spiegel zu schauen, wenn sie ihre Schwester ansah. Dani hatte sich längst daran gewöhnt und sah darin sogar einen Vorteil. Das ausdrucksvolle Mienenspiel auf Paris’ Gesicht zu beobachten hatte sie gelehrt, ihre eigenen Emotionen zu verbergen.
Zumindest vor allen anderen, außer vor Paris.
»Wir haben es uns versprochen«, erinnerte ihre Schwester sie. »Nicht in das Privatleben, die Gedanken und Gefühle der anderen einzudringen. Und es ist uns recht gut gelungen, diese Tür geschlossen zu halten. Aber ich weiß noch, wie man sie öffnet, Dani. Wir wissen es beide.«
Für eineiige Zwillinge war es natürlich nichts Außergewöhnliches, eine besondere Verbindung zueinander zu haben, doch die Verbindung zwischen Dani und Paris war, wie eine Freundin aus Kindertagen es ausdrückte, »etwas unheimlich«. Es handelte sich um mehr als Nähe, mehr, als die Sätze der anderen zu vervollständigen, sich gleich zu kleiden oder um das beliebte Zwillingsspiel, in die Rolle der anderen zu schlüpfen.
Dani und Paris hatten sich, vor allem während ihrer frühen Kindheit, eher als zwei Hälften einer Person gefühlt, statt als eigenständige Wesen. Paris war die von Natur aus Heiterere, lachte gerne und machte Späße, war stets gut gelaunt, offen und arglos, die Extrovertierte. Dani war die Ruhigere, beobachtend und still, fast verschlossen. Sie geriet nicht leicht in Wut, fasste aber auch nicht schnell Vertrauen und war wesentlich introvertierter als ihre Schwester.
Tag und Nacht, hatte ihr Vater sie genannt ‒ und er war nicht der Einzige, der das, was er sah, falsch deutete.
Dani und Paris war es auch lieber so, und sie vertrauten sich nur gegenseitig die Wahrheit an. Früh schon lernten sie, ihre mentale und emotionale Verbindung zu verbergen oder zu verschleiern, und später fanden sie heraus, wie sie diese »Tür« einrichten konnten, von der Paris gesprochen hatte.
Dadurch bekamen sie die Privatsphäre, mit ihren Gedanken für sich allein zu sein, etwas, das die meisten nie zu schätzen lernten. Das hatte den Zwillingen schließlich die Möglichkeit eröffnet, ein Leben als eigenständige Wesen zu führen und nicht nur als zwei Hälften eines Ganzen.
Allerdings vermisste Dani diese frühere Nähe. Sie war zwar nur eine Tür weit entfernt ‒ doch die war in letzter Zeit meist geschlossen geblieben, da die Zwillinge inzwischen Anfang dreißig waren und sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen hatten.
Dani nickte bedächtig. »Okay. Das mit dem Traum begann vor ein paar Monaten, im Sommer. Als die Tochter des Senators von diesem Serienmörder in Boston ermordet wurde.«
»Den sie noch immer nicht gefasst haben.«
»Ja.«
Paris runzelte die Stirn. »Ich sehe da keinen Zusammenhang.«
»Ich dachte ja auch, dass es keinen gäbe. Keinerlei Verbindung zwischen mir und diesen Morden, nicht zu den Opfern und zu keinem der ermittelnden Beamten. Und ich habe doch nie Visionen, die nicht mit mir oder den Menschen in meinem Leben verknüpft wären. Deshalb hielt ich den Traum anfangs auch nicht für eine Vorahnung.«
Ohne auf dieses Eingeständnis weiter einzugehen, sagte ihre Schwester: »Bis sich etwas änderte. Was?«
»Ich habe Nachrichten gesehen. Der FBI-Agent, der die Ermittlungen in Boston leitet, ist der Mann in meinem Traum. Bishop.«
»Ich begreife immer noch nicht.«
»Seine Frau ist Miranda Bishop.«
Paris richtete sich mit einem Ruck auf. »Ach, du meine Güte. Sie war es doch, die uns von Haven erzählt hat.«
»Tja.« Das war in Atlanta gewesen, vor fast eineinhalb Jahren. Paris und ihr Mann waren nur noch einen Krach weit von der endgültigen Trennung entfernt gewesen, und Dani hatte gerade ihren Job gekündigt und noch nichts Neues. Beide waren nicht daran interessiert, FBI-Agentin zu werden, und wollten auch nicht der Special Crimes Unit beitreten, von der ihnen Miranda Bishop erzählt hatte. Sie wollten keine Waffe tragen, wollten keine Polizistinnen sein. Aber für Haven, eine privat geführte, zivile Organisation von Ermittlern mit einzigartigen Fähigkeiten zu arbeiten ‒ das hatte interessant geklungen.
Gedankenverloren sagte Paris: »Das war das Tüpfelchen auf dem i für Danny, wie du weißt. Als ich meine Fähigkeiten nutzen wollte, als ich einen Job bekam, bei dem sie wirklich gefragt waren. Ich habe doch gesehen, wie sauer er war. Wie konnte ich mit jemandem zusammenbleiben, der eine solche Einstellung zu einem Teil von mir hat?«
»Ja, ich weiß. Kenne ich. Die meisten Typen, die ich kennengelernt habe, konnten nicht mit der Tatsache umgehen, dass ich ein eineiiger Zwilling bin, und dafür, Dinge zu träumen, die tatsächlich wahr werden, bekommt man auch keinen Spaßbonus.«
»Vor allem, wenn du etwas über sie geträumt hast?«
»Ach, diese Gefahr läuft jeder, der mir nahe kommt. Und nachdem ich nie von Sonnenschein und kleinen Hündchen träume, waren die meisten Männer in meinem Leben schon wieder weg, bevor sie etwas über ihr eigenes verhängnisvolles Schicksal zu hören bekamen.«
»Einen gab es, der ist nicht weggelaufen.«
Dani runzelte die Stirn. »Ja, schon. Wäre er aber. Früher oder später.«
»Weißt du das, oder rätst du bloß?«
»Können wir jetzt bitte wieder auf den Traum zurückkommen?«
Als Jugendliche hatten sie diese feierliche Übereinkunft getroffen, sich aus dem Liebesleben der anderen herauszuhalten, und sich seitdem streng daran gehalten. Und da Paris dank ihrer eigenen problematischen Ehe hypersensibilisiert war, konnte sie kaum weiter in Dani dringen. »Okay. Zurück zu deinem Traum ‒ würdest du sagen, dass er etwas mit diesem Serienmörder zu tun hat?«
»Ich glaube schon.«
»Wieso?«
»Ist so ein Gefühl.«
Paris sah sie unverwandt an.
»Und sonst?«
Dani wollte eigentlich nicht antworten, tat es dann aber doch. »Was auch immer sich da unten in diesem Keller befand, war ‒ ist ‒ böse. Auf eine Art böse, wie ich sie noch nie zuvor gespürt habe. Etwas, was mir wahnsinnige Angst macht. Und eines ist in jeder Variante meines Traums immer gleich geblieben ‒ die Tatsache, dass es Miranda hat.«
»Sie ist eine Geisel?«
»Sie ist der Köder.«
»Sie war mein einziges Kind.«
»Ja. Ich weiß.«
Senator Abe LeMott hob den Blick von der gerahmten Fotografie, die er betrachtet hatte, und richtete seine Aufmerksamkeit auf das Gesicht ihm gegenüber am Schreibtisch, das ihm während der letzten Monate beinahe so vertraut geworden war wie das seiner Tochter Annie.
Special Agent Noah Bishop, Chef der Special Crimes Unit des FBI, besaß allerdings auch ein Gesicht, das man nicht so leicht vergaß, fand LeMott, denn es war ein ungewöhnlich schönes Gesicht. Doch mehr noch, weil den bleichen, silbergrauen Augen nichts zu entgehen schien, und weil sich eine feine, hässlich gezackte Narbe als stummer Zeuge einer nicht gewaltfreien Vergangenheit über die linke Wange des Mannes zog. Dazu kam noch eine strahlend weiße Strähne an der linken Schläfe, in eklatantem Gegensatz zum restlichen rabenschwarzen Haar. Das alles ergab einen Mann, den man nicht so leicht übersah und noch weniger leicht vergaß.
»Sie und Ihre Frau haben keine Kinder.« LeMott stellte das Foto behutsam zurück an seinen angestammten Platz rechts neben der Schreibunterlage.
»Nein.«
Der Senator zwang sich zu einem Lächeln. »Und doch haben Sie welche. Brüder und Schwestern zumindest. Eine Familie. Ihre Einheit. Ihr Team.«
Bishop nickte.
»Haben Sie je einen von ihnen verloren?«
»Nein. Ein paarmal war es knapp, aber nein.«
Noch nicht.
Das Unausgesprochene hing zwischen ihnen, und LeMott nickte ernst. »Kann nicht ausbleiben. Bei der Arbeit, die Sie leisten, dem Bösen, dem Sie ins Auge blicken. Früher oder später wird … einem ein zu hoher Preis dafür abverlangt. Das ist immer so.«
Da Bishop darauf nicht eingehen wollte, antwortete er: »Wie ich Ihnen schon sagte, wir haben die schwache Spur, die wir hatten, bei Atlanta verloren. Ob er in der Stadt ist oder nur in der Nähe, jedenfalls ist das die Gegend. Doch solange er sich nicht bemerkbar macht …«
»Bis er wieder mordet, meinen Sie.«
»Er ist abgetaucht und wird wahrscheinlich nicht wieder auftauchen, bis er sich weniger bedroht fühlt. Weniger gejagt. Oder bis ihn seine Bedürfnisse trotzdem zum Handeln zwingen.«
»Mittlerweile ist es zu etwas Persönlichem geworden, nicht wahr? Zwischen Ihnen und ihm. Der Jäger und der Gejagte.«
»Ich bin Polizist. Mein Job ist es, Abschaum wie ihn zu jagen.«
LeMott schüttelte den Kopf. »Nein, für Sie war es immer schon mehr. Ich habe es Ihnen angesehen. Herrje, jeder könnte es sehen. Ich wette, er wusste es, wusste, dass Sie ihn jagen, und wusste, dass Sie in seine Gedanken eindringen würden.«
»Leider nicht tief genug.« In Bishops Stimme schwang Bitterkeit mit. »Dennoch ist es ihm gelungen, sich Annie zu holen, es ist ihm gelungen, sich noch mindestens elf weitere junge Frauen zu holen, und ich weiß nur, dass damit noch nicht Schluss ist.«
»Seitdem sind Monate vergangen. Kann es sein, dass er deshalb zögert, abwartet, bis der Sturm sich legt? Hat er deshalb Boston verlassen?«
»Ich nehme an, das trifft zumindest teilweise zu. Ihm ging es nicht um das Rampenlicht, um Aufmerksamkeit. Er wollte nie die Polizei dazu bringen, sich mit seinen Fähigkeiten und seinem Willen zu messen. Diese Art Mörder ist er nicht, darum geht es ihm nicht.«
»Worum geht es ihm dann?«
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen darauf eine halbwegs plausible Antwort geben, doch Sie wissen, dass ich das nicht kann. Das ist das Vertrackte bei der Jagd auf Serienmörder: An die Fakten kommen wir erst, wenn wir sie gefasst haben. Bis dahin können wir nur rätseln und raten. Außer Bruchstücken haben wir nichts, und davon auch noch viel zu wenige. Trotz all dieser Leichen hat er uns nicht viel hinterlassen, womit wir etwas anfangen können.«
»Aber Sie wissen doch, dass Annie ein Fehlgriff war, oder?«
Bishop zögerte und nickte dann. »Ich glaube, das war sie. Er sucht nach einem bestimmten Typ, einem bestimmten Aussehen, und da passte Annie so wie all die anderen auch. Wollte er mehr als das Aussehen, wollte er noch anderes über seine Opfer wissen, weil ihm wichtig ist, sie nicht nur oberflächlich zu kennen, dann hätte er gewusst, wer sie war, hätte das große Risiko erkannt, das er mit ihr einging. Die Art, wie sie lebte, ruhig und zurückgezogen wie viele andere junge Frauen in Boston, das so alltägliche Erscheinungsbild ihres Lebens, gab ihm keinen Hinweis darauf, wie unmittelbar und heftig die Reaktion auf ihr Verschwinden sein würde.«
»Hat er deshalb aufgehört, nach ihr?«
Bishop war sich nur allzu bewusst, dass der trauernde Vater, mit dem er sprach, viele Jahre Staatsanwalt in einer Großstadt gewesen war und somit die Gräuel, zu denen Menschen fähig sind, genauso gut kannte wie Bishop auch; dennoch war es nicht einfach, den Vater außer Acht zu lassen und nur den Berufskollegen zu sehen, um emotionslos über diese Dinge sprechen zu können.
Ich habe nicht nur ein Profil dieses Mörders erstellt, Senator. Auch Sie habe ich durchleuchtet. Und ich fürchte sehr, dass Sie demnächst in dieser Ermittlung eine Rolle spielen werden.
Eine tödliche.
»Bishop? Hat er deshalb aufgehört?«
»Ich denke, das war zum Teil der Grund, ja. Zu viele Polizisten, zu viele Medien, zu viel Aufmerksamkeit. Es störte seine Pläne, seine Jagdmöglichkeiten. Versetzte seine beabsichtigte Beute zu sehr in Alarmzustand, machte sie zu argwöhnisch. Und es bedeutete eine Ablenkung für ihn, die er sich nicht leisten konnte, vor allem in diesem Stadium. Er musste in der Lage sein, sich auf das, was er tat, konzentrieren zu können, denn er übte, wenn sie verstehen, was ich meine. Er überprüfte und perfektionierte sein Ritual. Daher …«
Als Bishop innehielt, vervollständigte LeMott mit stoischer Ruhe dessen Gedankengang. »Daher war kein Mord dem anderen gleich, nicht die Waffen, nicht der Grad an Brutalität. Er experimentierte. Versuchte herauszufinden, was ihm die größte … Befriedigung verschaffen würde.«
Sie müssen das anscheinend wieder und wieder hören, nicht wahr? Als würden Sie an einem Schorf kratzen, um den Schmerz zu spüren, weil das alles ist, was Sie noch haben. Dieser elende, jämmerliche Schmerz.
»Ja.«
»Hat er es schon herausgefunden?«
»Sie wissen, dass ich das nicht beantworten kann. Nicht genug Fakten.«
»Mir würde schon eine wohlbegründete Vermutung genügen. Von Ihnen.«
Weil Sie wissen., dass es viel mehr als eine Vermutung wäre. Und mir ist jetzt klar, dass es ein Fehler war, Ihnen zu erzählen, was an der SCU tatsächlich so besonders ist.
Bishop wusste nur zu gut, wie gänzlich sinnlos Selbstvorwürfe dieser Art waren. Der Fehler war geschehen, nun musste er mit den negativen Konsequenzen zurechtkommen. Er atmete ein und langsam wieder aus. »Meine Vermutung, meine Überzeugung ist, dass ihn die Reaktion auf Annies Entführung und Ermordung aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Gewaltig. Bis dahin hat er nahezu blindlings dem Zwang nachgegeben, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ein Dutzend Opfer in weniger als einem Monat zu ermorden heißt, irgendetwas hat diesen Amoklauf ausgelöst, etwas zutiefst Traumatisches, und was es auch immer war, der Auslöser hat entweder den Menschen ausgelöscht, der er bis dahin war, oder etwas schon seit Langem in ihm Schlummerndes freigesetzt.«
»Etwas Böses.«
»Daran zweifle ich nicht im Geringsten.«
LeMott runzelte die Stirn. »Doch sogar das Böse besitzt einen Selbsterhaltungstrieb. Das unerwartete Rampenlicht, in dem er nach dem Mord an Annie stand, hat diesen Teil in ihm wachgerüttelt. Oder die Kontrolle übernehmen lassen.«
»Ja.«
»Und daher hat er sich zurückgezogen, in ein sicheres Versteck.«
»Vorübergehend. Um sich zu sammeln, nachzudenken, seine Möglichkeiten zu überdenken. Vielleicht auch, um einen Weg zu finden, die Entwicklung seiner Rituale dieser neuen Dynamik anzupassen.«
»Weil er jetzt weiß, dass er gejagt wird.«
Bishop nickte.
LeMott hatte einen Crashkurs über die Psychologie von Serienmördern absolviert, hatte sich trotz Bishops Warnung in die Wissenschaft des Erstellens eines Persönlichkeitsprofils eingearbeitet und runzelte nun die Stirn noch mehr.
»Auch wenn er seine Grenzen austesten oder nur herausfinden wollte, was nötig ist, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, ist es doch ungewöhnlich, in so kurzer Zeit so viele Menschen zu töten und dann einfach aufzuhören. Wie lange kann er dem Verlangen widerstehen, das ihn treibt?«
»Nicht lange, hätte ich gesagt.«
»Doch es war länger als zwei Monate.«
Bishop schwieg.
»Aber vielleicht war es gar nicht so«, fuhr LeMott zögernd fort. »Vielleicht ist er nicht nur untergetaucht. Vielleicht hat er sich darauf eingerichtet, sowohl der Gejagte als auch der Jäger zu sein, und seine Vorgehensweise bereits geändert. Ist eine Weile von der Bildfläche verschwunden, das ja, hat die Gegend verlassen und mordet nun anderswo. Mordet anders als zuvor. Hat sein Ritual geändert. Ist es das, was Sie glauben?«
Mist.
Bishop wählte seine Worte mit Bedacht. »Die meisten Serienmörder waren Monate, sogar Jahre aktiv, bevor Gesetzeshüter sie als solche identifizierten, daher gab es im Laufe der Zeit mehr Anhaltspunkte, um aktive und nicht aktive Zyklen, Muster und Phasen von Verhaltensweisen aufzulisten. Das fehlt uns bei diesem Bastard. Noch. Sein Vorgehen war zu schnell. Er taucht auf, schlachtet ab und verschwindet wieder in der Hölle, aus der er gekrochen ist. Wir hatten keine Zeit, ihn richtig zu beobachten. Das Einzige, was ihn als Serienmörder auswies, war die unbestreitbare Tatsache, dass die jungen Frauen, die er umbrachte, Schwestern hätten sein können, so ähnlich sahen sie sich.
Das war alles, was wir hatten und noch immer haben: dass sein Ziel Frauen sind, kleiner als der Durchschnitt, zierlich, beinahe dürr, mit großen Augen und kurzen dunklen Haaren.«
»Kindlich«, stellte LeMott fest, ohne dass seine Stimme allzu sehr zitterte.
Bishop nickte.
»Ich weiß, ich habe Sie das schon gefragt, aber …«
»Ob ich glaube, er könnte es nun auf Kinder abgesehen haben? Das offizielle Profil sagt, es wäre möglich. Ich halte es jedoch für unwahrscheinlich. Er tötet wieder und wieder die gleiche Frau, und das ist das Erlebnis, das er jedes Mal haben will. Egal, was er verändert, sie muss immer die Gleiche bleiben.«
LeMott zog die Stirn kraus. »Aber falls er dabei ist, sein Ritual zu ändern, oder es schon geändert hat, falls er weiß, dass er gejagt wird und so schlau ist, wie Sie meinen, dann muss ihm doch klar sein, nach welchen Gemeinsamkeiten die Polizei bei jedem Mord Ausschau halten wird. Er wird wissen, dass seine Vorgehensweise bekannt und im Computer jeder Polizeibehörde des Landes registriert ist. Können wir es uns weiterhin erlauben, davon auszugehen, dass seine Zielgruppe Frauen sind, die in das Opferschema passen?«
Der gelassene Gesichtsausdruck und der sachliche, professionelle Ton des Senators konnten Bishop nicht sonderlich überzeugen, im Gegenteil, sie beunruhigten ihn. Wie bei Nitroglyzerin in einem Pappbecher konnte der Augenschein furchtbar trügen.
LeMott hatte jetzt schon ziemlich lange seine Gefühle unter Kontrolle gehalten, und Bishop war klar, dass sich der aufgestaute Druck früher oder später in einer gewaltigen Explosion Luft machen würde.
Ein trauernder Vater war schlimm genug. Ein trauernder Vater, der kaum noch etwas zu verlieren hatte, war schlimmer. Aber ein trauernder Vater, der ein mächtiger Senator der Vereinigten Staaten und ehemaliger Staatsanwalt war, mit dem Ruf, hart gegen Verbrecher vorzugehen, und dem unerschütterlichen Glauben, der Gerechtigkeit müsse Genüge getan werden, war etwas noch viel, viel Schlimmeres.
Bishop sagte jedoch nur: »Er kann nicht ändern, wer er ist, auch wenn er es noch so sehr will. Er wird es versuchen, klar.
Entweder versuchen, seine Triebe und Zwänge zu unterdrücken, oder auch nur, sie auf eine Weise zu befriedigen, die nicht ahnen lässt, wer er ist. Doch er wird sich selbst verraten, irgendwie. Das tun sie immer.«
»Zumindest Jäger, die wissen, wonach sie suchen müssen.«
»Das Problem besteht nicht darin, zu wissen, wonach wir Ausschau halten müssen, sondern in der bedauerlichen Tatsache, dass er erneut morden muss, um uns etwas zu liefern, was wir uns anschauen können.«
»Immer gesetzt den Fall, er hat nicht schon wieder getötet, und das auf eine so andere Art und Weise, dass der Mord durch das Raster fiel.« LeMott war von diesem Gedanken nicht abzubringen, das war klar.
»Das wäre natürlich eine Möglichkeit«, erwiderte Bishop. »Vielleicht sogar eine Wahrscheinlichkeit. Also lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob er erneut getötet hat, seit dem Mord an Ihrer Tochter.«
Falls er gehofft hatte, LeMott abzulenken, ihn auf Abstand zu bringen, ihn mit den vier letzten absichtlich gewählten Worten zu erschüttern, wurde Bishop enttäuscht, denn der Senator verzog keine Miene. Er zuckte nicht einmal mit der Wimper. Er griff nur wieder die Information auf, die Bishop ihm vorher schon gegeben hatte.
»Und dennoch wissen Sie, dass er sich nach Süden bewegt. Dass er in der Nähe von Atlanta ist.«
Mist.
»Und Sie wissen, wieso ich mir dessen sicher bin ‒ ohne echte Anhaltspunkte ‒, obwohl die vereinten Polizeikräfte Boston noch immer nach einer Spur von ihm durchkämmen.«
»Sind Sie das tatsächlich?«
»Mein Kopf sagt mir das, ja. Er ist nicht mehr in Boston. Er ist in der Nähe von Atlanta. Wahrscheinlich nicht in der Stadt selbst, obwohl sie wirklich groß genug wäre, dort unterzutauchen.«
»Sie haben jemand vor Ort?«
»Senator, ich habe Jahre darauf verwendet, ein Netzwerk aufzubauen, und es wächst ständig. Wir haben unsere Leute nahezu überall.«
»Menschen. Fehlbare Menschen.«
Bishop hörte die Bitterkeit in diesen Worten. »Ja, leider. Wir glauben, er befindet sich in dieser Gegend. Wir haben den Verdacht, er könnte wieder getötet haben. Aber wir haben keine Fakten, die den einen oder anderen Verdacht erhärten ‒ und die erkennbare Spur endet in Boston.«
»Wie können Sie so vieles wissen ‒ und doch nichts von Bedeutung?«
Bishop schwieg.
LeMott schüttelte den Kopf und verzog den Mund. Er blinzelte nach allzu langer Zeit zum ersten Mal, wandte sich sogar ab, wenn auch nur kurz. »Tut mir leid. Gott weiß, und ich auch, dass Sie mehr als Ihre ganze Energie und Zeit darauf verwendet haben, diesen Bastard zu finden und dingfest zu machen. Nur … helfen Sie mir zu begreifen, wie wir hier nur herumsitzen können und nichts tun, außer darauf zu warten, dass er wieder mordet.«
Erneut wählte Bishop seine Worte mit äußerstem Bedacht. »Offiziell gibt es sonst nichts, was ich tun könnte. Alle Beweise, die auf den Mörder hindeuten, haben wir hier in Boston gefunden. Alle Opfer, die laut unseren Erkenntnissen durch seine Hand gestorben sind, lebten und arbeiteten hier in Boston. Alle Hinweise und Spuren stammen aus Boston, und die Sondereinheit geht diesen Spuren noch immer nach, wahrscheinlich noch monatelang. Mein Team wurde angewiesen, in Boston zu bleiben und währenddessen mit der Sondereinheit zusammenzuarbeiten. Bis wir stichhaltige Anhaltspunkte haben, verwertbare Beweise, dass er anderswo aufgetaucht ist, bleibt unser Standort Boston.«
»Ich betrachte das als Verschwendung von Kräften der Bundesbehörde.«
»Offiziell spricht man vom Gegenteil. Die Stadt ist noch immer in Aufruhr, die nationale Presse ist nach wie vor in voller Stärke vertreten, und sämtliche Medien ‒ vom Fernsehen über Leitartikel der Zeitungen bis zu Internetblogs ‒ fordern täglich, dass mehr unternommen wird, um den Mörder festzusetzen, bevor noch eine junge Frau sein Ziel wird. Zudem sorgt der Umstand, dass sein letztes Opfer die Tochter eines Senators war, eindeutig dafür, dass dem Fall besondere Aufmerksamkeit zuteil wird und das Interesse nicht erlischt. Und das noch ziemlich lange.«
»Jobs stehen auf dem Spiel.«
»Ja.«
»Es gibt einen neuen Direktor«, fügte LeMott hinzu.
»Ja.« Bishops breite Schultern hoben und senkten sich in einem angedeuteten Zucken des Bedauerns. »Politik. Er wurde eingesetzt, um Verschiedenes beim FBI wieder in Ordnung zu bringen und das äußerst negative Bild zu verbessern, das in der Öffentlichkeit durch eine Reihe von unglücklichen Umständen entstanden ist. Top-Agenten von einer Ermittlung abzuziehen, auf die das ganze Land blickt, wäre von seinem Gesichtspunkt aus nicht der beste Schachzug.«
»Ich könnte …«
»Mir wäre lieber, wenn nicht. Dass wir auf Ihren Einfluss irgendwann angewiesen sind, ist gut möglich, ihn jedoch jetzt nützen, würde uns ‒ oder der Ermittlung ‒ sicher nicht helfen.«
LeMott nickte bedächtig. »In dieser Hinsicht muss ich mich ganz auf Ihr Urteilsvermögen verlassen.«
Ob es Ihnen gefällt oder nicht. »Danke.«
»Doch wieso sollte der Direktor etwas dagegen einzuwenden haben, ein paar Ihrer Leute durch weniger spezialisierte Agenten zu ersetzen?«
»Er sieht darin keinen großen Unterschied.«
»Ach. Das ist also der springende Punkt. Er glaubt nicht an paragnostische Fähigkeiten.«
»Nein. Tut er nicht.« Mit einem weiteren kleinen Schulterzucken fügte Bishop hinzu: »Wir haben schon mal eine Wachablösung überstanden. Wir werden es auch wieder überstehen. Unsere Erfolgsbilanz lässt sich nicht so leicht vom Tisch wischen, was auch immer der Direktor von unseren Methoden halten mag. Doch einstweilen …«
»Haben Sie Befehle zu befolgen.«
»Wenn ich will, dass die SCU weiter besteht, dann ja. Vorläufig. Zumindest offiziell.«
»Und inoffiziell?«
Trotz einer Vielzahl von Gründen, die dagegen sprachen, rang sich Bishop zu einer Antwort durch. »Inoffiziell gibt es Haven.«
Kapitel 2
Da die Klinge des Teppichmessers neu und scharf war, ließ er große Vorsicht walten, als er die Figur des Mädchens aus dem Foto schnitt.
Sie war hübsch.
Sie war immer hübsch.
Ihre Rundungen gefielen ihm. Das war auch einer der Gründe, warum er die Figuren mit so viel Sorgfalt aus den Fotos und Zeitungen schnitt, weil sein Messer dabei langsam ‒ ganz langsam ‒ ihre Formen liebkosen konnte.
Sogar ihr Gesicht schnitt er mit Bedacht aus, obwohl die Bögen von Nase, Kinn und Kiefer in seinem Inneren kaum eine Reaktion auslösten.
Ihre Kehle aber schon. Die zarte, sanfte Wölbung ihrer Brüste, diese sachte Andeutung von Weiblichkeit. Der leichte Schwung der Hüften. Dort verharrte sein Messer gerne.
Manchmal scannte er die Bilder in seinen Computer ein, um sie entsprechend seiner Fantasie bearbeiten zu können. Er konnte bekleidetes Fleisch durch nacktes ersetzen, konnte jede Art von Frisur in die jungenhaft dunkelhaarige abändern, die sie fast immer trug. Er konnte sie jede Pose einnehmen lassen, die ihm gefiel, und verrückte Sachen mit Farbe und Struktur anstellen. Er hatte sich Autopsiefotos besorgt und den Kopf der aufgebahrten Leichen, deren offengelegte Organe im klinisch kalten Licht glänzten, durch ihren ersetzt.
Doch all das, hatte er festgestellt, verschaffte ihm nicht genug Befriedigung.
Es war irgendwie … zu unpersönlich.
Vielleicht war das der Grund. Oder es war vielleicht etwas anderes.
Eines war zumindest klar ‒ der Computer war zwar ein nützliches Rechercheinstrument, hatte sich aber als nutzlos erwiesen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Doch die Fotos …
Noch ein Schnitt, und er hob sie behutsam heraus. Ein unbemerkt aufgenommenes Bild, wie sie gerade aus dem Drugstore kam, mit Einkaufstüten beladen, ihr Gesichtsausdruck konzentriert.
Der Tag war warm, obwohl schon Oktober war, und sie trug einen leichten Sommerrock, ein ärmelloses Oberteil und Sandalen.
Er nahm an, dass ihre Zehennägel lackiert waren. In kräftigem Rot, oder vielleicht leuchtendem Pink. Er war sich dessen fast sicher, auch wenn das Foto diese erfreuliche Vorstellung nicht bestätigte.
Einen Augenblick lang hielt er das ausgeschnittene Bild in der hohlen Hand, um sich daran zu erfreuen. Sein Daumen strich sanft über das glänzende Papier, fuhr den Schwung ihres Rockes nach und den der nackten Schenkel darunter.
Er betrachtete jedes Detail aufs Genaueste, prägte es sich ein.
Dann schloss er die Augen.
Und berührte sie in seinen Gedanken.
Weiche Haut. Warm. Beinahe summend vor Leben.
Die Klinge in seiner anderen Hand war kalt.
Seine Lippen öffneten sich, sein Atem wurde schneller.
Weiche Haut. Warm. Dann ein Ruck. Aus dem Summen wurde der Urschrei des Entsetzens und des Schmerzes, der Flammen durch seinen Körper jagte.
Weiche Haut. Nass. Glitschig.
Rot.
Er schmierte das Rot über ihre zuckende Brust. Sah es im Licht glänzen, als sie sich bewegte. Hörte das stöhnende Grunzen, die urtümlichen Laute des Todeskampfes. Sie dröhnten in seinen Ohren wie Rotorflügel, wie Herzschlag, wie sein eigener, immer schneller werdender Puls.
Die Flammen in seinem Körper brannten heißer und heißer, sein Atem wurde schneller, die Klinge in seiner Hand stieß voller Kraft wieder und wieder zu …
Sein eigener heiserer Befreiungsschrei war über den unartikulierten, schrillen Lauten der Sterbenden kaum zu hören.
Weiche Haut.
Nass.
Glitschig.
Rot.
Kapitel 3
Donnerstag, 8. Oktober
Eigentlich hatte Dani nicht beabsichtigt, nach Venture zurückzukommen, einer kleinen Stadt bei Atlanta, und hatte daher auch nicht entsprechend geplant. Ihre Wohnung war in Atlanta, wie auch die meisten ihrer Kleidungsstücke und anderen Besitztümer. Sie hatte für eine Ferienwoche mit unbestimmtem Ziel gepackt.
Das war vor fast einem Monat gewesen.
Kleidung war nicht das Problem, da sie bei ihrer Zwillingsschwester wohnte. Aber Paris und sie hatten sich die größte Mühe gegeben, ein getrenntes Erwachsenenleben zu führen, und im selben Haus zu wohnen, trug nicht besonders dazu bei, diesen Entschluss aufrechtzuhalten.
Genau genommen verführte es eher dazu, in alte Gewohnheiten und Verhaltensmuster ihrer Jungmädchenzeit zurückzufallen. Wie die allwöchentliche Fahrt in die Stadt zu Smiths Drugstore, weil man in Venture nur dort, an der noch immer gut besuchten Snackbar, wirklich hausgemachte Eiscreme kaufen konnte, und weil es die Gewohnheit der Zwillinge war, jeden Abend vor dem Schlafengehen Eis zu essen.
Das hatte Dani in Atlanta gefehlt. Sie hatte die Gewohnheit zwar nicht aufgegeben, denn ohne ein kleines Schälchen Eiscreme konnte sie einfach nicht einschlafen. Doch sie hatte das Hausgemachte durch Handelsware ersetzen müssen, die ihrer Meinung nach dem Vergleich absolut nicht standhielt.
Also wirklich.
Eiscreme.
Da war sie nun einunddreißig Jahre alt, und das Vergnügen, auf das sie sich den ganzen Tag freute, bestand darin, mit ihrer Zwillingsschwester Eis zu essen, bevor sie zu Bett gingen.
Elf Uhr war ihre übliche Schlafenszeit.