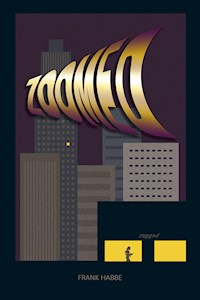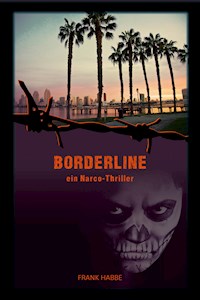
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender Trip von San Diegos sonnigen Stränden hinab in Mexikos dunkelste Verliese. Immer dabei: Claire, Ermittlerin bei der US-Küstenwache und Diego, skrupelloser Anführer eines mexikanischen Drogenkartells. Gemeinsam, aber mit unterschiedlichen Motiven sind sie auf der Suche nach Dave, einem Ex-Lover Claires und Dieb von Diamanten im Wert von 15 Millionen Dollar. Diamanten, die Diego gehören und der alles daransetzt, sie zurückzubekommen. Vordergründig als Freund auftretend, gewinnt er rasch Claires Vertrauen und Zuneigung, woraus sich schon bald eine stürmische Affäre entwickelt. Immer tiefer wird Claire in einen Strudel aus Lust, Gewalt und Lügen hinabgezogen und realisiert erst spät, mit wem sie sich eingelassen hat. Zu spät?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Habbe
Borderline
ein Narco-Thriller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kurzbeschreibung
Prolog - oder: Und all das für ein paar Dosen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Exkurs - Die Geschichte von Barbie
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
About
Impressum neobooks
Kurzbeschreibung
Nach einer Reise in ihre ehemalige Heimat Kapstadt kehrt Claire nach San Diego zurück, als sich unverhofft Dave, ein ehemaliger Liebhaber, bei ihr meldet und sie zu einem spontanen Dinner einlädt. Ein merkwürdiges Treffen, denn er, sonst charmant und entspannt, wirkt auf Claire seltsam gehetzt. Einen Tag später verschwindet Dave spurlos, dafür tritt sein Geschäftspartner Marc mit der Bitte an sie heran, ihm bei der Suche nach dem Vermissten zu helfen.
Was Claire nicht ahnt ist, dass es sich bei ihm um Diego, den Anführer eines aggressiv expandierenden Drogenkartells aus Mexiko handelt, der ebenfalls auf der Suche nach Dave ist. Aus gutem Grund, hat dieser seinerfamiliadoch Diamanten im Wert von 15 Millionen Dollar gestohlen. Diamanten, die Diego dringend zum Aufbau eines großangelegten Kokainschmuggels in die USA benötigt.
Prolog - oder: Und all das für ein paar Dosen
„Ab damit!“
„Bitte?“ Irritiert blickte Carlos zu Antonio, dem Kolumbianer. Die Füße lässig auf die gegenüberliegende Bank gestützt saß der ihm gegenüber im Heck der Yacht, spielte grinsend am Lauf seines Schnellfeuergewehrs.
Die Motoryacht pflügte mit zwanzig Knoten durch die Nacht. Der Fahrtwind und das Donnern der schweren Dieselmaschine lärmten betäubend. Carlos fragte sich, ob er Antonio richtig verstanden hatte. Anscheinend, denn wie zur Bestätigung fuhr sich sein Gegenüber mit dem Daumen über die Kehle.
„Na, Kopf ab! Allein die Vorstellung daran bringt die zum Reden. Wenn sie gefesselt vor dir knien, zeigst du ihnen die Kettensäge und das alte Messer. Glaub mir, sie werden diralleserzählen, um die Sache schnell hinter sich zu bringen.“
War er jetzt verrückt geworden? Carlos schob sich eine Haarsträhne aus der Stirn und kommentierte Antonios Vorschlag mit einem Kopfschütteln. Wie zur Bestätigung legte der Kolumbianer nach. „Doch, ich war selbst dabei! Erst bringen sie kein Wort raus. Sie wissen, dass es nicht gut für sie ausgehen wird, und das verklebt ihnen irgendwie die Zunge. Wenn sie aber sehen, dass sie am Ende eine Wahl haben, sind sie nicht mehr zu bremsen. Sie werden dir alles verraten. Ihre Verstecke, ihre Bosse, ihre Routen, was weiß ich – nur, damit sie nicht das Messer bekommen. Wenn sie fertig sind, gehst du zu dem, der dir am meisten erzählt hat, und wirfst die Säge an. Bei dem geht’s schnell, das kannst du mir glauben. Bei dem zweiten, dem mit dem Messer, da dauert’s etwas länger.“
Carlos bedachte sein Gegenüber mit einem prüfenden Blick, dann leerte er seine Dr.-Pepper-Dose mit zwei Zügen. Warum erzählte ihm Antonio das? Um ihm Angst zu machen? Um ihn davon abzuhalten, sich an den im Unterdeck deponierten Diamanten zu vergreifen?
Dazu braucht es etwas mehr als eine Gruselgeschichte, dachte Carlos stumm. Trotzdem, sie versetzte seinem Magen einen Stich. Er musste schlucken, was allerdings nicht allein an Antonios Erzählung lag. Der kühle Westwind hatte aufgefrischt und Carlos schloss die Windjacke. Er fröstelte, doch das lag nicht an der Kälte allein.
Tastend fuhr er sich mit der Zunge über den trockenen Gaumen. Er brauchte noch etwas zu trinken. Gegen den ausgedörrten Mund, vor allem aber zur Beruhigung der Nerven. Er erhob sich schwerfällig und wackelte auf unsicheren Beinen aus der offenen Lounge im Heck in die windgeschützte Kabine. Er war kein Mann der See. Das war er noch nie gewesen. Und heute, da hatte auch noch das Adrenalin seinen Anteil.
Vorsichtig schloss er die Glastür hinter sich, durchquerte den Salon und nickte im Vorübergehen Manuel zu, der dieSunseekervom erhöhten Steuerstand aus routiniert in Richtung Norden lenkte.
„Wie weit sind wir?“
Der Skipper schaute nur kurz herüber, bevor er sich wieder dem Radarschirm widmete. „Höhe Point Loma, San Diego. Noch etwa drei Stunden bis Newport.“
„Klingt gut.“ Carlos verzog zufrieden den Mund.Das klang sogar sehr gut. Die Grenze lag also bereits hinter ihnen. „Fahr bloß nicht zu schnell!“
„Klar.“
Obwohl ihnen die amerikanische Küstenwache bereits südlich von Ensenada einen Besuch abgestattet hatte, wollte Carlos kein Risiko eingehen. Angestrengt spähte er durch die Panoramascheibe in die Dunkelheit. Wolken hatten sich vor Mond und Sterne geschoben. Alles verlief genau nach Plan.
Leise summte Carlos eine mexikanische Ballade vor sich hin und stieg die schmale Treppe zum Unterdeck hinab. Dort beugte er sich in der kleinen Pantry zum Kühlschrank hinunter und zog die Whiskeyflasche hervor. Dann, seine Finger waren schon um den Verschluss gelegt, zögerte er.Eigentlich keine gute Idee, schoss es ihm durch den Kopf. So sehr ihm nach einem Drink war, intakte Reflexe waren jetzt einfach wichtiger. Schon gleich würde er sie brauchen, da war Carlos sich sicher.
Seufzend stellte er die Flasche zurück und zog stattdessen ein Tütchen Koks aus der Jackentasche, legte sich auf der Arbeitsplatte eine doppelte Linie und zog sie hastig mit einem gerollten Fünfziger. Als das Boot bei der zweiten Nase eine größere Welle schnitt, ließ die Erschütterung seinen Kopf unsanft gegen die Tischplatte knallen und das restliche Kokain großflächig über den Tisch stauben. Fluchend rieb sich Carlos das schmerzende Gesicht und wischte die Krümel mit dem Handrücken auf den Boden. Dann ging er mit immer noch wackligen Knien in seine Kabine und zog die Tür sorgsam hinter sich ins Schloss.
Der Raum war winzig und beherbergte nicht mehr als eine schmale Koje und einen Einbauschrank mit wenigen Fächern. Carlos bückte sich über das Bett, hob die Matratze an und tastete nach den drei dort verborgenen Sprengladungen. Sonderanfertigungen, via Handy auslösbar. Vorsichtig hob er sie aus ihrem Versteck und steckte sie in die Jackentaschen, danach zog er seine Remington aus dem Holster und schraubte einen Schalldämpfer auf. Für einen Moment schloss er die Augen. Er genoss die pulsierende Wirkung des Kokains, die seine Seekrankheit wohltuend überspielte. Er atmete zweimal tief durch, straffte sich und öffnete die Tür. Carlos war bereit.
Leise schlich er nach vorne und klopfte an die Tür der im Bug liegenden Kabine. Niemand reagierte. Er klopfte noch mal, und nach einer kurzen Pause öffnete er sie einen Spaltbreit. Drinnen lagen Alfons und Irene regungslos nebeneinander ausgestreckt auf dem breiten Doppelbett. Vorsichtig näherte sich Carlos den beiden und tippte dem jungen Mann mit dem Lauf der entsicherten Pistole gegen das rechte Bein. Alfons rührte sich nicht. Er war bewusstlos. Die Remington auf den Kopf des Schlafenden gerichtet, prüfte Carlos mit der freien Hand seinen Puls. Sehr schwach, kaum fühlbar. Beruhigt ging Carlos um das Bett herum und blickte auf die leblose Frauengestalt, die in ein schwarzes Kleid gehüllt auf dem Laken lag.Wie einladend, überlegte er. Er schob Irenes Rock nach oben. Seine Finger wanderten an der Innenseite ihres Oberschenkels entlang, bis er den schwarzen String ertastete.Kleine Schlampe, dachte er, und zog den Slip beiseite. Für einen Moment betrachtete er ihren rasierten Schritt, schob einen Finger in die Spalte. Dann sah er in ihr Gesicht. Immer noch keine Regung. Carlos’ Blick wanderte weiter, hin zu den beiden halbleeren Cocktailgläsern, die auf einem Sideboard neben dem Bett standen.Gut so. Bei der Menge an Rohypnol, die er in ihre Drinks gemischt hatte, wäre es ein Wunder, wenn sie überhaupt wieder aufwachten. Trotzdem: Er würde heute kein Risiko eingehen.
Für einen Moment hielt Carlos lauschend inne, aber außer dem leisen Stampfen der Maschine war es still. Er ging am Fußende des Bettes in die Hocke, zog den Teppich beiseite. Die darunter liegende Luke ließ sich problemlos öffnen. Carlos nahm eine der Sprengladungen und aktivierte den Zünder. Danach verschloss er die Luke, schob den Teppich zurück und ging zur Tür. Mit einem kurzen Blick versicherte er sich, dass er noch immer allein war, zog die Waffe und gab jeweils zwei Schüsse in die Köpfe der beiden regungslosen Körper ab.
Plopp-plopp. Plopp-plopp.Sicher ist sicher.
Zufrieden schloss Carlos die Tür und schlich sich zu seiner Kabine zurück. Dort installierte er nahe der Außenwand eine zweite Ladung. Blieb noch eine, die er an der Bar im untersten Fach des Küchenschranks hinter zwei Milchtüten versteckte. Wieder sah er die Whiskeyflasche – und wieder blieb er hart.
Ruhe. Immer mit der Ruhe.
Immerhin hatte er bereits Teil zwei seiner Aufgabe erfüllt. Alle Bomben waren scharf und lagen unterhalb der Wasserlinie, weit genug von den Benzintanks entfernt. Nach der Explosion würde der Wassereinbruch die Yacht innerhalb weniger Minuten im Meer versinken lassen. Ohne zuvor in Flammen aufzugehen, so hoffte er. Sie sollte bloß still und leise von der Oberfläche verschwinden.
Carlos sah auf die Uhr. Kurz nach Mitternacht. In knapp drei Stunden sollten sie Newport erreichen, aber in etwa neunzig Minuten wären sie vor San Clemente. Dort würde er aussteigen. Mit den Diamanten.
An und für sich war der Plan gar nicht schlecht, mit dessen Hilfe Maria die fünfzehn Millionen aus den Bergen des nördlichen Mexikos nach Kalifornien schmuggeln wollte. Das Risiko, die wertvolle Fracht auf dem Landweg durch das Gebiet feindlicher Kartelle und über die scharf bewachte Grenze zu verlieren, war gewaltig. Deshalb war der Umtausch ihrer Geldkoffer in eine handliche Portion Edelsteine ein geschickter Zug gewesen. Da sie keine Armee zum Schutz der teuren Ware aufbringen konnten, hatte es sich angeboten, auf eine der Charteryachten zurückzugreifen. Lediglich ein sicheres Versteck für die kostbaren Steinchen hatten sie finden müssen, um bei einer Kontrolle durch die Küstenwache nicht aufzufliegen.
Die Idee mit den Dosen war aus dem Team gekommen. So waren die Diamanten in ein Dutzend handelsüblicher Cola-Büchsen gefüllt, auf eine kleine Palette mit anderen, normalen Dosen gepackt und verschweißt worden. In Cabo war die Ladung auf eine Yacht und von dort aus gen Norden verschifft worden.
Carlos hatte sich direkt bei Maria für die Bewachung der Dosen empfohlen. Warum er von ihr letztendlich als Begleiter ausgewählt wurde, ließ sich nur ahnen. Sicher, er arbeitete seit vielen Jahren für sie, wie zuvor auch schon für ihren Vater. Außerdem war er an der Beschaffung der Diamanten beteiligt gewesen. Scheinbar genug Gründe, um ihm zu vertrauen.
Was Maria allerdings nicht ahnte, war, dass Carlos sich vorgenommen hatte, sie bitter zu enttäuschen.
Es war höchsteZeit, etwas in seinem Leben zu ändern.Als Teil von Marias Gefolgschaft war er während der letzten Jahre in unzähligen Gebirgsdörfern der Sierra Madre abgetaucht, immer auf der Flucht vor Armee, Polizei oder verfeindeten Familien. Und genau wie Maria und alle anderen hatte auch er einen hohen Preis für dieses Leben zahlen müssen. Dabei war Carlos alles andere als ein Kämpfer. Nur widerwillig hatte er in dieser Zeit zur Waffe gegriffen, um sich und die Seinen zu verteidigen. In den Jahren davor, unter Hectors Herrschaft, hatte er sich lediglich um Finanzielles kümmern müssen. Hier hatte er derart viel Geschick bewiesen, dass die Locandos auch während ihrer Zeit im Exil stets auf ein beträchtliches Vermögen zugreifen konnten. Und in diesem Land garantierte nur Geld das Überleben.
Erst nachdem Maria einige Monate zuvor die Wiederaufnahme des väterlichen Geschäfts beschlossen hatte, konnte Carlos die Waffe wieder aus der Hand legen. Über ihre Gründe zu diesem riskanten Schritt gab es viele Gerüchte. Allerdings wusste niemand Genaueres. Carlos meinte, dass die Entscheidung mit der Ankunft des Blonden zusammenhing, der mit einigen Männern im Schlepptau urplötzlich auf der Finca erschienen war. Selbst hatte er ihn nur einmal zu Gesicht bekommen, und er hütete sich davor, seine Einschätzung mit anderen zu teilen. Was für ihn zählte, war, dass er in einem klimatisierten Raum hocken und sich mit Zahlen auseinandersetzen konnte.
Von einem solchen Raum aus hatte Carlos den Diamanten-Deal eingefädelt. Die erfolglose Suche nach einer Antwort auf die Frage, warum Maria einen Teil ihres Vermögens dieses Malindas nördliche Nachbarland transportieren ließ, kostete Carlos unzählige durchwachte Nächte. Fünfzehn Millionen!
Und er? Wurde abgespeist mit ein paar hunderttausend Dollar. Viel zu wenig für das Risiko, das er in Kauf nahm. Es war an der Zeit, auch mal an sich zu denken. Damit meinte er nicht nur sich selbst, sondern seinefamilia. Und das war in erster Linie Sylvia. Sie waren seit fünf Jahren verheiratet, und er liebte sie noch wie am ersten Tag. Nur Kinder fehlten, dabei gab es nichts, was sich beide sehnlicher wünschten. Aber in diesem Umfeld, in dem sie lebten? Für Carlos ausgeschlossen, dazu wuchsen zu viele vaterlose Halbwaise in ihrer Umgebung auf. Für ihn stand fest: Sie mussten Maria und den ganzen Drogensumpf hinter sich lassen. Und diese Tour war seine Chance!
Um die Wellenbewegungen auszugleichen, lehnte Carlos breitbeinig an der Wand, während er auf seinem iPhone die Nummer, die den Zünder aktivieren würde, auf die Kurzwahltaste des Home-Buttons legte. Dann zog er aus dem Küchenschrank die Palette mit den in Folie eingeschweißten Dosen.Fünfzehn Millionen, dachte er lächelnd, während er die Packung auf die Tischplatte wuchtete. Er griff sich eine Dose, zog an dem kleinen Metallverschluss und nahm einen Schluck von der braunen Limonade. Mit der Cola in der Hand ging Carlos die Treppe hinauf. Das Kokain machte ihn hibbelig. Nicht gut, denn der schwerste Part lag noch vor ihm.
Um Manuel, den schmächtigen Skipper des Schiffs, machte er sich keine Sorgen. Was sollte der schon ausrichten? Antonio allerdings, der war ein anderes Kaliber. Antonio war an Bord, um die Ware sicher zum Blonden gelangen zu lassen. Der Blonde vertraute Antonio. Und wem er vertraute, der musste gut sein. Sorgen aber bereiteten Carlos nicht nur Antonios unzweifelhaft vorhandenen Fähigkeiten, sondern vor allem die schussbereit neben ihm liegende vollautomatische Heckler & Koch. Carlos war sicher, dass die Kugeln ihm im Falle eines Fehlers die lebenswichtigen Organe innerhalb von Sekundenbruchteilen perforieren würden. Allein deshalb durfte er sich keinen Fehler erlauben.
Durch die Panoramascheibe sah Carlos, dass Antonio noch immer draußen saß und in seine Richtung schaute. Der Griff nach der Pistole erschien ihm zu riskant, also nahm er einen weiteren Schluck von der Cola und hielt die Dose einladend in die Höhe. Antonio nickte zustimmend, und so drehte sich Carlos eilig auf dem Treppenabsatz um. Unten nahm er die Pistole aus dem Holster und steckte sie griffbereit in den hinteren Hosenbund. Dann stellte er sicher, dass die Jacke nicht störend darüberlag. Er griff nach einer weiteren Dose.
Ein leises und sich selbst anfeuerndes „¡Vamos!“murmelnd, stieg er die Stufen hinauf, ging ohne zu zögern zur Glastür, schob sie mit dem Ellenbogen auf und trat an Deck. Mit einem Lächeln hielt er Antonio die Dose vor die linke Hand. Die, die auf dem Lauf der Maschinenpistole lag. Antonio hob, begleitet von einem dankenden Brummen, die Hand und griff nach dem Getränk. Auf den Moment hatte Carlos gewartet. Blitzschnell schleuderte er die Dose in Antonios Gesicht. Der schrie überrascht auf und tastete nach der Waffe. Da aber hatten ihn schon zwei Schüsse aus der Remington getroffen. Blutstropfen spritzten ihm auf das Gesicht, einen Wimpernschlag später sank der Mann in die Kissen.
Carlos hob die Pistole zum finalen Kopfschuss, als er einen lauten Schrei aus dem Cockpit hörte. Erschrocken fuhr er herum und erblickte Manuel, der mit einer Signalpistole auf ihn zielte. Und sofort schoss.
Carlos warf sich zur Seite und so flammte die grellrote Leuchtkugel haarscharf an ihm vorbei. Funkensprühend prallte sie von Liegefläche ab und schwirrte in einem hohen Bogen ins Meer, wo sie zischend in den dunklen Fluten versank.
Verwirrt schaute Carlos wieder zum Steuerstand, wo der Skipper erneut anlegte. Doch Carlos kam ihm zuvor. Er schnellte vom Boden in Richtung Tür und feuerte drei Schüsse auf den Skipper ab. Die Wucht der Treffer warf Manuel auf das Steuer, wo er blutüberströmt in sich zusammensackte. Durch den Sturz hatte er das Ruder herumgerissen, was die Yacht einen ruckartigen Schlenker vollführen ließ. Hastig eilte Carlos nach vorne, schob den Getroffenen beiseite und brachte das Ruder zurück in die Ausgangsposition. Er schaute auf den unter ihm liegenden Skipper. Tot. Ein rascher Blick zum Heck folgte. Auch dort keine Bewegung, Antonio saß wie festgetackert in den Kissen.
Carlos zog einen Zettel aus der Tasche und stellte den Autopiloten auf die Koordinaten ein, die er sich zwei Tage zuvor notiert hatte. Eilig verließ er den Ruderstand und hastete hinunter, holte die Palette mit den Cola-Dosen und schleppte sie in das an der Reling festgezurrte Beiboot. Eher beiläufig blickte er noch einmal auf den leblos in seinem Blut hockenden Kolumbianer.¡Adios!,murmelte Carlos spöttisch. Dann verstaute er die Dosen in dem Fach unter der Sitzbank, löste die Befestigungsseile des Dingis und ging wieder zum Steuerstand derAlina.Teil drei wäre erledigt, ein befreiendes Gefühl. Durchatmend ließ er sich in den weich gepolsterten Ledersessel fallen und schaute in die vor den breiten Scheiben herrschende Dunkelheit.
Noch knapp eine Stunde. Dann brauchte er nur noch das Beiboot zu Wasser lassen und die Yacht samt Ladung in Richtung Strand zu verlassen. Dort würde Sylvia mit dem Wagen warten. Die Tickets für den Sieben-Uhr-Flug nach Atlanta hatte er dabei. Von dort waren verschiedene internationale Flüge für sie gebucht. Natürlich nicht mehr unter ihren richtigen Namen. Sie hatten mehrere Pässe zur Auswahl.
Eigentlich könnte er sich jetzt eine letzte Linie gönnen,zur Feier des Tages, überlegte Carlos. Da spürte er auf einmal, wie sich ein siedend heißer Strahl in seinen Rücken bohrte. Ihm war, als finge sein Oberkörper Feuer. Dann erst vernahm er den Lärm der Schüsse.
Verzweifelt blickte er an sich herab. Seine Jacke hatte sich an mehreren Stellen dunkelrot verfärbt. Auch klafften da plötzlich Löcher in seinem Bauch, die vorher nicht da gewesen waren. Carlos wollte den Kopf nach hinten drehen, spürte aber, wie ihn jemand fest an der Kehle packte. Dann erklang erschreckend nah die verzerrte Stimme Antonios an sein Ohr: „Puta madre…“ Weiter kam der Kolumbianer nicht, da er im gleichen Moment zu Boden ging, wo er zitternd liegen blieb.
Carlos schaute auf seine blutbefleckten Hände und strich sich über die immer stärker brennende Bauchdecke. Er spürte den metallischen Geschmack des eigenen Blutes, das ihm durch die Kehle nach oben stieg. Er wusste nur zu gut, was das bedeutete.Es hätte so schön werden können, dachte er.Sylvia, Kinder, ein neues Leben.
Ein neuer Schmerzschub ließ ihn gequält aufstöhnen. Sterne tanzten vor seinen Augen, während Carlos spürte, wie Blut und Leben langsam aus ihm wichen.Wenn schon sterben, dann nicht so!
Carlos tastete nach dem Handy, das zum Glück heil geblieben war. Dann murmelte er ein kurzes Gebet. Und drückte den Home-Button.
1. Kapitel
Endlich wieder zu Hause.
Claire drückt ihr Gesicht gegen das Plexiglas und starrt gebannt auf das unter ihr vorbeiflirrende scheinbar unendliche Lichtermeer des nächtlichen Los Angeles.
Endlich, sie hat es fast geschafft! Es ist das letzte Teilstück einer Reise, die sie vor zwanzig Stunden frühmorgens aus der nebelverhangenen Kap-Region via Johannesburg und New York bis nach LA geführt hat.
Seit die Kabinenbeleuchtung für die bevorstehende Landung gedimmt wurde, schaut sie fasziniert aus dem kleinen Fenster, betrachtet die geraden, wie auf einem Schachbrett angeordneten Linien der hell erleuchteten Straßen.
Von hier oben erscheint alles so klar und strukturiert. Sie weiß, wie schnell sich das wieder ändern wird, wenn sie den Erdboden berührt.
2. Kapitel
Unruhig wälzt sich Diego auf seiner Seite des Bettes hin und her. Das durch die bodentiefen Fenster hereinstrahlende Licht blendet ihn, aber so kann er besser den Körper des nackt neben ihm schlafenden Mädchens betrachten.
Wie heißt sie gleich? Angel?
Mit den Fingern streicht er über ihre Brust, erhebt sich dann und geht ins Bad. Er streckt sich und betrachtet sein Ebenbild in dem teuren Kristallspiegel. Gar nicht schlecht für einundvierzig, denkt er und streicht sich stolz über den flachen Bauch. Obwohl er schmal gebaut ist, gefällt ihm sein austrainierter Körper. Er tritt näher an den Spiegel heran, berührt den tiefen Ansatz seiner blonden mittellangen Haare. Ein blonder Mexikaner. Etwas, das die Leute verwundert innehalten lässt. Bei dem Gedanken daran, dass auch Angel ihm seine mittelamerikanische Herkunft vorhin bei ihrem kurzen präkoitalen Small Talk nicht glauben wollte, kichert er leise in sich hinein. Dann fährt seine Hand prüfend über das stoppelige Kinn. Es wäre mal wieder Zeit für eine Rasur.
Diego pinkelt, geht dann in das große Wohnzimmer und schaut auf die Lichter des Hafens von San Diego unter ihm. Beim Anblick von all den Schiffen wandern seine Gedanken zurück zur Alina, zu Antonio und Carlos. Vor allem aber denkt er an die verschwundenen fünfzehn Millionen. Und an Ernesto Avril, den Colonel.
Avril und er trafen sich ein paar Wochen zuvor in einem überteuerten mexikanischen Restaurant an La Jollas Goldküste. Außer ihnen saßen dort die gelangweilten Frauen reicher kalifornischer Steuerberater, Ärzte oder Anwälte gleich tischweise bei ihrer ersten Frozen Margarita des Tages. Oder einem Size-Zero-Evian. Der trostlose Anblick der aufgetakelten Damen wurde von einigen verlängerten Business Lunchs unterbrochen, bei denen sich Männer in handgefertigten Wildlederloafern zu tausend Dollar das Paar mit ihren Geschichten von Autos, Villen und zwanzigjährigen Mätressen zu übertrumpfen versuchten. Davon unbeeindruckt, in einem Separee an der rückwärtigen Wand, saß Diego im Gespräch mit einem mittelalten grauhaarigen Mann in Chinos und einem schwarzen Polohemd, unter dem sich ein drahtiger, gut erhaltener Körper abzeichnete. Es war ihr zweites Treffen, bei dem es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie ging.
„Dreißig Millionen, wofür?“
„Für dreißig Mann.“ Mit kühlem Blick taxierte der Colonel Diego.
„Dreißig Mann also …“, wiederholte dieser gedehnt, während er die Hände vor sich auf dem Tisch faltete und mit einer Brücke seiner sich berührenden Daumen sachte auf das Holz klopfte. „Die bekomme ich an jeder Ecke zwischen Tijuana und Juarez für dreitausend.“
Der Colonel schürzte verächtlich die Lippen und fuhr sich mit der Hand über den sorgsam gestutzten grauen Schnurrbart. „Jungs bekommt ihr an jeder Ecke. Jungs mit rostigen Revolvern, zerkratzten AKs oder schartigen Messern. Die, die für ein paar Dollar meinen, alles tun zu können. Die dann aber sterben wie die Fliegen. Abfall.“
Gut genug, um sie zur Abschreckung an Brücken aufzuhängen oder ihre Köpfe auf Laternenpfahle zu pflanzen. Diego kannte die immer gleich klingenden Nachrichten aus dem mexikanischen Drogenkrieg zur Genüge.
„Meine Männer aber“, der Colonel machte eine Pause und fixierte Diego mit dem Blick seiner starren eisgrauen Augen, „meine Männer bekommt ihr nicht an jeder Ecke. Fünfzehn Mann. Marine-Spezialkräfte, Fuerzas Especiales. Ausgebildet bei unseren hoch entwickelten Freunden hier im Norden. Kampftechniken, Überlebenstraining, Ausrüstung, alles auf höchstem Niveau. Trainiert, um Leute wie euch effizient zur Strecke zu bringen.“
Ein kaltes Lächeln huschte über das ansonsten unbewegte Gesicht des Colonels. Diego war beeindruckt, ließ sich dies allerdings mit keinem Zucken seiner Mimik anmerken.
„Diese fünfzehn sind gut für ein paar Hundert Ihrer Jungs“, fuhr der Colonel fort. „Oder einer Kompanie von diesen Deserteuren, mit denen sich manch einer eurer Konkurrenten schmückt.“ Ein abfälliges Schnauben hatte seine letzten Worte begleitet. „Außerdem sind sie absolut vertrauenswürdig.“
Während er das sagte, schwenkte er die Eiswürfel in seinem Glas und trank den Rest mit einem Schluck.
„Dazu für die Sicherung auf US-Gebiet fünf ehemalige Navy-Seals, frisch von der Front. Ex-Irak, Ex-Afghanistan, Libyen, Jemen. Harte Jungs. Uns gegenüber und dem Geld, das wir ihnen zahlen, loyal.“
Seals? Jetzt konnte Diego seine Verwunderung nicht mehr länger verbergen. „Wie viel?“
„Keine Zahlen. Ich garantiere aber, dass keiner nur annähernd auf meinem Niveau bietet.“
Eine Million zu Beginn, danach siebzig- bis hunderttausend im Monat. Das war Avrils Angebot an die US-Soldaten.
„Das Komplettpaket liegt bei dreißig Millionen. Dazu dreißig Prozent vom Erlös ab US-Grenze.“
Diego stieß einen leisen Pfiff aus. Er kam sich vor wie ein Kind, das über Nacht im Toys’R’Us eingeschlossen wird. „Da sollten sie loyal sein.“
„Das sind sie! Zu den zwanzig vor Ort erhalten Sie weitere zehn Männer unserer Einheiten aus Tijuana. Fünf bleiben in meinem Team, zuständig für die Kommunikation.“
„Die da wäre?“
„Informationen über die Grenzaufklärung auf unserer und US-Seite. In Echtzeit. Wenn die in Fort Blizz einen Helikopter starten, haben Sie das zwei Minuten später auf den Monitoren. Dazu erhalten Sie Einblick in die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber. Wenn wir ein neues Safe House oder einen LKW voller Kokain von denen auf dem Schirm haben - bitte, bedienen Sie sich.“
Diego gab sein mühsam beherrschtes Pokerface auf und grinste nun breit. Er war sich mittlerweile sicher, dass der Colonel seinen Preis wert war.
„Fünf Männer schicke ich außerdem samt Equipment zu Ihnen.“
„Equipment?“
„Eine Hybriddrohne samt dazugehöriger Steuerungseinheit. Vollständig ausgerüstet und bewaffnet. Dazu das kleine Boot.“
Das kleine Boot. Diego hob, begleitet von einem stummen Lachen, den Daumen. Ein unbemanntes Mini-U-Boot, Reichweite fünftausend Kilometer, Traglast eineinhalb Tonnen. Ausreichend, um innerhalb von zehn Tagen dieselbe Menge an Kokain von ihrem Stützpunkt im Süden Kolumbiens zu einem Hafen im Golf von Kalifornien zu transportieren. Seinen Gedankengang erahnend fuhr der Colonel fort.
„Ihr bringt die Ware auf eure Haziendas, fliegt sie von dort mit der Drohne rüber. Ganz einfach. Ihr benötigt in Mexiko keine Armee zum Schutz, auch keine Schmuggellogistik, keine Wartezeiten an der Grenze, kein Gefilze und keine Beschlagnahme.“
„Und Zoll, DEA, Heimatschutz?“
Erneut erntete er ein verächtliches Schnauben: „Wie gesagt, dafür garantiert mein Team. Es sollte sich immer ein Türchen finden, durch das ihr den kleinen Flieger schicken könnt. Ihr habt euch sicherlich über mich und mein Angebot erkundigt.“
Und ob sie das getan hatten. Carlos hatte mithilfe seiner Computernerds innerhalb von zwei Wochen einen umfassenden Hintergrundcheck des Offiziers durchgeführt.
Ernesto Avril, zweiundfünfzig Jahre alt, ledig, keine Kinder. Colonel bei den Seestreitkräften Mexikos, hochdekoriert, diverse Trainings bei Einsatzkräften des US-Northern Command in Colorado, Verbindungsoffizier mit exzellenten Kontakten zu DEA und FBI, Ausbildungsleiter der Marine-Spezialkräfte in Veracruz und Manzanillo, zuletzt Kommandant der Grenzüberwachung in Tijuana. Keiner Partei zugehörig, keinerlei Anzeichen von Korruption oder Verwicklung in kriminelle Organisationen. Frauen, Männer, Spiele oder Drogen? Fehlanzeige. Kurz: keine Leichen im Keller. Der perfekte Mann für ihr Projekt.
„Lassen Sie die anderen mit ihren Söldnern aufeinander einhacken und all die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie brauchen das nicht. Meine Männer und vollkommene Überlegenheit hier“, dabei tippte sich der Colonel mit dem Finger an die Schläfe, „sind alles, was zählt. Nach Eingang der Anzahlung präsentieren wir. Wie besprochen.“
„Sie ist bereits auf dem Weg.“
Diego hob nickend sein Glas mit bernsteinfarbenem Mescal: „Salut!“
Tja, da war noch alles in Ordnung.
Wütend ballt er die Faust, schlägt ins Kissen. Erschrocken wacht das Mädchen an seiner Seite auf.
„Que? Komm, geh duschen. Ich will allein sein!“ Er gibt ihr einen Klaps und schiebt sie aus dem Bett.
Die Kleine zieht einen Schmollmund, fügt sich aber, steht auf und sammelt ihre Sachen zusammen. Dann verschwindet sie im Bad.
Als sie zehn Minuten später das bereitgelegte Geld von der Anrichte neben der Tür nimmt und das Penthouse verlässt, ist Diego bereits wieder eingeschlafen.
3. Kapitel
In Utah hatten sie Willem Vandenbroucke immer nur den Buren genannt. Dorthin war er Anfang der Siebziger aus Kapstadt versetzt worden. Genauer gesagt, in die Kupfermine von Kennecott, einem verschlafenen Nest bei Salt Lake City, in dem er als leitender Ingenieur ein Joint Venture beaufsichtigen sollte.
Mit seinen hundertzehn Kilo, die sich auf einsachtundneunzig verteilten, entsprach er exakt dem Klischee, das den Amerikanern zu den Buren einfiel. Dazu strohblondes Haar, ein imposanter Schnauzbart und sein harter Akzent inklusive rollendem R. Es störte sich auch niemand aus seinem ausschließlich hellhäutigen Kollegenkreis daran, dass Willem nicht nur vom Äußeren her dem weißen Vorzeige-Südafrikaner entsprach. Rassismus war hier kein Makel, den man verbergen musste.
Cynthia, eine fünfundzwanzigjährige Sekretärin, die es von San Diego in die Wüste Utahs verschlagen hatte, lernte er in der Kantine kennen. Dank ihrer großen, dabei grazilen Statur, dem hellen, beinahe durchsichtig erscheinenden Teint und den wallenden ebenholzschwarzen Haaren war sie rein körperlich der vollkommene Gegensatz zu dem schwergewichtigen Südafrikaner. Trotzdem entwickelte sich recht bald eine stürmische Romanze zwischen den beiden, die nach Cynthias Schwangerschaft in einer Ehe mündete. Als es ein gutes Jahr später um die Erziehung der kleinen Claire ging, fanden beide wenig Gefallen an der Aussicht, ihre Tochter in der Einöde Utahs aufwachsen zu sehen. Auf Willems Wunsch hin sollte es zurück ans Kap gehen. Die Sanktionen gegen das Apartheid-Regime hatten zu einem erheblichen Mangel an Fachkräften geführt. Daher war es für ihn ein Leichtes, für sich eine hoch dotierte Position und für Cynthia eine Halbtagsstelle in Kapstadt zu bekommen.
So zog die kleine Familie im November 1976 in das frühsommerliche Constantia. Dort, am Fuße des Tafelbergs, bewohnten sie ein großzügiges Anwesen, das sie vom Konzern, für den Willem arbeitete, gestellt bekamen. In dieser begüterten Umgebung wuchs Claire auf, unbeeinflusst von den sich abzeichnenden Umwälzungen in ihrem Land. Sie war ein stilles Kind, das sich aber, wenn es einmal die Stimme erhob, schon früh mit einer Entschlossenheit äußerte, die ihren Altersgenossen gänzlich abging. Dies und die Tatsache, dass sie in jungen Jahren mit ihrer plumpen Statur eher nach dem Vater zu geraten schien, verschafften ihr in Kindergarten und Schule ein hohes Maß an Spott und Häme.
Claire war auf sich allein gestellt, denn von ihren Eltern war keine Hilfe zu erwarten. Willem, der pausenlos zwischen den im ganzen Land verstreuten Minen pendelte, sah sie lediglich an den Wochenenden. Und Cynthia? Die schien froh, allmorgendlich zur Arbeit in Richtung Kapstadt aufbrechen zu können. Außer einem Kuss blieb nicht viel an Aufmerksamkeit. Claire gewöhnte sich bald an die wechselnden Haus- und Kindermädchen, und anstatt mit anderen Kindern draußen herumzutoben, verkroch sie sich lieber in der riesigen Villa. Besonders hatte es ihr die maritime Bibliothek angetan, in der sie Bildband um Bildband verschlang. In ihren Träumen reiste sie mit den Fotografen und Autoren über die Ozeane dieser Welt. Früh schon stand für sie fest: Sie würde Meeresbiologin oder Fischerin werden - Hauptsache ein Beruf, der sich auf dem Meer abspielte. Das waren natürlich keine Jobs, mit denen sie bei den Mitschülern punkten konnte. Aber nicht nur mit den Gleichaltrigen gab es Ärger, denn mit dem Einsetzen der Pubertät verstärkte sich ihre direkte Art, die von den meisten Lehrern eher als patzig und vorlaut wahrgenommen wurde. So wurde ihre Mutter Cynthia in immer kürzeren Abständen vor das Kollegium zitiert, bis ihr schließlich eindringlich geraten wurde, Claire von der Schule zu nehmen. Bei der schwierigen Suche nach einem Ersatz musste Cynthia sich allein auf ihren Charme verlassen. Von Willem, der sich nur noch sporadisch zu Hause blicken ließ, war nichts zu erwarten. Es kriselte zwischen den Eltern, was auch der jungen Claire nicht verborgen blieb.
Trotzdem gelang es Cynthia schließlich mit viel Überredungskunst und Charme, den Direktor einer Highschool in Tokai davon zu überzeugen, Claire mitten im Semester an seiner Schule aufzunehmen. Und so kam es, dass die Vierzehnjährige sich eines Montagmorgens im Oktober in der hintersten Reihe ihres neuen Klassenraums wiederfand, um dort ihre beschwerliche Schullaufbahn fortzusetzen.
Jedoch fiel ihr die Eingewöhnung hier leicht, da sich mit zunehmendem Alter etwas veränderte, was ihre Akzeptanz besonders unter dem männlichen Teil ihrer Mitschüler begünstigte: Ihr Körper hatte begonnen, sich von dem plumpen Vorbild des Vaters zu lösen. Claire hatte einen ordentlichen Schub gemacht, der sowohl ihre Beine als auch ihren Oberkörper in eine Figur streckte, die den Jungs den Atem stocken ließ. Zusammen mit den langen schwarzen Haaren, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, und dem goldbraunen Teint machte sie das rasch zur ernsten Anwärterin auf den Platz des Sweethearts ihres Jahrgangs. Claire war sich ihrer Wirkung durchaus bewusst und lernte, diese für ihre Zwecke einzusetzen.
Nur einer schien sich von der allgemeinen Begeisterung nicht anstecken zu lassen: Ken. Groß, blond, langhaarig, Surfer. Dazu vermögendes Elternhaus, ein rebellisches Wesen und eine aus beidem entstandene Fuck You-Mentalität, besonders gegenüber Lehrern und anderen Autoritäten. Wie gemacht, um Probleme anzuziehen. Aber auch perfekt, um Mädchen um den Verstand zu bringen. Was permanent geschah, und auch bei Claire dauerte es nur kurze Zeit, bis es sie erwischte.
Doch ihr erging es genau wie all den anderen Schönheiten der Highschool; sie schien Ken gänzlich egal zu sein. Für ihn gab es bloß Surfen, seine Gang und die Steigerung davon: Surfen mit der Gang. Dabei handelte es sich um vier seiner ehemaligen Klassenkameraden und ein dünnes, unscheinbares Mädchen, bei der niemand verstand, wieso ausgerechnet sie es in den erlauchten Kreis geschafft hatte.
Die sozialen Kontakte von Claires Schwarm spielten sich zu achtundneunzig Prozent innerhalb der Clique ab. Die Welt außerhalb war Luft. Sie surften, wann immer es der Stundenplan zuließ. Im Sommer oder überhaupt immer bei gutem Wetter, gern auch mal während der Schule. Stets lagen in der Kabine von Kens altem Land Cruiser diverse Boards und Wet-Suits, um bei Bedarf ein paar Wellen in der nur wenige Kilometer entfernten False Bay zu nehmen.
Anders als ihre Konkurrentinnen zog sich Claire nach Kens Abfuhr allerdings nicht schmollend zurück, sondern wählte eine andere, langfristig angelegte Strategie: Sie lernte Wellenreiten. Von nun anstürzte sie sich voller Eifer in das Vorhaben und die Wellen, die bei Muizenberg an den Strand donnerten. So oft es ging, zog es sie in Gary’s Surf-Camp. Ob nach der Schule oder am Wochenende - stets belud sie in diesem Sommer ihren City Golf und fuhr die kurze Strecke hinunter ans Meer. Es kostete sie unzählige Stunden, Schürfwunden an Rücken und Knien und Gallonen an geschlucktem Salzwasser, bis sie das Brett soweit beherrschte, dass sie sich aus der Obhut von Garys Team traute. Kens kritischem Blick wollte sie sich noch nicht aussetzen und trainierte deswegen weiter an den Surf-Spots der Kap-Region. Zu Beginn erntete sie von den Locals meist nur abfällige Blicke oder wurde bei ihren Bemühungen sogar von der einen oder anderen Welle vertrieben. Als sie aber sahen, wie verbissen Claire nach jedem Sturz mit ihrem Brett zurück in die Brandung paddelte, legte sich die Arroganz allmählich.
Claire registrierte dies mit Genugtuung, und bald darauf stand für sie fest, dass es an der Zeit war, sich bei Ken und seinen Freunden zu beweisen. So nahm sie eines Nachmittags ihren ganzen Mut zusammen und steuerte ihren bepackten VW die schmale Stichstraße hinunter nach Llandudno, den Ort, zu dem die Gang nach der Schule aufgebrochen war. Nachdem sie hinter dem Strand geparkt hatte, lehnte sie sich für einen Moment in ihrem Sitz zurück und schloss die Augen. Sie spürte, wie ihr das Herz bis zum Hals klopfte. Warum bloß? Die paar Wellen, dachte sie, stieg aus und schlüpfte in ihren kurzärmligen Neoprenanzug. Dann griff sie nach dem Brett und ging entschlossen die wenigen Schritte zum Wasser hinunter.
An diesem Tag blies der berüchtigte Cape Doctor den feinen Sand kräftig über den Strand, sodass sich die wenigen Sonnenanbeter hinter die Steine verzogen hatten. Rechter Hand, bei einigen ins Wasser laufenden Felsen, machte Claire eine bunte Ansammlung von Kleidungsstücken aus. Die dazugehörige Clique schwebte in etwa hundert Metern Entfernung im Rhythmus der leichten Dünung auf dem Wasser. Strömung und ablandiger Wind führten zu einer sich am Eingang der Bucht steil aufstellenden Welle, die kurz danach sauber brach und sprudelnd am Strand auslief. Perfekte Bedingungen für einen Anfänger wie Claire. Dachte sie.
Sich ein wenig links von der Gruppe haltend, marschierte sie schnurstracks ins eiskalte Wasser, warf sich auf ihr Brett und paddelte mit kräftigen Zügen in Richtung Ozean hinaus. Doch je weiter raus sie kam, desto ungemütlicher wurde die Lage für sie. Die ersten beiden Wellen verfehlte Claire schon beim Reinschwimmen. Nummer drei ging sie zu steil an und tauchte die Spitze ihres Boards in das Wellental, was es zum Überschlagen brachte und sie in hohem Bogen aufs Wasser warf. Verbissen und bemüht, das rechts von ihr treibende Grüppchen zu ignorieren (die doch sicher jeden ihrer Fehltritte bemerkten!) paddelte sie zurück in den Break. Sie zitterte. Vor der Kälte des Atlantiks, aber auch vor Wut über sich selbst.
Was war nur los mit ihr? Sie konnte es doch!
Tief durchatmend, visierte sie kurz die nächste Welle an, die sie ohne großes Nachdenken anschwamm. Wenn sie sich die herankommende Woge nur etwas genauer angeschaut hätte, wäre ihr nicht entgangen, dass diese kurz davor war, sich zu einem kapitalen Brecher zu entwickeln. Was Claire jedoch erst bemerkte, als sie sich gerade kraftvoll von ihren Knien in den Stand gestemmt hatte. Da war ihr das laute Brausen des Wassers bereits gefährlich nahe, und aus dem Augenwinkel sah sie nichts außer der sich direkt hinter ihr aufbäumenden Welle, die nur einen Augenblick später schäumend über Claire zusammenbrach.
Mein erster Tunnel, registrierte sie angsterfüllt. Da aber hatte die Wasserwand sie bereits unter sich begraben, war über ihren Körper hinweggerollt und hatte sie tief in die eisigen Fluten hinabgedrückt. Sie spürte, wie sie über den steinigen Untergrund gezogen wurde, während sie mit zappelnden Armen und Beinen verzweifelt versuchte, wieder an die Oberfläche zu gelangen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam sie hustend und spuckend nach oben, griff nach dem an der Leine hinter ihr treibenden Brett und schwamm benommen zurück zum Strand. Dort kauerte sie sich in den von der Sonne aufgewärmten Sand, stützte den Kopf in die Hände und ließ ihren Tränen freien Lauf. Sturzbäche der Wut und Verzweiflung flossen ihre Wangen hinab. Was hatte sie sich blamiert!
Vollkommen mit sich selbst beschäftigt, bemerkte sie nicht, wie sich eine Hand auf ihre Schulter legte. Sie zuckte erschrocken zusammen.
„Mutig, mutig!“
Claire blickte nach oben, kniff die Augen zum Schutz gegen die Sonne zusammen. „Bitte?“
„Respekt, dass du dich an dieses verschissene Monster rangetraut hast!“
Jetzt erst erkannte sie Ken, der mit einem anerkennenden Lächeln im Gesicht über ihr stand. Sie wollte etwas erwidern, doch da war er schon einen Schritt zurückgetreten. Mit einem Wink lud er sie ein, ihr zu folgen. „Komm zu uns rüber. Wir haben Coke. Oder Windhoek. Vielleicht herrscht ja Bedarf?“
Damit drehte er sich um und ging die paar Meter zu seinen inzwischen am Strand lagernden Leuten.
Claire nickte stumm. Sie war viel zu erschöpft, um sich über die Einladung zu freuen. Dann erhob sich und folgte dem Surfer. Und so wurde sie zum zweiten weiblichen Mitglied der Clique.
Von da an war sie kaum noch aus dem Wasser zu bekommen. Unter der Woche ging es nach der Highschool direkt an den Strand.
An den Wochenenden fuhren sie raus aus der Stadt. Kens Vater gehörten Immobilien in der gesamten Kap-Region, darunter Sommerhäuser in Camps Bay und Elands Bay - sie hatten die freie Auswahl.
Seit ihrem Llandudno Wipe Out war Claire nur noch mit der Gang unterwegs, was ihrer Mutter überhaupt nicht gefiel. Seit klar war, dass Willem sich inklusive neuer Freundin eine Zweit-Existenz am anderen Ende des Landes aufgebaut hatte, hatte sich ihre Ehe aus dem Zustand des friedlichen Desinteresses in eine kriegerische Auseinandersetzung verwandelt. Allein gelassen von ihrem Mann, versank Cynthia zusehends in Depressionen. Und jetzt fehlte auch noch Claire, sodass es nun an der Mutter lag, sich mit ihren Gedanken und Ängsten in der großen Villa zu verschanzen. In dieser trostlosen Lage fand sie mehr und mehr Gefallen an einer Rückkehr in die Staaten.
Zunächst bemerkte Claire nichts von dem Wandel, der in ihrer Mutter vorging. Wie auch, sie war ja ständig unterwegs. Ihre jugendliche Leidenschaft für Ken hatte sich zu einer ausgewachsenen Verliebtheit gesteigert. Sie wunderte sich über sich selbst, denn sie war eigentlich nicht der Typ, der sich einfach so verknallte. Doch je häufiger sie zusammen waren, desto schlimmer wurde es.
Nur: Es tat sich nichts. Sie kam nicht voran bei ihm. Dabei versuchte sie es pausenlos mit vorsichtigen Flirtversuchen. Kens Reaktion darauf? Ernüchternd, denn es gab keine. Zuerst hatte Claire Gaby, das schmächtigste Mitglied der Clique, im Verdacht. Aber obwohl auch sie offensichtlich viel für Ken übrig hatte, stand sie auf einem ähnlichen Abstellgleis wie Claire. Immer ging es nur ums Surfen.
Erst mit der Zeit verstand Claire die Hierarchie innerhalb der Gruppe. Ganz oben stand Ken, natürlich. Gleich darunter sein ältester Kumpel Frederick „Frat“ Fred. Auf gleicher Ebene danach kamen Colin und Marten, etwas ältere muskelbepackte Hardcore-Surfer, die beide nicht viel redeten. Zusammen formten die vier Jungs den Kern der Gang, den die beiden Mädels wie zwei Satelliten umkreisten.
Es war nicht so, dass sie ausgegrenzt, überheblich behandelt oder bei den Wellen benachteiligt wurden. Aber richtig drin waren sie eben nicht. Gaby schien sich nicht daran zu stören, aber Claire machte die unmerkliche Trennung zu schaffen. Besonders aus Marten wurde Claire nicht schlau. Oft hielt er sich abseits der Gruppe, um sich dann mit aller Vehemenz als Erster in die Wellen zu stürzen. Bis auf die Möglichkeiten, die ihm Ken hinsichtlich Transport und Unterkunft bot, schien er kein weiteres Interesse an der Clique zu haben. Manchmal war Claire allerdings, als ob zwischen Marten und Ken eine ganz eigene Verbindung bestand. Sie sollte bald sehen, wie richtig sie mit ihrer Vermutung lag.
Sie waren gemeinsam für ein Wochenende nach Elands Bay gefahren. Die Bedingungen am Samstag waren nicht berauschend gewesen, und so hatten sie beschlossen, den Tag grillend auf ihrer Terrasse ausklingen zulassen. Vielleicht lag es daran, dass Claire den ersten und einzigen Joint ihres Lebens rauchte, vielleicht auch an der einen Rum-Cola zu viel. Jedenfalls lief sie später in der Nacht giggelnd über den Flur zu Kens Zimmer - das keiner von ihnen ohne direkte Einladung des Gastgebers jemals betrat. Berauscht setzte sie sich über das unausgesprochene Gesetz hinweg und schlich sich leise in den spärlich beleuchteten Raum. Der Anblick Martens, der mit gespreizten Beinen nackt vor dem ebenso unbekleideten Ken lag und sich mit geschlossenen Augen von ihm einen blasen ließ, ernüchterte Claire auf der Stelle. Eine lahme Entschuldigung stotternd, trat sie augenblicklich den Rückzug an, rannte in ihr Zimmer und raffte ihre Sachen zusammen. Dann verließ sie das Haus, bevor Ken sich etwas anziehen und ihr folgen konnte. Den Rest der Nacht verbrachte sie am kalten Strand, ehe sie am nächsten Tag einen Surfer fand, der sie mit zurück nach Kapstadt nahm. Ken sah sie nie wieder.
Die folgenden Tage heuchelte Claire ihrer Mutter eine Grippe vor, ließ sich krankschreiben und schloss sich in ihrem Zimmer ein. Sie war nicht wütend auf Ken, auch nicht moralisch entsetzt oder angeekelt. Vielleicht war sie sogar erleichtert zu wissen, dass Kens Ablehnung nicht mit ihr persönlich zusammenhing, sondern einzig mit der Tatsache, dass sie eine Frau war.
Dennoch fühlte sie sich traurig und leer. Ihr war bewusst, dass es für sie keinen Weg zurück in die Gang gab. Auch die Schule, insgesamt alles, was mit Ken zu tun hatte, war tabu. Da passte es gut, dass Cynthias Rückwanderungspläne in der Zwischenzeit weit gediehen waren. Für Claire stand fest: Sie würde mit ihrer Mutter fahren. Es kostete sie nicht viel Überredungskunst, und neun Wochen später reisten sie nach San Diego, zurück in Cynthias Heimat.
San Diego klang gut für Claire. Trotz der Wellen.
* * *
Bei dem Gedanken an die Wellen sinkt Claire versonnen zurück in ihren Flugzeugsitz. Sie kann es kaum erwarten, dem brausenden Schlag der Wogen am Mission Beach von morgen an wieder zuhören können.
Als die Räder auf der Rollbahn aufsetzen, reibt sich müde die juckenden Augen und ist froh, die beengte Kabine endlich verlassen zu können. Während sie über das riesige Flughafengelände zum Gate rollen, schaltet Claire ihr Mobiltelefon ein. Um sie herum ertönt ein eifriges Gepiepe und Gebrumme, mit dem all die Nachrichten auf den Telefonen ihrer Mitreisenden angekündigt werden. Auch ihr Gerät signalisiert mit einem leisen Klingeln, dass jemand eine Nachricht für sie hinterlassen hat. Eine SMS von Dave, der ihr für Montag geplantes Dinner auf morgen vorverlegen möchte.
Umso besser. Morgen ist ihr letzter Urlaubstag.
Mit einem Ruck stoppt die Maschine an ihrem Gate. In dem sofort entstehenden Gewusel und den sich klappernd öffnenden Gepäckfächern lehnt Claire den Kopf an die Lehne und gönnt sich einen letzten Moment der Ruhe.
Schon kurios, dass Dave sich ausgerechnet gemeldet hat, als sie in Kapstadt war. Da, wo es vor Jahren zwischen ihnen zu knistern begonnen hat. Sie betrachtet für eine Weile das Display ihres Mobiltelefons, dann bestätigt sie Dave den Termin per SMS, ohne jedoch etwas von ihrem Aufenthalt am Kap zu verraten. Dafür wird beim Essen noch genug Zeit bleiben.
Claires Gedanken schweifen ab in die Vergangenheit. Es war Ende 2005, als sie für zwei Monate in Simons Town bei einem Schulungsprojekt für die südafrikanische Küstenwache eingesetzt wurde, das ihr Arbeitgeber, die US Coast Guard, unterstützte. Natürlich bewarb sich Claire. Schließlich hatte sie in der Region die ersten fünfzehn Jahre ihres Lebens verbracht. Nach einigem Genörgel stellte sie Doug, ihr Boss, für das Projekt frei.
Beruflich wurde es eine entspannte Zeit. Es ging um die Einweisung in neue Sonar- und Radaranlagen, die die südafrikanische Küstenwache zur Aufrüstung ihrer Flotte von den Amerikanern gekauft hatte. Eine Technik, die auf den Booten der Coast Guard seit Jahren problemlos lief. Sie installierten das neue Equipment auf einem Marineschnellboot. Mit diesem fuhr Claire mehrmals die Woche in die False Bay, wo sie die Crews in der Handhabung des Geräts unterwies. Die Teams bestanden zum Großteil aus Marineoffizieren und Ausbildern, die im Anschluss die Schiffsbesatzungen der Küstenwache einarbeiten sollten. Alles Männer und Frauen also, die etwas von der Materie verstanden und Claire nicht durch pausenlose Fragerei nervten. Ein definitiver Pluspunkt. Ein weiterer war, dass sie ihr Programm meist bereits am frühen Nachmittag beenden konnten. Oft machte der Kapitän auf der Rückfahrt noch einen kleinen Abstecher in Richtung Gordons Bay. Claire stand dann meist an der Reling, ließ sich das Haar vom frischen Wind zerzausen und schaute auf die so vertraute Küstenlandschaft. Manchmal gesellten sich einige der Ausbilder auf eine Zigarette dazu und fragten sie über ihr zweites Leben in den Staaten aus. Es fiel ihnen schwer zu verstehen, warum sie ihr naturgewaltiges Heimatland verlassen hatte. Wobei sie zugeben mussten, dass Südkalifornien eine akzeptable zweite Wahl darstellte.
Anders als in der konzentrierten Arbeitsatmosphäre während der Schulungen war die Stimmung während dieses Teils der Tour stets gelöst. Es hätte nur gefehlt, dass sie Boote zum Wasserskifahren ausgesetzt hätten. So weit ging die Freizügigkeit allerdings nicht. Außerdem lag Claire nicht unbedingt daran, in Gewässern mit hungrigen Weißen Haien baden zu gehen.