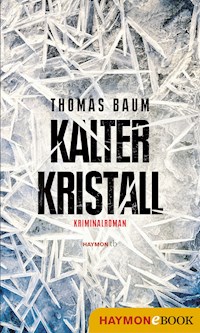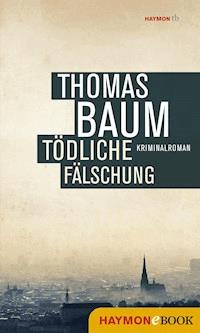Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Worschädl-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein hitziger Kommissar, ein eiskaltes Verbrechen und eine unsichtbare Bedrohung: Wenn Geld mehr wert ist als Leben, wem kannst du noch vertrauen? Kommissar Worschädl in seinem bisher persönlichsten Fall Worschädl hat Schädlweh. Denn wieder einmal werden seine Kollegin Sabine Schinagl und er zu einem Verkehrsunfall gerufen – und das bei 36 Grad im Schatten. Was sollen sie als Kripo-Team dort? Am Tatort wird klar: Clemens Löffler, Motorradfahrer und Controller am Linzer Flughafen, wurde absichtlich überfahren – das bestätigt dem Linzer Ermittlerduo auch ein Augenzeuge. Als es ein zweites Mordopfer gibt, sind sich Worschädl und Schinagl sicher: Hier hütet jemand Geheimnisse. Um jeden Preis. Die beiden versuchen – entgegen aller polizeiinternen Widerstände –, mehr Klarheit in Löfflers Machenschaften zu bringen: Was genau geht am Zoll des Flughafens vor sich? Ein Wettlauf gegen die Zeit in einem Ermittlungstempo, das uns den Atem stocken lässt Worschädls Frau Karoline hat in der Zwischenzeit andere Sorgen: Ihre beste Freundin ist an Krebs erkrankt, doch die Therapie schlägt nicht richtig an. Das Seltsame: So geht es auch anderen Patient*innen, die dasselbe Medikament bekommen. Aber: Je mehr Karoline in dieser Causa recherchiert, desto mehr bringt sie sich selbst in Gefahr … In einem atemberaubend temporeichen Fall decken Worschädl und Schinagl Geschäfte auf, die zeigen: Wenn es um Einfluss und Geld geht, ist manchen Menschen kein Preis zu hoch. Krimis, um sich die Nacht um die Ohren zu schlagen Robert Worschädl ist ein Original. Vorgesetzte? Können ihm sehr lästig werden bei Ermittlungen. Regeln? Sind dazu da, um im Zweifelsfall mal gebrochen zu werden. Bereits zum fünften Mal lässt Thomas Baum den mürrischen und impulsiven Kommissar mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn in und um die oberösterreichische Hauptstadt ermitteln. Sein Erfolgsrezept: eine Riesenportion rasante Action mit psychologischem Twist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Baum
Böse Hoffnung
Kriminalroman
Thomas Baum
Böse Hoffnung
1
Er fuhr am Limit. Mit höchstmöglichem Tempo und extremer Kurvenlage. Nicht etwa, weil er gestresst war. Clemens Löffler wurde von niemandem dringend erwartet. Von keiner Verpflichtung unter Druck gesetzt.
Er trieb seine Yamaha so rasant über den Asphalt, weil er extrem happy war. Heute mussten die Korken knallen. Heute war Feiern angesagt.
Noch konnte er nicht wirklich fassen, was ihm gelungen war. Er hatte sich selbst am Schopf gepackt und aus dem Dreck gezogen.
Unzählige schlaflose Nächte waren diesem Schritt vorangegangen. Stundenlang hatten sich seine Gedanken wie ein Karussell gedreht.
Würde er es schaffen, dem zunehmenden Druck der Auftraggeber anders als mit Ja und Amen zu begegnen? Könnte es ihm gelingen, seine Feigheit zu überwinden und endlich einzufordern, was ihm zustand?
Eigenartig, dass er als ausgewiesene Autoritätsperson einen solchen Bammel vor Autoritäten hatte. Stand jemand auch nur einen Rang über ihm, verflüchtigte sich sein spärliches Selbstbewusstsein, und er verwandelte sich in einen angepassten Befehlsempfänger.
Was er als klugen Umgang mit hierarchischen Konstellationen bezeichnete, nannte seine Ex den widerlichen Hang, Vorgesetzten in den Arsch zu kriechen. Sich auf den Kopf scheißen zu lassen. Aber diesmal lief es anders. Diesmal wäre Chiara stolz auf ihn gewesen.
Gestern hatte er sich ein Herz gefasst. Hatte klargestellt, dass für ihn das Maß voll sei. Dass es so nicht weitergehen könne. Da stand seinem Gegenüber erst einmal die Klappe offen. Doch es kam noch weitaus dicker. Der sonst so leicht lenkbare Clemens Löffler, der seine Jobs stets ohne zu murren erledigte, begehrte nicht nur auf, sondern setzte auch noch nach. Verlangte, dass seine Arbeit ab sofort neu bewertet und honoriert werde. Falls er für die Auftraggeber weiterhin Kopf und Kragen riskieren sollte, koste es ab sofort das Doppelte.
Seine Ansprechperson starrte ihn erstaunt an. Brauchte ein paar Schrecksekunden, um das Gehörte zu verdauen. Konnte nicht verhindern, dass ihre Mundwinkel ein Eigenleben entwickelten und zuckten. Unter erheblicher Spannung entgegnete sie schließlich, dass diese überzogene Ansage bei den Leuten im Hintergrund für immensen Ärger sorgen würde. Ärger, den keiner haben wollte. Ärger, der zu Reaktionen führen könnte, die sich womöglich gegen Clemens richteten. Er wäre nicht in der Position, Bedingungen zu stellen. Vielmehr habe er ihren Anweisungen ohne Wenn und Aber zu folgen.
Die scharfe Stimme, die kurz angebundenen Sätze und der zurechtweisende Blick hätten Clemens fast zurückgescheucht. Es verschlug ihm die Sprache, er rang nach Worten, brachte schließlich seine von allen seit Jahren geschätzte, absolute Loyalität ins Spiel. Er habe bis jetzt nichts ausgeplaudert, keinem auch nur ein Wort erzählt. Er sei einer, auf den man sich tausendprozentig verlassen könne. Doch das müsse man sich in Zukunft um einiges mehr kosten lassen. Weil er sonst nicht mehr länger für seine Verschwiegenheit garantieren könne.
Ein Argument, das Wirkung zeigte. Sein Gegenüber lenkte tatsächlich ein und versprach, mit den Auftraggebern zu reden und ihnen ein Zugeständnis abzuringen.
Heute war es dann so weit gewesen. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Verhandlungen kein Spaziergang gewesen seien, man habe sich aber letztendlich durchgesetzt und eine Verdoppelung seines bisherigen Honorars erwirkt.
Sensationell, schrie Clemens unter seinem Helm. Der reine Wahnsinn, brüllte er, als sein Knie beinahe den unter ihm vorbeirasenden Asphalt streifte. Er genoss die Fliehkraft, das Rupfen der Reifen, das Spiel mit der Gefahr.
Kurze Gerade, scharfe Rechtskurve, runter vom Gas, abdriften bis über die Mittellinie, zurück in die Spur. Alles kommt in Ordnung, alles wird gut, dachte er, als erste Regentropfen gegen das Visier klatschten. Längst fällige Vorboten eines Gewitters, das sich seit Stunden anbahnte und die schwere Schwüle eines stickigen Sommertages vertreiben sollte.
Clemens drosselte die Geschwindigkeit. Legte auf der leeren Landstraße einige lässige Slalomschwünge ein. Streckte zur Entspannung die Beine zur Seite. Spürte den Sommer, den Fahrtwind, die wiedergewonnene Lebenslust. Hätte in diesem Moment seine alte, klapprige, lendenlahme Yamaha liebend gerne gegen einen schnittigen, PS-starken Edelbrummer eingetauscht.
Doch zuerst würde er von seinem nächsten schwarz verdienten Geld für Niko ein Bett und einen Kleiderschrank kaufen. Dazu einen neuen, besonders flauschigen Teppich. Und natürlich jede Menge Spielzeug, damit Niko sich auch bei seinem Vater so richtig zu Hause fühlte. Dann könnte die Sozialtussi von der Kinder- und Jugendhilfe sich unmöglich weiterhin dagegen aussprechen, dass sein Sohn das Wochenende bei ihm verbringen durfte.
Vielleicht wäre dann auch Chiara zu einem Besuch bei ihm bereit, dachte Clemens. Er ging davon aus, dass sie Nikos Zimmer mögen würde. Sich vielleicht zu einem Aperol Spritz überreden ließe. Eventuell könnte man sogar gemeinsam anstoßen. Einfach so. Als Zeichen der Versöhnung.
Man könnte es doch noch einmal miteinander versuchen. Noch einmal von vorn beginnen, dachte Clemens, als im Rückspiegel plötzlich der SUV auftauchte.
Wie ein schwarzer Büffel, der rasch näher kam. Clemens gab Gas, konnte den Abstand kurz vergrößern, aber in einer engen Kurve schob sich der SUV wieder heran. Machte auf der anschließenden Geraden keine Anstalten, ihn zu überholen.
Nein, der blieb absichtlich hinter ihm.
Der hielt direkt auf ihn zu.
Die nächste Kurve nahm Clemens extrem riskant. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass die Stoßstange des monströsen Wagens sein Hinterrad erwischte.
Er geriet ins Schleudern, brachte das Motorrad mit größter Mühe wieder in die Spur.
Unmittelbar danach folgte der nächste Stoß. Diesmal wuchtig, brutal.
Clemens hörte das Krachen. Spürte die Schubkraft, der er nichts entgegensetzen konnte. Die ihn auf die Gegenfahrbahn drängte.
Er verlor die Kontrolle, rutschte weg. Wurde aus dem Sattel katapultiert. Knallte auf den harten Asphalt, bevor er in die totale Finsternis kippte.
Als er kurz danach die Augen aufschlug, konnte er nicht fassen, dass er lebte.
Wollte sich aufrichten, sich bewegen.
Da sah er den schwarzen SUV. Der vor ihm gehalten hatte. Ihn mit laufendem Motor anvisierte.
Trotz höllischer Schmerzen hob Clemens die Hand.
Er war nicht tot.
Er brauchte Hilfe.
Stattdessen heulte der Motor auf.
Dann rollte der Wagen auf ihn zu.
2
Stimmungsschwankungen hatten bei Robert Worschädl nur selten mit dem Wetter zu tun. Von äußeren Faktoren ließ sich der Chefinspektor seine Laune nicht verderben. Ein paar Regentage konnten ihn ebenso wenig aus dem Gleichgewicht bringen wie nasskalter Nebel im Oktober. Den ausgeglichenen Seelenhaushalt des überzeugten Frühaufstehers vermochten meteorologische Kapriolen kaum aus dem Tritt zu bringen.
Wirklich allergisch reagierte sein Organismus nur auf Föhn und feuchte Hitze. Beim Heranrollen und Einsetzen eines warmen, trockenen Fallwinds entwickelte sich sein Kopf zu einem Bergwerk, in dem gehämmert, gestemmt und gegraben wurde. Drückende Schwüle wirkte sich deutlich anders aus. Die legte sich tonnenschwer auf sein Gemüt und verursachte eine bedenkliche Reduktion seiner Kombinations- und Entscheidungskraft.
Am heutigen Morgen plagten ihn die Höhepunkte einer bereits ewig lang andauernden Hitzewelle mit südtropischer Affenhitze und Saharasand. Draußen wie drinnen dominierte schweißtreibende Saunaluft. Von oben schürten tiefgraue Wolkengebirge seit Stunden die Hoffnung auf Erlösung und kündigten ein Gewitter an, das sich nicht und nicht entladen wollte.
Dabei wäre es vor geschätzten 40 Minuten fast so weit gewesen. Fette, schwere Regentropfen, die auf Fenster- und Windschutzscheiben prasselten, sorgten für erste Anzeichen von Entspannung, doch die Enttäuschung folgte auf dem Fuß.
Es blieb bei einem kurzen Guss. Für den 53-jährigen Chefinspektor nicht mehr als eine Frotzelei, die ihm das Leben in keiner Weise leichter machte.
Er hatte seine deutlich jüngere Kollegin Sabine Schinagl beim Einsteigen in ihr Auto mit knappen Sätzen über seine seelische und körperliche Verfassung informiert und damit die Ursache für seine grantige Grundstimmung geliefert. Sie musste seinen mürrischen Gesichtsausdruck, seine inkompatible Körperhaltung und seine dürftige Kommunikationsbereitschaft also nicht auf sich beziehen. Mit ihr hatte die mehr als üble Laune des Herrn Kollegen ursächlich nichts zu tun.
„Du weißt, wohin die Reise geht?“, brummte er am Beifahrersitz.
„Selbstverständlich“, antwortete Schinagl und lenkte den Wagen in die Hagenstraße. „Auf den Pöstlingberg.“
„Ein Toter?“
„Sieht so aus. Angeblich ein Unfall.“
„Na bravo! Ist doch herrlich, dass wir jetzt auch noch das Unfallkommando vertreten dürfen.“
„Könnte sein, dass es sich um eine absichtliche Tötung handelt.“
„Könnte sein, ist aber nicht sicher? Na gut, dann schicken wir auf alle Fälle die Idioten der Kripo hin. Und unser Weichei von Chef nickt das widerspruchlos ab. Ehrlich, ich habe es satt!“
Worschädl betätigte zornig die Klimaanlage, was nichts nützte, da diese ohnehin auf vollen Touren lief.
„Schweitzers Spielraum ist leider ebenfalls begrenzt.
Und wir sind doch alle schon urlaubsreif.“
„Nimmst du Schweitzer in Schutz? Spielst du jetzt die Schweitzerversteherin?“
„Überhaupt nicht. Aber wir sind alle mit unserer Geduld am Ende und brauchen dringend eine Pause.“
„Meine kommt erst in drei Wochen!“
„Und dann geht’s mit deiner Karoline ab in den Süden. Wie läuft es eigentlich bei ihr?“
Schinagl erntete nur unverständliches Gemurmel. Trotz ihres versuchten Themenwechsels hatte sie keine Chance, zum Herrn Kollegen durchzudringen. Den musste man granteln lassen, bis er eventuell wieder halbwegs genießbar war.
Sie überquerte die Schienen der Pöstlingbergbahn, bog kurz danach in die Samhaberstraße ein und brachte den Wagen hinter einem Notarzt- und einem Rettungswagen zum Stehen. Davor parkten mit rotierendem Blaulicht zwei Polizeiautos und ein Bus des Unfallkommandos. Rund um die Unfallstelle hatten die Kollegen bereits die üblichen Sperren errichtet.
Schinagl nickte Worschädl zu, dann stiegen sie aus dem Wagen.
Vor ihnen auf der linken Straßenseite lag wie hingeworfen ein Motorrad.
Etwa zehn Meter dahinter sahen sie einen leblosen Menschen in einer schwarzen Lederkluft.
Worschädl, der sich hinter Schinagl hielt, wandte seinen Blick sofort vom Unfallopfer ab. Heute war kein Tag, an dem er Tote sehen wollte. Auch die Frage, ob dieser Unfall aus Unachtsamkeit beziehungsweise aufgrund eines Fehlverhaltens passiert oder sogar bewusst herbeigeführt worden war, hätte er nur allzu gerne gemieden. Stattdessen hätte er sich weitaus lieber mit einer Kombination aus Sonnenliege, Strandbad und gutem Buch beschäftigt.
Als Gerichtsmediziner Jürgen J. Janko, der neben dem Toten seine Arzttasche schloss, aufstand und eifrig auf sie zueilte, fielen ihm vor allem dessen obligate Stiefeletten auf. In denen muss der Schweiß bis über die Knöchel stehen, dachte Worschädl und hoffte, dass sich Jankos Bericht möglichst kompakt gestalten würde.
„Sehr schön, mein Lieblingsteam! Sicher topmotiviert und bester Laune! Ich habe vehement darauf bestanden, dass hier nichts verändert wird.“
„Sehr gut, Herr Janko“, lobte Schinagl.
„Ist eigentlich selbstverständlich“, stichelte Worschädl.
„Genau so sehe ich das auch“, parierte Janko souverän. „Laut unserem Augenzeugen wurde der Lenker des Motorrads um 8 Uhr 25 von einem Wagen abgeschossen. Nach dem Aufprall dürfte es ihn aus dem Sattel gehoben und weit nach vorn geschleudert haben. Der Aufprall auf dem Asphalt hat aber meiner Einschätzung nach noch nicht zum Tod geführt.“
„Woran könnte er sonst gestorben sein?“
„Vermutlich an sehr üblen inneren Verletzungen. Als er auf der Straße lag, muss er noch brutal überfahren worden sein.“
„Entsetzlich“, entfuhr es Schinagl.
„Wissen wir schon etwas über die Identität des Toten?“, wollte Worschädl wissen.
„Sein Führerschein steckte in seiner Jackentasche.
Clemens Löffler, 43 Jahre alt.“
„Viel zu jung“, konstatierte Schinagl, tippte den Namen auf ihrem Handy ein und fütterte damit die polizeiinterne Suchmaschine.
„Reden Sie weiter, Herr Janko“, forderte der Chefinspektor.
„Sehr gerne.“ Janko bemühte sich, Worschädls forschem Ton mit besonderer Höflichkeit zu begegnen.
„Nachdem ich den Tod des Mannes festgestellt hatte, habe ich natürlich sofort umfangreiche Erkundigungen angestellt.“
„Die hoffentlich erfolgreich waren.“
„Der Mann ist fast einer von uns.“
„Wieso nur fast?“, hakte Worschädl nach.
„Beruflich achtete er darauf, dass souvenirhungrige Urlauber keinen sardinischen Sand zu uns über die Grenze schmuggeln.“
„Er arbeitete beim Zoll?“
„Als Controller am Linzer Flughafen. Ist vermutlich von der Nachtschicht gekommen.“
„Danke, sehr gute Arbeit“, lieferte Schinagl die angemessene Anerkennung. „Der Aufprall muss am Wagen doch sicher Spuren hinterlassen haben?“
„Sehr wahrscheinlich. Kratzer, Dellen …“
„Kann der Augenzeuge eine brauchbare Beschreibung des Wagens liefern?“, wollte Worschädl wissen.
„Das fragt ihr ihn am besten selbst. Er steht da drüben“, erklärte Janko und deutete auf einen Mann, der in seiner orangen Arbeitskleidung etwas verloren neben einem Polizeiwagen stand.
„Na gut, dann reden wir mit ihm.“
„Moment“, warf Schinagl ein und wischte über das Display ihres Handys.
„Hast du etwas in unserer Datenbank gefunden?“, erkundigte sich Worschädl.
„Allerdings. Das Opfer wohnt im Stadtteil Spallerhof.“
„Am anderen Ende der Stadt. Er war also nicht nach Hause unterwegs.“
„Vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder ist einfach so durch die Gegend gefahren. Jedenfalls ist er amtsbekannt. Sieht so aus, als hätte der liebe Herr Löffler privat ziemlichen Mist gebaut.“
„Inwiefern?“
„Es gab zwei Wegweisungen.“
„Von zu Hause? Von seiner Familie?“
„Ja, Robert. Von seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn. Wegen häuslicher Gewalt.“
3
Als besonders sensibel hätte Straßenmeister Lorenz Furtner sich selbst wohl nicht beschrieben. Allerdings hatte ihn vor wenigen Minuten eine spürbare Unruhe erfasst. Seine innere Apparatur wurde von einem Dilemma auf Trab gehalten. Er befand sich in einer Entweder-Oder-Situation, die ihn heillos überforderte. Dabei galt er sonst wahrlich nicht als entscheidungsschwach. Wenn die jüngeren Kollegen beim Einsetzen eines Leitpfostens den Abstand zu den Nachbarpfosten auf den Millimeter genau bestimmen mussten, genügte ihm eine ungefähre Daumenpeilung, um den Standort festzulegen. Beim wöchentlichen Lottospiel überlegte er nicht lange, sondern kreuzte die entsprechenden Zahlenkästchen in Sekundenschnelle an. Zugegebenermaßen bis dato nicht unbedingt erfolgreich.
Doch heute, am Rand einer Landstraße, etwa 480 Meter über Linz, kam er beim Hin und Her zwischen der einen und der anderen Möglichkeit auf keinen grünen Zweig. Er tendierte zwar in eine Richtung, aber dem Einschlagen dieses Pfades stemmten sich seine moralischen Prinzipien entgegen. Seine aufkeimenden liederlichen und schurkischen Anteile wurden zurückgepfiffen von eingefleischten Glaubenssätzen. Als er den etwas gesetzteren Herrn und die junge Dame aus dem Wagen steigen sah und eine Polizistin auf sie zueilte, schloss er daraus sofort, dass die beiden eine wichtige Rolle spielten. Vermutlich Kriminalpolizei.
Die würden mit ihm reden wollen.
Die würden ihn fragen, was er gesehen hatte, und eine ehrliche und detaillierte Antwort erwarten.
Die konnte er ihnen jedoch nur geben, wenn er bereit war, auf eine einmalige Chance zu verzichten. Stimmt schon, Gelegenheit macht Diebe, und für einen Dieb wollte er keinesfalls gehalten werden. Zugleich gab es in so einem Menschenleben mitunter Gelegenheiten, die man auf keinen Fall versäumen sollte. Genau eine solche bot sich ihm jetzt überdeutlich an, und bestimmt würde er sich ewig in den Hintern beißen, wenn er sie nicht ergriff.
Andererseits hatte er sich als sonntäglicher Kirchgänger stets der Wahrheit verschrieben. Er verachtete die Lüge und wollte auch die Notlüge in keiner Weise tolerieren.
Wer lügt, sündigt.
Das war immer sein Credo gewesen, und bei dieser Ansicht war er auch geblieben, wenn er nach der Messe beim Frühschoppen schon vier Halbe intus hatte. Selbst beim ärgsten Zungenschlag und mit vom Alkohol gerötetem Gesicht ging ihm die Rechtschaffenheit über alles. Deshalb galt er in der Pfarrgemeinschaft als zwar manchmal betrunkene, doch moralisch stets einwandfreie Größe. Insofern lag es auf der Hand, dass man ihm aufgrund seiner ethischen Tadellosigkeit trotz seines augenscheinlichen Suchtverhaltens die Funktion des Pfarrgemeinderatsobmanns anvertraute. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass der Furtner Lorenz im städtischen Linienbus auch nur einmal schwarzgefahren wäre oder bei der Entnahme der Sonntagszeitung weniger als den vollen Betrag eingeworfen hätte.
Kein Mensch hätte angenommen, dass Furtner seine bereits verstorbene Frau jemals heimlich betrogen oder irgendwelche verbotenen Substanzen eingenommen hätte. Nicht ein einziges Pfarrgemeinderatsmitglied hätte vermutet, dass über die Lippen ihres Vorsitzenden Lorenz Furtner auch nur eine Halbwahrheit gekommen wäre.
Auch er selbst hätte sich noch vor etwa 45 Minuten, als er sofort nach dem schrecklichen Ereignis die Rettung verständigt hatte, keinesfalls gestattet, die Wahrheit zum eigenen Vorteil zurechtzubiegen.
Aber nun kokettierte er damit.
Unangenehm war ihm dabei, dass er angesichts des allgegenwärtigen Gottes keine privaten Gespräche führen konnte. Er wäre in dieser Angelegenheit vorerst einmal ganz gerne für sich allein geblieben.
Aber die Heilige Dreifaltigkeit hatte gewiss längst mitbekommen, dass sich der Lorenz Furtner anschickte, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen.
Hallo, du willst morgen wieder in den Spiegel schauen können, wies er sich zurecht. Du darfst unter keinen Umständen lügen.
Der Straßenmeister schwankte hin und her. Wie ein steuerloses Schiff auf turbulenter See. Bis er sich nun doch fix vornahm, den beiden Beamten in Zivilkleidung, die gerade auf ihn zukamen, alles, wirklich alles, wahrheitsgetreu zu schildern.
Hundertprozentig glaubwürdig erschien der Straßenmeister dem Chefinspektor aber nicht, als er kurz danach erzählte, wovon er rein zufällig Zeuge geworden war.
Es stimmte natürlich, dass vor Furtners Augen nicht jeden Tag ein schlimmer Unfall, geschweige denn ein hundsgemeiner Mord passierte, aber für ein gestandenes Mannsbild Ende 50 hinterließ er doch einen übertrieben schockierten Eindruck. Als ob er auf einer Bühne stünde und mit dramatisiertem Pathos und gefühlsbetonten Pausen für Wirkung beim Publikum sorgen müsste.
Interessant, dass Schinagl es ähnlich empfand. Ihr fiel sofort die Vorstellung eines ländlichen Sommertheaters ein, die sie vor Jahren besucht und in der Pause wegen Effekthascherei und mieser Pointen fluchtartig verlassen hatte.
„Ja, also zuerst ist das Motorrad wie der Blitz, ich sage noch einmal, wie der Blitz an mir vorbeigerast, gleich danach dieses unglaublich fette Auto … ebenfalls mörderisch schnell … Und wenn ich mörderisch sage, dann meine ich mörderisch … meine Wenigkeit hat sich hinter den Büschen gerade vom Reparieren eines Leitpfostens erholt.“
„Der Leitpfosten da vorn?“
„Ja, genau der.“
„Und was passierte dann?“
„Plötzlich … ich sage Ihnen … plötzlich macht es einen Tuscher, und ich sehe gerade noch, wie es den Motorradfahrer in einer Art Salto aus dem Sattel schleudert. Was heißt schleudert? Torpediert! Und dann hat es ihn auf den Asphalt gedroschen. Mein Gott, dieser arme Kerl. Ich habe alles fallen gelassen, wollte hinrennen, aber dann gibt dieser Verbrecher wirklich Gas, fährt über den Verletzten, legt den Retourgang ein und überrollt ihn im Zurücksetzen gleich noch einmal.“ Der Straßenmeister schlug beide Hände vor dem Gesicht zusammen. „Alles mit voller Absicht. Schrecklich. Danach ist dieses … Verzeihung … Dreckschwein einfach davongerast. Entsetzlich, oder? Mein Gott, wie kriege ich diese erschütternden Bilder wohl jemals wieder aus dem Kopf?“
Zur zittrig gewordenen Stimme fasste sich der Schmierenkomödiant auch noch theatralisch an die Stirn. Bei Worschädl und Schinagl erzeugte er damit allerdings nicht einmal einen Hauch von Mitgefühl.
„Furchtbar“, murmelte Worschädl mit geheuchelter Empathie.
„Sie haben einiges durchgemacht“, fügte Schinagl hinzu. „Automarke und Kennzeichen haben Sie sich hoffentlich gemerkt.“
Erstaunlich, dass menschliche Vorsätze oft ein äußerst kurzes Leben haben. Kaum zur Welt gekommen, können sie schon wieder in sich zusammenbröseln. Straßenmeister Lorenz Furtner beschloss jedenfalls von einer Sekunde auf die andere, sich nun doch ein wenig bedeckt zu halten.
„Mein Gott, die Marke … das ist alles so schnell gegangen. Das war eines von diesen wuchtigen amerikanischen Autos, die man eigentlich verbieten sollte.“
„Ein SUV?“, rätselte Schinagl.
„Ja, richtig – ein SUV.“
„Na also. Welche Farbe?“
„Tut mir leid … meine Kurzsichtigkeit …“
„Was jetzt?“, mischte sich Worschädl mürrisch ein.
„Gelb, grün, orange?“
„Dunkel. Ja, das beschreibt es wohl am besten.“
„Dunkelgrün, dunkelblau …“
„Nein. Dunkel im Schwarz-Grau-Bereich.“
Bei dieser Antwort bemerkte Schinagl in Furtners Gesicht einen Anflug von Verschlagenheit. Seine Augen wichen den ihren aus, als wollten sie etwas verbergen. Möglicherweise war es nur ein Anzeichen von Unsicherheit oder Überforderung, weil Furtner der existenziellen Dimension des erlebten, tragischen Ereignisses nicht gewachsen war. Oder es gab Informationen und Details, die er ihnen unterschlug.
„Gibt es sonst noch etwas, das uns weiterhelfen könnte?“, fragte Schinagl argwöhnisch.
„Nein, das war alles. Ich müsste mich jetzt auch wieder an die Arbeit machen.“
„Aber freilich, selbstverständlich“, erwiderte Worschädl und nahm sich vor, dieses sich so entgegenkommend und auskunftsfreudig gebärdende Straßenmeisterchen genau im Auge zu behalten. Wer sich so scheinheilig benahm, konnte durchaus etwas zu verheimlichen haben.
Der Chefinspektor wartete, bis sich Furtner entfernt hatte und außer Hörweite war.
„Der ist ein ausgesprochen schlechter Lügner.“
„Was immer er uns aufgetischt hat … ich kümmere mich um alle in Linz und Umgebung zugelassenen dunklen SUVs“, kündigte Schinagl an.
„Ruf bitte auch die Werkstätten durch. Wir müssen wissen, ob jemand so einen Wagen zur Reparatur bringt. Ich checke inzwischen, ob es auf der Strecke hierher Videokameras gibt. Und ob auf den heutigen Aufnahmen zur fraglichen Zeit ein dunkler SUV zu sehen ist.“
„Falls der wirklich dunkel war“, warf Schinagl ein. „Jemandem, der so betont ehrlich und treuherzig daherkommt, traue ich wirklich alles zu.“
„Geht mir genauso“, antwortete Worschädl. „Hinter seiner gutherzigen Masche lauert etwas Durchtriebenes. Kann durchaus sein, dass er etwas im Schilde führt.“
„Dann, Robert, können wir nur hoffen, dass er sich dabei nicht übernimmt.“
4
Delegieren. Das war sein Schwachpunkt. Bevor er ewig lange herumdiskutierte, um sich mit anderen abzustimmen, nahm er die Dinge lieber höchstpersönlich in die Hand. Nur ließ sich ein komplexes Imperium wie das seine auf Dauer unmöglich im Alleingang führen.
Jeder Kaiser braucht sein Gesinde, jeder Feldherr seine Soldaten. Seine paar Leute zeichneten sich durch Fleiß und Gehorsam aus und hielten das Getriebe brav am Laufen. Nahezu allen war bewusst, welche Vorteile sich damit verbanden. Was sie an ihrem Dottore hatten. Sie verhielten sich nicht aufmüpfig, legten keinen nennenswerten Widerstand an den Tag, sahen zu ihm auf, erwarteten seine Anweisungen und hielten sich exakt an den von ihm bestimmten Kurs.
Sie schätzten seine spontane Entschlusskraft, auch wenn sie so manche Gefahren barg. Unüberlegte, überhastete Aktionen und die rasche Befriedigung eines plötzlich auftretenden Bedürfnisses konnten so manches Projekt zum Straucheln oder sogar zum Scheitern bringen.
Sein altes Lied. Wieder einmal hätte er sich mehr Zeit lassen und weitaus durchdachter handeln müssen. Erneut hatte er viel zu viel aufs Spiel gesetzt.
Selbstverständlich wagte es aus seiner Gefolgschaft keiner, ihn dafür zu kritisieren. Der Dottore, das wusste jeder, duldete keine Widerrede. Konstruktive Anregungen waren ihm jederzeit willkommen, bei Respektlosigkeit und Anmaßung platzte ihm der Kragen. Zum Beispiel, wenn so ein Knecht vom Zoll aus heiterem Himmel einen unangemessen hohen Lohn verlangte und an diese unverschämte Forderung auch noch eine Drohung knüpfte.
Eine derartige Impertinenz brachte das Fass zum Überlaufen. Da verkroch sich die Vernunft, der Zorn übernahm das Kommando, und dann überlegte der Dottore nicht lange, sondern legte sofort los.
Ein Fehler, der sich im Lauf der Jahre nicht nur einmal als schwerwiegend erwiesen hatte.
Und jetzt hatte er als obersten General sich selbst leichtfertig an die Front geschickt, obwohl die Schlacht noch lange nicht geschlagen war. Unter allen Umständen hätte er damit einen seiner Handlanger betrauen müssen. Du bist nach wie vor zu impulsiv, sagte er sich und schenkte sich noch ein Glas Champagner ein. Brut Gold. Rebsorten aus der Champagne. Am Gaumen exotische Früchte, Kirschen, Vanille, Honig. Prickelnder Abgang.
Die Flasche 790 Euro. Sein kleiner, feiner Luxus, den er mit seiner unbedachten Aktion gefährdet hatte.
Wobei ihm die Form der Sanktionierung höchsten Genuss bereitet hatte. Der Moment, in dem er dieses undankbare Stück Scheiße aus dem Sattel seines Motorrads befördert hatte. Der Anblick, als diese Missgeburt im Lederanzug über den Asphalt schlitterte, zum Liegen kam, sich noch bewegte.
Das Einlegen des Ganges, die zweieinhalb Tonnen Eigengewicht seines Achtzylinders, das Rumpeln unter den Reifen, als er den Wagen insgesamt dreimal über den Körper rollen ließ.
Die Gewissheit, dass die Angelegenheit geregelt, die Ordnung ein für alle Mal wiederhergestellt war.
Aber besonnen, nein, besonnen hatte er nicht gehandelt. Er hatte sich vielmehr wie so oft von seinen Emotionen leiten lassen. Ihm war ein Rückfall passiert, den er sich selbst nicht durchgehen lassen durfte.
Er nahm einen großen Schluck, ließ die prickelnde Flüssigkeit über Zunge und Gaumen rollen, spürte sie gleich danach im Magen, stellte das Glas ab und atmete tief durch.Jetzt kam, was kommen musste. Was schon immer gekommen war.
Er stand auf, ging durch den Salon ins großzügige Vorzimmer, ließ sich vom Lift hinunter zum Wellnessbereich mit Infrarotkabine, Dampfdusche, Sauna und Kaltwasserbecken bringen. Dort zog er sich aus, stellte sich an den Beckenrand, gab sich einen Ruck und stieg ins Wasser.
Zehn Grad.
Die Kälte prügelte auf ihn ein.
Er erlaubte sich nicht, zu flüchten. Tauchte unter.
Zwang sich, es auszuhalten. Blieb ewig lange unter Wasser.
Bis ihn die Pein beinahe überwältigte.
Bis die Kälte längst nicht mehr zu ertragen war. Erst jetzt riss er den Kopf hoch.
Stieß ein lautes Brüllen aus. Spürte dabei seine Kraft.
Mit der er alles erreichen und alle besiegen konnte.
5
Zuerst fetzte Chiara Löffler die Jacken ihres Ex von der Ikea-Garderobe. Dann riss sie die drei Laden der an den Ecken abgeschlagenen Kommode auf. Die mittlere, schlampig montiert, flog aus der Halterung und krachte auf den Boden. Der Inhalt war enttäuschend, lauter sinnloser Kram. Jedenfalls nicht das, wonach Chiara suchte. Scheiße! Da war ein Entlastungstritt fällig, ihr rechter Fuß fegte die am Boden liegende Lade in Richtung des einzigen größeren Zimmers, das alles enthielt, was man zum Wohnen brauchte: Küchenzeile, Esstisch mit zwei Sesseln, Kasten, Bett. Mehr ließ sich auf 15 Quadratmetern nicht unterbringen.
Auch durch diesen Raum brauste Chiara wie ein Tornado. Kleidung flog aus dem Kasten, Geschirr aus dem Küchenschrank und die Matratze vom Bett. Das scharfe Messer, das auf den Boden fiel, ließ sich gleich in die Matratze rammen, doch bis auf die Kaltschaumeingeweide fand sich auch hier nicht, wonach sie so dringend suchte. Münzen, Scheine, Euros, Geld.
Chiara raste zum klapprigen Spiegelschrank über dem Waschbecken im Badezimmer, nahm keine Rücksicht auf zerbrechliche Materialien wie Glas oder Porzellan, räumte den Schrank leer, ließ sich von der Duftwolke aus einer am Fliesenboden zerberstenden Parfumflasche nicht beirren, war angesichts des erneuten Misserfolgs nur noch wütend und verzweifelt.
Weiter ins Minizimmer, das bis auf zwei Umzugsschachteln und eine Matratze leer und für Niko gedacht war. Noch nicht einmal zu einem Bett hatte es Clemens für seinen Sohn gebracht, geschweige denn zu einem Kasten. Die Wände waren weiß gestrichen, zu mehr war er nicht fähig gewesen, und das hatte er verkündet, als hätte er gleich mehrere Weltwunder zugleich vollbracht.
In der einen Schachtel befanden sich Klebebänder, Pinsel, Farbwalzen, Arbeitshandschuhe, Schraubenzieher und eine Spachtel, in der anderen Bubenkleidung. Chiara beförderte alles auf den Boden. So eine Scheiße, wieder nichts.
Die erneute Enttäuschung löste einen Weinkrampf aus. Verdammt! Sie brauchte wenigstens ein paar Münzen, um die dringendsten Lebensmittel einzukaufen! Sie zog Rotz auf, wischte sich über die Augen, fixierte den einzigen Luxus, den diese Wohnung in einer der unattraktivsten Gegenden von Linz zu bieten hatte: den Balkon.
Balkon war gleich Zigarette, in die Lunge strömendes Nikotin, war gleich Entspannung. Auch wenn dieser nur eineinhalb Mal zwei Meter maß, im Halbparterre lag und eine mäßige Aussicht versprach.
Zwei Sekunden später stand sie draußen und zog hastig eine durch. Jagte sich zwischen den Zügen eiskaltes Dosenbier aus dem Kühlschrank in die Kehle. Fand, dass die nüchternen Bahnhofsgleise und die sich dahinter auftürmenden, hässlichen Silos und Schlote des Stahlwerks genau zu ihrer Stimmung passten. Unterm Hund. Total beschissen.
Eine Packung Milch, vor vier Tagen abgelaufen, war alles, was sie noch zu Hause hatte. Ihr Magen schmerzte vor Hunger, und sie wusste nicht, wie sie zu einer einzigen Semmel kommen konnte. Dabei war sie nicht die einzige Person, für die sie zu sorgen hatte. Klar gab es einen Weg, auf die Schnelle zu Geld zu kommen. Nur war ihr das Herumvögeln mit irgendwelchen fremden Männern inzwischen widerlich geworden. Wenn du in deiner Not fürs Ficken nur 50 Euro verlangst, ziehst du auch extrem schräge, grindige Typen an. Nachdem sie im Netz mit ihrem jungen Alter warb, standen ständig alte Säcke auf der Matte. Die ekligen Nasen- und Ohrenhaare kosteten sie bei denen die größte Überwindung.
Chiara zückte ihr Handy, schrieb eine Nachricht und schickte sie an ihren skurrilsten Kunden. Trat im Netz als Superlover auf, bekam ihn aber nur hoch, wenn er seine Sexpartnerinnen erniedrigen und sich dabei so richtig gehen lassen durfte. Das tat meistens weh, führte oft zu blauen Flecken, dafür war er danach sehr fürsorglich und freundlich. Und er bezahlte richtig gut. Wäre sie ehrlich zu sich selbst gewesen, hätte sie festgestellt, dass sie vor diesem Irren Angst hatte, und wahrscheinlich war ihr dieses Verhalten von ihrem Ex noch allzu gut bekannt.
Die Antwort per SMS kam prompt. Natürlich sagte er zu. Er war gierig nach ihr, wahrscheinlich sogar in sie verknallt. Sie ließ ihn machen, was er wollte, würde auch nach diesem Treffen, bevor sie unter Leute ging, jede Menge Make-up brauchen. Was soll’s. Hauptsache, sie konnte für sich und Niko wieder etwas zu essen kaufen.
Chiara war am Balkon so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie den Vorgängen außerhalb ihrer kleinen Welt nicht die angemessene Bedeutung beimaß. Zum Beispiel jenen zwei Personen, die auf das Haus zusteuerten. Bewohner, Besucher, irgendwelche Leute, die Chiara nicht beachtete. Hätte sie jemand nach dem Aussehen der unscheinbaren Gestalten gefragt, hätte sie keinen der beiden beschreiben können. Verschiedenen Geschlechts, ja. Ein Mann und eine Frau. Das war auch schon alles, was sie hätte sagen können.
Erst kurz danach, als es läutete, sie erschrocken durch den Spion der Wohnungstür schaute und ihr ein männliches Gesicht jenseits der 50 entgegenblickte, dämmerte ihr, dass die beiden zu Clemens wollten. Nur war der eben nicht zu Hause. Und Chiara, ohnehin übel gelaunt, hatte nicht die geringste Lust, mit diesen komischen Vögeln auch nur ein Wort zu wechseln. Sie warf noch einen Blick auf die Zerstörung, die sie angerichtet hatte, kehrte zurück auf den Balkon, stieg übers Geländer und sprang hinunter auf die Wiese.
Ihre Wahrnehmung hatte ihr allerdings einen Streich gespielt. Nachdem sie aus den Augenwinkeln zwei sich dem Haus nähernde Personen gesehen hatte, glaubte sie automatisch, dass sich nicht nur der Mann, sondern auch die Frau zur Wohnungstür begeben hatte. Das war jedoch nicht der Fall.
Der Bezirksinspektorin Sabine Schinagl war nämlich ins Auge gesprungen, dass die junge, spindeldürre Frau, die auf dem Balkon stand, als sie sich dem heruntergekommenen Hochhaus näherten, gehörig unter Strom zu stehen schien. So hastig, wie sie an der Zigarette sog, lief augenscheinlich gerade etwas nicht ganz rund. Der Dame ging offensichtlich etwas gehörig an die Nieren.
Worschädl, der sich inständig nach dem sich anbahnenden Gewitter sehnte, zeigte Respekt vor den hitzeresistenten Sensoren seiner Kollegin. Ihrem Vorschlag, sich in der Nähe des Balkons gut verborgen zu positionieren, während er allein nach oben ging, stimmte er selbstverständlich zu.
Demnach war die Bezirksinspektorin nicht sonderlich überrascht, als jetzt unweit von ihr zwei abgewetzte Sneakers in der Wiese landeten. Aus ihnen ragten dünne Beine, darüber ein Minirock, ein fleckiges T-Shirt und eine verfilzte Dreadlock-Mähne.
„Hallo, darf ich Sie etwas fragen?“, ergriff Schinagl das Wort.
Die junge Frau drehte sich verstört um, bedachte Schinagl mit einem wütenden Blick und stakste Richtung Straße davon. Schinagls Rufe ignorierend legte sie an Tempo zu.
Nun war es nicht so, dass die Bezirksinspektorin als ehemalige Polizei-Landesmeisterin im 200-MeterHürdenbewerb jeden Tag Lust auf Laufen hatte. Noch dazu bei 36 Grad im Schatten.
Aber was blieb ihr schon übrig. Also trabte sie los, bog hinter der Frau um die Hausecke, sah sie am Gehsteig vor der dicht befahrenen, mehrspurigen Glimpfingerstraße kurz innehalten, schrie noch, dass sie stehen bleiben solle, weil sie doch nur mit ihr reden wolle, doch das hagere Geschöpf trat trotz der herankommenden Fahrzeuge ohne zu zögern auf die Fahrbahn und ging tatsächlich einfach los.
Verflucht!
Schinagl hörte das einsetzende Hupen, die quietschenden Reifen, das Schimpfen aus geöffneten Autofenstern, sie registrierte die gewagten Brems- und Ausweichmanöver eines Linienbusses, eines Kombis, zweier Taxis und einer Limousine.
Anders als Worschädl hatte Schinagl beim Verfolgen flüchtender Personen kein Faible für den riskanten Drahtseilakt. Sie hatte für zwei Kinder zu sorgen und konnte es sich als Alleinerzieherin nicht leisten, für ein paar Tage auszufallen. Andererseits wollte sie diesen bizarren, über die Straße tanzenden Engel nicht verlieren.
Sie blickte nach links und schätzte den herankommenden Verkehr ab. Die Lage erschien ihr nicht gerade übersichtlich, aber mit der entsprechenden Geschwindigkeit und dem nötigen Geschick durchaus bewältigbar.
Es war ein wahnwitziges Autoballett, durch das sich Schinagl ihren Weg bahnte, indem sie zur Seite sprang, stoppte, auswich und nach vorne hetzte. Vor ihr, wie ein feengleicher Luftballon, freischwebend und ohne Bodenhaftung, erreichte die Harakiri-Tänzerin wie durch ein Wunder den Gehsteig auf der anderen Straßenseite.
Noch während Schinagl hinter sich den scharfen Wind eines knapp vorbeifahrenden Autos spürte, sah sie, wie die junge Frau in einen auf einem Laternenmast befestigten Mülleimer griff, eine leere Bierflasche herauszog, sie gegen den eisernen Mast knallte und Schinagl erwartete. In der rechten Hand den Flaschenhals mit den darauf verbliebenen spitzen Scherben.
Rundherum erschrockene, zurückweichende Passanten.
Und das Gebrüll der jungen Frau.
„Ihr Arschgesichter kriegt ihn nicht! Ich gebe ihn nicht her!“
„Okay, keine Sorge, wir kennen uns ja gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden.“
„Immer diese falschen Weiber. Nichts als Lügen. Nichts als Beschiss. Aber nicht mit mir. Ich lasse das nicht mit mir machen!“
Sie zielte mit dem Flaschenhals in Schinagls Richtung, war aber glücklicherweise viel zu weit von ihr entfernt.
„Wir können über alles reden.“ Die Chefinspektorin hob beschwichtigend die Hände. „Aber bitte legen Sie die Flasche weg!“
„Reden? Was denn noch reden? Ich habe euch das schon 10.000 Mal vorgebetet. Was soll ich machen, wenn ihr Schweine mir nicht glaubt?“
Schinagl sah die Tränen. Die Verzweiflung. Überlegte fieberhaft, wie sie zu der Frau durchdringen, sie irgendwie erreichen konnte.
„Ganz ruhig, okay, es wird nichts passieren. Irgendwie kriegen wir das hin. Sagen Sie mir, worum es geht.“ Die Augen der jungen Frau entglitten in die Ferne, nach oben, ganz weit fort. Als würde sie jeden Halt verlieren. Dann kehrte sie zurück. Ihr Blick traf den von Schinagl. Sie schüttelte den Kopf. Flüsterte.
„Ist das Ihr Ernst? Sie fragen mich, worum es geht? Das wisst ihr doch längst. Ihr wisst es alle ganz genau. Dass ich ohne meinen Niko nicht leben kann.“
Die junge Frau riss die Hand mit dem Flaschenhals nach oben.
Rang nach Worten, nach einem Satz. Brachte nichts mehr heraus.
Wirkte wie am Rande des Abgrunds.
Holte aus und rammte sich die spitze Scherbe des Flaschenhalses tief in ihren Unterarm.
6
Ein Schwarm von Vögeln zog über den Himmel.
Mit schnellen Flügelschlägen in geordneter Formation.
Orientiert und zielgerichtet.
Fliegt, solange ihr könnt, dachte Silvia und schleppte sich mithilfe ihrer Stöcke die Donaulände entlang. Genießt die Geschwindigkeit, das Sonnenlicht, das verrückte Blau des Himmels. Umarmt das Leben und die Welt.
Da war plötzlich wieder dieses Stechen. Zuerst im Bauch, dann raste es wie ein Feuerball durch alle Glieder. Die 46-jährige Frau hielt inne, legte eine Hand auf ihre Bauchdecke, hyperventilierte.
Die heiße Sommerluft brannte im Hals. Ihr Körper war ein einziger Schmerz. Alles Mühe, alles Qual.
Zum Glück erreichte sie ein neuerlicher aufmunternder Blick von Karoline. Die Hand ihrer besten Freundin berührte Silvias Arm. Ihre kräftige Stimme vermittelte Halt und Zuversicht.
„Lass dir ruhig Zeit. Wir beide müssen nicht als Erste durchs Ziel.“
Silvia rang sich ein Lächeln ab, zwang sich zu einem Hauch von Optimismus.
Beide trugen lockere, saloppe Kleidung und Sonnenbrille. Karolines Haare waren mit einer blauen Kappe bedeckt, während Silvia ein oranges, um den Kopf gewickeltes Tuch trug.
„Es geht schon wieder.“ Silvia bemühte sich, ihrer Stimme Kraft zu geben. Sie nickte bestätigend, hob ihre Stöcke und setzte ihren Weg fort. Langsam. Zentimeter für Zentimeter.
Nur gut, dass Karoline vorgeschlagen hatte, ihr heu tiges Treffen nach draußen zu verlegen. Die Bewegung strengte sie an, tat ihr aber zugleich gut.
„Orange steht dir toll“, machte ihr Karoline, die ihr im Windschatten folgte, ein Kompliment.
„Ich finde, dass es mich jünger aussehen lässt. Damit wirke ich nicht mehr wie eine steinalte, sondern nur mehr wie eine alte Schachtel.“
„Die alte Schachtel hat vor wenigen Wochen noch 80 Patienten pro Tag behandelt.“
„Sie hätte damals auch darauf geschworen, dass sie diesen Rhythmus ewig schaffen wird.“
Karoline zögerte für einen Moment. „Es kann wieder werden, Silvia.“
„Das sage ich mir jeden Tag. Zu jeder Stunde. Bei jeder Verlaufskontrolle. Allerdings … mein Tumormarker …“
„Was ist damit?“
„Er macht keine Anstalten, sich zu verbessern, obwohl ich sehr starke Medikamente nehme.“
„Er geht nicht runter?“
„Keinen Millimeter, der bleibt stur stabil.“
„Woran kann das liegen?“
„An der Tücke des Mammakarzinoms. An meinem Organismus, der zu wenig darauf anspricht. Mein Arzt meint, dass es vielleicht einfach noch Zeit braucht.“
„Er tut sicher, was er kann.“
„Davon bin ich überzeugt. Weißt du, früher … früher … da dachte ich …“
Lange Pause.
Wie anstrengend es doch für Karolines Freundin geworden war, fließend zu sprechen und unterbrechungsfreie Sätze zu bilden. Genauso schien sie das Formen von Gedanken einiges an Energie zu kosten. Karoline ließ ihr die Zeit, die sie brauchte. Als Psychotherapeutin fiel ihr auch das Begleiten längerer Pausen nicht schwer. Ebenso wenig das verzögerte Mitschwingen von einem inneren Bild zum nächsten und von einer Gefühlsregung zur anderen. Manchmal brauchte es nur eine einfache Frage, um die nächste Stufe der Leiter zu erklimmen.
„Dir ist etwas von früher eingefallen?“
Silvia nickte: „Früher dachte ich, dass ich keine Angst vor dem Sterben habe.“
„Mit dem Tod wirst du dich als junger Mensch nicht allzu intensiv beschäftigt haben.“
„Stimmt. Obwohl ich ständig mit Krankheit und Endlichkeit konfrontiert war, habe ich es von mir ferngehalten.“
„Mache ich genauso. Auch ich kenne depressive Phasen … ich bin auch manchmal neben der Spur …“
„Du zeigst es aber nicht.“
„Genau. Ich schiebe es erfolgreich weg.“ Karoline lächelte, weil sie in ihrem Beruf Menschen dabei unterstützte, sich frühere, verdrängte Erfahrungen und Gefühle bewusst zu machen und einen stimmigen Umgang damit zu finden.
„Dabei hat man bei dir den Eindruck, dass dich nichts erschüttern kann“, meinte Silvia.
„Aber ich habe im Hinterkopf, dass auch mir jederzeit wirklich alles passieren kann.“
„So ist das Leben. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wie oft spielt der Tod in deiner Praxis eine Rolle?“
„Nicht zu oft, aber immer wieder.“
„Und wie gehst du damit um?“
„Mit der nötigen Distanz. Was nicht immer ganz gelingt. Aber ich muss aufpassen, dass es mir nicht zu nahegeht.“
„Wie ist das bei mir?“
„Du bist meine Freundin, Silvia.“
„Du machst da einen Unterschied?“
„Der ergibt sich ganz von selbst.“
„Aber was ist anders?“
Jetzt machte Karoline eine Pause. Musste sich ein paar Tränen aus den Augen wischen.
„Karoline …“
„Es macht mich betroffen. Es berührt mich, und ich habe Angst um dich.“
„Mein Gott! Angsthasen oder Hosenscheißerinnen sind wir zwei aber noch nie gewesen“, reaktivierte Silvia ihren früher so gewinnenden Humor und schmunzelte.
Jetzt musste auch Karoline lachen.
„Meine Rede. Manchmal macht das Verdrängen Sinn.“
„Eben. Stell dir nur vor, wir wüssten, was uns so alles blühen wird. Die Suizidraten würden in die Höhe schießen.“
Karoline blieb unvermittelt stehen.
„Hast du schon daran gedacht?“
„Daran, mich umzubringen? Selbstverständlich. Das könnte mir viel Leid ersparen. Aber solange es noch einen Funken Hoffnung gibt …“
Silvia beobachtete ein Passagierschiff, das die Donau hinunterglitt.
„Eine Kreuzfahrt ans Schwarze Meer. Noch vor einem halben Jahr habe ich mir geschworen, dass ich so etwas Langweiliges frühestens mit 80 mache. Aber jetzt … jetzt wäre ich liebend gerne auf diesem Schiff.“
„Ein schöner Plan fürs nächste Jahr.“
„Das hängt davon ab, wie sich mein Tumor entwickelt und ob die Behandlung endlich anschlägt.