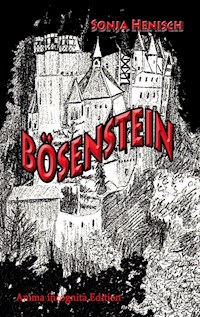
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mutter brennt mit dem Regisseur der Theatergruppe durch. Es kommt zum Brandanschlag wegen Flüchtlingen. Ein Jugendlicher erfährt der Dinge, die eigentlich nicht für seine Ohren geeignet wären. Die Schwester des Freundes wird vom Onkel vergewaltigt. Ein Vater will das Verbrechen decken und schlägt deshalb seine Frau krankenhausreif. Ein anderer Vater, der seine Töchter missbraucht und schwängert. Ein Musiklehrer, der den Holocaust leugnet und Jugendliche in eine militante Gruppe ordert. Und ein Theatermensch mit Motorrad, der versucht Ordnung in das Chaos zu bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich.Thomas Bernhard
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 1
Die Sirene plärrt ihren schwirrenden, auf und nieder schmetternden Ton durch das Tal. Dichter, weißer Rauch verhüllt jeden Anhaltspunkt, jede Ecke und Kante, jeden Durchgang, jedes Fensterbrett und auch den Handlauf der Stiege der kleinen Schule.
Er beißt zwar nicht in den Augen und brennt nicht in den Lungen, wie der Rauch eines richtigen Brandes. Unangenehm ist er trotzdem. Diese Simulation gehört zu der Feuerprobe, die mein Vater, der Feuerwehrhauptmann des Ortes gemeinsam mit dem Direktor, den Lehrern der Schule und den Schülern abhält. Dass die Klassentüre der ersten Klasse geöffnet wird, kann ich an den Stimmen erkennen. Frau Moser, die Klassenlehrerin, hat in den letzten Tagen mit den Erstklässlern immer wieder dafür geübt. Die Kleinen stellen sich in der Zweierreihe an und müssen sich dann so die Hände reichen, dass eine lange Kette mit allen Kindern zustande kommt. Jetzt sollen sie das im weißen, undurchsichtigen Rauch machen und die Stiegen nach unten gehen.
Die gegenüberliegende Klasse ist auch schon abmarschbereit. Ich kann die Stimme von Frau Auer genau erkennen. Dahinter erklingen die sonoren Worte des Schulleiters: „Na, was ist? Doris, dann Susi! Los geht’s! Und Kinder: Leise und vorsichtig! Schritt für Schritt!“
Ich, stehe noch immer bei der Türe vor dem Lehrerzimmer, bin unsichtbar in der Unsichtbarkeit, habe den Nebel mit Hilfe meines Vaters erzeugt und beobachte hier den weiteren Ablauf der Dinge. Ich kann mehr fühlen als erkennen, schemenhaft erfasse ich, wie sich die Kinder langsam, Schritt für Schritt zur Treppe herantasten, ihren Klassenlehrerinnen nachfolgen und merke, wie sich ihre zerfließenden Silhouetten bald im Weiß auflösen. Gelegentlich dringt ein kurzer Schrei oder ein „Pass auf!“, an mein Ohr.
Als die Klasse des Schulleiters loszieht, mischt sich der Nebel mit dem Geräusch eines anhaltenden Tumults, von gegenseitigem Anrempeln und Stoßen, vielleicht auch gelegentlichem Zwicken und sonstigen üblen Ausdrucksformen des unleidlichen Miteinanders.
Ebenerdig gibt es hier noch eine Klasse, das sind die Großen, die im letzten Jahr die Schulküche benützen. Deshalb liegt der Klassenraum auch direkt neben der Küche.
Diese Kinder hatten, nach Anweisung, das Schulgebäude zuerst verlassen.
Die Stimmen und Geräusche sind leise geworden, klingen jetzt von sehr fern. Vermutlich haben alle das Gebäude verlassen, ohne, dass jemand gestürzt ist. Jetzt ist es an mir, einen Klassenraum wieder zu betreten, um ein Fenster zu öffnen.
So hat es mein Vater angeordnet. Mit der Drehleiter soll ich, zum Gaudium der Zuseher, aus dem Gebäude gerettet werden. Es ist sozusagen die Belohnungsshow für die Kinder, die zwar gerettet, aber ohne Mantel im Freien vor der Schule stehen und der Dinge harren, die noch oder nicht kommen.
Ich fühle, dass es noch nicht an der Zeit ist und öffne die Türe des Lehrerzimmers.
Eigentlich ist es nur ein schmaler Raum mit Kästen an der einen und Tischen an der anderen Seite. Auf den Tischen stehen ein Kopier- und ein Schneidegerät. Dahinter an der Wand hinter den Tischen gibt es eine Türe, unbeachtet zwar, fast unsichtbar, aber vorhanden. Es ist eine Metalltür, mit Wandfarbe in einem beigen Farbton. Über dem Tisch steckt der Schlüssel. Ich drehe nach rechts, die Tür springt auf. Mit Bedacht ziehe ich den Schlüssel ab und stecke ihn in meine Hosentasche. Dann steige ich durch die kleine Tür in den nächsten Raum, ziehe die Metalltür an den Rahmen heran und schiebe von innen den Riegel ins Schloss. Ein staubiger Dachboden nimmt mich in Empfang.
Draußen, vor dem Schulgebäude warten die Kinder auf dem kleinen Platz. Vor jeder Gruppe steht die Klassenlehrerin wie eine Glucke. Nur bei den Viertklässlern ist niemand. Der Schulleiter Hannes Wildhas, ein passionierter Jäger, steht drüben beim Feuerwehrhauptmann. Seine Schüler sind sich mehr oder weniger selbst überlassen. Weil ihnen fad ist, versuchen sie sich gegenseitig auf die Zehen zu treten, was sehr bald in ein tumultartiges Geschrei ausartet, welches die drei Lehrerinnen mit mehr oder weniger pädagogischen Geschick zu dämpfen versuchen.
Das Feuerwehrauto mit dem Hebekran steht neben der Figur des Heiligen Nepomuk. Die Männer gestikulieren. Schulleiter Wildhas möchte unbedingt, dass der im Haus verbliebene Schüler mit dem Hebekran für die Show des Tages gerettet wird. Weil aber das Fenster der vierten Klasse noch nicht geöffnet ist, versucht Viktor Althauser, mein Vater, die Zeit hinaus zu zögern. Er hat keine große Lust, die mit weißem Rauch gefüllten Räume zu betreten. Er wartet, blickt auf die Armbanduhr, zieht seine Jacke zurecht und wird ungeduldig.
‚Wo der Rotzbengel so lange bleibt? ’, fragt er sich.
Es war ausgemacht, dass Daniel sofort, wenn die Kinder das Haus verlassen haben, ein Fenster der oberen Klasse öffnet. Die Fenster sind aber alle zu.
‚Vergessen wird er doch nicht haben? ’, denkt Althauser weiter, nimmt den Stahlhelm vom Kopf und kratzt sich den Schädel hinter dem rechten Ohr. Seine Haare wirken wie immer schmierig und dünn. Schließlich ruft er dem Kollegen der Feuerwehr ein paar unverständliche Worte zu und stapft in das Schulgebäude.
„Daniel! Daniel!“, ruft er, so laut er kann.
Keine Antwort.
Althauser nimmt immer zwei Schritte und rennt durch die Nebelwand die Stiegen bis zum ersten Stockwerk hinauf. Wieder ruft er und wieder kommt kein ersehntes Geräusch, kein „Papa, hier bin ich!“
Er öffnet die Klassentüre, tappt zum ersten Fenster, reißt beide Fensterflügel auf, dann das nächste Fenster, bis alle geöffnet sind und der Rauch durch die hereinströmende Luft dünner und dünner wird.
Althauser schreit auf den Platz hinunter, dass er Daniel noch nicht gefunden hat.
Die unten können es nicht glauben.
Althauser rennt zurück, öffnet die weiteren Klassen, ruft, öffnet Fenster, sucht den Buben in den Toiletten, kommt zurück, weiß nicht mehr wo er suchen soll. Steif steigt er die Stufen hinunter, sucht den Sohn im Kanzleiraum, in der Schulküche, im Umkleideraum und im Turnsaal. Zuletzt verlässt er das Gebäude durch die Veranda. Im Schulgarten, steht er knieweich im Gras und brüllt: „Daniel, wenn ich dich erwische, aber dann kannst du etwas erleben!“
Ein Lichtstrahl fällt durch die Dachluke und lässt die Staubpartikel im Sonnenlicht tanzen. Zögernd schaue ich mich um. Dunkle Dachbalken und Stützbalken ordnen sich im Raum. Auf der Südseite atmet der Dachraum durch eine runde Öffnung den Duft des Waldes. In der Ecke wartet ein verstaubtes Kasperltheater mit seinen in einer Schachtel ruhenden Puppen auf den nächsten Auftritt. Ich krame und nehme eine Puppe nach der anderen in meine Hand. Der Kasperl ist im Spiel immer lustig, obwohl er keine Eltern hat, nur die Großmutter ist da, und der muss der Kasperl helfen. Noch nie hat jemand erzählt, was mit Kasperls Familie passiert ist, warum er keine Eltern oder Geschwister hat. Er ist eigentlich ein armer Kerl und dennoch lustig und fidel. Dann gibt es den Freund Seppl. Ob der auch ein Waisenkind ist? Von der Gretel weiß man ebenfalls nichts Genaues. Eine seltsame Gesellschaft. Die Prinzessin hat im Spiel zumindest einen Vater, die Mutter gibt es nicht. Vielleicht hat die sich in den Jäger verliebt und den König verlassen? ‚Blödsinn‘, denke ich weiter. ‚Der Jäger hat sicher nicht soviel Gold wie der König. Hat er mehr Gefühl? Dass das Krokodil keine Familie hat, passt. Ein Krokodil genügt wahrlich und ein Räuber auch. Nur, warum der Räuber ein Räuber geworden ist, das habe ich auch noch nicht herausgefunden’, sinniere ich.
‚Ob der Räuber schon als Räuber zur Welt gekommen ist? Als Sohn einer Räuberbraut und eines Räuberhauptmannes, das wäre vielleicht möglich’.
Neben dem Kasperltheater liegt eine Matratze, ein paar alte Decken und sogar ein Polster. Ich wundere mich und mache es mir gemütlich. Da entdecke ich Kleidungsstücke von einem Balken hängen. Eine Uniform hängt da, komplett: Jacke, Hose, Ledergürtel mit Pistolentasche. Die Pistolentasche ist leer. Dafür hängt ein Stahlhelm auf dem nächsten Kleiderbügel. Einen Ledergürtel mit der Lederscheide und einem Messer gibt es auch. Es ist zu verlockend, diese Kleidungsstücke nicht anzuprobieren. Noch dazu, wo ich schon die passende Größe habe.
Meinen geheimen Platz habe ich aufgegeben. Ich bin bei der hinteren Dachluke über eine Metallleiter in den Schulgarten geklettert und habe diesen beim Seitenausgang verlassen. Obwohl die Kinder aller Klassen mitsamt den Lehrerinnen, dem Schulleiter Hannes Wildhas und den Männern der freiwilligen Ortsfeuerwehr mit meinem Vater vor dem Schulgebäude auf die große Show warten, hat mich niemand bemerkt, als ich an ihnen vorbei schlich. Noch dazu in dieser Aufmachung! Das ist schon seltsam! Eine komplette Uniform aus dem letzten Weltkrieg habe ich an, die Jacke ist mit an den Schultern nebeneinander genähten silbernen Plattschnüren verziert. Echt geil!
Ich bin schon neugierig, was meine Schulkollegen dazu sagen, wenn sie nach der Schule in den Park kommen. Bis dahin werde ich mich in die Dorfkonditorei setzen, gleich neben der Bachbrücke. Von dort hat man einen guten Ausblick, was rundum geschieht.
Ich nehme an einem runden Tisch Platz, höre dem Glucksen der kleinen Wellen zu, die braun und grün mit Schaumkronen über die Steine hüpfen und im Schatten der Brücke verschwinden.
Die Kellnerin kommt durch die dunkelgrün umrahmte Glastüre und sieht sich um. Ich winke ihr und möchte eine Limo bestellen. Sie reagiert nicht. Beim zweiten Versuch rufe ich ihr zu. Sie dreht sich auf der Stelle um und verschwindet im Café. Nachdem ich noch ein wenig gewartet habe, stehe ich auf, gehe zur Türe und rufe meine Bestellung laut hinein. Linda, die Kellnerin und derzeitige Besitzerin der Konditorei schaut kurz auf und macht sich dann an der Theke zu schaffen. Sie wischt Gläser sauber und stellt sie ins Regal hinter ihr. Dann dreht sie die Musik des Senders Ö3 lautstark auf. Verunsichert stehe ich da, als ich von hinten einen Stoß erfahre und auf die Theke stürze. Dabei fällt ein Glas mit Gummibärchen um und die Tierchen verteilen sich hüpfend auf dem Boden. Ich drücke mich in die Ecke und sehe die dicke Emmi aus dem Fleischerladen gegenüber eben einen Barhocker erklimmen. Mein Blick wendet sich nach draußen. Da rennt meine Mutter aus dem gegenüberliegenden Haus.
Die Kellnerin bückt sich, um die Gummibärlis mit dem Besen auf eine kleine Schaufel zu kehren und zu entsorgen.
„Na, was meinst du zu der Sache?“, höre ich die dicke Emmi, welche eingetreten ist und mich geschubst hatte, Linda, die Kellnerin, fragen.
„Wozu?“ wird ihr als Antwort rück erstattet.
„Nun zu der Geschichte mit dem Motz. Seine Frau, die Fini, ist schon ganz mager vor Kränkung geworden und die Anni, diese dumme Gans, bekommt nicht genug von dem Alten!“
„Ich kenne die Geschichte etwas anders“, meint gelassen die Kellnerin.
„Der Motz hat sich so lange um die Anni bemüht und ist ihr nachgelaufen, bis sie nachgegeben hat!“
„Und was ist mit dem Vickerl? Der war auch nicht mehr jung, wie sie ihn geheiratet hat? Oder hat sie ihn am Ende nur wegen des Besitzes und der Pferde genommen, die sie so liebt?”
Die Kellnerin zuckt mit den Achseln.
„Ja, woher soll ich das so genau wissen? Ich weiß auch nur, was so geredet wird. Darf ich dir einen Kaffee machen?“
Die dicke Emmi nickt und versinkt in tiefes Schweigen, trinkt ihre Tasse leer zahlt, rutscht vom Hocker und verschwindet danach wieder dorthin, woher sie gekommen ist: in den Fleischerladen, hinter Berge von rohem Fleisch und Würsten.
Ich nehme mir eine Limonade aus der Kiste hinter der Schank, öffne sie und trinke einen kräftigen Schluck. Niemand hat etwas davon bemerkt. Erst als ich die leere Flasche hinstelle, wundert sich Linda.
Betroffen schleiche ich aus dem Laden und begreife immer mehr, dass ich von meiner Umwelt nicht gesehen werde.
Meine Mutter hat also eine Affäre mit dem Motz! Meine Mutter, die aussieht wie ein Engel, mit ihren strahlend blauen Augen, ihrem blonden Haarschopf und ihrer mädchenhaften Figur. Ich habe mir immer vorgestellt, meine Mutter gibt es schon immer so und der Bildhauer, der die Kapelle mit dem Schutzengel am Ende der Schlossstraße gemacht hat, hat meine Mutter als Modell vor sich gesehen. Vielleicht ist alles harmlos, diese Frauen verbraten nur eine Halbwahrheit und es ist ganz anders.
Gedankenverloren spaziere ich durch den Park, gehe über die Brücke, die über den kleinen Teich führt, der immer mehr zuwächst und gelange schließlich zum Kinderspielplatz mit dem Beach Volley Ball Platz. Dort ist der Treffpunkt der etwas Größeren.
Es ist noch niemand da, obwohl auch die Hauptschüler bereits Schulende haben.
Deshalb setze ich mich auf eine Bank und warte.
Kurz darauf kommen Julian und seine jüngere Schwester Jasmin von der Straße zum Park herunter. Noch kann ich sie nicht sprechen hören, aber ich sehe, dass Jasmin verheult ist. Ihr Gespräch wirkt aufgeregt, emotionell. Jetzt setzen sie sich auf die Bank neben mich. Auf mein freundliches „Hallo, Leute!“, reagieren sie nicht.
„Also, jetzt erzähl mir, was hat Onkel Leschek, von dem du immer so begeistert warst, gemacht?“, bohrt Julian.
Jasmin heult nur noch mehr. „Wozu soll ich es dir denn nochmals erzählen, wenn du es mir nicht glaubst!“, stößt das Mädchen dann hervor. Die Schultern beben. Unter der Nase hat sich Rotz gesammelt. Ihr Bruder drückt ihr ein Papiertaschentuch in die Hand.
‚Eigenartig’, denke ich. ‚Die tun alle so, als würden sie mich nicht sehen und ich erfahre die intimsten Geschichten. Mehr und mehr begreife ich, dass mich die anderen tatsächlich nicht sehen können‘.
Jasmin hat, wie schon öfters, gestern bei ihrem Onkel und Taufpaten im Nachbarort schlafen wollen. Der hat nämlich einen Großbildfernseher und kann auch Programme aus Polen anschauen. Und gestern war eine Konzertübertragung. Irgendetwas, auf das Teenies abfahren. Dieses Programm hatte Jasmin unbedingt sehen wollen. Damit hätte sie heute ihre Schulkolleginnen beeindrucken können.
„Aber dann“, höre ich Jasmin weiter berichten und sie berichtet durch einen Vorhang der Tränen und durch einen Wall des Schmerzes, dann haben mich beide geschlagen, mein Onkel und sein Freund, damit sie mit mir Sachen machen können…“, die Stimme wird immer leiser, der ganze Körper bebt, die Schultern sind hochgezogen und der Kopf verschwindet dazwischen.
„Was für Sachen?“, höre ich den Bruder fragen.
„Einer hat mich auf dem Bett festgehalten und der andere hat mir die Beine auseinander gedrückt, und dann hat sich Onkel Leschek auf mich gelegt und…“.
„Was, er hat dich wirklich gefickt!“, schreit Julian jetzt auf, „So eine Sau!“, empört er sich.
Er steht mit seiner Schwester auf und ich höre ihn im Weggehen sagen: „Du, das müssen wir…“
Ich sitze betroffen allein auf der Bank.
Mein Herz krampft sich zusammen.
Ausgerechnet Jasmin musste das passieren! Diesem schüchternen, zarten, Geschöpf, vor dem ich vor Verehrung fast vergehe. Natürlich lasse ich mir nichts anmerken. Ich drehe mich immer weg, damit sie nicht sehen kann, wenn meine Ohren heiß und rot werden. Im letzten Sommer im Freibad bin ich in der Nähe des Bassins gelegen und habe immer an ihren schlanken Beinen hochgeschaut, wenn sie vorbei ging. Und jetzt das!
Lange sitze ich noch im Park und denke nach. Soll ich die Sache dem Pfarrer erzählen? Oder dem Schuldirektor Wildhas? Nein! Dem sicher nicht, der würde nur blöd herumreden, aber nichts tun. Vielleicht hat mein Klassenvorstand demnächst Zeit. Aber wie soll ich erklären, dass ich davon weiß?
Weil ich hungrig bin, habe ich vor, daheim, in der Küche vorbei zu schauen.
Ich verlasse den Park und gelange zur Hauptstraße, die durch den Ort hindurch und weiter hinein ins Gebirge führt. Auf der anderen Straßenseite liegt das Haus meines Vaters. Es ist ein graues, hohes Gebäude, etwas verwahrlost, weil der Umbau viel Geld kostet. Daneben steht das Wirtschaftsgebäude mit den Ställen. Meine Mutter liebt die Pferde. Untertags stehen sie auf der Koppel. Am Abend müssen sie in den Stall. Über dem Stall ist der Heuboden.
Die Stiegen in den ersten Stock springe ich mit großen Schritten hinauf, öffne die Küchentür und stehe vor meiner Mutter. Verheult steht sie da, die Haare zerzaust, dreht sie sich zum Fenster mit einer Zigarette in der Hand.
Gerne wüsste ich, was an den Worten, die ich gehört habe, stimmt. Doch es schnürt mir die Kehle zu. Meine Mutter zu fragen, steht mir nicht zu. Außerdem bezweifle ich, dass sie meine Worte versteht.
Blitzschnell greife ich in die Brotdose, hole Brötchen hervor. Aus dem Apfelkorb schnappe ich zwei Äpfel und stecke sie in die Hosentasche. Da stolpert fluchend mein Vater zum Tor herein.
Er stürmt die Treppe hinauf, ich höre ihn schreien: „Anna, Anna, Daniel ist weg! Verschwunden!“
Vorsichtig schleiche ich die Stufen nochmals hinauf.
„Ja verdammt noch einmal! Ist dir das völlig egal? Hast du überhaupt mitbekommen, was ich gesagt habe?“, brüllt mein Vater durch das Haus, in dem überall volle Wäschekörbe stehen.
Meine Mutter sieht ihn mit tränennassen Augen an.
„Was? Du hast es also doch schon gehört, dass unser Bub verschwunden ist“, murmelt mein Vater ziemlich verdutzt und nimmt sie in die Arme. „Der muss doch wieder auftauchen, er war nur in der Schule. Sicher ist ihm wieder irgendein Blödsinn eingefallen!“, tröstet er sie.
Ich schlendere die Dorfstraße entlang. Vor der kleinen Kapelle unter dem Felsen salutiere ich. Ich blicke kurz rundum. Es ist niemand da, der mich sehen könnte.
Eigentlich ist es schade, finde ich. Fesch und schneidig fühle ich mich in der Uniform, bin damit ein richtiger und ganzer Kerl! Ein paar Schritte weiter, dann bin ich beim Schwetz, unserem Wirt. Das Gasthaus liegt gegenüber vom Bahnhof. „Dschungelexpress“ bezeichnen Lästermäuler die Bahn die von draußen, von der Stadt zu uns ins Tal hereinfährt. Es stimmt, dass nicht mehr viele Leute die Bahn benutzen. Sie fährt auch nur mehr vier Mal am Tag. Die meisten Leute haben ein Auto und fahren mit diesem in die nächste Stadt, wenn größere Besorgungen zu machen sind.
Den Türflügel des Gasthauses stoße ich auf, begebe mich nach links in den Gastraum. Mit großen Augen starrt Alfons Schwetz, der Wirt, auf den noch immer schwingenden Türflügel.
Vermutlich ist seine Erklärung dafür, dass er heute bereits zu viel Alkohol genossen hat. Kurz darauf verschwindet er und seine Frau löst ihn ab.
Heute erlaube ich mir etwas, wozu ich noch nie die Gelegenheit hatte. Ich gehe im Raum herum und betrachte die alten Fotografien, die dunkel gerahmt an den Wänden hängen. Sonst hat mich immer jemand gerufen und mir einen Auftrag erteilt, wenn ich die Fotos genau betrachten wollte. Aber heute ist alles anders.
Auf das Foto mit dem Schwetz-Gasthof, geschmückt mit einer Hakenkreuzfahne, fällt mein Blick zuerst. Das nächste gerahmte Foto zeigt einen Mann vor dem Bahnhof in Uniform und mit Stahlhelm und ausgestrecktem rechten Arm. Das dritte Bild zeigt Knaben auf der Sonnkogelwiese, vermutlich mit einem Ausbildner. „Schöne Zeiten“, steht darunter gekritzelt. Unwillkürlich greife ich erst jetzt in die Brusttasche der Uniform und ziehe unerwartet einen Anhänger heraus. Es ist ein blau emailliertes Kreuz mit einem goldenen Strahlenkranz, in dem sich ein Kreis mit einer Inschrift befindet. Ich drehe das Ding in meiner Hand und lese: „Der deutschen Mutter“. Innerhalb der Inschrift befindet sich das rechtsdrehende Sonnenrad, bei uns Hakenkreuz genannt. Da fällt mir ein: Droben, auf dem Weg zur Burg, ist dieses Hakenkreuz auch an einen Felsen gemalt, aber mit weißer Farbe.
‚Geil‘, denke ich, was ich alles entdecke!
Weil ich schon da bin, drücke ich mich in eine Ecke und beobachte die Männer, die um diese Zeit schon im Wirtshaus hocken. Ich kenne sie alle. Die meisten von ihnen haben hinten im Wald eine kleine Wirtschaft oder ein Sägewerk. Wer eine Wirtschaft hat, lebt hier vom Holz. Die Männer spielen Karten und konsumieren Bier und Schnaps.
Als die Wirtin wieder eine Runde Bierkrügeln bringt, fasst sie einer am Hintern. Sie klatscht ihm über die Finger.
„Geh, sei nicht so empfindlich!“, meint ein Mannsbild mit lockerer Zunge, die Geschichte mit deinem Vater kennt doch ohnehin ein jeder!“
Die Wirtin dreht sich um und verschwindet ohne eine Antwort gegeben zu haben.
Der dicke Franz nimmt sich eine Zigarette aus der silbernen Zigarettendose, dreht sie ein paar Mal zwischen den fetten Fingern hin und her und greift schließlich zum Feuerzeug. Mit einem tiefen Zug bringt er den Glimmstängel tatsächlich zum Leuchten, pafft eine Wolke vor sich her und beginnt zu erzählen und zieht mich hinein in eine für mich völlig neue Geschichte.
Ihr müsst euch vorstellen, dort, wo die Wirtin herstammt, aus Greinau, war Kirchweihfest. Es war in den 50-er Jahren. Ein paar Schießbuden waren aufgestellt mit Papierrosen und Muschipuppen mit übergroßen Kulleraugen. Die Holzbauern saßen im Wirtshaus nach der Messe, die Frauen waren daheim bei Kochtöpfen und Kindern. Ein paar Protestantenköpfe sind auch hereingeschneit, drüben vom anderen Tal und lehnten an der Schank herum. Am Stammtisch machte man abfällige Bemerkungen. Die Stimmung wurde gespannter. „Sakra, ist mein Schilling weniger wert, als der eines schwarzen Kerzenschluckers?“, wurde hörbar, als der Wirt kein weiteres Krügel ausschenken will.
„Bleibt doch daheim in Eurem Tal, oder gibt es dort kein Bier?“ stänkerte einer zurück „ihr Protestantengesindel!“
„Komm, gehen wir“, sagte da ein Hagerer mit scharfer Nase und wollte einen schmalen Kerl zur Tür hinausdrängen.
Der riss sich los, mit einem Satz stand er beim Stammtisch. „Du Sauschädel bist schuld, dass mein Vater nicht mehr am Leben ist! Du hast ihn den Hang hinauf gehetzt, um dort Bäume zu schlägern und du hast genau gewusst, wie gefährlich das ist! Und du hast auch gewusst, welche gefährliche Zeit im Jahr das war! Wenn ich noch einmal eine blöde Meldung von dir höre, dann stech ich dich ab!“ Seine Klinge fuhr summend in die Tischplatte und blieb vibrierend dort stecken.
Ein stämmiger, rotgesichtiger Bauer im zünftigen Lodenjanker mit Silberknöpfen dran, erhob sich mächtig.
„Das getraust du dir nicht noch einmal zu sagen! Jeder hier weiß, dass dein Vater ein ziemlicher Depp war. Besoffen wird er gewesen sein, sonst wäre er nicht von dem Baum erschlagen worden. Jeder hier weiß, dass die Holzknechte gut bezahlt waren. Und jetzt schaut, dass ihr fortkommt, sonst…“
„Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, höhnte jetzt der Scharfnäsige.
Ein Krügel flog durch den dunklen Wirtsraum und trifft den Kleineren an der Stirn. Dem wurde schwarz vor den Augen und er kippte blutüberströmt vornüber.
Wie auf Kommando verließen die Stammtischler das Wirtshaus, einer nach dem anderen verdrückte sich nach Hause.
Der Wirt schob die Störenfriede zur Tür hinaus in den Garten. Der Große wischte dem Verletzten das Blut von der Stirn und lehnte ihn draußen mit dem Rücken an einen Baum. Die Blasmusik spielte neben der Kirche einen feschen Landler und einige Burschen und Mädchen standen lachend unter der Linde.
Ein zartes Mädchen in einem viel zu großen Dirndlkleid erblickte die beiden. Es kam herüber und fragte, was denn geschehen wäre. „Misch dich nicht ein, es geht dich nichts an“, sagte ein Bursch und wollte sie am Arm zurückziehen.
Sie riss sich los und wollte dem Schmalen beim Aufstehen helfen. „Gleich wird es dir wieder besser gehen. Möchtest du mir nicht eine Rose schießen?“ fragte das Mädchen leicht verschmitzt. „Ich würde mich riesig freuen!“ Jetzt schaute sie die beiden mit flehenden Augen an. „Mir geht es auch nicht gut bei meinem Bauern!“
Im selben Augenblick kam der feiste Bauer vom Stammtisch mit einem Pferdewagen die Straße entlang. Er hielt an, zog das Mädchen zu sich auf den Kutschbock und fuhr mit ihm rasch davon. Es wagte nicht, sich los zu reißen und vom Wagen zu springen. Auf einer Anhöhe bei einer Jagdhütte hielt er an.
Er zerrte das Mädchen vom Wagen hinter die Hütte, warf es auf den Boden, schob ihm den Kittel hinauf.
„Dem Gesindel machst du freiwillig schöne Augen, und ich wäre für dich ein Niemand, obwohl du von mir dein Fressen hast, na das will ich sehen!“ Das Mädchen ließ den Segen willenlos mit sich geschehen. Danach setzte sich der Dicke auf seinen Wagen, ließ das wimmernde Mädchen neben der Hütte bedenkenlos liegen und fuhr seelenruhig zurück.
Mir ist schlecht von der Erzählung. Luft steigt in mir hoch und ein glucksendes Geräusch entfährt mir. Angst, entdeckt zu werden ist da. Zum Glück prosten eben ein paar Biertrinker einander zu und der dicke Franz fährt fort mit seiner Geschichte.
Die Dunkelheit brach ein. Die Stallarbeit war noch nicht gemacht, die Kühe muhten bereits unruhig im Stall.
„Wo das Mensch solang bleibt?“, fragte verständnislos die Bäuerin.
„Die wird sich noch am Kirtag herumtreiben, du weißt ja, was du von so einer Dirn zu halten hast,“ meinte versonnen der Bauer und goss sich noch ein Schnapserl ins Glas.
Da hörte die Bäuerin draußen schlurfende Schritte und machte die Tür am Gang auf.
Die sonst ordentlich hochgebundenen, geflochtenen Haare hingen dem Kind zerzaust herunter, das Gesicht war verweint und mit Dreck verschmiert, der Kittel zerrissen. Die Beine zerkratzt und blutig.
„Fein kommst du daher, das passiert, wenn man den Dienstleuten zu viele Freiheiten gönnt!“ fiel der Bäuerin dazu ein.
„Jetzt schau, dass du schnell in den Stall kommst, das Vieh schreit schon und ist hungrig, und die Kühe wollen gemolken werden!“
Das Mädchen drückte sich sprachlos an ihr vorbei und wollte in seine Kammer. Da holte die Bäuerin aus und versetzte ihm einen heftigen Schlag.
Danach nahm sie selbst das Kopftuch, holte den Melkeimer und ging hinüber in den Stall.
Vom nächsten Tag an hieß es für Elisabeth noch früher hoch vom Strohsack und noch mehr Arbeit.
Allerdings stellte sie am Morgen beim Stall Ausmisten des Öfteren die Scheibtruhe beiseite und erbrach, obwohl sie noch nichts im Magen hat, als ein paar Schlucke Tee.
Ich erinnere, wie es war, bevor mein Bruder Gabriel auf die Welt kam. Da konnte meine Mutter auch eine Zeit lang nichts essen, ohne, dass ihr danach schlecht war. Ich muss aufpassen, dass ich die weitere Erzählung nicht verpasse, denn der Franz redet inzwischen weiter.
Misstrauisch wurde die Bäuerin, als sie im Garten nach einigen Wochen noch immer keine Monatstücher hängen sah und alsbald kombinierte, dass das Mädchen schwanger sein muss. Solang es genug arbeitete, soll es ihr Recht sein.
Ein Maul mehr zwar, dass gefüttert werden muss, das bedeutete früher oder später aber für Jahre eine ansonsten kostenlose Arbeitskraft. Wenn sie Elisabeth allerdings darauf ansprach, brachte diese keinen Ton heraus und die Bäuerin erfuhr daher nicht das Geringste, was vielleicht Stoff für den Dorftratsch abgeben hätte können. Dieser bestand daher allein in der Annahme, das Mädchen sei schwanger.
Daher riet die Bäuerin dem Mädchen, doch zum Pfarrer in die Kirche zu gehen, um zu beichten. Insgeheim hoffte sie, dass damit die Zunge sich ein wenig lockern möge. Dem war aber nicht so. Elisabeth ertrug ihr Schicksal ohne mit irgendjemandem darüber zu reden.
Sie war aus der Lilienfelder Gegend gekommen, zwölf Kinder waren sie daheim auf dem elterlichen Hof, was sollte sie von dort hoffen. Was sollte sie überhaupt hoffen? Gerade, dass sie in den spärlichen Schultagen lesen und schreiben gelernt hatte, ohne wohlhabende Eltern, die ihr vermittelt hatten, nach einem braven Ehemann Ausschau zu halten. Welcher brave Ehemann, der ihr gefiel, wollte so eine haben mit einem fremden Bankert? Vielleicht war es auch unwichtig, ob ihr einer gefiel. Vielleicht genügte es, wenn sie gefiel. Vielleicht genügte es, wenn einer eine Frau brauchte und sie haben wollte. Nein, sie wollte diese Gedanken nicht weiterspinnen, während sich ihre mageren Körperformen langsam ausdehnten.
Wenn ihr der Bauer im Haus allein begegnete, griff er ihr unter den Kittel und zwickte sie in das magere Hinterteil. Dazu grinste er: „Du kannst froh sein, wenn du noch einem gefällst! Einen Anständigen findest du jetzt nicht mehr!“
Da wurde es ihr einmal zu viel und sie fauchte zurück: „Meinst du vielleicht so anständig, wie du bist? Auf so einen spuck ich!“ Etwas irritiert wendete sich da der Bauer ab, vor allem aber weil seine Ehefrau gerade erschienen ist und dem Mädchen die Wäsche zum Aufhängen im Garten hin gestellt hatte.
Die schleppte trotz ihres Hohlkreuzes und vorgeschobenen Beckens den randvollen Korb hinaus auf die Wiese, dorthin, wo die Wäscheleinen zwischen den Zwetschkenbäumen gespannt waren. Stück für Stück zog sie die karierten oder bedruckten Tuchent- und Polsterüberzuge, die vielen Leintücher, Handtücher, Unterhosen, Leibchen und Hemden aus dem wilden Durcheinander und befestigte sie sehr genau mit den hölzernen Kluppen an der Schnur. Danach sollte sie hinunter ins Dorf, zum Kaufmann, um dort frischen Käse und selbst gebrannten Schnaps abzuliefern.
Die Flaschen hatte sie in einem kleinen Holzwägelchen, ebenso den in saubere Tücher eingeschlagenen Käse. Als sie zur Dorflinde kam, merkte sie, wie ein paar von den jungen Leuten im Dorf, mit denen sie noch vor einiger Zeit Spaß gehabt und gelacht hatte, sich scheinbar zufällig von ihr abwandten, um sie nicht sehen zu müssen.
Nur die Frau im Laden fragte sie nach ihrem Befinden und als Elisabeth meinte, es ginge ihr gut, was hätte sie denn anderes sagen sollen, wechselte die Krämerin das Thema. Hätte sie der Frau gestehen sollen, wie kraftlos sie sich fühlte, wie entwürdigt, wie ausgenützt und wie grenzenlos gemein sie behandelt wurde?
„Du wirst schon wohl deinen Teil beitragen haben, dass es so ist“, würde wohl die Antwort gewesen sein und vor einer solchen Antwort hatte Elisabeth Angst. Sie, die Sanfte, hatte Angst, davor auszurasten, der Welt die ganze gemeine Wahrheit und Brutalität ins Gesicht zu schreien und weiter die Angst davor, wieder gedemütigt zu werden, weil ihr niemand Glauben schenkte.
Also nickte sie bei den Worten übers Wetter, steckte das zugeschobene Geld für ihren Herrn ein und wollte sich eben auf den Rückweg machen, als genau zu diesem Zeitpunkt der Schmale mit der Platzwunde am Kopf, die zu diesem Zeitpunkt schon verheilt war und sich nur noch durch einen dunkelrosa Strich auf der Stirne als vorhanden bestätigte, vorbeikam.
„Na, jetzt passt du doch in das ein wenig zu große Dirndlkleid hinein“, meinte Matthias. Elisabeth senkte beschämt den Blick.
“Dass du mich gerade ausspottest, das hätte ich nicht geglaubt, “ sagte sie leise. Da nahm er ihr schmales Kinn in seine breiten Hände, schaute ihr lang ins Gesicht und fragte: „Willst du mich heiraten?“
Ihr schossen die Tränen in die Augen, heiße Tränen voll Not und Verzweiflung. Sie wagte nicht zu sagen: „Ich werde es mir noch überlegen.“
Sie wusste, er war Holzarbeiter, hinten vom engen Tal am Weißenberg, wo die Nichtkatholischen hausten.
Aha, denke ich mir, wieder etwas Neues erfahren! Davon habe ich noch nie etwas gehört.
Sie wusste, er gehörte zu denen, die Ausbeutung kannten und sich dagegen zur Wehr setzten. Darauf setzte sie und antwortete: „Wenn du mich mit dem Kind nimmst?“
Er fragte nicht einmal nach dem Vater. Wahrscheinlich hätte sie die wahre Geschichte ihrer leidvollen, schuldlosen Schwangerschaft nicht Preis gegeben. Aber es wäre für sie das Gefühl gewesen, dieser Mann hätte Interesse an ihr, an ihrer Geschichte. Er grummelte nur: „Mit oder ohne Kind, das ist völlig egal. Wir werden sehen, ob das Kleine überhaupt durchkommt!“, was ein nicht sehr gefühlvoller, dafür aber klar berechnender Gedanke war.
Also wurde vereinbart, dass sie noch bis zum Monatsende beim Bauern bleiben soll. Danach wurde auf der Gemeinde und in der Kapelle geheiratet. Mit einem geliehenen Fuhrwerkswagen reisten sie in den heimatlichen Graben. Schattig war es bereits, die steilen Hänge knapp neben der Straße waren bedeckt mit Fichten, wenigen Tannen, an den sonnigen Hängen mit Kiefern, die damals noch größtenteils mit Pechhäferln versehen waren, um das Harz zur Weiterverarbeitung aufzufangen.
Romantische Felsenformationen öffneten den sich weitenden Talgrund und gaben den Blick auf eine nette Häusergruppe frei, die den Dorfeingang bildete. Matthias gab jetzt den Wagen mit Pferd beim ersten Haus ab, griff nach den Bündeln am Wagen und machte sich mit seiner jungen Frau auf den Weg zu seinem einfachen Haus.
Es war niedriger als die meisten anderen, bestand nur aus einer großen Küche und zwei Nebenräumen. Angebaut waren zwei kleine Ställe für Schafe und Schweine. Die Hühner hatten einen extra Verschlag, wo sie Fuchs und Marder nicht so leicht überraschen konnten.
Matthias hatte verschwiegen, dass es noch eine Schwiegermutter gab. Diese nahm Elisabeth mit der Schnapsflasche in der Hand in Empfang, versicherte ihr, was sie für eine prächtige Ehefrau für ihren Hias abgeben werde und dass sie sich freue, endlich weniger Arbeit zu haben.
Als sie bald mit dem ihr fremden Mann in der einer der beiden Kammern, deren Wände aus rohen Holzbalken gebaut waren, im Bett lag, hörte sie das Schnarchen der Schwiegermutter durch die Wände.
Immerhin nahm Matthias sie in seine Arme und sie konnte ihren Kopf mit den brünetten langen Locken an seiner Brust lagern. In der Stadt draußen trugen die Frauen schon seit Jahrzehnten kurz geschnittenes Haar. Hier war die Zeit stehen geblieben. Von welchem Geld sollte sie einen Haarschnitt bezahlen? Wer weiß, ob sie mit kurz geschnittenen Haaren so hübsch ausgesehen hätte? Die flackernde Petroleumlampe an der Wand lieh ihren Wangen einen rosigen Schein und dem Haar einen goldenen Schimmer. Der ihr Angetraute erfreute sich ihrer mädchenhaften Schönheit, die trotz des gewölbten Bauches unter dem Nachthemd geblieben war. Sanft legte er seine breite Hand auf ihren Bauch und fühlte das Pochen des werdenden Lebens. So schliefen sie wie ein verliebtes Paar ein, trotz des Schnarchens der Frau im Nebenraum.
Elisabeth versorgte die Tiere, putzte, kochte, strickte, nähte und tat, was so anfiel. Manchmal durfte sie mit dem Postbus nach Siebenkirchen fahren, um Einkäufe zu machen. Das war vor allem Baumwollstoff und Wolle, um die Baby-Ausstattung fertig zu stellen. Oft saß Elisabeth mit der Schwiegermutter im Garten, wo Rittersporn, Rosen, Lavendel und Ringelblumen blühten und die Frauen fertigten gemeinsam Jäckchen und Höschen, Häubchen und Söckchen für den Kleinen. Matthias jedoch musste früh, noch im Dunkeln, hinaus auf die Hänge, wohin der Fußmarsch oft lange dauerte. Er hatte seine Brote, seinen Apfel, manchmal ein Bier mit und kam dann erst wieder, wenn die Sonne hinter den Bäumen verschwand. Mit einem Trupp anderer Männer, machten sie sich gemeinsam nach Auftrag der Bauern oder des Grafen auf, bestimmte Teile des Waldes auszulichten oder manche Hänge zu roden, bevor sie wieder mit schnellwüchsigen Fichten aufgeforstet wurden. Dann gab es zwischendurch auch Arbeit auf so manchem Sägewerk, wo man beim Verarbeiten des Holzes Hilfe nicht scheute. Die Holzstämme wurden in diesen Tagen noch nicht mit dem Lastkraftwagen ins Tal befördert. Mit einem Zappel, einem hakenförmigen Werkzeug, zog man den Stamm an eine richtige Stelle, um ihn beim nächsten Schnee durch eine Schneise weiter hinunter gleiten zu lassen, von wo es dann die Möglichkeit eines Transportes mit Hilfe des Fuhrwerks gab.
Bei einem dieser Transporte war es, als der Graf Matthias anredete. Grafen gab es offiziell zu dieser Zeit nicht mehr. Aber da auch sonst die Zeit hier in dieser Bergwelt stehen geblieben war, redeten die hier Ansässigen den Herrn X. mit Herrn Graf an und daran wird sich in den kommenden hundert Jahren auch nichts ändern. An manchen Orten gehen die Uhren besonders langsam.
Nun, der Graf machte Matthias auf ein Haus auf einem sonnigen Wiesengrund inmitten einer herrlichen Wiese aufmerksam. Dieses Haus wäre sehr günstig zu erwerben. Dafür hätte Matthias jederzeit Arbeit im Sägewerk und außerdem einen Posten als Forst- und Jagdgehilfe bei ihm. Dieser Graf war noch ein richtiger Herr. Sein Wort galt, an seinem Handschlag brauchte keiner zweifeln. Er und seine Gattin waren bei jeder sonntäglicher Frühmesse und versuchten tatsächlich dem zu entsprechen, was eine christliche Lebensweise bedeutete. Dazu gehörte auch die angewandte Nächstenliebe und da war es egal, ob es sich um einen Lutheraner oder einen Katholiken handelte. Bei manchen Menschen ändert sich eben doch etwas, selbst dort, wo die Uhren langsam gehen.
Elisabeth wollte vor dem Umzug die Geburt ihres Kindes abwarten. Weil Matthias aber der sichere Arbeitsplatz wichtig war, wollte er möglichst rasch sein Häuschen verkaufen und hinüber ins sonnige Zeistertal ziehen.
Jetzt wird mir klar, welches Haus gemeint ist. Das Haus, hinten, im Zeistertal an der Straßenseite, wo es nicht weit ist zum Sägewerk und wo dann der Weg steil bergauf geht zum Sattel, das muss es sein. Die Nase beginnt mich zu jucken. Ich halte sie fest mit Zeigefinger und Daumen zu, um nicht nießen zu müssen.
Am selben Tag, als Matthias und seine Mutter den Kasten, die Truhen, den Tisch mit den Sesseln und die Betten aufgeladen hatten, bekam Elisabeth Schmerzen. Zunächst noch leicht und ziehend, dann immer stechender, dann pochend und ziehend, sich in immer kürzeren Abständen wiederholend. Elisabeth wand sich vor Schmerzen. Es blieb noch die dunkle Kücheneckbank, auf die sie sich legen konnte, dann ein Schrei und Wasser rann zwischen ihren Beinen hervor.
Matthias hielt ihr den Kopf und die Hand, die Nachbarin kam. Man trug sie hinüber in ein fremdes Bett. Eine alte Frau wurde geholt und um Hilfe gebeten. Die schüttelte auch nur bedenklich den Kopf und hieß die anderen einen Topf mit Wasser auf den Herd stellen, um heißes Wasser zu machen. Elisabeth wurde erschüttert, sie fühlte sich nur noch als Schmerz. Diesen Schmerz loswerden war ihr einziger Gedanke.
Besser diesem Schmerz entkommen, als dieses eigene, schäbige Leben verlieren. So kam es dann auch, dass zwar der Kopf des Knaben aus dem Mutterleib Austritt fand, aber als dann auch das Körperchen nachgefolgt war, hatte der kleine Körper zu atmen aufgehört.
Vielleicht war es Elisabeths harter Kampf gewesen, den sie mit ihrem Bauern geführt und auf diese Weise gewonnen hatte! Sie war dieses ungewollte Kind einer Vergewaltigung losgeworden!
Nun fragte sie sich, ob diese dafür eingegangene Ehe wirklich ihre Notwendigkeit hätte. Jetzt wäre sie ohne Kind, sie hätte wieder überall hingehen können und hätte eine Stelle gefunden. Von einer Totgeburt hätte niemand erfahren. Eine Ehe aufzulösen war hier aber undenkbar. Draußen, in der Stadt, davon hörte man schon, ließen sich die Leute manchmal scheiden. Aber hier, im Bergland, gab es das nicht. „Bis das der Tot euch scheidet“, hieß es hier und das könnte noch lang sein. Matthias war gut zu ihr, sie durfte nicht klagen. Er gab ihr Geld, ließ sie wirtschaften, war freundlich und nett, hatte bislang von ihr im Bett noch nichts gewollt, weil sie ja schwanger gewesen war und er sich auf den Buben, da war er ganz sicher gewesen, freute.
Während sie sich noch einige Tage schonen musste, wurde in der Zwischenzeit das Häuschen drüben im anderen Tal von hilfsbereiten Nachbarn geschrubbt und wohnlich gemacht, sodass Matthias sie nur mit einem Wagen abholte und sie in das neue Heim brachte. Da stand sie nun und schaute sich um, während sich die Schwiegermutter bereits am Herd zu schaffen machte.
Die Stube war hell und freundlich, man blickte hinaus auf den Bauerngarten, wo zwischen Unkraut Malven und Rittersporn blühten. Neben der Stube gab es eine kleine Speisekammer, darunter eine Klapptür zum Keller.
Von der Stube aus konnte man in drei weitere Kammern kommen. Von dort aus blickte man hinauf auf die Wiese und zum Wald, wo Apfelbäume und Zwetschkenbäume eine gute Ernte versprachen.
Vom Vorraum aus gab es sogar eine kleine, hölzerne Treppe hinauf auf den Dachboden.
Als sie alles bestaunt hatte, erblickte sie neben dem Haus einen Schuppen und einen Stall, wo die Ziegen und Schafe ihren Unterstand hatten. Für die Hühner, die bereits eifrig auf der hinteren Wiese herum gackerten, gab es auch einen sicheren Verschlag. So hatte hier alles wieder seine Ordnung gefunden.
Auf dem dunklen, schweren Holztisch stand bereits eine dampfende Kartoffelsuppe, als sie aus der Sonnenhelle wieder ins Haus trat. Sie löffelte schweigend mit den beiden anderen aus der großen Schüssel.
Ohne Worte nahm sie nach dem Essen das Geschirr und stellte es in einen Holzzuber, der auf einem Sessel stand. Mit einem Kübel holte sie Wasser vom Brunnen vor dem Haus, wusch alles sauber und stellte danach das Geschirr in den Schrank. Die Schwiegermutter holte einen Krug mit Most und schenkte ein. „Das muss jetzt gefeiert werden“, meinte sie, „das neue Haus und das neue Leben, das jetzt für euch beginnt!“ Matthias stieß mit seinem Becher an ihren an und sagte leise: „Nimm es nicht so schwer, jetzt wird alles anders!“
Elisabeth wollte nicht nachdenken, was jetzt für sie anders werden sollte. Ihre Augen wurden feucht und sie wich seinem Blick aus.
Als Matthias sie abends in der Kammer in seine Arme nehmen wollte, befreite sie sich und drehte sich zur anderen Seite. Er streichelte trotzdem ihr Haar und meinte, sie leide noch wegen des toten Kindes.
Als sie aber weiter abweisend blieb, kam er viel später nach Hause als sonst. Der Geruch von Wirtshaus und Wein umgab ihn, als er zu ihr kam, um sein Recht als Ehemann einzufordern.
Die Wirtin kommt herein und nimmt neue Bestellungen auf. Weil es spät geworden ist, sind einige der Zuhörer bereits hungrig. Auch bei mir kracht schon der Magen. Frisches Gulasch, Bohnensuppe und Würstel bietet sie an, Bier kommt natürlich noch dazu. Ich nütze den Lärmpegel um hinaus zu schlüpfen und auf die Toilette zu gehen. Als ich zurückkomme und mich auf Zehenspitzen zu einem leeren Platz auf der Eckbank begebe, erzählt der Franz schon weiter, während sich die Zuhörer für die weitere Erzählung stärken.
Elisabeth kümmerte sich fleißig, so wie sie es gewohnt war, um Haus und Garten. Sie hielt den Stall sauber, versorgte die Tiere, fütterte schon zeitig am Morgen die Hühner, noch bevor sie Matthias den Malzkaffee und den Sterz zubereitete. Danach putzte sie das Haus, wusch die Wäsche draußen im Bottich in der Waschküche, wo sie zuerst den Kessel heizen musste. Oft ging sie mit einem Buckelkorb hinauf in den Wald, um das nötige Holz zu klauben. Im Spätsommer brachte sie herrliche Steinpilze und Parasole, die köstlich schmeckten.
Aber das unbeschwerte Lachen, das sie damals, an jenem Kirchtag noch hervorzaubern konnte, war nicht wieder zu hören. Manchmal saß sie oberhalb des Hauses auf der Bank unter einem Lindenbaum und blickte hinunter auf das Tal und das Haus. Da kam es vor, dass ein Summen aus ihr hervorbrach. Manchmal entstand dann daraus ein Lied, eines von jenen Liedern, das sie als Kind daheim noch gehört hatte. Wenn Matthias aber zu ihr heraufkam, verstummte sie. Er nahm dann ihre Hand in die seine und hoffte noch immer, mit ihr glücklich zu werden. Oder wollte er, dass sie doch mit ihm glücklich wäre?
Im Sommer darauf lag ein Kind in der hölzernen Wiege, die Matthias eigens hatte machen lassen. Elisabeth war sehr glücklich mit der Kleinen. Ihre Augen strahlten, wenn sie die kleine Anna in den Arm nahm. Sie versuchte allerdings, das Kind von ihrer Schwiegermutter fern zu halten, so gut es ging, weil diese immer wieder von schweren Hustenanfällen geplagt wurde. Matthias brachte der alten Frau Kiefernharz zum Lutschen, Elisabeth machte ihr Schmalzwickel, aber der Husten wurde nicht besser.
Dafür guckte die kleine Anna munter aus ihrem Bettchen, wenn sie gerade nicht schlief, übte ihre kleinen Hände und strampelte sich fleißig durch den Tag. Draußen vor dem Haus bereitete Elisabeth ihr manchmal eine Decke und das Kind krähte fröhlich nach den zwitschernden Meisen. Bald robbte es nach den Gräsern und Blüten und besonderen Spaß machte es ihm, auf Elisabeths Schoß auf und ab zu wippen, um seine Beinchen stark werden zu lassen. Kam Matthias dann abends nach Hause, lachte und quietschte es ihm fröhlich entgegen.
Zärtlich saß er dann mit der Kleinen im Arm abends im Garten, genoss den kühlen Abendwind, kitzelte sie dann am Hals, bis sie herzhaft krähte und erzählte ihr vom Wald und den Tieren, die darin lebten.
An einem solchen Abend war es, als er aus der Kammer der Alten einen pfeifenden, tief in die eigenen Lungen schneidenden Ton hörte, dann ein heftiges Keuchen und als er hineineilte, lag die Mutter mit verdrehten Augen auf dem Lager, die Hände in die Decken gekrallt. Elisabeth holte rasch ein nasses Tuch und legte es der Kranken auf die Stirn, sie öffnete die Bluse und rieb den Oberkörper mit Branntwein ab. Die Augen waren verdreht, der Atem wurde immer flacher. Dann war ein heftiges Aufbäumen, die Lippen waren blau, langsam verfärbten sich auch die Nägel, während der Körper wieder zurücksank.
Matthias stand fassungslos da mit der Kleinen im Arm.
Der Arzt war weit weg, mindestens eine Stunde Fußweg war es ins Dorf.
Er legte das Kind in sein Bettchen und machte sich auf, um den Doktor zu holen, obwohl ihm klar war, dass seine Mutter bereits dieses Leben gelassen hatte.
Als er mit dem Arzt zurückkam, konnten dieser nur, wie befürchtet, den Tod der Frau feststellen.
Elisabeth legte ein frisch gebügeltes Leintuch über die Tote und verhängte den einzigen Spiegel im Haus.
„Damit sie sich nicht schreckt, wenn sie merkt, dass sie nicht mehr unter den Lebenden weilt“, kommentierte sie ihr Tun. Matthias nickte nur still dazu. Dann stellte sie zwei Kerzen neben das Bett, holte ihr Gebetsbüchlein und begann daraus zu beten. Später gesellten sich noch die Nachbarin, die Sägewerksbesitzerin, und deren alte Tante dazu.
Die ganze Nacht hindurch beteten die Frauen die Litaneien. Als am nächsten Morgen der Pfarrer vorbeikam, schlichen sie alle wie Schatten durch das Haus. Selbst die kleine Anna krähte nicht so fröhlich, wie sonst. Sie spürte an der Stimmung der Großen eine unheimliche Veränderung. Der Pfarrer setzte die Gebete fort, besprengte die Tote mit geweihtem Wasser und setzte das Begräbnis für den übernächsten Tag fest. Danach ließ er sich mit Brot. Speck und Schnaps bewirten und sich mit einem Fuhrwerk zurück in den Ort bringen.
Es war ein stilles Begräbnis mit nur wenigen Verwandten. Als die Trauernden dann im Gasthaus beisammensaßen und über das Leben der Verstorbenen sprachen, warf plötzlich eine der Tanten von Matthias ein: „Ja, ja, der eine kommt, der andere geht!“
„Was meinst du damit?“ fragte Matthias.
„Das sieht doch ein Blinder, dass bei euch schon wieder etwas Kleines unterwegs ist“ meinte darauf die etwas breit geratene, der Verstorbenen nicht allzu ähnlich sehende Tante. „Hoffentlich wird es dieses Mal ein Bub!“
Matthias schaute verstohlen und irritiert nach seiner Elisabeth, die mit rotem Kopf auf die Tischplatte starrte.
Dann schaute sie hoch, verzog ihren Mund zu einem Lächeln, stieß Matthias in die Seite und meinte: „Es hat nie gepasst, wenn ich es sagen wollte, ich wollte dich in einem passenden Augenblick überraschen.“
Matthias zog seine Frau rasch zu sich und drückte ihr einen herzhaften Kuss auf den Mund. „Jetzt gibt es doch einen Buben!! Darauf gibt’s a extra Runde“, rief er begeistert. Der Wirt brachte grinsend eine metallene Untertasse mit randvoll gefüllten Schnapsgläsern, die alle zügig leerten. Mit „Hallo“ brachen alle auf und trollten sich heimwärts.
Im Winter lag wieder nur ein Mädchen in der Wiege.
Matthias war inzwischen Vorarbeiter im Sägewerk geworden. Das bedeutete, dass er für drei andere Männer die Arbeit einteilen und planen musste. Dafür hatte er jede Woche einen Hunderter mehr im Lohnsäckchen. Den brauchte er auch, denn mittlerweile hatte Elisabeth zwei weitere Mädchen zur Welt gebracht. Trotzdem hatte er sich einiges zur Seite gelegt und sich damit ein Motorrad gekauft. Kein neues, denn dazu hätte es nicht gereicht. Aber er fühlte sich jetzt unabhängig, konnte ohne auf ein Fahrzeug oder auf den Bus zu warten hinüber nach Greinau oder nach Tiefau fahren. Das brachte ihm einiges an Selbstbestätigung. Auch wenn er dann im Wirtshaus gehänselt wurde, er könne nur Mädchen machen. „Dafür kann ich mir einen Harem aufmachen, wenn ich will!“ schrie er dann oft hinüber in die Runde grölender Mannsbilder. Worauf diese zurück brüllten: „Na das wollen wir sehen!“
„Geht’s nach Siebenkirchen ins Puff, da könnt ihr vielleicht zuschauen!“, war dann meist seine Antwort. Worauf sich dann die anderen wieder murmelnd ihren eigenen Gesprächen zuwandten, ihre Krügel hoben und laut einander zuprosteten und der Kellnerin auf den Hintern klatschten. Helmuth, sein hagerer Freund von früher, klopfte ihm dann wohlmeinend auf die Schulter und munterte ihn auf: „Du schaffst das schon mit deinen Mädeln!“
Helmuth warf eine Münze in die Music-Box und „Rock around the clock“ heulte heraus.
Die Bauern und ein paar anwesende Jäger verstummten und Helmuth rief übermütig: “Nun, ist das nicht eine Weltnummer?“
„Aufhören mit diesem Scheiß! Macht eure Nummern daheim oder sonstwo, “ prustete der rotgesichtige Bauer, der Matthias so wohlbekannt war. Er stand auf und zog den Stecker aus der Steckdose. Jaulend verstummte die Musik. „Du hast am wenigsten jemandem zu sagen, wo er seine Nummern machen soll, du Dienstmädelschänder!“, tobte jetzt Matthias.
„Was? Du wagst es, mich zu beschuldigen? Ohne Beweis wird dir das teuer kommen!“ baute sich der Rotgesichtige vor Matthias auf.
„Der Beweis liegt seit acht Jahren am Friedhof“, setzte Matthias nach.
„Ach ja, und ein Bub wäre es gewesen, das was du nicht schaffst!“, höhnte der Bauer jetzt.
„Schleich dich, du alte Sau, “ schimpfte ihn Matthias und stützte sich mit den Armen auf der Tischkante auf, während er sich erhob, „und trau dich ja nicht in meine Nähe, sonst zeige ich dich jetzt noch an, weil die Elisabeth kann noch immer gegen dich aussagen!“
Daraufhin zog sich der Fettsack in seine Ecke am Stammtisch zurück.
Die Kellnerin erschien wieder mit einem Tablett, voll mit Schnapsgläsern.
Alles grölte und einer griff ihr unter den Kittel.
„Irmgard, du schönes Kind, zeig uns deine Titten!“ schrie einer.
„Nur sachte meine Herren, wer wird denn gleich so vulgär sein?“ antwortete die dralle Irmgard aus Hamburg, die auf der Flucht vor ihrem Zuhälter hier gestrandet war.
„Wer gut zahlt, darf sogar anfassen, aber zuerst wird gewogen!“
Die Augen vom Stanagl Pepi aus einem Graben bei Bösenstein wurden immer stierer.
„Ich zahl einen Fünfziger“, und er tappte schon mit seinen Klodeckelhänden in ihrem üppigen Dirndlausschnitt.
„Geh, sei nicht so geil“, zierte sie sich und begab sich hinter die Theke zur Waage.
„Zuerst rechts oder links?“ fragte Irmgard jetzt kokett, was zu ihrer Statur nicht besonders passte.
„Beide!“ grölten die Männer.
„Also zuerst links, weil links ist Herz“, meinte Irmgard und ließ ihre linke Brust aus dem Ausschnitt rutschen. „Soviel Feinsinn hätte ich dir nicht zugetraut“, schnaubte einer zu ihr hinüber, während sich seine Wangen röteten.
Der Zeiger der Waage schlug weit aus, es war aber in der schummrigen Atmosphäre nicht zu erkennen, was er anzeigte. „Fünf Kilo zehn“, frohlockte die üppige Kellnerin.





























