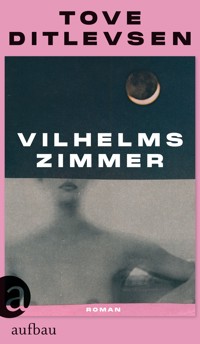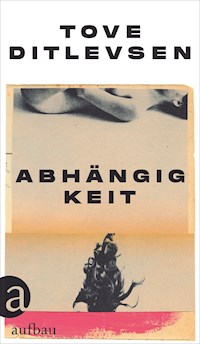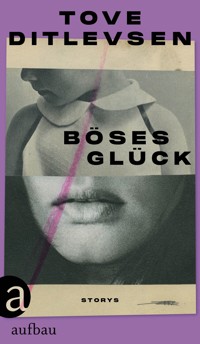
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erstmals in deutscher Übersetzung ausgewählte Storys von Tove Ditlevsen, Autorin der gefeierten »Kopenhagen-Trilogie«
Eine frisch verheiratete Frau sehnt sich obsessiv nach einem gelben Regenschirm. Ein Ehemann verjagt die geliebte Katze seiner Frau. Eine betrogene Mutter entlässt impulsiv ihre Haushälterin. Unter der Oberfläche dieser unbeirrbar scharf beobachteten Geschichten über Liebe und Beziehungen im Kopenhagen des 20. Jahrhunderts pulsieren Verlangen und Verzweiflung. Während vor allem die Frauen darum kämpfen, den ihnen zugewiesenen Rollen zu entkommen, träumen sie davon, frei und glücklich zu werden – ohne je ganz zu verstehen, was das wahrhaft bedeuten könnte. Luzide kartografiert Ditlevsen Momente des Alltags, die ein Leben in eine andere Richtung wenden. Der Band »Böses Glück« zeigt sie als Meisterin der kurzen Form.
»Ditlevsen schreibt Sätze, die eigentlich Gemälde sind.« FAS.
»Von hypnotischer Qualität.« THE NEW YORK TIMES.
»Es ist kein Zufall, dass Tove Ditlevsen gerade wieder entdeckt wird. Man hat ihre sezierende Prosa mit der Annie Ernauxs verglichen. Der Vergleich ist berechtigt. Was sie verbindet, ist ihre Fähigkeit, einer widrigen Wirklichkeit standzuhalten. Im Leben, und wenn nicht im Leben, dann in der Literatur.« TAZ.
»Diese funkelnden Geschichten beschwören tiefste Gefühlsquellen herauf.« VOGUE.
»Ditlevsen kann mit wenigen Worten eine ganze Welt erstehen lassen.« THE TIMES.
»Eine monumentale Autorin.« PATTI SMITH.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Eine frisch verheiratete Frau sehnt sich obsessiv nach einem gelben Regenschirm. Ein Ehemann verjagt die geliebte Katze seiner Frau. Eine betrogene Mutter entlässt impulsiv ihre Haushälterin. Unter der Oberfläche dieser unbeirrbar scharf beobachteten Geschichten über Liebe und Beziehungen im Kopenhagen des 20. Jahrhunderts pulsieren Verlangen und Verzweiflung. Während vor allem die Frauen darum kämpfen, den ihnen zugewiesenen Rollen zu entkommen, träumen sie davon, frei und glücklich zu werden – ohne je ganz zu verstehen, was das wahrhaft bedeuten könnte. Luzide kartografiert Ditlevsen Momente des Alltags, die ein Leben in eine andere Richtung wenden.
Über Tove Ditlevsen
Tove Ditlevsen (1917–1976), geboren in Kopenhagen, galt lange Zeit als Schriftstellerin, die nicht in die literarischen Kreise ihrer Zeit passte. Sie stammte aus der Arbeiterklasse und schrieb offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Heute gilt sie als eine der großen literarischen Stimmen Dänemarks und Vorläuferin von Autorinnen wie Annie Ernaux und Rachel Cusk. Die » Kopenhagen-Trilogie« mit den drei Bänden »Böses Glück«, »Jugend« und »Abhängigkeit« ist ihr zentrales Werk, in dem sie das Porträt einer Frau schafft, die entschieden darauf besteht, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Die »Kopenhagen-Trilogie« wird derzeit in sechzehn Sprachen übersetzt.
Bei Aufbau ist zuletzt »Gesichter« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tove Ditlevsen
Böses Glück
Storys
Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
DER REGENSCHIRM
DIE KATZE
MEINE FRAU TANZT NICHT
SEINE MUTTER
KÖNIGIN DER NACHT
EIN MORGEN IN EINEM WOHNGEBIET
EIN GUTER JUNGE
DAS EIGENSINNIGE LEBEN
ABEND
DEPRESSION
DAS MESSER
EIN GUTES GESCHÄFT
DIE KLEINEN SCHUHE
ZWEI FRAUEN
BÖSES GLÜCK
Impressum
DER REGENSCHIRM
Helga hatte schon immer, und vollkommen widersinnig, mehr vom Leben verlangt, als es bieten konnte. Menschen wie sie wandeln zwischen uns und unterscheiden sich äußerlich kaum von denen, die instinktiv eine Bilanz ziehen und genau den Platz in der Welt finden, der ihnen gemäß Aussehen, Fähigkeiten und Herkunft zusteht. Hinsichtlich dieser drei Faktoren war Helga bloß durchschnittlich ausgestattet. Als sie auf den Heiratsmarkt entsandt wurde, war sie ein etwas zu kleines und farbloses junges Mädchen mit schmalen Lippen, Stupsnase und – als einzig vielversprechendem Vorteil – einem Paar großer, fragender Augen, die ein aufmerksamer Beobachter als »verträumt« beschrieben hätte. Nach ihren Träumen gefragt, wäre Helga jedoch in Verlegenheit geraten.
Spezielle Begabungen hatte sie nie gezeigt. In der Grundschule war sie gut zurechtgekommen und auch immer lange auf ihren Stellen als Hausmädchen geblieben. Sie hatte nichts gegen die Arbeit, die in ihrer Familie so selbstverständlich war wie das Atmen. Alles in allem war sie anpassungsfähig und bescheiden, ohne dabei allzu verschlossen zu sein. Sie hatte einige Freundinnen, mit denen sie abends in Tanzlokale ging. Dann trank jede von ihnen eine Limonade und hielt Ausschau nach einem Partner. Wenn sie lange genug gesessen hatten und nicht aufgefordert worden waren, hätten ihre Freundinnen mit jedem getanzt, und sei es ein Buckliger. Helga dagegen blickte sich nur zerstreut im Raum um, und die Männer, die sie als gut aussehend einstufte – sie waren immer dunkelhaarig und hatten braune Augen –, betrachtete sie so lange, offensichtlich und ernst, dass es ihnen nicht entgehen konnte. Forderte ein anderer als einer dieser wenigen Auserwählten sie auf (was im Übrigen nicht oft geschah), blickte sie schüchtern auf ihre Knie hinab, errötete schwach und entschuldigte sich unbeholfen: »Ich tanze nicht.« Einige Tische weiter verfolgte ein Paar brauner Augen diesen seltenen Anblick. Dies war ein Mädchen, das sich nicht dem Erstbesten an den Hals warf.
Und so bewegten viele kleine Schwärmereien die Oberfläche ihrer Seele, wie der Frühlingswind die jungen Blätter erzittern lässt, ohne den Lauf ihres Lebens zu ändern. Der Mann begleitete sie nach Hause und küsste kalte, verschlossene Lippen, die sich nicht zu irgendeiner Leidenschaft öffnen ließen. Helga war sehr konventionell. Heiraten musste sie nicht unbedingt, ehe sie sich hingab, aber sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, vorher einen Ring am Finger zu tragen und den Auserwählten ihren Eltern vorzustellen. Diejenigen, die zu ungeduldig oder zu mäßig interessiert waren, um dieses Prozedere abzuwarten, verschwanden mehr oder weniger enttäuscht wieder. Mitunter streifte Helga ein leiser Schmerz; dann vergaß sie ihn in ihrem Lebensrhythmus aus Arbeit, Schlaf und neuen Abenden mit neuen Möglichkeiten.
Bis sie im Alter von 23 Jahren Egon traf. Er verliebte sich in ihre Besonderheit, ihre unbestimmbare Eigenart, die nur selten von anderen Menschen entdeckt und noch seltener als Vorzug eingestuft wurde.
Egon war Mechaniker und interessierte sich außerdem für Fußball, Wetten, Billard und Mädchen. Doch weil jeder Verliebte vom Flügelschlag höherer Sphären gestreift wird, fing dieser gewöhnliche Mann plötzlich an, Gedichte zu lesen und sich so gewählt auszudrücken, dass seine Kollegen in der Werkstatt erstaunt gewesen wären, hätten sie ihn gehört. Rückblickend betrachtete er diese Zeit wie eine schwere Krankheit, die nicht spurlos an seinem Leben vorübergegangen war. Doch solange es währte, war er stolz auf Helga und entzückt über ihre sorgsam gehütete Unschuld, und als sie endlich den Ring trugen und der Antrittsbesuch bei der Familie überstanden war, nahm er sein Eigentum auf dem Schlafsofa seines gemieteten Zimmers in Besitz. Es war, wie es sein sollte. Sie hatte ihn nicht getäuscht. Zufrieden schlief er ein, hinterließ Helga aber in einem verwirrten Gemütszustand. Sie weinte ein wenig, denn sie hatte, auch davon, etwas Wunderbares erwartet. Ziemlich vergebliche Tränen, denn jetzt war ihr Weg endgültig abgesteckt. Das Hochzeitsdatum stand fest, und die Aussteuer war gesammelt, und sie hatte ihre Stelle gekündigt, weil Egon nicht wollte, dass sie »für andere Leute schrubbte«, wenn sie erst einmal verheiratet waren. Ihre Freundinnen waren angemessen neidisch und ihre Eltern zufrieden. Egon war Facharbeiter und stand damit eine kleine Stufe über ihrem Vater, der ihr beigebrachtet hatte, man solle niemals nach unten streben, sich allerdings auch nie »etwas einbilden«.
Helga hatte an diesem Abend kein klares Gefühl, dass etwas Einschneidendes mit ihr passiert war. Trotzdem lag sie lange wach, ohne an etwas Bestimmtes zu denken. Erst im Halbschlaf schwebte ein eigenartiger Wunsch in ihr Bewusstsein: Hätte ich doch bloß einen Regenschirm, dachte sie. Plötzlich kam es ihr so vor, als wäre es genau dieser für manche Menschen so alltägliche Gebrauchsgegenstand, von dem sie schon ihr ganzes Leben träumte. Als Kind hatte sie vor Weihnachten immer Wunschzettel mit vernünftigen, erschwinglichen Dingen geschrieben: eine Puppe, ein Paar rote Fäustlinge, Rollschuhe. Doch sobald die Geschenke an Heiligabend unter dem Baum lagen, geriet sie in eine erwartungsvolle Ekstase. Sie starrte auf die Pakete, als enthielten sie den Sinn des Lebens, und ihre Hände zitterten beim Auspacken. Anschließend weinte sie über die Puppe, die Fäustlinge und die Rollschuhe, die sie sich gewünscht und auch bekommen hatte. »Du undankbares Wesen«, sagte ihre Mutter wütend, »du machst uns alles kaputt.« Das stimmte auch, denn am nächsten Heiligabend oder Geburtstag wiederholte sich die Szene. Sie wusste nie, was sie in diesen festlich verpackten Paketen eigentlich zu finden glaubte. Vielleicht hatte sie schon einmal einen Regenschirm auf den Wunschzettel geschrieben und ihn nicht bekommen. Es wäre allerdings auch albern gewesen, ihr etwas so Lächerliches und Überflüssiges zu schenken. Ihre Mutter hatte nie einen Schirm besessen. Wind und Wetter hatte man so zu nehmen, wie sie kamen, und sollte sich bloß nicht einbilden, Haut und Haar persönlich vor dem Regen schützen zu dürfen, der alles andere durchnässte.
In der folgenden Zeit, in der Helga sich in Gedanken ganz ihrem künftigen Dasein als Ehefrau widmete und gemeinsam mit ihrer Mutter alle Tätigkeiten ausführte, die zu den Pflichten einer Verlobten gehörten, kam es nichtsdestotrotz häufig vor, dass sie nachts wach an der Seite ihres Mannes oder allein in ihrem Dienstmädchenzimmer lag und ihrem sonderbaren Traum von einem Regenschirm nachhing.
Ein bestimmtes Bild formte sich in ihr und verlieh diesem geheimen Gedanken einen Hauch von etwas Verbotenem, Leichtsinnigem, der selbst im wachen Zustand über ihren Gesichtszügen lag wie ein zarter, nicht greifbarer Schleier und ihren Verlobten mitunter zu dem Ausruf veranlasste: »Woran denkst du denn nur?«, verärgert und eifersüchtig, als würde er sie irgendeiner Untreue verdächtigen. Einmal antwortete sie: »Ich denke an einen Regenschirm«, und er erwiderte überzeugend ernst: »Du spinnst ja wohl!« Zu diesem Zeitpunkt hatte er längst aufgehört, Gedichte zu lesen, und er sprach auch nicht mehr von ihren »verträumten Augen«, was jedoch keinesfalls bedeutete, dass er enttäuscht war; vielmehr war sie ein für alle Mal ein Teil seines Lebens und seiner Gewohnheiten geworden. Sie sah unzählige Fußballspiele mit ihm, ohne je zu begreifen, was es mit dieser Unterhaltung auf sich hatte, die andere Menschen dazu bewegte, Hurra zu grölen und sich wie wild zu gebärden.
Das Bild, das sich aus ihrer Erinnerung formte, war folgendes: Sie saß, etwa zehn Jahre alt, auf dem Fensterbrett im Schlafzimmer der Familie und blickte in den Hof hinab, der spärlich vom Licht über der Treppe des Hinterhauses beleuchtet wurde. Sie war im Nachthemd und sollte eigentlich im Bett liegen, hatte es sich jedoch angewöhnt, für eine Weile hier zu sitzen, ehe sie schlafen ging, und in den Abend hinauszusehen, während ein sanfter Friede die Ereignisse des Tages aus ihren Gedanken verdrängte. Dann ging die Tür zur Straße auf, und über die feuchten Pflastersteine des Hofs, auf die in hitzigem Takt Regentropfen platschten, trippelte ein anmutiges, traumgleiches Wesen. Ein langes gelbes Kleid berührte fast den Boden, und hoch über einer Fülle von seidigen Locken schwebte ein Regenschirm. Nicht so wie der Schirm ihrer Großmutter, der rund war, wie eine Kuppel gewölbt und schwarz, mit einem soliden Griff, sondern ein flaches, helles, durchsichtiges Gebilde, das noch ein Teil der Person zu sein schien, die es trug; wie die glänzenden Flügel eines Schmetterlings. Es dauerte nur einen kurzen Moment, dann lag der Hof wieder so da wie vorher, aber Helgas seltsam erregtes Herz schlug schneller. Sie rannte ins Wohnzimmer, wo ihre Eltern saßen: Gerade ist eine Dame über den Hof gegangen, sagte sie leise und fügte mit verwunderter Ehrfurcht hinzu: Sie hatte so einen schönen Regenschirm!
Barfuß stand sie da und blinzelte ins Licht. Obwohl sie keinen Vergleich hatte, erschien ihr das vertraute Zimmer mit einem Mal klein und ärmlich. Ihre Mutter wirkte erstaunt: Eine Dame?, fragte sie, dann zog sie, wie immer, wenn etwas ihren Unmut erregte, die Mundwinkel nach unten: »Ach, dieses Flittchen von nebenan«, sagte sie in scharfem Ton, »das ist wirklich eine Schande.« Dann richtete sich der Vater in plötzlichem Zorn an das Kind: »Warum sitzt du auch da und glotzt aus dem verdammten Fenster, obwohl du längst ins Bett gehörst«, rief er, »zieh Leine und schlaf!«
Sie hatte etwas gesehen, was sie nicht sehen durfte. Etwas, das vorher nicht existiert hatte, war in ihre Welt getreten. Normalerweise ein braves Kind, schlich sie fortan abends immer zur Fensterbank und sah das gelbe Kleid über den Hof huschen, bei jedem Wetter, aber stets von einer bezaubernden und geheimnisvollen Aura umgeben und stets von diesem merkwürdigen Regenschirm getragen; sichtbar oder unsichtbar, je nachdem, ob es regnete oder nicht. Dieser Anblick hatte nichts mit dem verschlafenen Gesicht gemein, das in der Tür der Nachbarin auftauchte, wenn Helga klingelte, um ein wenig Margarine oder Mehl für die Mutter zu borgen, der immer das Wichtigste fehlte, wenn sie gerade eine Sauce kochen wollte. Selbst als das Geschöpf eines Tages auszog, änderte sich an Helgas Gewohnheit nicht viel. Noch lange danach blieb das Kind auf der Fensterbank sitzen, um auf das lange gelbe Kleid und den schwebenden, durchsichtigen Regenschirm zu warten. Nachdem es mit dem allabendlichen Wandeln über den dämmrigen Hof vorbei war, schloss Helga einfach die Augen und hörte das Platschen des Regens auf gespanntem, seidigem Stoff, ferner und immer ferner, wie alle Geräusche und Düfte der Kindheit.
•••
Helga zog mit Egon in eine Zweizimmerwohnung, ähnlich der ihrer Eltern und auch nur wenige Ecken entfernt. Aber es war eine Erdgeschosswohnung zur Straße hin, und ein alter Traum ging in Erfüllung, als Helga in ihrem eigenen Wohnzimmer sitzen und auf den Verkehr hinabblicken konnte. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie viel Zeit, und da Müßiggang aller Laster Anfang ist (für solche Lebensweisheiten war sie anfällig), litt sie ein wenig unter schlechtem Gewissen. Nicht unbedingt gegenüber dem Mann, der sie versorgte, sondern ganz allgemein. Sie legte sich ein sanftes, entschuldigendes Wesen zu, erledigte ihre wenigen Pflichten mit übertriebenem Ehrgeiz und achtete darauf, häufig ihre Eltern zu besuchen oder von ihnen besucht zu werden. Die Schwiegereltern wohnten in der Provinz; ihnen schrieb sie oft, obwohl sie sich nur einmal bei der Hochzeit gesehen hatten. Diese Briefe, in denen sie ausführlich darüber berichtete, wie ihr Tag mit den häuslichen Pflichten verstrich und sie zu ihrem gemeinsamen Wohl das Beste aus Egons Lohn machte, endeten immer recht eintönig mit der Wendung: »Uns geht es gut, wir hoffen, Euch auch. Eure ergebene Schwiegertochter Helga.«
Jeden Vormittag ging sie mit ihrer Mutter einkaufen, beide mit einem Tuch über dem Haar und einer robusten Tasche über dem Arm. Die Mutter suchte beim Metzger das beste Stück Fleisch aus: »Männer, die hart arbeiten, müssen auch etwas Ordentliches essen«, erklärte sie. Helga servierte ihrem Mann täglich um Punkt sechs »etwas Ordentliches zu essen«. Doch in der Zeit zwischen seinem Aufbruch am Morgen und dem Essen am Abend verschwendete sie kaum einen Gedanken an ihn. Wenn sie die Einkäufe und das Putzen erledigt hatte, setzte sie sich mit einer Stopfarbeit, die sie vom Gedanken befreien sollte, dass sie ihre Zeit verbummelte, während die Leute auf der Straße offenbar alle schrecklich viel zu tun hatten, ans Fenster. Aus ihrem geschützten Versteck hinter der Gardine betrachtete Helga die Passanten ernst und aufmerksam, so wie sie vor Egons Zeit alle Männer mit braunen Augen betrachtet hatte. Eine schwache Neugier erfüllte sie: Wo wollten sie hin? Warum hatten sie es so eilig? Ohne es zu wissen, war sie ein einsamer Mensch. Sie dachte oft an ihre Mutter, weil sie in Helgas Augen als Einzige seit jeher dieselbe war. Es gab ihr eine gewisse Ruhe, mit ihr zusammen zu sein. Mutter und Kind. Geborgenheit. Sie dachte gern an ihre Kindheit zurück. Sie hörte ihre Mutter auch gern konkrete Dinge daraus erzählen. Ihre Mutter redete viel. Die Sätze strömten aus ihr hervor und bildeten solide Rahmen um ferne, verschwommene Landschaften. »Wie gut du es getroffen hast«, sagte sie oft, »du solltest das ein bisschen mehr wertschätzen, aber du warst schon immer ein undankbares Wesen.« »Inwiefern undankbar?«, fragte Helga. Dann bekam sie jedes Mal die Geschichte von all den vergossenen Tränen zu hören, wenn ihr jemand etwas geschenkt hatte. »Am Ende haben wir uns regelrecht davor gefürchtet, etwas für dich zu kaufen«, sagte die Mutter, und sie saßen beide in der Dämmerung und schüttelten den Kopf über dieses undankbare Wesen, das weinte, wenn man ihm Dinge schenkte, über die andere Kinder entzückt gewesen wären. Sie sprachen von diesem Mysterium wie von einem überstandenen Scharlach: »Mein Gott, so krank, wie du warst, hätten wir nie geglaubt, dass du dich je wieder erholen würdest.«
Am liebsten hörte Helga etwas über all das, was außerhalb der verstreuten Flecken ihrer eigenen Erinnerung lag. Die ersten Worte, die sie gesagt hatte, wie sie sauber geworden war usw. Dinge, die sich durch nichts von dem unterschieden, was andere Mütter von ihren Kindern erzählen konnten. Helgas Mutter beendete diese Geschichten gern, indem sie aufstand und ihre Sachen zusammensuchte, während sie Bemerkungen machte wie: »Ach ja, die Zeit, in der du noch klein warst, wird nie mehr zurückkommen.« Auch wenn sie klangen wie Gemeinplätze, die ohne das geringste Bedauern dahingesagt waren, hinterließen sie einen kleinen Riss in dem Schleier, der Helgas innerstes Wesen umgab wie eine Fruchtblase das ungeborene Kind.
Wenn die Mutter gegangen war (immer einige Zeit bevor sie mit Egons Heimkehr rechnete) und Helga ihrer vertrauten, robusten Gestalt so lange nachgewinkt hatte, bis sie verschwunden war, setzte sie sich erneut ans Fenster, ohne das Licht einzuschalten. Eine Traurigkeit wuchs in ihr und um sie herum. Sie dachte: Ach, wenn Egon nur bald nach Hause käme. Kam er dann aber und erfüllte die kleinen Zimmer mit seiner lärmenden Präsenz, die jeden Zauber brach, hatte sie sich doch nicht nach ihm gesehnt. Sie ging leise umher und führte ihre häuslichen Pflichten aus, aß wie ein Spatz und sagte Ja und Nein, sofern die Sätze des Mannes nach einer Antwort verlangten. Ab und zu sah er sie forschend an: »Du solltest ein Kind kriegen«, sagte er, »ich verstehe verdammt noch mal nicht, warum das nicht bald passiert.« Dann errötete sie ein wenig über ihre diesbezügliche Unzulänglichkeit, vor allem aber darüber, dass sie ein Kind in Wirklichkeit gar nicht vermisste. Die Gesellschaft ihrer Mutter erweckte das Kind Helga in ihr zum Leben, sodass gewissermaßen kein Platz mehr für etwas anderes blieb. Manchmal log sie ihn an, wenn er fragte, ob ihre Mutter da gewesen sei, denn aus irgendeinem Grund gefiel es ihm nicht, dass sie so oft zu Besuch kam, wenn er nicht da war.
So vergingen die Tage, die sich kaum voneinander unterschieden.
Eines Abends wartete Helga eine Stunde mit dem Essen auf Egon, ehe er nach Hause kam, und als er endlich eintraf, war er betrunken und warf sich auf das Sofa, von wo aus er mit einem lauernden und boshaften Blick all ihre Bewegungen verfolgte. »Was ist denn mit dir los?«, fragte er plötzlich. »Du bist ja ganz grün im Gesicht.« Sie erschrak und trug sofort ein wenig Rouge auf. Später gewöhnte sie sich an seinen ruppigen Ton. Außerdem gewöhnte sie sich daran, Essen zu kochen, das man gut aufwärmen konnte, weil sie mittlerweile nie sicher sein konnte, wann er nach Hause kam. Sie erzählte es ihrer Mutter. »Egon trinkt neuerdings.« Die Mutter schien darüber besorgter als sie selbst. »Wenn ein Mann trinkt, ist er mit seiner Frau unzufrieden«, urteilte sie, und weil sie der Meinung war, es gebe für alles eine Lösung, riet sie ihrer Tochter, sich mit Egon »auszusprechen«, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Helga hatte jedoch noch nie versucht, sich in die Gedanken eines anderen Menschen hineinzuversetzen; in erster Linie deshalb, weil es bislang nie nötig gewesen war. Ihre ganze Person bestand aus nichts als einem Haufen Erinnerungen ohne Struktur und Zeit. Es gab eine Reihe von braunen Augenpaaren, eine Dämmerungsstimmung, eine ungeheure, ziellose Erwartung, ein gelbes Kleid und einen Regenschirm. Es gab Tränen und Enttäuschungen und vieles mehr, hin und wieder auch kleine Freuden. Und es gab einmal einen Mann, der ihre schmalen, blassen Lippen geöffnet und sie für einige wenige Momente den Hauch von etwas Unbekanntem, Wundervollem hatte spüren lassen. Es gab eine Stimme, die seltsame, süße Worte zu ihr gesagt hatte, und über all das spannte der Regenschirm ihrer Kindheit und Träume sein feines Seidensegel. Das hatte nicht viel mit dem Mann zu tun, der neuerdings trank. Sie fand, sie hätte ihm so viel von sich gegeben, wie er es erwarten durfte, und ihr schwaches Gefühl von Unvollkommenheit ihm gegenüber betraf nur diese eine Sache; dass sie nicht schwanger wurde, wie es sich für eine frischgebackene Ehefrau gehörte. Doch selbst jetzt war ihr, als würde sie etwas darüber Hinausgehendes erwarten, für sich allein, einen Gewinn, der stattdessen anderen, unbekannten Menschen zufiel. Sie gab niemandem die Schuld daran, das hatte sie nie getan, dazu wusste sie zu genau, wie überzogen ihre eigenen Ansprüche waren. Auf den Wunschzettel des Lebens hatte sie erschwingliche Dinge geschrieben: ein bisschen Zeit zum Träumen, einen Ehemann mit braunen Augen – und ein Kind, Letzteres eher aus Gründen der Konvention. Nach außen hin war ihr Handeln immer von greifbaren Dingen geleitet gewesen, weshalb sie davon ausging, dass auch Egon einen sehr konkreten Anlass dafür haben musste, zu trinken und so grob mit ihr zu reden. Sie nickte ihrer Mutter nachdenklich über die Teetasse hinweg zu und versprach, sich mit ihrem Mann »auszusprechen«. Doch sie hatte bereits entschieden, dass es das ausbleibende Kind war, das ihn plagte, und über Dinge, die man nicht ändern kann, spricht man auch nicht. Nicht mal mit seiner Mutter.
An jenem Abend kam Egon erst um Mitternacht nach Hause. Mitten im Zimmer warf er seinen schmutzigen Overall auf den Boden und rief nach Helga, die gerade das Essen aufwärmte.
»Jetzt reicht es aber«, sagte er langsam und schwankte wie ein Matrose. Sie erschien in der Küchentür und starrte ihn mit ihren traurigen, verwunderten Augen an.
»Was reicht?«, fragte sie ängstlich.
Er trat einen Stuhl um und stellte sich vor sie hin.
»Alles«, sagte er und hauchte sie mit seiner Schnapsfahne an, »glaubst du, ich bin dumm?«
Sie antwortete nicht, sondern wich ein wenig vor ihm zurück. Ihre Gedanken bewegten sich so langsam, sie kamen nie ganz nach, vor allem in einer komplizierten Situation, die erst in der Erinnerung lebendig wurde.
»Das Essen brennt an«, sagte sie unsicher.
Er lachte freudlos.
»Ich brauche kein Essen«, lallte er. »Ich habe schon gegessen.«
»Wo hast du denn gegessen?«, fragte sie leise und begann ihre Schürze aufzubinden. Ihre Hände zitterten leicht. Er sah, dass sie verletzt oder ängstlich war, und lachte erneut.
»Bei einem wahnsinnig hübschen Mädchen, wenn du es unbedingt wissen willst«, rief er triumphierend. Dann rülpste er ihr ins Gesicht, ging ins Schlafzimmer und legte sich angezogen aufs Bett.
Helga folgte ihm. Sie betrachtete ihn verwirrt und hatte keine klaren Gedanken oder Gefühle, als sie auf der Suche nach einer sicheren und kindlichen Zeit flüsterte: »Das sage ich meiner Mutter.« Doch er war bereits eingeschlafen.
In Wirklichkeit empfand sie bei dem Gedanken, dass er sie aller Wahrscheinlichkeit nach betrogen hatte, nicht mehr als die Kränkung, von der sie wusste, dass sie von einer Frau in ihrer Situation erwartet wurde. Ein Mann darf nicht trinken, aber noch viel schlimmer ist es, wenn er fremdgeht. Ihre mäßige Phantasie bewahrte sie davor, ihn sich mit einer anderen Frau vorzustellen, aber das hätte auch nichts geändert. Er bedrohte lediglich ihr äußeres Leben. Sie selbst blieb unverändert, ihr Körper war derselbe wie zuvor, bis auf den kleinen Unterschied, dass sie für andere Männer im Wert gesunken war. Der Begriff »andere Männer« war ihr seit der Hochzeit nicht mehr in den Sinn gekommen. Und jetzt, während sie sich langsam auszog, dachte sie auch nur daran, weil sie wusste, dass ihre Mutter es tun würde. Wenn dieser Mann seinen Verpflichtungen gegenüber ihrer Tochter nicht nachkam, so würde die Mutter überlegen, müsste der Weg zum sicheren Lebensunterhalt eben über andere Männer mit braunen Augen führen – und diese fixe Idee, dass sie unbedingt braune Augen haben sollten, stammte ursprünglich auch von der Mutter. Eine Bemerkung, die sich festgesetzt hatte: Dunkle Männer sind die Güte in Person.
Egon schlief tief und fest, und Helga lag neben ihm und betrachtete ihn. Trotz der späten Stunde war sie nicht müde. Sein Kinn war schlaff, er hatte Bartstoppeln und schnarchte. So etwas denkt man nicht über seinen Mann, sondern nur über einen Fremden. Vielleicht war er schon lange ein Fremder für sie – seit jenem Tag, als sie sich ihm mit einer so großen Erwartung genähert hatte und mit einer so großen Enttäuschung wieder gegangen war. Auf ihre eigene stille Art und ohne es als größeres Unglück wahrhaben zu wollen. Welche Bedeutung hat ein Mensch überhaupt für den anderen, abgesehen davon, dass der eine den anderen zum Handeln zwingt?
Helgas Handlung war merkwürdig. Bisher hatte sie keine bestimmte Absicht verfolgt, wenn sie hin und wieder zur Haushaltskasse geschlichen war, um ein bisschen Geld daraus zu stibitzen und es in ihrem kleinen Kästchen zu verstecken, einem ursprünglich für Schmuck vorgesehenen Konfirmationsgeschenk. Vielleicht hatte sie sich einreden wollen, es wäre für Weihnachtsgeschenke und andere Dinge gedacht, die sie sich sonst kaum leisten konnten. Doch jetzt wusste sie genau, warum sie es gespart hatte. Plötzlich lächelte sie in die Dunkelheit und stahl sich ganz leise aus dem Bett und zu der Schublade, in der sie das Kästchen aufbewahrte. Der Mond erhellte das kleine Zimmer wie eine falsche Morgendämmerung. Mit der lautlosen Geschicklichkeit einer Diebin zählte Helga das Geld. Es waren fast vierzig Kronen. Sie hielt sie in ihren Händen und lächelte noch immer, sanft, erlöst und für sich, wie ein Kind im Schlaf. Sie konnte an nichts anderes mehr denken als einen geöffneten, durchsichtigen Regenschirm in einer ganz bestimmten Farbe und Form. Ihr Herz klopfte vor Sehnsucht nach dem Morgen so heftig wie das Herz einer Frau, die bald ihren Liebhaber trifft. Sie stellte sich die Straße bei Regenwetter vor und sich selbst, wie sie dort unter dem Seidendach entlangspazierte. Wolkige, lichte Gedanken breiteten sich über ihr Bewusstsein wie Pusteblumenbäusche: ein Haus, in dem sie angestellt gewesen war, die Dame des Hauses im Festkleid: Ach, Helga, reichen Sie mir doch bitte mal meinen Regenschirm! Sie hatte schon viele Schirme in den Händen gehalten, ohne das Geringste dabei zu empfinden, Dinge, die außerhalb ihrer Welt lagen, hatten ihr nie viel bedeutet. Bis jetzt. Kurz vor der Handlung.