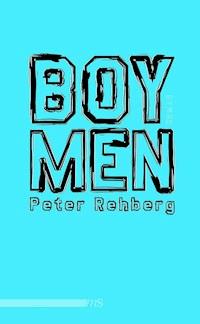
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felix bricht auf ins ferne Amerika und landet – Ironie der Geschichte – ausgerechnet im German Department der Universität von Ithaca, NY. Nicht New York City, nicht San Francisco, sondern tiefste Provinz. Sein Freund verlässt ihn, seine beste Freundin macht zielstrebig Karriere. Felix will das Leben genießen, seine Jugend festhalten, doch die Tage verstreichen wie im Leerlauf. Bis er Clay kennen lernt, einen gut aussehenden und auch noch reichen Künstler. Das Glück ist plötzlich zum Greifen nah. Doch wie Felix will auch Clay nicht alt werden – und er findet eine erschreckende Lösung dieses Problems. Hunger nach Leben und Angst vor dem Trott, grenzenlose Mobilität und Midlife-Crisis: bereits in 'Play' und 'Fag Love' hat Peter Rehberg den Tonfall gefunden, der das Lebensgefühl seiner Generation sinnlich erfahrbar macht. Sein neuer Roman erzählt ungeschminkt vom Leben nach der Party, von der Alterspanik eines Mannes, der lieber ein Junge geblieben wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
PETER REHBERG
BOYMEN
Roman
Männerschwarm Verlag
Hamburg 2011
Länger als vierzig Jahre zu leben ist unanständig, trivial, unsittlich. Dostojewski
Dark city: we kiss in the blanket street Taken by headlights and a gaggle of boymen Dominic Eichler
DID YOU FIND EVERYTHING
YOU WERE LOOKING FOR?
Ithaca, NY, November 6
Die Wände sind lange nicht gestrichen worden, undefinierbares Gelb oder einfach nur schmutzig. Trotz Rauchverbot riecht es muffig. Morgens in der Cafeteria, als wären wir in einer Wartehalle, irgendwo auf der Welt. Der Kaffee schmeckt nicht. Wahnsinn, was man in diesem Land immer kriegt, wenn man mal nicht bei Starbucks landet. Fieses dunkles Wasser, ohne jeden Geschmack, echt gar kein Geschmack, auch essen kann man hier nichts, nichts als Doughnuts mit Vanille- oder Schokoladeschmiere drin. Die Stimmung ist wie in Bulgarien.
Wir sind doch nach Amerika gekommen, um alles Europäische, alles Deutsche hinter uns zu lassen, sage ich zu Anna, zu Marco, zu Anna und Marco, den anderen beiden Deutschen, die ich hier morgens treffe, bevor die Arbeit losgeht. Meine neuen Kollegen also. Obwohl ich an die Kategorie Kollege gar nicht glaube. Einfach die, mit denen ich ab jetzt rede, hauptsächlich.
Dass man noch mal wer anderes werden kann, nicht der, der man war, bevor man herkam, von wo man herkam. Machten wir das Gleiche wie unsere Elterngeneration in den 1950ern und 1960ern: manisch arbeiten oder vor dem Horror davonlaufen? Denke ich, sage ich nicht, bin erst halb wach, Anna gar nicht, Marco redet:
Die Wiedervereinigung hat Deutschland um fünfzig Jahre zurückgeworfen, sagt er. Darin waren wir uns alle einig, auch wenn sonst jeder andere Gründe dafür hatte, jetzt hier zu hocken. Bisschen dickes Thema um diese Zeit.
Mitten in den 1990ern sind wir praktisch gerade wieder bei Kriegsende und bedingungsloser Kapitulation gelandet, jaja, die Entnazifizierung hat noch nicht mal begonnen, sagt jetzt Marco selber (wieso war der überhaupt so wach), und die Stimmung dementsprechend.
Egal, ob aus Ost oder West, sage ich, solange Deutschland noch immer so monokulturell ist, hat man keine andere Wahl, als auszuwandern.
Deshalb sitzen wir drei jetzt hier, in dieser Stadt, in diesem Land. In dieser Cafeteria. Aber amerikanische German Departments sind genau der Ort, wo man gerade nicht hinwill. Weil man wieder gelandet ist, wo man wegwollte.
Ostblock-Feeling, sagt Marco, und er musste es ja wissen, als Ossi. Mitten in den USA schlimmer als im Osten, sagt er.
Anna guckt uns an, aber sagt nichts.
Weiß auch nicht, was ich sagen soll.
Ich denke an Jack.
Nicht an Jack denken.
Da kommt Gisela Podolski um die Ecke. Gisela ist die Sekretärin des German Department. Morgens ist sie immer als Erste auf dem Platz.
Ich glaube, sie schläft hier.
Ich glaube, sie schläft hier, sage ich. Nachts legt sie sich auf die abgewetzte Couch, auf der tagsüber die Studenten sitzen und warten, bis sie zu den Professoren in die Sprechstunde dürfen. Gisela Podolski arbeitet seit über dreißig Jahren hier. Sie liest keine Zeitung und guckt kein Fernsehen. Sie liest Bücher. Literatur. Alles, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert ist, hat sie nicht mitgekriegt. Wie die Wiedervereinigung zum Beispiel. Wie die Mutter in Goodbye Lenin, sagt Anna, die den Film gerade mit ihren Studenten guckt.
It gives me the creeps, sagt Marco, der Gisela nicht lustig findet, gar nicht lustig findet, Goodbye Lenin wohl auch nicht, gives methe creeps, sagt er bisschen angeberisch auf Amerikanisch. Er gruselt sich vor ihr.
Gisela Podolski sieht aus wie Norman Bates’ Mutter in Psycho, sage ich. In ihrer Handtasche steckt ein Messer. Ein langes, großes Küchenmesser.
Anna unterbricht mich.
Ich liebe sie, sagt sie.
Ich gucke Anna an.
Ich liebe sie auch, sage ich, so wie man auf Amerikanisch eben sagt «I love you».
Wegen ihrer dunkelgrauen Haare, die in der Mitte streng gescheitelt sind, eng am Kopf kleben und bis auf Kinnhöhe an beiden Seiten gleichmäßig herabhängen.
Wegen ihrer Hornbrille.
Gisela hat die gleiche Brille wie Robert Lembke, sagt Anna aufgeregt, aber so leise, dass Gisela, die gerade herüberlacht, es nicht mitkriegt. Robert Lembke, der in den 1970er-Jahren in Westdeutschland sehr beliebte Moderator von Was bin ich?
Was ist das?, fragt Marco, der die Sendung nie gesehen hat. Anna sagt: Ein heiteres Beruferaten. Der prominente Gast, dessen Identität ermittelt werden sollte, kriegte am Anfang immer die Frage gestellt: «Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?» Und jedes Mal, wenn er eine Frage mit Nein beantwortet hat, wurde ein Fünfmarkstück in das Sparschwein geworfen. Marco hat keine Peilung, kapiert gerade gar nichts, guckt Anna an, bisschen blöde. Du erklärst das auch falsch, sage ich, aber Anna redet einfach weiter. Vier Teilnehmer im Studio, Guido, Hans, Anneliese und Annette, raten der Reihe nach, sie stellen dem prominenten Gast Fragen und sitzen so lange mit verbundenen Augen im Scheinwerferlicht, bis seine Identität enthüllt wird und sie ihre Augenbinden abnehmen dürfen.
Ich habe Heimweh nach der alten Bundesrepublik.
Ich glaube, Anna auch.
Wir könnten Freunde werden.
Eine Freundin könnte ich gerade gut gebrauchen.
Giselas Robert-Lembke-Brille, die ihre Augen stark vergrößert, sieht so aus, als würde sie nicht nur ihre im Alter zunehmende Sehschwäche ausgleichen, sondern auch die verschiedenen Teile ihres Kopfes zusammenhalten. Ohne Brille halten ihre Haare nicht, sage ich. Es sieht so aus, als würde Gisela Podolski abends, wenn sie auf dem Sofa liegt, immer beides, Brille und Haare, zusammen abnehmen und dann neben sich auf den Schreibtisch legen, einen Nachttisch gab es ja nicht. Ich wäre gerne einmal dabei, wenn Gisela Podolski abends ihre Brille mit Haaren abnimmt, denn ich würde gerne wissen, wie Gisela dann, ohne Brille und ohne Haare, aussieht. Eigentlich möchte ich wissen, ob Gisela bloß dünnes Haar hat oder wirklich eine Glatze.
Nachts sieht sie aus wie du, sagt Anna.
Am anderen Ende der Cafeteria sitzt Gisela alleine an einem Tisch und lutscht an ihrem Doughnut.
Eleanor Rigby. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. All the lonely people.
Psycho, sagt Marco, und mir ist nicht ganz klar, ob er Gisela oder mich meint oder uns beide.
Wenn wir hierbleiben, werden wir so enden wie Gisela Podolski, sage ich.
Eigentlich lebe ich schon jetzt wie Gisela Podolski.
Hast du eine Zigarette, fragt Anna.
Ich rauche nicht.
Du auch nicht, sagt Marco und guckt Anna an.
Paarkontrolle oder was.
Das komplett Unnormale des Paardaseins.
Marco guckt, wie Anna mich anguckt, sagt nichts. Als wäre er eifersüchtig. Ich gucke ihn an. Marco weicht meinem Blick aus. Nix mit Männern im Moment. Davon habe ich erst mal genug.
Ich rede.
German Departments in Amerika sind der einzige Ort, wo Aus-Deutschland-Kommen was wert ist, wo das eine Kompetenz sein soll, Deutschsein und Deutschdenken. Nur, was sollte das in Wahrheit sein? Wieso wollte man das hierher importieren? Weil wir doofe Dichter und Denker sind? Deshalb ja wohl nicht, das war ja wohl das allerdümmste Gerücht, nur insofern wahr, wie Dichter-und-Denker-Sein hauptsächlich heißt, dass es in Deutschland keine Dichter gibt, denn das Denkenmüssen macht immerzu das Dichten kaputt, weshalb man als Dichter zum Schluss weder dichten noch denken kann. Deutschland, Land ohne Dichter und Denker.
Quatsche / denke selber schon wie Marco oder irgendein anderer Amerikaner, Akademiker, wollte ich sagen. Habe ich immerhin gelernt.
Eigentlich interessiert sich Amerika nur für eine Sache, wenn es um Deutschland geht, sagt jetzt Marco.
Für was denn?
Für Nazis.
Was?
Alle German Departments in Amerika sind heimliche Nazi-Departments, also Anti-Nazi-Departments, sagt er. Wo gute Deutsche den Amis jetzt mal zeigen dürfen, dass es damals vor sechzig Jahren geklappt hat mit der Entnazifizierung, wie gut das damals für die Amis gelaufen war in WW II. Das Gleiche wird jetzt noch einmal mit den Ostdeutschen gemacht. Gute Deutsche sollen am besten immer auch gleich arme Säue sein.
Komm, gehen wir, sagt Anna, die das Opfer-Gequatsche bisschen peinlich findet. Ich auch. Wir laufen den langen Gang runter, in dem jeder Schritt hallt, Gisela Podolski hinterher, die zehn Meter vor uns mit den Schlüsseln klappert und zwischendurch grundlos kichert. Ich glaube, sie ist gar nicht verrückt. Sie ist betrunken.
Anna und Marco verschwinden in ihren Klassenzimmern.
Ich mache die Tür auf und da sitzen sie.
Manchmal denke ich, ich vergeude meine besten Jahre. Morgens vor verwöhnten Zwanzigjährigen stehen, die einen komisch angucken, weil man einen deutschen Akzent hat, die man quälen muss, damit sie überhaupt was tun, außer auf ihren Handys und iPods zu spielen.
Nixversteher, Nixnachdenker.
Man muss sie anbrüllen, sonst hört hier keiner zu.
Ihr seid dick!
Ihr seid hässlich!
Die Kleinen, so nenne ich die Studenten immer, unsere lieben Kleinen, lieben es, wenn man mal bisschen deutsch und böse mit ihnen wurde. Um diese Zeit sind sie so verschlafen, dass sich keiner wehren kann. Man kann ihnen erzählen, was man will. Man muss nur selber die ganze Zeit reden. Akademiker redeten überhaupt sehr viel. Ich nicht. Ich gebe den Kleinen den Semesterplan und schicke sie wieder nach Hause.
Ich will hier raus.
Durch den Flur und weg.
Am abstoßendsten an Universitäten finde ich die bunten Flyer, die überall in den Fluren, links und rechts an den Wänden hängen, weil das angeblich eine geeignete Weise war, Veranstaltungen anzukündigen. Buntes Din-A4-Papier, es gibt genau vier Farben (Gelb, Rosa, Grün, Blau). Alles schreiend grell, damit man auch nichts übersieht. Ist ja wichtig. Bunt und fett bedruckt und immer in der gleichen Schrift. Ist ja extrawichtig, was da draufsteht. Die auf vier beschränkte Zahl der Farben wechselt nie. Mit der Zeit nimmt somit deutlich die Signalwirkung ab. Leider nimmt niemand jemals die Flyer ab. Kleben nacheinander, nebeneinander, übereinander an Bürotüren, Fahrstuhltüren und Klotüren. Obwohl amerikanische Universitäten echt nicht arm sind, sind sie vom Gesamteindruck kurz vorm Obdachlosenasyl, genau wie in Deutschland. Ich will nicht, dass mein Name auf so einem Flyer draufsteht. Ich will das lieber nicht.
Die kleine Villa, in der das German Department untergebracht ist, mit den blassen, grünen Holzpaneelen und dem hellgrauen Dach, hätte hübsch sein können. Verträumt und idyllisch. In Wirklichkeit ist sie bloß schäbig. Sogar unheimlich. Wie das Haus von Norman Bates.
Ich gehe nach Hause. Keiner in der kleinen Collegestadt kennt mich, aber alle können mich sehen. Ich glaube, sie gucken mich an. Ich gucke niemanden an, ich gehe weiter. Das Haus, unser Haus, jetzt mein Haus, gehört zu den Häusern, die die Universität für ihre Angestellten auf dem Campus gebaut hat. Entweder man wohnt in Sichtweite vom Klassenzimmer und kann praktisch vom Bett aus unterrichten, oder man zieht zehn Kilometer weiter, wo es wieder sicher wird. Die gute Uni-Gegend ist von schlechten Gegenden umzingelt, die Frontlinie rückt immer näher und der Bürgerkrieg steht kurz bevor.
Der Versuch, sich in der Sicherheitszone niederzulassen, im Prinzip schon mal gescheitert. Als Single hat man kein Bleiberecht mehr. Könnte ich auch gleich meine Sachen packen. Von außen sieht es noch einigermaßen okay aus, mein Haus, mein Leben, aber innen herrscht Chaos, Morbidität, Vermüllung, der Untergang. Ich wohne inzwischen wie ein Obdachloser. Das Schlafzimmer betrete ich gar nicht mehr. Die einzigen benutzbaren Möbelstücke sind ein verwichstes Schlafsofa vom Vormieter und ein Abstelltisch aus Blech, den ich als Schreibtisch benutze. Den Rest hat Jack mitgenommen. Als Bettdecke nehme ich die Plastikfaser, die British Airways an seine Fluggäste für Transatlantikflüge verteilt. Der Fusselkram hat sich schon über dem Ozean fast in seine Bestandteile aufgelöst. Würde man die Decke waschen, bliebe davon nichts übrig. Aber ich wasche sie nicht und sie hält noch. Ich lege mich auf das verschmierte Sofa. Es ist noch früh am Tag, aber ich schlafe sofort ein.
Ithaca, NY, November 5
Ich liege da und denke an nichts. Ich höre dem Wind zu. Amerikanische Häuser sind so leicht gebaut, es ist verrückt. Als wären sie bloß ein flüchtiger Traum, eine Kulisse, die nur so lange halten muss, bis der Film abgedreht ist. Als könnten sie gleich wieder verschwinden. Es macht mir Angst. Ich liege mit offenen Augen auf dem Sofa und fühle mich traurig und denke, es würde für immer so bleiben. Einsamkeit ist nur für die sinnvoll, die sonst zugrunde gehen, denke ich, für Menschen, die überleben, weil sie den Mut haben, allein zu bleiben.
Als ich wieder aufwache, weiß ich nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Etwas bewegt sich, das Sofa, das ganze Haus. ALLES. Bevor ich denken kann, ein Erdbeben, ist es schon wieder vorbei. Ich mache die Augen zu und warte darauf, was passiert. Als müsste es noch einmal passieren, damit ich es glauben kann. Ein Erdbeben. Ich traue mich nicht, mich zu bewegen. Ich liege still, mein Atem stört mich. Mein bisheriges Leben scheint unerreichbar. Was es gibt, ist dieses Haus. Das ist alles. Der Rest ist Träumerei.
Ein paar Sachen hat er hiergelassen. Ich trage die Kartons nacheinander die Treppe hoch und verstaue sie auf dem Dachboden. Der Dachboden ist riesig. Staubig und dunkel und bald würden die neuen Kartons auch so aussehen. Abgestellt, alt. Für einen Moment macht mich das traurig. Ich mache die Klappe wieder zu.
Ich gehe durch das Haus, das nun mir gehört. Habe ich nicht genau das gewollt? Das Haus riecht modrig, immer noch. Bevor wir hier eingezogen waren, stand es einen Sommer lang leer. Es riecht noch immer nicht bewohnt. Dafür sind wir noch nicht lange genug hier gewesen. Ich öffne die Fenster, erst im Erdgeschoss, dann, Zimmer für Zimmer, überall. Selbst wenn ich das Wohnzimmer als Schlaf- und Arbeitszimmer benutze und die Zimmer im ersten Stock nicht mehr betrete, ist das Haus noch zu groß. Ein Familienhaus, ein Haus für eine ganze Familie.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben hier aussehen soll. Dafür brauchte man andere Menschen, das geht nur zusammen, zu zweit zum Beispiel, sodass man sich dann vorstellen kann, wie man leben wollte. Das geht nicht ganz alleine. Sonst geht es einfach weiter, immer weiter, irgendwie, ohne Zeugen.
Ich habe alle Fenster geöffnet. Es ist sonnig, aber kalt. Ich stehe im Türrahmen und gucke auf die Straße. Mitten am Tag, aber es bewegt sich nichts.
Ich habe wieder Lust zu rauchen.
Ithaca, NY, November 6
Die Hälfte aller Möbel in akademischen Bürozimmern sieht so aus, als seien sie dort zur Zwischenlagerung abgestellt, nicht zum wirklichen Gebrauch hingebracht worden: Sperrmüll. Die andere Hälfte, die zur Benutzung freigegeben war, wurde um 1970 angeschafft. Seitdem ist nichts mehr dazugekommen. Kein Büro, ein Büromuseum. Arbeit an der Uni Museumsarbeit. Ich bin ein Teil davon. Wir (Anna, Marco und ich) sind die letzten lebenden Intellektuellen. Eine aussterbende Rasse. Ich setze mich auf den staubigen Drehstuhl und gucke auf die gelblichen Rollos, die zwischen den rot-grünen Wollgardinen (warum Wollgardinen?) halb heruntergezogen sind, damit nicht zu viel Sonnenlicht hereinfällt.
Nebenan sitzt Gisela Podolski. Hier sitze ich, da sitzt sie. So sieht meine Zukunft aus, denke ich: Einzelhaft mit Gisela Podolski als Zellennachbarin. Man darf sie nur nicht «Sekretärin» nennen, weil Sekretärin diskriminierend klingt, man muss Administrative Assistant zu ihr sagen. Was in Ordnung geht, weil die Sekretärin tatsächlich die Einzige ist, die weiß, wie der Laden läuft. Alle anderen arbeiten zu Hause oder arbeiten gar nicht. Die Sekretärin ist immer auf ihrem Platz.
Am Telefon klingt Gisela Podolski aber gar nicht wie eine, die einem erklären kann, wie der Laden läuft, sondern einfach bisschen prollig. Sie klingt so, als hätte sie gerade getrunken. Sie spricht halt Hessisch, hat Anna gesagt. Aber ich denke: Gisela Podolski ist eine Säuferin. Morgens schon mal einen Schluck und zwischen den Telefonaten einfach weitersaufen. Gisela Podolski lallt so eindeutig, dass es schwierig ist, zu verstehen, was sie sagt. Immerhin handelte es sich ja um geschäftliche Telefonate, auch wenn Gisela Podolski so klingt, als riefe sie direkt aus der Kneipe an.
Eine Fahne hat sie aber nicht, denke ich, nachdem Gisela Podolski vorsichtig an meine angelehnte Tür klopft, die man ja nicht verschließen darf, damit hier bei Tageslicht keine Sauereien mit den Studenten laufen, nachbarschaftlich in mein Büro reinspringt, um mir freudestrahlend einen schwarzen Einwegplastikkugelschreiber und zwei Bleistifte zu geben.
Hier haben Sie erst einmal, was Sie brauchen, sagt sie, als hätte sie mich gerade mit der neuesten Software versorgt, und guckt mich dabei eindringlich an. Aufdringlich eigentlich.
Sie hat doch schon getrunken.
Sie wartet darauf, dass ich mich bedanke.
Danke, sage ich etwas benommen.
Was ich Ihnen noch zeigen wollte, sagt sie dann, nachdem mir immer noch nicht eingefallen ist, was ich sonst sagen soll, mit Hinweis auf den einen Bleistift, der nicht angespitzt war, jetzt ist auch klar, warum, damit sie mich nämlich vom Schreibtisch wegzerren kann und mich dazu zwingt, ihr zu folgen und mir den genau in der Mitte zwischen unseren beiden Bürotüren an der Wand angebrachten mechanischen Bleistiftanspitzer zu zeigen, den sie jeden Nachmittag säuberlich leert, bevor sie die Tür von ihrem Büro abschließt und nach Hause geht. Schläft sie also doch nicht auf dem Studentensofa. Gisela Podolski ist zwar eine Säuferin, aber keine verkommene Person. Sie erfüllt ihre Pflichten. Sie trinkt halt.
Ich warte, bis Gisela Podolski das Gebäude verlassen hat. Ich schließe ihr Büro auf und durchsuche es, bis ich hinter den Aktenordnern im Regal den Gin gefunden habe. Ich nehme einen kräftigen Schluck aus der Flasche und stelle sie wieder zurück.
Ithaca, NY, November 7
Die Tür zu meinem Büro steht offen.
Anna kommt rein, ohne anzuklopfen.
Was machst du?
Ich sortiere meinen Zettelkasten.
Wofür?
Mein Buch.
Worum geht es?
Bevor ich antworten kann, hat sie schon die Karteikarten in der Hand.
Schleichend wird die Zeit zum Feinde des Menschen.
(F. Scott Fitzgerald)
Altwerden ist nichts für Feiglinge.
(ein altes amerikanisches Sprichwort)
Ich stottere verlegen. Ich schreibe ein Buch übers Älterwerden, sage ich. Mehr fällt mir nicht ein. Aber Anna will auch gar nicht mehr wissen, sie sagt:
Einfach angucken, wie Madonna das macht, die bringt uns durch die Wechseljahre.
Ich glaube nicht mehr an die Lösungen der Popkultur.
Dann Susan Sontag.
Die ist tot.
There is no remaking of reality.
Just take it as it comes.
Hold your grounds and take it as it comes.
Face your loss and live on.
Wenn man alt wird, zeigt sich, was wichtig ist, sagt sie, so einfach ist das. Solange man den Tod verdrängt, ist alles Spielerei.
Hm.
Dann erzähle ich ihr von Jack und mir, erzähle ihr alles und fühle mich dabei ein bisschen so, als wenn es gar nicht um mich geht, als wenn ich die Geschichte von jemand anderem gehört hätte. Wie die Sätze auf den Karteikarten in meinem Zettelkasten.
Ithaca, NY, November 7
Nur wenige Dinge habe ich so geliebt. Nur selten fühlte ich mich so sehr am Leben. Dass ich ganz genau überlegen musste, weil von dem, was ich sagte, nicht nur mein eigenes Glück, sondern alles, sogar das Glück der Welt abhing, dachte ich, glaubte ich, dass ich meine Einsichten hinausschreien musste, dass diese Worte dann wie Kostbarkeiten aufbewahrt werden mussten, wie ein Gesetz. Aber eins, zu dem keiner gezwungen wurde, sondern ein Gesetz, das so schön war, und so wahr, sodass jeder, der damit in Berührung kam, gleich danach leben wollte, so offensichtlich war es. An diese Lust, die größte, die ich kannte, erinnerte ich mich noch ein bisschen und fast schon nicht mehr.
Wovon sprichst du?, fragt Anna.
Vom Lesen, was sonst?
Dann sage ich mal kurz meine aktuelle Leseliste auf, so wie einige Jungs bei GayRomeo, als würde damit die Wahrscheinlichkeit steigen, dass man zueinanderpasst:
Dennis Cooper
Rainald Goetz
Bret Easton Ellis
Michel Houellebecq
Frédéric Beigbeder
Die habe ich alle nie gelesen, sagt Anna.
Anna, die Germanistin.
Du wolltest von Jack erzählen.
Ich wusste nicht, wie ich anfangen soll.
Ich erzähle einfach weiter.
Ich konnte nicht verbergen, wie sehr ich enttäuscht war. Ich war vom Lesen enttäuscht, wie man von einem Liebhaber enttäuscht ist. Ich hatte geglaubt, mein Leben würde sich, durch das Lesen, auf wunderbare Weise verwandeln. Damals hatte es keine Rolle gespielt, dass das Lesen ins Unbekannte führte. Lesen hatte kein Ziel, genau das war das Abenteuer gewesen. Ich würde frei werden. Ich habe verstanden, dass von diesem Freiheitstraum nur das Lesen selbst zurückblieb, Lesen, Lesen, immer wieder, immer von vorne. Lesen war für mich zu einem Training geworden. Eine Frage der Disziplin. Ich fand es notwendig. Lieben konnte ich es nicht mehr.
Dass das Lesen nichts half, nützte, nicht ging. Das konnte doch nicht sein. Ging es allen anderen denn auch so? Wenn es so war, gaben sie es nicht zu. Alle fanden es scheinbar normal, dass Lesen nichts als Lesen war.
Du wolltest von Jack erzählen, sagt Anna schon wieder.
Ihre Ungeduld ist manchmal fast unsympathisch.
On the way from New York to Ithaca, October 18
Jack hatte keine Probleme damit. Aber Jack hätte auch Anwalt werden können. Für Jack war Lesen ein Beruf, er hatte sich vor langer Zeit dafür entschieden, so war es eben. Jack hatte keine Geheimnisse, glaube ich, und ich kannte ihn gut. Als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, habe ich sofort verstanden, wer er war. Jack war erwachsen, immer schon, sein ganzes Leben lang ist er erwachsen gewesen, dachte ich, sagte ich nicht.
Er saß im Auto neben mir.
Wir fuhren noch zwei Stunden.
Das war das Komische am Erwachsenwerden, einige Menschen wurden praktisch so geboren, andere schafften es nie. Jack war erwachsen, ich schaffte es nicht. Er hatte feste Standpunkte und spielte nicht mit den Gedanken wie ich. Er war erwachsen und das mochte ich. Meistens widersprach ich seiner Sicht der Dinge, ehrlich gesagt fand ich ihn auch ein bisschen langweilig, ein bisschen zu oft zu langweilig. Aber wenn ich unsicher war, tat es mir gut, dass er da war, und wenn ich mich manchmal nach, was denn, Sicherheit? sehnte, die ich allein nicht finden konnte, glaubte ich ihm für kurze Zeit jedes Wort.
Wie man richtig Sport macht.
Was man essen muss.
Was man lesen muss.
Wie man im Leben bekommt, was man will.
Jack war ein Macker. Ein Ami-Macker, aber immer noch ein Macker. Manchmal konnte ich mich nicht wehren, dann wurde ich böse. Dann machte ich mich gerne über ihn lustig, auch wenn es letztlich auf meine Kosten ging. So konnte ich wieder friedlich mit ihm zusammenleben. Ich wollte keine Experimente mehr. Ich erwartete nicht, dass es mit einem anderen besser lief. Resignation und Erwachsenwerden waren manchmal schwer zu unterscheiden, schließlich war er vierzig und ich auch bald. Doch bevor ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht, dachte ich lieber: Das Leben ist so.
If you want to know how love goes, don’t look at Popculture.
Read the French.
Als wir uns kennenlernten, haben Jack und ich oft die halbe Nacht wach gelegen und geredet, bis wir so aufgeregt waren, dass wir nicht mehr schlafen konnten und dreimal Sex brauchten, um uns wieder zu beruhigen. Wir gingen zusammen ins Kino und lasen die gleichen Bücher. Es machte doch einen Unterschied, wie man die Welt sah. Jack hatte die typischen Träume eines gebildeten Amerikaners: Paris oder Barcelona. Ich wollte lieber nach New York. Für ihn bedeutete Partnerschaft Kameradschaft, ich hatte die Suche nach Abenteuern noch nicht aufgegeben. Jetzt hatten wir keine Fragen und keine Antworten mehr. Unsere Träume waren berechenbar geworden, wir brauchten keine Bücher mehr, um ihnen zu folgen. Jack wollte ein bequemes Leben. Und mir fiel bald auch nichts Besseres mehr ein.
Er saß neben mir im Auto, wir waren stumm. Ich versuchte das zu mögen, das Nichtsagen. Das war die wahre Intimität, versuchte ich mir zu sagen: nichts sagen zu müssen. Ich griff nach seiner Hand. Das war auch eine Leidenschaft gewesen: mit Freunden verreisen und die eintönige Autofahrt benutzen, um stundenlang miteinander zu reden, bis man das Gefühl hatte, jetzt, jetzt weiß man alles über den anderen, und man war nicht mehr allein. Leidenschaftlich reden und denken: So sollte das Leben sein. War es mit Jack jemals wirklich so gewesen? Ich konnte mich nicht erinnern. Ich konnte mich auch nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal Sex hatten. Auf einmal fragte ich mich, wie das passiert war, dass ich in diesem Auto neben diesem Mann saß, keiner sagte was.
Ich mochte die Musik nicht, die er hören wollte, Hip-Hop. Das habe ich nie verstanden, wie man Hip-Hop mögen kann. So heterosexuell, dass es nervt. Jack liebte Hip-Hop. Ich konnte diese Musik nicht lieben, nur weil er sie liebte. Wenn es nicht von alleine bisschen funkte, konnte man es vergessen. Wenn ich ihm das sagte, war er gekränkt und zweifelte an meiner Liebe, und, ehrlich gesagt, ich selber auch.
Ich saß im Auto neben ihm und kriegte schlechte Laune, weil ich nicht sagte, was ich dachte. Ich versuchte zu schlafen, aber es ging nicht, doch ich tat so. Alle Männer kamen mir gewalttätig vor, ohne dass sie es merkten. Jack hätte mich niemals geschlagen. Aber er forderte Dinge von mir, die ich nie fordern würde. Ich fand, dass man solche Dinge nicht fordern konnte. Im Auto Hip-Hop hören, obwohl er wusste, wie sehr ich das hasste. Ihm zuhören, wenn er über analytische Philosophie referierte. Seine College-Freunde besuchen, vor denen man dann so tun musste, als wäre man nicht schwul.
Wir waren auf dem Weg von New York City nach Ithaca, Up-state New York. Ich begriff erst jetzt, wo wir hingezogen waren. In eine amerikanische Kleinstadt, viereinhalb Stunden von New York, was für amerikanische Verhältnisse nicht viel war. Aber es fühlte sich an wie in einem anderen Land. Es war in einem anderen Land.
Es schneite, wir konnten nur im Schritttempo fahren. Es würde nicht zwei, sondern noch vier Stunden dauern, bis wir zu Hause waren. Zum ersten Mal in meinem Leben kam es mir so vor, als hätte ich einen Fehler gemacht. Wir hätten niemals hierherziehen dürfen.
Ithaca, NY, sometime in June
Hier werden wir leben, hatte Jack gesagt, als wir das Haus vor drei Monaten zum ersten Mal gesehen hatten. Er hatte den neuen Job angenommen. Mir wurde ein Einjahresvertrag angeboten. Man nahm uns als Paar. Wir werden die Vorzeigeschwulen werden, haben wir gesagt und hatten nichts dagegen. Wir sind mit seinem Pick-up-Truck im Schritttempo durch die Straßen der kleinen College-Stadt gefahren und hielten nach Schildern Ausschau, auf denen stand «for rent» oder vielleicht sogar «for sale». Wenn es uns gefällt, dann kaufen wir es, hatte Jack gesagt. He was a rich boy. He came from money.
Wir hielten an und gingen um das Haus, Hand in Hand, Felix und Jack. Unser Einverständnis kommt ohne Berührungen aus, sagte ich mir und fühlte mich ein bisschen zu alt dafür, Händchen haltend mit einem erwachsenen Mann den Blicken von Fremden ausgesetzt zu sein. Ich wäre gerne mit ihm überall hingegangen, Hand in Hand, im Dunkeln, wenn es keiner sieht.
Das wird unser Zuhause werden, hatte Jack gesagt und war stehen geblieben. Es klang ein bisschen zu aufgeregt. Es klang so, als hätte er sich dazu entschlossen, nur um sich zu entscheiden. Es klang so, als hätte er sich vorgenommen, mich hier glücklich zu machen, jedenfalls gehörte ich in diesem Moment zu seinem Glück dazu. Ich ließ es mir gefallen. Man brauchte einen Platz, wo man zusammen leben kann, so einfach war das.
Aber ging das in diesem Dorf, weit weg von New York, wo es nichts gab außer einem Job? Was wollte ich sonst? Die meisten machten es so. Früher wäre das ein Grund gewesen, abzuhauen, alles hinzuschmeißen, noch einmal von vorne anzufangen. Inzwischen versuchte ich mir zu sagen, dass es etwas gab, was man Notwendigkeit nennen konnte oder sogar Realität (in Wirklichkeit war das Leben gefährlich). Ein Rhythmus, der sich nicht ignorieren ließ.
Ich wurde älter, auch wenn mir noch nicht klar war, was das bedeutete. Ich sah nicht aus wie vierzig. Aber ich wurde bald vierzig und ich wusste es. Ich wusste nicht, ob ich hier glücklich werde, dachte ich, aber ich ließ mich gerne dazu überreden. Es war ein Versuch. Es war so friedlich hier. Das war es, was die meisten Menschen suchten: nicht Glück. Ich hätte wissen müssen, dass das ein Fehler war. Ich hätte die Zeichen ernst nehmen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass dies nicht mein Leben war.
Jack hatte sich hinter mich gestellt und mir einen Kuss auf den Hals gegeben. Es störte mich ein bisschen. Ich fühlte mich nicht berührt, wenn er mich anfasste. Was hätte ich stattdessen gewollt? Ich drehte mich um und wollte ihn auf den Mund küssen, aber er hatte sich, ohne dass ich es bemerkt hatte, von mir abgewendet. Ich lehnte den Kopf auf seine Schulter. Das machte ich selten. Jack hielt inne. So standen wir.
Ithaca, NY, November 7
Hattest du Angst, allein zu sein?
Haben nicht alle Angst davor?
Ich nicht, sagt Anna.
Fast ein bisschen angeberisch.
Warum bist du dann mit Marco zusammen?, denke ich, aber sage ich nicht.
Ich habe keine Angst, allein zu sein, sage ich schnell.
Wovor hattest du dann Angst?
Ich konnte es nicht sagen.
Ich hatte Angst, dass das Leben, für das man sich entschieden hat, auseinanderfällt.
Dass es immer wieder auseinanderfällt.
Das ist, ich weiß nicht,
nicht zu ertragen.
Es verändert sich, sagt sie.
Ich finde das grausam.
Das ist ein kindischer Gedanke.
Ich brauche etwas, das sich nicht verändert.
Woran glaubst du?
An meine Arbeit, sagt sie, ohne zu zögern.
Ich würde gerne an die Liebe glauben.
Oder an irgendwas.
Was ist mit Jack passiert?
Ithaca, NY, October 19
Wir fuhren die ganze Nacht. Ich habe im Auto geschlafen, bin wieder aufgewacht, wieder eingeschlafen. Draußen lag Schnee. Nur eine dünne Blechwand trennte uns vom Chaos. Jack fuhr, stumm. Ich hatte keine Ahnung, was er dachte. Auf einmal kam er mir vor wie ein Unbekannter. Es war nicht die verführerische Unbekanntheit des Anfangs, wenn man sich kennenlernte, die man dann später manchmal selber herbeiführt, um die Aufregung des Verliebtseins weiterleben zu lassen, es war nicht diese Unbekanntheit, mit der sich die ganze Welt in ein Geheimnis verwandelte, als würde man sie zum ersten Mal betrachten, so wie den Menschen, den man gerade getroffen hatte – auch wenn diese Naivität gespielt werden musste, weil sie immer von selbst verging, bis sie irgendwann anfing, ironisch zu werden, und dann unwiederbringlich vorbei war.
Die Unbekanntheit mit Jack war wie mit einem Menschen, mit dessen Welt man nichts zu tun hatte, und die Entscheidung darüber war schon lange gefallen. Wann hatte ich mich entschieden, nichts mit Jack zu tun zu haben? Eigentlich könnte ich auch gehen. Es wäre kein großer Verlust, wenn ich allein wäre, dachte ich auf einmal und kriegte einen Schreck. Wenn er zum Beispiel bei einem Autounfall ums Leben kommen würde.
Jack hielt an.
Hier wohnten wir jetzt. Das Haus war von Schneebergen umhäuft, einen Meter oder höher. Wir mussten uns bis zum Eingang durcharbeiten. Alles fühlte sich falsch an, aber ich wusste nicht, wann die Fehler begonnen hatten. Mir wurde nur klar, dass die Summe meiner Entscheidungen im Moment nicht so gut aussah. Du bist müde, du musst dich ausruhen, versuchte ich mir zu sagen, aber ich konnte die wirkliche Müdigkeit – diese Nacht im Auto, der Umzug, der neue Job – nicht unterscheiden von dem Gefühl, tatsächlich etwas falsch gemacht zu haben in meinem Leben.
Wir betraten das Haus, ich wollte allein sein. Das fand ich am schwierigsten am Zusammenleben: Was machte man, wenn man allein sein wollte, nicht nur in einem anderen Zimmer? Ich gehe ins Bett, sagte ich und versuchte zu lächeln. Jack guckte mich an, nickte stumm und lächelte auch fast. Er war nicht böse. Ich konnte ihn mir gut als einen meiner Arbeitskollegen vorstellen. Das ist es, was wir in Wirklichkeit waren: Arbeitskollegen. So wie die Helden in amerikanischen Krimiserien. Immer zusammen und trotzdem allein. Eine ideale Partnerschaft. Konnte ich aber auch nur dran glauben, wenn ich es im Fernsehen sah.
Ich war so erschöpft, dass ich nicht einschlafen konnte, die Matratze des neuen Bettes, das Jack gekauft hatte, war zu hart. Im Zimmer war es kalt, trotz der schweren Bettdecke wurde mir nicht warm. Er saß nebenan, in dem Raum, wo es noch keine Möbel gab. Wir hatten keine Idee, was wir damit machen sollten. Es gab zu viele Zimmer in diesem Haus. Ein Futon-Gestell, ein Fernseher waren dort abgestellt. Obwohl die früheren Besitzer einiges hiergelassen hatten, fehlte überall was. Jack hatte den Fernseher angemacht. Er guckte Oz auf DVD. Gefangene im Knast, die sich zum Sex zwangen, eine reine Männerwelt. Wie ein schwuler Porno mit Handlung. Ich glaube, er holte sich darauf einen runter, weil er sich nicht traute, einen echten Porno zu gucken, während ich nebenan war.
Ich lag im Bett und konnte nicht schlafen. Ich hörte Jacks Schritte im Flur, er machte die Tür auf. Er legte sich zu mir. Er küsste mich auf den Hals, die Schultern, den Rücken. Er kam mit seinem Mund an mein Ohr, als wollte er mir etwas hineinflüstern, aber ich drehte mich weg. Wenn wir uns wenigstens streiten würden, könnten wir hinterher Wiedergutmachungssex haben. Er drückte sich an mich und ich machte die Augen zu.
Ithaca, NY, October 20
In diesem Haus konnte man sich nicht voreinander verstecken. Alles hing davon ab, was uns jetzt miteinander gelang. Wir standen in der Küche und guckten uns an.
Er fragte mich, ob ich mit ihm ins Museum komme.
Ins Museum?
Wir hatten noch nicht mal ausgepackt.
Ich machte das nicht, ich machte das nicht mit ihm. Ins Museum gehen. Weil es nicht ging. Weil es einfach nicht ging. Was alles nicht mit ihm ging. Wollte er mir das Gegenteil beweisen?
Das Museum hatte noch nicht auf, nur das Museumscafé. Die Öffnungszeiten standen auf dem Schild vorne rechts neben dem Eingang: 10 AM – 6 PM. Er guckte mich an. Ins Café oder gleich wieder nach Hause. Ich wollte zurück nach Hause. Oder weit weg. Das Café war auf der anderen Seite. Wir gingen um das Haus aus dem 19. Jahrhundert, oder aus dem 18., ich glaube, aus dem 19. Wir waren still, es schneite.
Er wollte nicht ins Museum, er wollte nur ins Café. Wollte er mir was sagen? Er wollte ins Café und ich nach Hause, ins Museum wollte hier keiner.
Ich hatte Angst. Wenn wir uns gegenübersaßen, im Café. Wo es keine Musik gab und keinen Fernseher. Ich hätte ein Buch mitnehmen sollen oder wenigstens eine Zeitung. Weil ich Angst hatte, dass wir dann da saßen, im Café, ohne Musik, ohne Fernseher und uns nichts zu sagen hatten. Wir saßen im Café und hatten uns nichts zu sagen.
Dann müssten wir uns trennen.
Ohne Buch, ohne Zeitung. Das Café war groß. Das Café war so etwas wie ein Festsaal, ein Raum, den man mieten konnte. Wo einige hinkamen, nur um zu essen, nicht, nachdem sie die Bilder angeguckt hatten oder davor. Ich wusste nicht, warum er mich hierhergebracht hatte. Ich wusste nicht, was er wollte.
Was willst du?
Wir waren nicht die einzigen Gäste. Wir saßen da und sahen so aus, als wenn wir nicht hierhergehörten, als wenn wir nur kurz da sein dürften und gleich wieder wegmussten, wenn die wirklichen Gäste kamen. Die anderen drei oder vier, die auch schon da waren, saßen weit weg, sodass man sie leicht vergessen konnte.
Ich guckte ihn an, er guckte weg.
Ich hatte das Gefühl, es war vorbei.
Alles vorbei, wir konnten wieder gehen.
Er hielt nicht meine Hand.
Unsere Knie berührten sich nicht.
Wir saßen uns im Café gegenüber. Große Saalfenster auf beiden Seiten. Auf der einen Seite sah man die kleine Stadt. Draußen war es grau, ein hübsches Hellgrau, kein doofes Deutschgrau. Die kleine Stadt sah nicht hässlich aus, sondern schutzlos.
Im Hintergrund das Klirren von Gläsern, die geputzt wurden, das Klappern von Besteck, das poliert wurde. Das Fest war vorbei oder hatte noch nicht angefangen. Wir saßen da und sagten nichts. Draußen schneite es. Er trank grünen Tee so wie ich. Wir guckten uns an und sagten nichts.
Ich hatte diesen Satz im Kopf.
Ich will mich von dir trennen.
Aber ich sagte es nicht.
Ithaca, NY, October 22
Ja, wir hätten unsere postromantische, ironische Erwachsenenbeziehung weiter pflegen können. Wir hätten einfach den Mund halten können. Eine Weile hatten wir es genau so gemacht. Aber was immer zwei Menschen zusammenhielt, war verschwunden. Alles war auf diesen Moment zugelaufen, immer schneller, fast als hätten wir es mit dem Umzug nach Ithaca von Anfang an so geplant.
Ich hatte es mir für später vorgenommen, nicht jetzt, noch nicht. Ich wusste nicht, wie lange ich noch warten würde, worauf. Ich wusste nur, dass ich es eines Tages tun würde. In einem Monat oder einem Jahr. Ich hatte es schon geübt: Ich hatte es aufgeschrieben, war mit dem Zettel in der Hand durch das Haus gelaufen und habe den Satz gesagt, immer wieder.
Ich will mich von dir trennen.
So machte ich es immer bei Entscheidungen.
Ich war vorbereitet.
Ich musste es nur noch wirklich sagen.
Ithaca, NY, October 25
Ich hatte keine Ahnung, wo der Satz herkam. Es war nicht der Anfang einer Auseinandersetzung, es war schon das Ende, obwohl es gar keine Auseinandersetzung gegeben hatte. Als wäre automatisch klar, wenn wir einmal zu reden anfangen, kann es nicht anders enden.
Ich will mich von dir trennen.
Es war mein Satz gewesen, nicht seiner.
Ich will mich von dir trennen.
Jetzt gab es weder Streit noch Sex.
Keine Tränen und keine Worte.
Jack sagte nur: Ich will mich von dir trennen.
Ich verstand nicht, wie er diesen Satz sagen konnte.
Es war mein Satz gewesen, und nicht seiner.
Ithaca, NY, November 7
Ich war noch niemals allein.
Immer war da einer, ob ich wollte oder nicht.
Ich glaube, es klingt nicht mal eitel, wenn ich das sage.
Es klingt ein bisschen, als hätte ich mir mit meinem Privatleben nicht so viel Mühe gegeben.
Ich hätte jetzt gerne geweint.
Bist du traurig?
Fragt Anna ganz nüchtern.
Ich weiß es nicht.
Jetzt nicht.
Keine weiteren Fragen.
Wir kennen uns ja kaum.
Wollen wir morgen Abend zusammen essen gehen?
Wenn mich jemand so direkt fragt, kann ich nicht Nein sagen.
Etwas Gesellschaft konnte ich gerade ganz gut gebrauchen.
Und ich glaube, ich will gerne mit Anna befreundet sein.
Marco kommt auch mit.
Jetzt habe ich schon Ja gesagt.
Ich gehe nach nebenan und hole den Gin aus Giselas Bücherregal.
Willst du?
Nein, sagt Anna und guckt mich traurig an, als müsste man Mitleid mit mir haben, nur weil ich gerade einen Drink gebrauchen kann.
Ich trinke nicht, sagt sie.
Also trinke ich allein.
Ein Glas und noch eins.
Ithaca, NY, November 8
Mit Menschen zusammen sein, mit denen man sonst keine Zeit verbringen würde.
Sowieso als Single nur noch mit Paaren zu tun haben.
Dadurch vielleicht auch interessant sein.
Aber im Ernst will keiner in diesem Alter von vorne anfangen.
Alle haben ihre Partner gefunden.
Wer keinen hat, bleibt jetzt allein.
So funktioniert die heterosexuelle Welt.
So funktioniert die heterosexuelle Welt für Homosexuelle.
Die Sentimentalitätsfalle nicht zuschnappen lassen. Es geht mir doch gut. Vielleicht funktioniere ich alleine einfach besser. Nur unpraktisch, dass ich an einem Ort gelandet bin, wo das Singledasein praktisch verboten ist.
Abends mit Anna, wir warten auf Marco. Die Auswahl an Restaurants in Ithaca, New York, ist absurd: Tibetanisch, Thailändisch, Anatolisch, Indisch, Chinesisch, Französisch, Mexikanisch. Überdurchschnittliche Restaurantvielfalt und -qualität für Städte, die ohne Studenten unter 10.000 Einwohner haben. Essen als einziges Vergnügen für Akademiker über vierzig. Völlerei statt Vielsex.
Ich habe grundlos gute Laune.
Nur eine Regel.
Nicht über Jack sprechen.
Da kommt Marco. Anna nennt Marco manchmal «die Kröte». Soll wohl ein Kosename sein. Sie findet das «süß». Ich finde ihren Humor bisschen derb, derb und direkt, was ich bei Frauen normalerweise gut finde. Dass mein Partner mich «die Kröte» nennt, würde ich allerdings nicht wollen. Ich würde mich in meinem GayRomeo-Profil ja zum Beispiel auch nicht «die Kröte» nennen. Aber Anna nennt Marco heute Abend «die Kröte» und gibt der Kröte dann einen Kuss auf den Mund, als wenn sich die Kröte dadurch in einen Prinzen verwandeln würde.
Die Kröte guckt gern krötig, deshalb heißt sie Kröte, sagt Anna, als Marco aufs Klo geht, und lacht dann ein bisschen zu laut, sodass ich schon Angst um sie bekomme. Sie hat dann so einen Hau ins Verrückte. Vielleicht hat sie auch nur einfach keinen Stil, was ja bei akademischen Menschen normalerweise der Normalfall ist. Als Marco vom Klo zurückkommt, traue ich mich gar nicht mehr, ihn anzugucken.
Wir bestellen Wildbraten (welche Nationalität war das jetzt? – deutsch?). Weil wir nicht wissen, worüber wir reden sollen, jetzt wieder mit der Kröte am Tisch, hält Anna, während wir auf das Essen warten, einen kurzen Vortrag. Anna fährt jeden Sommer auf Bildungsreise nach Europa, sie ist eine richtige Germanistin, nicht so ein Pseudogermanist wie ich. Sie redet über Goethes Haus in Weimar und über Freuds Wohnung in Wien. Wie die Raumaufteilung die Psyche widerspiegelt. Was im Keller verborgen bleibt und was auf den Dachboden wandert. Wo man arbeitet, wo man Sex hat und wo man seine Freunde empfängt. Ich arbeite kaum noch, habe gerade keinen Sex und überhaupt keine Freunde. Mein Psychohaus wurde gerade ausgeräumt, der Laden leer, mein Leben stillgestellt. Mein Hirn so gut wie tot. Vorzeitiger Hirntod mit vor vierzig. Das war die Lage. Immerhin war ich noch nicht obdachlos so wie drei Millionen andere Amerikaner.
Alle Akademiker tun so, als seien sie Nomaden, obwohl sie längst Hausbesitzer sind. Hausbesitzer, Aktienbesitzer.
Denken wie ein Nomade, leben wie ein Bürger.
Darf man aber nicht sagen.
Was man alles nicht sagen darf.
Fucking Political Correctness.
Schließlich sage ich: Mein Haus ist alles, was ich habe.
Anna guckt mich an, streng, streng, streng, sie mustert mich, das finde ich jetzt ziemlich unamerikanisch, also unhöflich. Sie kennt mich ja kaum. Auf die Glatze rauf, sie starrt mir auf die Glatze rauf, als sei ich doch ein deutscher Faschist. Genau! Was will denn dieser schwule Skinhead hier am Tisch, dass der bei der Germanistenrunde überhaupt dabei sein darf. Wann bin ich eigentlich in dem Alter, dass meine Glatze einfach als Alterserscheinung wahrgenommen wird und nicht mehr als politisches oder sexuelles Statement? Vielleicht sollte ich ihre bösen Blicke als Kompliment verstehen. Ich mache meinen Rotwein alle, noch ein Glas. Vielleicht sollte ich besser gehen und Anna mit ihrer Kröte beim Wildschweinbraten alleine lassen, damit sie dann ungestört ihre Krötengespräche führen können. Doch dann mache ich mich vor versammelter Runde erst mal über mich, dann über alle Intellektuellen lustig. Damit hier keine Missverständnisse entstehen, damit hier keiner Angst kriegt.
Ich bin doch bloß der Quotenhomo.
Ein Durchschnittsschwuler in der Midlife-Crisis.
Dabei können mir die Philosophen leider auch nicht weiterhelfen.
Die schreiben darüber nämlich kein Wort.
Deshalb habe ich meine Derrida-Bücher gerade alle bei eBay verramscht.
Mein Antiintellektualismus kommt bei Anna gerade super an. Wir kichern wie Schulmädchen. Verbindungsstrategie von Frauen und Schwuchteln an der Uni, während Marco, die sogenannte Kröte, auf der andern Seite vom Tisch sitzt und nicht mitlachen kann. Die Hete-Kröte kennt da keinen Spaß. Ich glaube, die Kröte würde ja am liebsten mit Heidegger im Wald spazieren gehen. Deshalb gibt es hier auch Wildbraten. Vielleicht lacht die Kröte auch nicht, weil ich zu schnell rede, wenn ich betrunken bin, bin ich denn schon betrunken?, vielleicht trägt ja die Kröte auch ein Hörgerät, und mit dem Hörgerät an ist das Geschnatter von uns Nichtkröten wahrscheinlich nur verzerrt zu hören, oder das Hörgerätmikrofon kann die Datenmenge nicht in angemessener Geschwindigkeit prozessieren und bleibt immer irgendwo hängen, während Anna und ich schon weiterschnattern. Weil wir mitkriegen, wie die Kröte nichts mitkriegt, reden wir einfach noch schneller und fangen dann, während die Kröte schon wieder aufs Klo geht (wer hat hier eigentlich ein Suchtproblem?), fangen wir also wieder an, über die Kröte selbst zu quatschen.
Kröte
Flöte
Anna und ich sitzen beim Wildbraten im deutschen Restaurant in der amerikanischen Provinz und quatschen über die hörbehinderte Kröte.
Nach zehn Minuten schon wie betrunken, obwohl wir noch fast nichts getrunken haben, Anna noch gar nichts getrunken hat, weil Anna nichts trinkt, weil Anna nämlich hier die Alkoholikerin ist, nicht ich. Was sie jetzt schon wieder erzählt, was sie allen erzählt, obwohl Anna seit siebzehn Jahren nichts getrunken hat, keinen Schluck. Darf man sich dann überhaupt noch Alkoholikerin nennen, frage ich mich.
Darf man sich dann überhaupt noch Alkoholikerin nennen, frage ich Anna.
Alkoholikerin bleibst du für immer, sagt sie stolz.
Als ich Anna heute Morgen anrief, um nach der Adresse des Restaurants zu fragen, sagte sie, ich kann jetzt nicht, ich muss gleich zum AA-Meeting. Ist immer irgendwo gerade ein AA-Meeting, überall auf der Welt. Vielleicht sollte ich mal mit, denke ich und bestelle noch ein Glas Rotwein.
Die Kröte ist zurück und lutscht allein gelassen am Wildbraten und hat die Hoffnung aufgegeben, hier noch heute ein Gespräch zu führen. Gackern, glucksen, grinsen. Die Kröte blickt schon bisschen böse aus ihren Krötenaugen und bereut es wahrscheinlich gerade, mitgekommen zu sein. Blickt mich krötig an, denke ich, obwohl sie mit dem Hörgerät, war wohl ein Auslaufmodell, gar nix mehr mitkriegen kann, denke ich.
Dick
Fick
Ich stelle mir vor, die Kröte sitzt da mit lädiertem Hörgerät, das eine Fünf-Sekunden-Verzögerung eingebaut hat und wahrscheinlich auch einen Zensor, der schmutzige Worte rausnimmt oder durch ein Piepen ersetzt, wie im amerikanischen Fernsehen, und lutscht alleine auf seinem Wildschwein oder hat das Hörgerät schon längst abgeschaltet.
Dann sagen wir auch nichts mehr.
Ich gucke Anna an. Ihr Gesicht ist auch ungeschminkt schön. Einen Haarschnitt hat sie praktisch nicht. Sie könnte tatsächlich ein bisschen mehr Styling vertragen. Andererseits mag ich Menschen, die so uneitel sind, dass sie sich nicht für ihr Aussehen interessieren. Die ihre Schönheit für Intelligenz opfern. Die ein bisschen wirr sind, aber es schaffen, einem regelmäßigen Job nachzugehen. So ist Anna. Sie ist so intelligent, dass sie kein Problem damit hat, albern zu sein. Ich glaube, ich wäre gerne auch so. Ja, ich wäre gerne wie Anna. Als wenn das die Lösung für meine Probleme wäre. Aber ich brauche eine Lösung in meinem Leben, nicht die Lösung aus einem anderen Leben. Wenn ich noch weitertrinke, gebe ich ihr einen Kuss. Wenn wir Männer wären, würden wir jetzt ab nach Hause. Wenn da nicht die Kröte wäre, denn da hockt ja noch die Kröte. Anna hat die Kröte schon fast vergessen, glaube ich, genauso wie ich. Ob die ihren Mann immer so behandelt?
Komm mit raus, sagt Anna.
Eine rauchen.
Meine erste Zigarette seit zehn Jahren.
Ithaca, NY, November 9
Seit ich in Amerika lebe, gehe ich jeden Tag, Tag für Tag, ins Gym. Egal, was sonst so los ist. Um durchzuhalten, um tough zu werden. Meine homosexuelle Leidensfähigkeit soll mich nicht in die Irre führen. Denn das Leben ist Kampf, Spiel und Kampf. Das ist in Wahrheit mein Job, denke ich, Muskeln trainieren, hart werden, ein Amerikaner werden. So wie Jack, mit Holzfällerhemd und Pick-up-Truck. Alle wollen Amerikaner werden, auch die, die so tun, als sei es anders. Jedenfalls sehen sich doch alle Abend für Abend im Fernsehen an, wie das geht.
24
CSI New York
CSI Miami
Criminal Intent
Law and Order
Crossing Jordan
Da kommt die Kröte. Die Kröte verabschiedet sich gerade von zwei Mädels. Die sehen aus wie höchstens sechzehn. Einige konzentrieren sich zwischenmenschlich nur noch auf die Studenten, sonst lernt man ja auch keinen hier kennen in diesem Kaff. Ich finde das sozialmäßig kaputt, grundkaputt.
Studentenficken.
Steh ich nicht drauf.
So alt bin ich noch nicht.
Anna und Marco und ich vor dem Norman-Bates-Psycho-Department. Für einen Moment ist es komisch. Wegen dem Wildschweinabend oder wegen Marcos Studentinnen oder ich weiß auch nicht. Weil es Dinge zwischen uns gibt, die noch keiner verstanden hat und über die man nicht reden darf. Anna und Marco, Anna und ich.
Last night with Anna I felt connected.
I didn’t have that feeling, in a long, long time.
Ich gehe jetzt ins Gym.
Marco guckt mich an, als wollte er was sagen. Aber ich glaube, er traut sich nicht, solange Anna dabei ist, fällt mir jetzt ein, wo ich nicht betrunken bin.
Was für eine Zeitverschwendung, sagt sie und rollt so komisch mit den Augen.
Ich hatte recht: Anna ist manchmal sehr streng.
Sie guckt Marco an. Wie Frauen mit ihren Männern umgehen.
Armer Marco, denke ich auf einmal.
Erst macht er mich aggressiv, dann tut er mir leid. Gegenüber Heten habe ich immer so übertriebene Reaktionen. Weiß meistens nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Ich weiß im Moment sowieso nicht, was ich mit Männern anfangen soll. Ausgerechnet mit Marco.
Vielleicht komme ich später nach, sagt die Kröte.
Ich muss noch mein Sportzeug holen.
Anna und Marco fassen sich nie an, so als wären sie gar kein Paar.
Ich finde, sie passen auch gar nicht zusammen.
Anna sagt, ich gehe in die Bibliothek, und guckt uns abwechselnd an. Jetzt nicht mehr streng. Ich glaube, sie denkt, wir werden nun Freunde. Marco und ich. Zu dritt zusammen, nicht zu zweit, nicht mehr allein.
Für Menschen, die an der Uni arbeiten, ist das Gym umsonst. Nur deswegen gehe ich hierher und nicht in das Luxusgym, wo die anderen Professoren sind, denn akademische Berufsanfänger sind arm. Ich bin arm. Auch wenn es nervt, wenn die kleinen Kinder dort kreischen und grölen. Alle andern hier sind zwanzigjährig, sodass man mit fast vierzig schon fast als Freak erscheint. Alle andern hier sind reich und geben an, mit ihren neuen Nike-Sneakern und iPods, während man als Assistant Faculty kaum über die Runden kommt. Zwanzigjährig und reich und auch noch gut aussehend.
Plane trotz potenzieller Erniedrigung jeden Tag hierherzukommen, jeden Tag zwei Stunden, weil es sonst nichts zu tun gibt. Früher bin ich immer mit Jack gegangen. Zwei Muskelmänner zusammen im Gym. Wirklich gewordene Pornofantasie. Jedenfalls fühlte ich mich im Gym immer super, wenn er in meiner Nähe war. Wir guckten uns an und manchmal gab er mir einen Kuss. Manchmal reichte es schon, wenn noch einer da war, wenn man nicht immerzu überall alleine rumhängt. Wenn man sich in Gesellschaft mit einem zeigt, nicht nur, um sich zu zeigen, sondern weil man zwischendurch mal zu dem hinkann. Auch wenn es sonst zu zweit, allein zu zweit, nicht immer nur so toll ist. Dafür sind dann Paare nicht ganz überflüssig, muss ich leider sagen, kann man das Modell «Paar» noch nicht komplett ausrangieren. Aber es muss ja nicht gleich eine Beziehung sein. Reicht ja vielleicht auch ein Trainingspartner. Ja, ich hätte gerne einen neuen Trainingspartner.
Da kommt Marco.
Als weniger routinierter Gymgeher versteht Marco nicht, dass Gymgespräche nicht länger als zwei Minuten dauern können, denn mehr Zeit darf zwischen zwei Übungen nicht vergehen. Versteht auch nicht, dass man beim Sprechen zwischen den Übungen nicht so nah rankommen soll, er berührt mich ja fast, sodass man nicht mehr weitermachen kann, weil nicht genug Platz für die Übung selber ist, weil Marco so dicht neben einem steht und man ihm dann sagen muss: Geh bitte mal drei Schritte zurück! Ist das jetzt schon wieder ein Hörgerätproblem oder was? Ich hatte mir vorgenommen, nett zu sein, weil er mir leidtat, wegen Anna, aber jetzt nervt er schon wieder.
Wenn Anna weg ist, ist Marco total enthemmt. Daran kann man sich vielleicht gewöhnen. Woran ich mich aber nicht gewöhnen will, ist, was Marco anhat. Ich habe ihm gezeigt, wo die Umkleidekabinen sind, damit er sich dort, wie alle andern auch, in Ruhe umziehen kann. Ich habe sogar angeboten, ihm eines meiner Schlösser für den Spind zu leihen, aber Marco zieht sich lieber im Trainingsraum um.
Er kommt in den Raum rein, wo gerade 50 Cent läuft, setzt dann seinen Rucksack auf die Bank der Bench-Press, auf der ich gerade meine Übungen mache, und fängt an, sich auszuziehen. Mitten im Raum. Da gucken die anderen Jungs schon mal rüber. Gleich darauf tun alle so, als wäre nichts gewesen, weil in Wirklichkeit keiner daran interessiert ist, Marco beim Umziehen zuzugucken. Alle machen mit ihren Übungen weiter, außer ich, weil ja Marco gerade meine Bench-Press als Ablage benutzt. So gut sind wir wirklich noch nicht befreundet. Nur wegen der Zwangspause und aus überhaupt keinem anderen Grund rede ich also schon mal mehr als zwei Minuten mit Marco, anstatt weiter meine Chest-Übungen zu machen.
Dann ist er fertig mit Umziehen. Dies ist der Augenblick, wo sich alle im Gym sicher sind, dass wir beide ein Paar sind. Alleine kann man nicht wirklich schwul sein. Erst zu zweit beginnen alle andern sich vorzustellen, was man wohl zusammen macht, wenn die andern mal nicht dabei sind. Jack und ich, das Dreamteam im Gym, da ist der eine oder andere beim Duschen gerne mal dazugekommen. Jetzt werde ich geoutet, weil der ignorante ostdeutsche Kollege in seiner schwarzen Schwedenhose so lesbisch-schwul aussieht, dass man selber gleich zu den Perversen mit dazugezählt wird, wenn man sich mal länger in seiner Nähe aufhält.
Ich muss jetzt gehen.
Marco guckt mich an – traurig oder was? Ich weiß nicht. Ich werde nicht schlau aus ihm. Er benimmt sich in jedem Moment immer wieder anders, vollkommen anders, als wenn er gar keine stabile Persönlichkeit hätte.
Diesmal weiche ich seinem Blick aus.
Ithaca, NY, November 10
Gisela sitzt nebenan auf dem Drehstuhl, schlenkert mit den Beinen in der Luft herum und pfeift bekannte Melodien aus ihren Lieblingsmusicals wie eine professionelle Schwulenmutti. Dabei blättert sie in der von ihr abonnierten Gartenzeitung und schneidet mit einer Nagelschere Blumenmotive aus, die sie am Nachmittag ins mitgebrachte grüne Lederimitatalbum neben die Fotos ihrer Enkelkinder klebt. Ich warte darauf, dass sie geht. Ist ja wie in einer betreuten Wohngruppe hier, nur wer hier wen betreut, nicht ganz klar.
Gisela macht Feierabend.
Endlich bin ich allein.
Ich gehe ins Büro nebenan und hole die Flasche aus dem Regal.
Mein Handy klingelt.
Hallo Anna.
Wir fahren morgen nach New York.
Kommst du mit?
Hätte Lust, das Wochenende mit Anna zu verbringen.
Hätte vielleicht sogar Lust, das Wochenende mit Marco zu verbringen.
Habe aber keine Lust, das Wochenende mit Anna und Marco zu verbringen.
Immerhin gibt’s da noch paar Schwule, sage ich, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich könnte mir in Chelsea im Sportstudio eine andere Muskelschwuchtel suchen. Mit der könnte ich dann eine Wochenendbeziehung aufbauen. Oder regelmäßig trainieren.
Muss denn immer alles schwul sein, fragt Anna. Habe mich mit meiner Jack-Geschichte ja umfassend geoutet, gleich am Anfang schon geoutet, ist ja auch nicht zu übersehen, sie ist ja nicht blöd, wenn auch als Fag Hag etwas unerfahren. Trotzdem will Anna nichts davon hören, oder versteht nicht, was es bedeutet, oder ich weiß auch nicht. Immer, wenn ich davon spreche, dass ich eine Schwuchtel bin, ist sie beleidigt. Ich finde das wahnsinnig egozentrisch. Ich glaube, sie will sich einfach nicht vorstellen, dass es eine Welt gibt, in der sie nicht vorkommt.
Ich finde, Schwule achten zu viel auf ihr Äußeres, sagt sie und sieht selber meistens so aus, na ja, als sei sie gerade aus dem Bett gekrochen. Nein, ich wünschte mir schließlich doch, sie würde etwas mehr auf ihr Äußeres achten. Ich frage mich gerade, ob Anna wirklich eine geeignete Fag Hag ist oder ob ich mir eine andere suchen muss, mit größeren Titten und bisschen mehr Schminke im Gesicht. Ich habe plötzlich den Verdacht, dass Marcos Schwedenhosen in Wirklichkeit ihr gehören.
Ich bin jetzt echt für einen Themenwechsel.
Warum bist du überhaupt mit der Kröte zusammen? Frage ich sie.
Anna lacht.
Wir sind verheiratet.
Als wenn das eine Antwort wäre.
Das ist keine Antwort.
Komm mit nach New York, sagt sie, dann erzähle ich es dir.
Die Alternative zu einem Wochenende mit Anna und Marco in New York heißt gerade, meinen Samstagabend unbezahlt mit vierzig- bis sechzigjährigen Menschen in überheizten, fensterlosen Räumen bei Neonlicht zu versitzen, während das Englisch des Gastredners im schlecht sitzenden Anzug beim Vortrag vorne so furchtbar ist, dass man überhaupt nichts versteht, auch sonst nichts verstehen würde, und schon mit nicht mal vierzig verbittert auf die auberginefarbene, silberdurchwirkte Stola der Leiterin des Departments für Vergleichende Literaturwissenschaften vor einem starrt, weil es sonst nichts zu tun gibt. Was ein Wahnsinn, was hier abends an der Uni bei Vortragsveranstaltungen im fensterlosen Raum mit allen anderen Vierzig- bis Sechzigjährigen abgeht. Für die das Alleraufregendste, für mich so aufregend wie ein Abendessen in durch und durch lesbischer Gesellschaft. Man fühlt sich wie vor der Geschlechtsreife.
Das ist mein Leben, sage ich zu Anna.
Silberdurchwirkte Stolas oder Marcos Schwedenhosen.
Ach, sagt Anna, Marco ist einfach nicht dein Typ.
An die Möglichkeit, dass er mein Typ sein könnte, hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Ich habe ihn bisher gar nicht als geschlechtliches Wesen wahrgenommen.
Eine Alternative zu diesen Abendunterhaltungen gibt es nicht. Nicht allein nach Hause, die beiden Flaschen Rotwein, die noch im Regal lagen, alle machen, und die nächsten drei oder fünf Stunden kostenlose Pornoseiten im Netz auschecken. Sich seinen Wohnort so aussuchen, dass noch mehr da sind, die so drauf sind wie man selber. Ist nicht ganz unwichtig. Nicht nur was Sex angeht, auch damit man nicht zum Vollidioten wird. Die anderen um mich rum sind entweder am Sublimieren oder schon im Halbschlaf. Im Lebenshalbschlaf. Nächstes Jahr werde ich vierzig.
Studenten oder Senioren.
Dazwischen gibt’s nichts.
Praktisch keine erwachsenen Menschen.
Ich muss jetzt los, sagt sie.
Du musst dich entscheiden.
Ich bleibe hier.
Okay.
Ich muss mich bewegen.
Ich weiß noch nicht, wohin.
IMPRESSUM
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet die Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über
http://www.dnb.ddb.de abrufbar.
Peter Rehberg: Boymen
Roman
© Männerschwarm Verlag, Hamburg 2011
Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik, Bremen
Ebook-Ausgabe 2011
ISBN 978-3-86300-018-9
Buchausgabe
ISBN 978-3-939542-60-5
Männerschwarm Verlag
Lange Reihe 102 –20099 Hamburg
www.maennerschwarm.de
DER AUTOR UND SEINE BÜCHER
Peter Rehberg wurde 1966 in Hamburg geboren. Nach Auslandsaufenthalten in New York und Chicago unterrichtet er Deutsche Literatur und Queer Studies in Bonn. Von 2006 bis 2011 war er Chefredakteur von «Männer». Peter Rehberg lebt in Berlin.
Bei Männerschwarm erschienen bereuits der Erzählband «Play» und der Roman «Fag Love».
Play
Klappenbroschur, 120 Seiten
ISBN 978-3-935596-06-0
Angekommen in der schönsten Stadt der Welt überlässt sich der Erzähler mit uneingeschränkter Bewunderung einem Dasein, das süchtig macht. Rhythmus und Atmosphäre der Mega-Metropole spiegeln sich auch in der Sprache: Das Stakkato der Sätze erzeugt einen Beat, bei dem man den Einfluss von Rainald Goetz erkennen kann. Steile Formulierungen schaffen Distanz zu jeder Art von deutscher Innerlichkeit. Sie erzeugen den Hintergrund für Rehbergs präzise Beobachtungen der Stadt und ihrer Menschen: schwule Popliteratur.
Presse:
«Play» ist tatsächlich so etwas wie das literarische Pendant zu den Forschungsstrategien der Queer Studies: ein Roman, dessen Erzähler eigentlich nichts anderes macht, als die vermeintlichen Vorgaben der Gesellschaft, ihrer Subkulturen und individuellen Übereinkünfte in Frage zu stellen. Nur dass eine Romanfigur im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen Hypothese damit natürlich glamouröser scheitern darf. (Kolja Mensing in taz)
Fag Love
Klappenbroschur, 208 Seiten
ISBN 978-3-935596-71-8
Felix ist ein typischer Repräsentant jener Dreißigjährigen, die trotz hoher Qualifikation ohne feste Anstellung und auf der Suche nach einem Leben sind, das sich zu leben lohnt. Als ihn ein Job nach New York bringt, verliebt sich Felix sofort in die «schwulste Stadt der Welt», sein Berliner Boyfriend Anton rutscht auf Platz 2 der Prioritätenliste und muss sich mit einer Urlaubsbeziehung begnügen, was auf Dauer nicht gut geht. «Fag Love» ist der stilistisch präzise gestaltete Ausdruck eines Lebens, das die postmoderne Popkultur vorbehaltlos bejaht und ihre Versprechungen ernst nimmt. Die Einheit von Sprache und Geschichte erzeugt eine Intensität, die jeden in den Bann zieht, egal, ob man sich mit dem Helden identifiziert oder einem die Sorgen und Nöte dieser Generation bisher nur als plakative Lifestyle-Fragen erschienen sind. Ohne es zu wollen, ist «Fag Love» damit ein klassischer Bildungsroman geworden, der auf zeitgemäße Art seine eigenen Perspektiven auf die Gegenwart entwickelt.
Presse:
«Felix lebt in New York, verliebt sich in Berlin, doch als er seines Freundes wegen dorthin zurückkehrt, geht die Beziehung in die Brüche. In Chicago geht das Leben weiter. In Chicago geht das Leben weiter. Diesen plötzlichen Umschwüngen vom Glück in die Traurigkeit, von gemeinsamen in einsame Stunden, gibt Rehbergs manchmal bewusst rauer, unebener Sprachfluss eine starke Unmittelbarkeit, vergleichbar den intensiven Handkamerabildern der Dogma-Filme. Die Reise ins Innere der Liebe, der Lust und des Lebens zwischen Sex, Beziehung und moderner Lebensgestaltung wird kontrapunktisch mit diversen Popsongs durchsetzt: Ein Lied kann eine Brücke sein.» (Christoph Dompke in Hinnerk)
INHALT
DID YOU FIND EVERYTHING YOU WERE LOOKING FOR?
YOU WILL NEVER GET MY SOUL
EVERY DAY WE ARE GETTING OLDER
WE WILL FUCK FOREVER
Impressum
Der Autor und seine Bücher





























