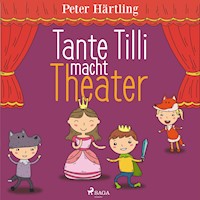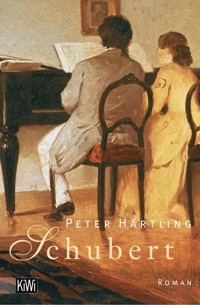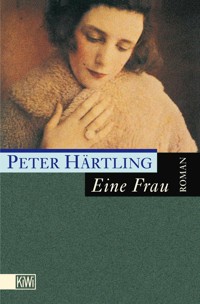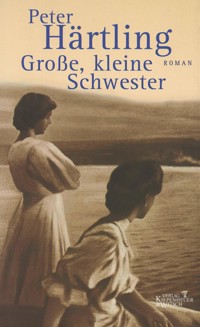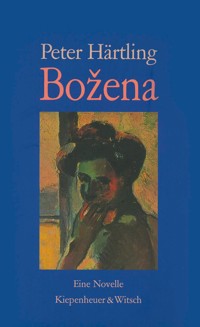
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 1992 besuchte Peter Härtling zum ersten Mal nach 1945 die Stadt seiner Kindheit Olomouc (Olmütz) in Mähren. Er wollte noch einmal den Spuren seines Vaters folgen, der ein paar Jahre in Olmütz als Rechtsanwalt tätig war und mit dessen Andenken er sich vor allem in Nachgetragene Liebe (1980) auseinandergesetzt hat. Wieder muß Härtling sein Bild vom Vater revidieren, wieder macht er die für sein Schreiben zentrale Erfahrung, daß die Erinnerung nichts Gegebenes, Statisches ist, sondern sich die Vergangenheit mit jeder neuen Lebensphase neu darstellt.Doch Härtlings Aufmerksamkeit, sein Interesse gelten neben dem Vater nun vor allem einem anderen Menschen: der tschechischen Sekretärin seines Vaters, deren Leben nach dem Ende der Nazizeit Härtling in Bruchstücken in Erfahrung brachte. Offenbar ist diese Frau, da sie für einen Deutschen gearbeitet hatte und als Kollaborateurin betrachtet wurde, ihr Leben lang geächtet worden.Hier beginnt Härtlings Novelle. Sie ist fiktiv, auch wenn sie einen wahren Grund besitzt, muß erfinden, um die Wirklichkeit dieser Frau fassen zu können. Härtling nennt sie Bozena Koska.Bozena muß nach der Befreiung der Tschechoslowakei erfahren, daß sie nicht mehr dazugehört. Erst soll ihr Chef, der »Herr Doktor«, ein Nazi gewesen sein, nun, ab 1948, die Kommunisten regieren, gilt er als Faschist. Für Bozena bleibt er ein Mensch, der entgegen der Weisungen der Nazis allen half, waren sie nun Deutsche, Tschechen oder Juden. Bozena wird verhöhrt, wehrt sich, wird bestraft, ausgegrenzt.Da beginnt sie, Briefe an ihren »Herrn Doktor« zu schreiben, in denen sie ihm erzählt, was sie sonst nicht auszusprechen wagt. Erst spät erfährt sie, daß alle ihre Briefe an einen Toten gerichtet waren.Behutsam, genau und mit großer sprachlicher Intensität zeichnet Peter Härtling in Bozena das Schicksal einer Frau nach, deren Leben von der Gewalt der Geschichte, die immer wieder Menschen dazu verurteilt, ohne Schuld auf der falschen Seite zu stehen, zerrieben wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Peter Härtling
Bozena
Eine Novelle
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Härtling
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Härtling
Peter Härtling, wurde 1933 in Chemnitz geboren. Er arbeitete als Redakteur bei Zeitungen und Zeitschriften. Anfang 1967 Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt am Main, dort von 1968 bis 1973 Sprecher der Geschäftsleitung, seit 1974 freier Schriftsteller.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Im Herbst 1992 besuchte Peter Härtling zum ersten Mal nach 1945 die Stadt seiner Kindheit Olomouc (Olmütz) in Mähren. Er wollte noch einmal den Spuren seines Vaters folgen, der ein paar Jahre in Olmütz als Rechtsanwalt tätig war und mit dessen Andenken er sich vor allem in Nachgetragene Liebe (1980) auseinandergesetzt hat. Wieder muß Härtling sein Bild vom Vater revidieren, wieder macht er die für sein Schreiben zentrale Erfahrung, daß die Erinnerung nichts Gegebenes, Statisches ist, sondern sich die Vergangenheit mit jeder neuen Lebensphase neu darstellt.Doch Härtlings Aufmerksamkeit, sein Interesse gelten neben dem Vater nun vor allem einem anderen Menschen: der tschechischen Sekretärin seines Vaters, deren Leben nach dem Ende der Nazizeit Härtling in Bruchstücken in Erfahrung brachte. Offenbar ist diese Frau, da sie für einen Deutschen gearbeitet hatte und als Kollaborateurin betrachtet wurde, ihr Leben lang geächtet worden.Hier beginnt Härtlings Novelle. Sie ist fiktiv, auch wenn sie einen wahren Grund besitzt, muß erfinden, um die Wirklichkeit dieser Frau fassen zu können. Härtling nennt sie Bozena Koska.Bozena muß nach der Befreiung der Tschechoslowakei erfahren, daß sie nicht mehr dazugehört. Erst soll ihr Chef, der »Herr Doktor«, ein Nazi gewesen sein, nun, ab 1948, die Kommunisten regieren, gilt er als Faschist. Für Bozena bleibt er ein Mensch, der entgegen der Weisungen der Nazis allen half, waren sie nun Deutsche, Tschechen oder Juden. Bozena wird verhöhrt, wehrt sich, wird bestraft, ausgegrenzt.Da beginnt sie, Briefe an ihren »Herrn Doktor« zu schreiben, in denen sie ihm erzählt, was sie sonst nicht auszusprechen wagt. Erst spät erfährt sie, daß alle ihre Briefe an einen Toten gerichtet waren.Behutsam, genau und mit großer sprachlicher Intensität zeichnet Peter Härtling in Bozena das Schicksal einer Frau nach, deren Leben von der Gewalt der Geschichte, die immer wieder Menschen dazu verurteilt, ohne Schuld auf der falschen Seite zu stehen, zerrieben wurde.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1994, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Kalle Giese, Overath
Covermotiv: Henri Manguin
ISBN978-3-462-30031-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Sie tritt an die Tür …
Empfangen wurde sie am ersten Arbeitstag …
Sie tritt in die Tür …
Zu den zitierten Gedichten
Alles wovon wir in der Kindheit träumten
und auch das
was niemand sich hätte träumen lassen
Und auch die Schönheit
die wir zumindest aus dem Augenwinkel erhaschten
aber auch die
an der wir blind vorübergingen
Selbst die Liebe
Selbst die Liebe wird gegen uns verwendet
der Sarg aus Glas
die Erdbeere die erste in diesem Jahr
die Herbstrose unseres Uneingedenkens
Und alles Gestrige das kein Übermorgen kennt
Jan Skácel
SIE TRITT AN DIE TÜR und wartet auf den Hund, dem sie einen deutschen Namen gab, Moritz, wie seinen vier Vorgängern auch. Es könnte ihr letztes Hündchen sein. Das hat sie vor ein paar Tagen zu Václav gesagt, ohne groß nachzudenken, und er hat sich wie immer mit einem raschen Trost davongemacht: Sie werde mindestens auf ein Dutzend Hunde kommen, und über neue Namen brauche sie sich ja keine Gedanken zu machen.
Sie versteht seine Eile, mag seine hastigen Aufbrüche, seine kurzatmigen Besuche, denn sie hält den Neffen auch nicht lange aus. Manchmal kommt er mit Ženka, seiner Frau; sie bringen ein Essen mit. Dann sitzen sie schweigend bei Tisch, bis Ženka regelmäßig anfängt zu klagen, über die Arbeit, über Václav, über die Zeit, die besser sein könnte, und sie einen Grund hat, aufzustehen und abzuräumen, die jungen Leute zu verabschieden.
Moritz! ruft sie. Im Grunde wartet sie gar nicht auf den Hund. Er kann sich noch eine Weile herumtreiben. Sie hat es gern, in der Tür zu stehen, über die Straße zu spähen, die Äcker, bis zum dunstigen Wald, Gesicht, Brust und Hände in der Kälte, Rücken und Hintern in der Wärme. Paní Božena Koska, die alte Schlampe, die eine Deutschenliebste gewesen ist, eine Kollaborateurin, die nichts dazugelernt hat, wie die angeblichen Kenner ihrer Geschichte behaupten. Nichts! sagt sie sich oder denen, an die sie eben denkt. Das geht euch auch nichts an.
Es kommt darauf an, wie sie sich in die offene Haustür stellt. Hat sie die Füße weit draußen, kühlt sie rascher aus. Schiebt sie die Fersen hingegen in die Stube, fördert sie einen leisen Genuß. Sie lehnt sich gegen die Wärme, die ihr vom Rücken in den Bauch rieselt. Nimmt die Lust dabei überhand, ruft sie sich zurecht. Noch immer spielt ihr die Phantasie mit, und abgestandene Gefühle setzen sich ihr unter die Haut und treiben das Blut um.
Moritz! Er wird ohnehin nicht auf ihr Geschrei hin kommen. Vor ein paar Jahren hat sie dem vorhergegangenen Moritz gepfiffen, und ein Zahn ist ihr dabei über die Lippen geschossen. Darauf spülte sie ihren Mund mit Kamillentee, und die restlichen Zähne hat sie bis heut behalten. Das war einer der wenigen Erfolge gegen all die Mißhelligkeiten und Gemeinheiten, die sie in den Jahren erfuhr. Dabei hatte sie sich, fand sie, schon an alles gewöhnt. Was allerdings nicht dazu führte, daß sich auch ihre Umgebung, die wenigen Menschen, mit denen sie noch umging, an sie gewöhnten. Im Gegenteil. Sie kam sich in ihrer Gesellschaft immer unmöglicher vor, ganz und gar fremd. Warum, konnte sie sich nicht erklären, obwohl sie, da war sie sich sicher, die Schuld daran trug. Schuld, die sie sich geholt hatte wie eine ansteckende Krankheit, schon vor langer Zeit. Sie konnte sich kaum mehr daran erinnern, wie sie vor dieser Schuld gelebt hatte. Aber vorstellen konnte sie es sich. Das gehörte zu ihren heimlichen Vergnügen.
Moritz! ruft sie. Der Hauch bleibt wie eine Sprechblase vor ihrem Mund stehen. Sie lehnt sich gegen den Türrahmen, da eine Wade unerwartet fest wird vor Schmerz. Vorsichtig verlagert sie ihr Gewicht auf das andere Bein und hofft, der Schmerz werde mit dieser leisen Bewegung wandern. Noch gelingt es ihr, beinahe jeden Schmerz zu unterdrücken. Sie vergißt sich ganz einfach. Sie verliert sich in Gedanken und verliert dabei auch ihren geplagten Leib.
Jetzt sieht sie den Hund wie einen hin und her springenden Floh auf der grauen Linie des Horizonts. Sie muß nicht mehr nach ihm rufen. Mit Blicken läuft sie ihm entgegen. Und sie kennt jede Einzelheit, jede Erhebung, jeden Graben, die unterschiedlich hoch gewachsenen Bäume in der ersten Reihe vor dem Wald. Sie kennt die verrutschten Karos aus Grün und Braun, die sich zu jeder Tageszeit anders ausdrücken, zu jeder Jahreszeit mit einer anderen Farbe auffüllen. Sogar nachts schlägt dieses Muster durch, ein dunkles Geweb in der Schwärze.
Plötzlich wächst der Hund, dieser Bastard aus Spitz und Foxl, neben ihr aus dem Boden. Sie hat ihn aus dem Blick verloren und ihn so bald nicht erwartet. Er möchte getätschelt werden. Es fällt ihr schwer, den Rücken zu beugen. Der Hund kennt diesen einen Seufzer und hält ihn vermutlich für einen kosenden Schnalzer. Gleich wird sie, sobald sie verschnauft hat, ihn mit dem Fuß ins Haus schieben, die Tür schließen und sich wieder einsperren. Sie schaut zu Moritz hinunter, er zu ihr auf. Kannst du mir sagen, wieso deine Augen glühen, Hund, du bist doch keine Katz. Worauf er den Kopf senkt und ihrem Fuß zuvorkommt. Das bringt sie nun tatsächlich durcheinander. Was ist in dich gefahren, du Deubel?
Sie macht kein Licht. Der Hund sucht sich in der Dunkelheit seinen Platz, sie den ihren. Ihrer beider Blicke sind an Dämmer und Finsternis gewöhnt, ihre Ohren an die wenigen Geräusche. Wenn das Tier sich bewegt, schmatzt, sich kratzt, im Traum seufzt, bleibt sie ebenso ruhig wie er, wenn sie mit den Füßen scharrt, laut atmet, weil die Beklemmungen zu mächtig werden oder wenn sie von ihrem eigenen Schnarchen mit einem knappen Röcheln aufwacht.
Die Kate, die ihr 1945 als Erbe zufiel und die sie erst vier Jahre unbewohnt am Straßenrand stehenließ oder stehenlassen mußte, weil sie an andern Orten festgehalten wurde, faßt zwei Räume, die Wohnküche und einen Schlafverschlag. Das Klo wurde später angebaut; jahrelang mußte sie ihre Notdurft in einem mehr und mehr verrottenden Bretterhaufen am Rande des Gartens verrichten.
1949 zog sie ein, nachdem bereits ein Bauer aus der Nachbarschaft Anspruch auf das Häuschen erhoben und ihr älterer Bruder, der sonst nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte, es doch für sie gehütet hatte. Nicht einmal in ihren ärgsten Wachträumen hätte sie es sich ausmalen können, daß sie hier vierzig Jahre mehr oder weniger eingesperrt leben sollte. Sie haben sie nicht freigelassen, nicht einmal die Nachgeborenen, denen die Geschichte weitererzählt wurde, als hätte sie noch Sinn, als hätte sie noch Leben. Längst gelang es ihr, die sichtbaren und unsichtbaren Wärter zu täuschen. Vermutlich erwarteten sie, daß sie ausdörre, dahinsieche, verblöde. Es hätte auch geschehen können. Sie drückte ihren Rücken, den sie manchmal spürte wie sperriges Holz, manchmal wie fließenden Schmerz, gegen die hohe Lehne des Sessels. Vielleicht haben sie es tatsächlich geschafft, sie aus dem Leben zu stoßen, erst die unter Beneš und danach die Roten. Immerhin ist es ihr besser ergangen als vielen, die erst jubelnd dafür waren und denen danach aus unerfindlichen Gründen der Prozeß gemacht wurde. Auf Dubček hatte sie gesetzt, das ist wahr. Nur ist er schneller von der Bühne verschwunden, als sie sich hat aufrappeln können.
Moritz! ruft sie leise. Sie hört ihn. Er hat geschlafen, streckt sich. Komm, Hunderl. Er weiß, was er zu tun hat. Ohne Eile durchquert er die Küche, setzt sich neben den Sessel, daß ihre Hand ihn streicheln kann, den Kopf, den Nacken. Ihre Hände brauchen etwas Warmes, Lebendiges, sonst wären sie ihr schon längst abgefallen, redet sie sich ein.
Soll ich schlafen gehen? fragt sie den Hund und sich. Sie wäre nicht erstaunt, bekäme sie eine Antwort. Sie steht auf, geht zum Radio, das sich auf einem vom Bruder zurechtgeschnittenen, an der Wand befestigten Brett befindet, schaltet es ein. Wahrscheinlich melden sie uns ein neues Unheil, murmelt sie. Wer möchte das schon versäumen.
Der Hund begleitet sie zum Radio und zurück zum Sessel, ohne aufzuschauen. Diesen Weg kennt er. Nun legt er sich neben den Sessel, auf dem sie wieder Platz nimmt. Noch eine Stunde, sagt sie zu dem Hund. Wenn du willst, kannst du jetzt schon in deinen Korb gehen. Ich halte dich nicht auf. Ihre Hand sucht nach seinem Kopf. Ich nicht, murmelt sie. Er bleibt. Die Stimmen aus dem Radio erreichen sie nicht. Sie reden in einer Sprache, die sie nichts angeht. Seit ihr auffällt, daß sie morgens immer länger schläft, vor Anbruch des Tags in einen todnahen tiefen Schlaf fällt, hält sie sich nachts länger wach. Sie möchte dem Schlaf auf keinen Fall die Gelegenheit geben, ihr das Leben, und sei es noch so erbärmlich, vor dem Tod zu nehmen.
Wenn ihr das Kinn auf die Brust sinkt, der Schlaf sie zu übermannen droht, hebt Moritz den Kopf, drückt gegen ihre Hand, und sie wacht wieder auf. So halten sie sich wach, bis die Stunde, die sie sich auferlegt hat, um ist. Geh schlafen, Moritz. Ich geh es auch.
Sie braucht eine Ewigkeit, bis sie sich ausgezogen, die Kleider auf dem Stuhl neben dem Bett gefaltet hat. Dann lauscht sie eine Weile auf den Hund, vermeidet es, sich selber zu hören, ihr Ächzen, ihren pfeifenden Atem.
Dobrou noc, Moritz. Wir wollen sehen, wer morgen wen weckt.
Wenn sie auf dem Rücken liegt und den Schlaf erwartet, kommt es ihr vor, als sinke die schwer werdende Stirn in den Schädel hinein und zerpresse alle Gedanken.
DAS ENDE (ODER DEN ANFANG) hat sie niedergeschrieben. Gleich, nachdem es geschehen war, aber schon so, als müsse sie eine wieder aufgestiegene Erinnerung unbedingt festhalten:
Herr Doktor hat sich verabschiedet, völlig überraschend. Die Kanzlei ist geschlossen. Mir wird mein Gehalt noch zwei Monate weitergezahlt. Die Frau Doktor wird sich um die Auflösung der Kanzlei kümmern. Aber die Räume sind noch gemietet für ein Jahr. Herr Doktor ist zur Wehrmacht eingezogen worden, obwohl das wegen seines kranken Herzens nicht sein darf. Sicher hat man ihn damit gestraft. Weil sich wahrscheinlich noch Klienten melden werden, hat er mich gebeten, in den nächsten Wochen regelmäßig in die Kanzlei zu gehen. Was soll ich auch anderes tun? Mit Herrn Doktor habe ich Glück gehabt. Jetzt hat es ein Ende. Heute ist der 21. Mai 1944.
In dem Heft, in das sie diese Notiz auf der ersten Seite eintrug, blieben die übrigen Seiten leer. Die Briefe, mit denen sie später ein Selbstgespräch mit dem Herrn Doktor und anderen begann, füllen ein anderes Heft.
R.H. hat sie so gut wie nie mit Namen angesprochen, sondern stets mit dem Titel, den er gar nicht hatte, aber nach ihrer Vorstellung von einem Anwalt haben mußte, wie sein Vorgänger auch. Herr Doktor folgte dem Herrn Doktor. Beiden hat sie als Sekretärin beigestanden. Dem alten Vorgänger nur für kurze Zeit. Sie war eingesprungen, als dessen Sekretärin krank wurde und sich für die kurze Frist, die er noch tätig sein würde, niemand fand. Der alte Anwalt war mit ihrer Familie bekannt. Sie ließ sich überreden, einzuspringen. Seit sie ihr Jurastudium im zweiten Semester hatte abbrechen müssen, die tschechischen Universitäten waren vom Reichsprotektor geschlossen worden, half sie gelegentlich in der Verwaltung eines Hotels aus. Nun ordnete sie den Abschied des alten Herrn Doktor und rechnete nicht entfernt damit, auch bei dem Nachfolger eine Anstellung zu finden. Der kam mit seiner Familie aus dem Altreich. Allerdings stamme er aus Brünn, sei dort aufgewachsen, habe die ersten Semester in Prag studiert und eine seiner Schwestern sei mit einem Tschechen verheiratet. Das hat ihr der alte Doktor nicht nur zur Beruhigung erzählt. Er habe sich den jungen Mann, der seine Kanzlei übernehme, sehr genau angeschaut.
Hat er sie besucht, hier, in der Kanzlei?
Nicht nur einmal, Fräulein Božena, ich kann doch meine Klienten nicht einem X-beliebigen ausliefern, sagte er und verbesserte sich nach einem Zögern: Überlassen, meine ich.
Wie soll sie sich ihm vorstellen? Wird er tschechisch mit ihr sprechen wie der alte Herr Doktor oder Wert legen auf deutsch? Warum sollte er überhaupt viel mit ihr sprechen wollen? Sie möchte den alten Herrn Doktor nach dem neuen Herrn Doktor ausfragen, aber sie traut sich nicht. Bis er von sich aus redet, als sei ihm ihre unausgesprochene Frage lästig geworden: Er ist Mitte Dreißig, seine Frau um ein paar Jahre jünger. Sie haben zwei Kinder. Sie werden in dem Haus am Ende der Passage wohnen, an der Wassergasse.
Ihre Familie, der sie diese Neuigkeiten weitergibt, stellt fest, daß die Welt nobel zugrunde gehe und sie überhaupt keine Aussicht habe, von dem Nachfolger angestellt zu werden.
Die Szene in dem geräumigen Wohnzimmer ändert sich kaum. Es scheint, als hätte die Familie sich seit dem Einmarsch der deutschen Truppen verabredet, sich am späten Nachmittag bis nach dem Abendessen hier aufzuhalten, rund um den großen, dunklen, auf Glanz polierten Tisch, jede und jeder die Hände auf der Platte, als sollte eine spiritistische Séance beginnen, doch der Tisch bewegt sich nicht, und manchmal wird auch das Schweigen nicht gebrochen, bis Vater aufsteht, aufbricht zur Arbeit in der Weinstube, die pro forma einem »Unbescholtenen« gehört, doch tatsächlich noch immer ihm.
Gegen die familiäre Erwartung hat sie dem jungen Herrn Doktor auf den ersten Blick gefallen. Natürlich hat sie der alte Herr Doktor empfohlen, ihre Fingerfertigkeit auf der Schreibmaschine, ihre Freundlichkeit, ihre Personenkenntnis und nicht zuletzt ihre fachliche Beschlagenheit. Das alles bewog den jungen Herrn Doktor, Božena Koska weiterzubeschäftigen. Überdies erfuhr er zu seinem Entsetzen, nachdem er ihr geraten hatte, das Studium doch wieder aufzunehmen, daß das den Tschechen nicht gestattet sei.
Weil die Klienten Božena trauten, suchten sie auch bei dem neuen Herrn Doktor Rat und Hilfe. Anfänglich schüchterte ihn die gemischte Klientel ein. Es waren in der Mehrzahl Deutsche, doch gab es noch viele Tschechen und einige Juden. Mit der Zeit könne er in Schwierigkeit geraten, gab er mehr sich als Božena zu bedenken. Sie half ihm, schon mit ihrer Freude über sein gutes Tschechisch, über alle Ängste hinweg. Immer wieder einmal würde er verzagen und sich überlegen, ob er sich auf diesen Fall einlassen solle. Immer wieder würde sie ihn überreden: Ich bitte Sie, Herr Doktor. Wer sonst kann der armen Frau aus dem Schlamassel helfen.
Es dauerte nicht lange, bis sie sich in den Herrn Doktor verliebte. Unter Umständen, die ihr selber nicht geheuer und von großem Reiz waren, denn sie entzündete sich an einem fremden Feuer. Zufällig entdeckte sie zwischen Akten einen Brief seiner Brünner Schwägerin. Keinen gewöhnlichen Verwandtenbrief, sondern eine leidenschaftliche Liebeserklärung. Sie hätte den Brief nicht lesen dürfen, doch die ersten Sätze fingen sie ein, legten sich ihr auf die Lippen. Sie redete sie nach und steckte sich an ihrer Lust an.
Verblüfft stellte sie fest, daß sie sich veränderte. So schämte sie sich gar nicht, den Herrn Doktor in Gedanken zu umarmen und zu küssen. In seiner Gegenwart allerdings verbot sie sich diese Phantasien. Sie fand auch nichts dabei, daß der Doktor seine Frau betrog. Die spielte die einzige erlaubte Rolle, und sie war in dieser Konstellation langweilig. Manchmal telefonierte Herr Doktor mit seiner Schwägerin. Božena war versucht, ihr Ohr an die verschlossene Tür zu seinem Zimmer zu legen. Sie tat es nicht, sondern dachte sich die Gespräche aus, stellte sich die Dame in Brünn vor nach der Stimme, die sie vom Telefon kannte. Es war eine sehr sinnliche, dunkel eingefärbte Stimme. Sie spürte ihren Körper und prüfte ihn an dem der Frau, den sie nachzufühlen versuchte.
Er überrascht sie, steht in der offenen Tür. Sie ist in ihre ausschweifenden Gedanken versunken. Es ist ihr nicht aufgefallen, daß er das Gespräch beendet hat. Der Atem stockt ihr, sprechen kann sie nicht. Sie fängt an zu flattern.
Fehlt Ihnen etwas?
Mehr als ein Krächzen schafft sie nicht.
Was ist denn mit Ihnen? Besorgt beugt er sich über sie. Jetzt könnte es sein, daß sie ohnmächtig wird.
Er spricht tschechisch mit ihr, so wie auch mit der Brünnerin.
Mir ist gut, beteuert sie schließlich.
Ich brauche Sie heute nicht mehr, Fräulein Božena. Gehen Sie nach Hause.
Das ist ein falscher Vorschlag. Sie möchte, daß er sie brauche. Dennoch gibt sie dem Herrn Doktor nach, sucht fahrig ihre Sachen zusammen, räumt den Tisch auf, deckt die Schreibmaschine ab, merkt gar nicht, daß er ihr Zimmer wieder verlassen hat. Sie müßte sich noch die Lippen nachziehen. Nun läßt sie sich selber keine Zeit mehr. Na shledanou, Herr Doktor, ruft sie und wartet seine Antwort nicht ab.
Am Abend trifft sie Pavel, den sie seit der Volksschule kennt, seit vielen Jahren nicht gesehen hat, vor dem Kino in der Passage. Sie fragt ihn, wo er sich die ganze Zeit herumgetrieben hat, bekommt darauf keine Antwort und hat auch keine erwartet, und kaum hat der Film begonnen, den sie anschaut, ohne ihn zu verstehen, haben ihre Hände sich ineinander verkrallt, drückt ein Schenkel gegen den ihren. Sie bildet sich ein, es könnte der Herr Doktor sein und findet das zugleich verrückt, denn nie würde der Herr Doktor so riechen wie Pavel, nach Schweiß und ungewaschenen Kleidern.
Bis zum Ende des Films halten sie es nicht aus.
Er habe eine Stube, in der sie unterschlüpfen könnten. Er wohnt hinter dem Schwimmbad. Sie laufen durch den Michaeler-Ausfall. Hinter jedem mächtigen Baum drückt er sich gegen sie, sie nimmt seinen Körper an wie eine Form. Dabei wird ihr ein wenig übel.
Nicht zu fest, Pavel, bittet sie.
Er hat sein Zimmer im Paterre neben der Wohnung seiner Eltern. Der Holzboden knirscht unter ihren Füßen. Sie bittet ihn, das Licht auszulassen; der Mond genüge. Dann zieht sie sich aus und hofft, daß er keinen Umstand mache. Im Grunde wünscht sie sich, gar nicht zu sich zu kommen. Aber er zögert, hat selber Angst und tut ihr weh. Sie zerrt ihn an sich. Er fängt an, ihr eine Last zu sein. Nun kann sie sich nichts mehr vormachen, weiß, daß sie Herrn Doktor anders lieben würde, daß es überhaupt eine Liebe ist, die solche übermäßige Nähe nicht verträgt.
Mit ihren Träumen hat sie sich unbedacht und gierig in die Wirklichkeit gewagt. Aber eine solche Liebe, wie die ihre zu Herrn Doktor, verträgt Grenzübergänge nicht. Die wirklichen Bilder und die geträumten dürfen nie durcheinandergeraten. Sie wird es lernen. Sie muß es lernen.
Im Morgengrauen verläßt sie Pavel, verspricht ihm ein Wiedersehen. Sie muß aufbrechen, es könnte Alarm geben. Zwar fürchtet sie sich vor den deutschen Soldaten, die Streife gehen, aber sie will nicht neben Pavel liegen, bis es hell wird. Die Angst läuft mit ihr, spannt sie an, läßt ihren Atem und ihre Schritte unnötig laut werden. Der Mond ist verschwunden, und die sich auflösende Nacht breitet sich grau und feucht über die Stadt. Der Herr Doktor, denkt sie, wird noch schlafen, neben seiner Frau. Sie kennt die Wohnung an der Wassergasse, das riesige, düstere Vorzimmer, in dem die Kinder oft spielen. Selbst tagsüber brennt da Licht.
Die ganze Wohnung horcht, als sie das Haus betritt. In der winzigen Garderobe wartet sie einen Augenblick, mustert sich im Spiegel, streicht mit den Fingern die Haut unter ihren Augen glatt, zwinkert sich zu, auf einmal übermütig, eine junge Frau, schlank, ziemlich groß, die hennaroten Haare hochgesteckt – was können sie ihr anhaben, sie ist längst aus den Kinderschuhen, hat ihre Arbeit, kann sich leisten, was ihr paßt, zum Beispiel einen Mann lieben. Sie muß auch keinem auf die Nase binden, daß der genaugenommen eingesprungen ist für einen andern, den sie wirklich liebt und der für eine solche Liebe nicht in Frage kommt. Sie könnte ins Zimmer gehen, das sie mit ihrer Schwester teilt, und ein wenig später zum Frühstück kommen, nachdem sie sich im Bad erfrischt hat, aber sie sieht Licht in der Küche, hört Vater und Mutter sich leise unterhalten. Ich bin gleich da, sagt sie gegen die halboffene Tür, sich ankündigend, hat sie schon aufgedrückt. Guten Morgen, sagt sie und kann nichts dagegen tun, daß das Lächeln, das sie sich vornahm, in ein verlegenes Kichern umspringt.
Dobré jitro.
Guten Morgen.
Sie geht zum Herd, um sich Kaffee einzuschenken. Dabei streift sie die Stöckelschuhe ab und weiß, wie sie Mutter damit ärgert. Ihr Gezeter ist ihr lieber als ihr vorwurfsvolles Schweigen. Kannst du die Schuh nicht in der Garderobe lassen? Sie setzt sich zwischen Vater und Mutter, streicht sich ein Brot. Vor dem Fenster fängt die Gasse an zu leben. Köpfe gleiten am Fensterbrett entlang. Manche schauen herein, andere stur geradeaus. Kinder und Kleinwüchsige kommen ungesehen vorbei. Die sehr Großen zeigen sogar Hals und Schultern. Von klein auf hat sie dieses Kasperltheater vergnügt.
Wo bist du gewesen? Vater schaut sie an, eher neugierig, ohne Vorwurf.
Bei Pavel.
Haben wir den zu kennen?
Er ist mit mir auf die Volksschule gegangen, Pavel Diskočil.
Die Eltern können sich nicht erinnern. Vater ist es auch gleich.
Hast du bei ihm übernachtet? Er käme nie darauf, sie zu fragen, ob sie bei ihm oder mit ihm geschlafen habe. Und für Mutter hört sich diese Frage schon unanständig an.
Ja. Wir sind erst miteinander im Kino gewesen; dann sind wir zu ihm gegangen. Er wohnt hinterm Schwimmbad.
Ist es dir ernst?
Was soll sie Vater antworten? Soll sie sagen: Er ist ein Vorwand, ein Ersatz. Sie nickt. Mutter schüttelt den Kopf. Vater beginnt zu rascheln mit der Serviette, der