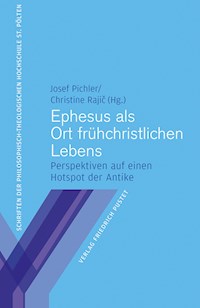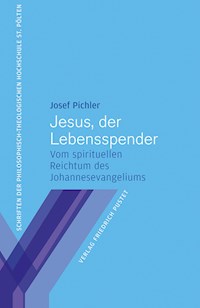Brandlastsenkende Maßnahmen und vorbeugender Brandschutz bei der technischen Infrastruktur von Bürogebäuden E-Book
Josef Pichler, Dipl.-HTL-Ing.
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2004
Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Elektrotechnik, Note: keine, , Sprache: Deutsch, Abstract: In modernen Bürobauten wird an die technische Infrastruktur ein hoher Anspruch gestellt. Mehrere Bereiche sind hier für das Wohlbefinden der darin arbeitenden Personen, für das zuverlässige Funktionieren der Geräte, für einen niedrigen Energieverbrauch und für geringe Betriebs- und somit Folgekosten zu beachten. Ein Aspekt hat aber in letzter Zeit besonders an Bedeutung gewonnen: Der vorbeugende Brandschutz Beleuchtet sollen in dieser Arbeit brandlastsenkende Maßnahmen unter folgenden Aspekten werden: · Installation der Räume, · Energieversorgung und Verteilung, · Datenverkabelung, · Sonstige Brandschutzmaßnahmen, · Errichtungsvorschläge. Die Vorgangsweise für die Erzielung guter und zeitgemäßer Lösungen, und deren kostenrelevanten Belange welche eine Realisierung nicht scheitern lassen, ist im folgenden Projekt detailliert beschrieben. Auch sollen Denkanstösse für das Vorbeugen gegen mögliche Fehler gegeben werden. Die heutige Leicht- und Mischbauweise mit einem hohen Anteil an Holz, Kunststoff, Gipskarton, Glas und Stahl stellt an den Brandschutz in Gebäuden ganz besondere Anforderungen. Durch diese Bauweise sind nur mehr wenige Leitungen unter Putz oder in Beton verlegt. Im Bereich der Elektroinstallation ist besonders stark der Zuwachs an Daten- und Kommunikationsleitungen zu beobachten, welche mittlerweile einen sehr hohen Anteil an der Brandlast ausmachen. Durch differenzierte Geräte- und Produktwahl und geeignete Arten der Installation, sowie den Einsatz dezentraler Techniken, können hohe Einsparungen erzielt werden. Die Einsparungen betreffen nicht nur die Brandlast sondern auch die Errichtungs- und Folgekosten. Auch ist eine Steigerung der Verfügbarkeit (insbesondere bei Umbauarbeiten) ein leicht erreichbares Ziel. Brandschutz ist die Summe aller Vorkehrungen, angefangen beim Vermeiden von Brandlasten, über die taugliche Wahl von Schutzmaßnahmen und die sorgfältige Installation bis hin zu den im Ernstfall leicht erreichbaren Löschhilfen. Es muss daher Bewusstseinsbildung gemacht werden, Brandlasten als solche zu erkennen und auf deren Minimierung zu achten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsübersicht
Inhaltsübersicht
1 Kurzdarstellung
2 Arbeit
2.1 Vorbemerkungen
2.2 Grundlegendes
2.3 Ausgangssituation
2.3.1 Brandrisken von PVC-isolierten Kabeln und Leitungen sowie Rohren
2.3.2 Personengefährdung durch PVC
2.5 Untersuchungen an einem Objekt
2.5.1 Vorbemerkungen
2.5.2 Installation der Räume
2.5.3 Gebäudeangaben
2.5.4 Büroausführung
2.6 Ansatz der Möglichkeiten der Brandlastsenkung
2.7 Untersuchung über die Möglichkeiten der Brandlastreduktion
2.7.1 Brandlast der Leitungen je Büro
2.7.2 Brandlast der Netzwerkverkabelung je Büro
2.7.3 Brandlast des Kabeltragsystems der Büros
2.7.4 Bürogesamtbrandlast-Vergleich „herkömmliche – dezentrale Installation“
2.7.5 Brandlast der Büroanspeisungen, der Etagen- sowie der Netzwerkverkabelung
2.7.6 Versorgung der Etagenverteiler und der Netzwerk-Steigverkabelung
2.7.7 Gesamtbrandlast-Vergleich
2.7.8 Mengenvergleiche
2.7.9 Schlussfolgerung
2.8 Sonstige Brandschutzmaßnahmen
2.8.1 Vorschriftsgemäße Leiterdimensionierung und Sicherungszuordnung
2.8.2 Richtige Typenwahl
2.8.3 Erdung, Blitzschutz, Überspannungsschutz
2.8.3.1 Erdung
2.8.3.2 Blitzschutz
2.8.3.3 Überspannungen
2.8.3.3.1 Die Ursachen
2.8.3.3.2 Galvanische Einkopplung
2.8.3.3.3 Induktive Einkoppelung
2.8.3.3.4 Kapazitive Einkopplung
2.8.3.4 Schutz
2.8.4 Brandschutz durch Fehlerstrom-Schutzschalter
2.8.5 Brandschutz durch Fehlerstrom-Überwachung
2.8.6 Fünfleitersystem
2.8.7 Bussystem und Heizungssteuerung
2.9 Installations- und gerätetechnische Vorschläge, basierend auf den Untersuchungsergebnissen
2.9.1 Fünfleitersystem
2.9.2 Schienenverteiler
2.9.2.1 Allgemeines
2.9.2.2 Anwendungsbereich
2.9.2.3 Normen
2.9.2.4 Planung
2.9.2.5 Aufbau
2.9.2.6 Komponenten
2.9.2.6.1 Schienenkasten
2.9.2.6.2 Abgänge
2.9.2.6.3 Zubehör
2.9.2.7 Montagezeit und –kosten
2.9.2.8 Anpassungsfähigkeit
2.9.2.9 Brandschutz/Brandverhalten
2.9.2.10 Betriebssicherheit – Qualität
2.9.2.11 Wirtschaftlichkeit
2.9.3 Energiebussysteme
2.9.3.1 Allgemeines
2.9.3.2 Reduktion von Kosten, Mengen und Brandlast
2.9.3.3 Etagenverkabelung
2.9.3.3.1 Energiebus System Hager-Tehalit
2.9.3.3.2 Flachkabelsystem (Dätwyler/Woertz)
2.9.4 Brüstungskanal
2.9.4.1 Stahlblech-Installationskanal
2.9.4.2 Kanalsteckdose
2.9.4.3 Zubehör/Brandschutzpolster
2.9.5 Brüstungskanal-Verkabelung
2.9.5.1 Rundkabelsystem mdm
2.9.5.1.1 Komponenten
2.9.5.2 Verkabelungs-System WAGO Winsta / Hager-Tehalit
2.9.5.3 Flachkabelsystem (Dätwyler/Woertz)
2.9.5.3.1 Komponenten
2.9.5.3.2 Verlegung
2.9.5.3.3 Brandverhalten
2.9.5.3.4 Kostenbetrachtung
2.9.5.3.5 Zukunftssicherheit
2.9.6 Allgemeine Bemerkungen zum Brandschutz
2.9.6.1 Fehlen von Brandlastangaben in Katalogen
2.9.6.2 Bewußtseinsbildung
Teil III
3.1 Bilder, Zeichnungen, Beilagen:
3.2 Fußnotenverzeichnis
3.3 Literaturverzeichnis
3.4 Lieferantenverzeichnis
1 Kurzdarstellung
In modernen Bürobauten wird an die technische Infrastruktur ein hoher Anspruch gestellt.
Mehrere Bereiche sind hier für das Wohlbefinden der darin arbeitenden Personen, für das zuverlässige Funktionieren der Geräte, für einen niedrigen Energieverbrauch und für geringe Betriebs- und somit Folgekosten zu beachten.
Ein Aspekt hat aber in letzter Zeit besonders an Bedeutung gewonnen:
Der vorbeugende Brandschutz
Beleuchtet sollen in dieser Arbeit brandlastsenkende Maßnahmen unter folgenden Aspekten werden:
Installation der Räume
Energieversorgung und Verteilung
Datenverkabelung
Sonstige Brandschutzmaßnahmen
Errichtungsvorschläge
Die Vorgangsweise für die Erzielung guter und zeitgemäßer Lösungen, und deren kostenrelevanten Belange welche eine Realisierung nicht scheitern lassen, ist im folgenden Projekt detailliert beschrieben.
2 Arbeit
2.1 Vorbemerkungen
Aus der Erfahrung von vielen Ausschreibungen und der Mitarbeit an einer großen Zahl von Gebäudeplanungen kam wurde mir klar, dass ein Systemdenken bei Planungen nicht in dem Maße verbreitet ist, wie es aus technischer und wirtschaftlicher Hinsicht notwendig wäre.
All zu oft werden die in Gebäuden eingebauten System singulär betrachtet und auch in den einzelnen Gewerken ist ein übergreifendes Denken und Planen heute noch nicht alltäglich.
Diese Arbeit soll einen Anstoß dazu geben.
2.2 Grundlegendes
Die heutige Leicht- und Mischbauweise mit einem hohen Anteil an Holz, Kunststoff, Gipskarton, Glas und Stahl stellt an den Brandschutz in Gebäuden ganz besondere Anforderungen.
Durch diese Bauweise sind nur mehr wenige Leitungen unter Putz oder in Beton verlegt.
Bei einem Brand ist sehr schnell die technische Infrastruktur miteinbezogen.
Erschwerend kommt hinzu, dass auch die heute verwendeten Materialien für die Heizungs-, Wasser- und Abwasserinstallation einen hohen (brennbaren) Kunststoffanteil am Rohr- und Isoliermaterial haben.
Im Bereich der Elektroinstallation ist besonders stark der Zuwachs an Daten- und Kommunikationsleitungen zu beobachten, welche mittlerweile einen sehr hohen Anteil an der Brandlast ausmachen.
In den letzten Jahren wurde ganz besonders kritisch der Kunststoff PVC betrachtet, daher auch dazu eine kurze Übersicht.
2.3 Ausgangssituation
2.3.1 Brandrisken von PVC-isolierten Kabeln und Leitungen sowie Rohren
In den vergangenen Jahren haben mehrere große Brände, bei denen Kabel und Leitungen betroffen waren, für Aufsehen und beträchtliche Schäden gesorgt.
Folgende Brände mit PVC-Kabeln und Leitungen sind bekannt:
Telefonvermittlung der Telekom, Düsseldorf, 1988
Kunsthalle Düsseldorf, 1988
U-Bahn Düsseldorf, 1991
Deutscher Dom in Berlin, 1994
Klinikum Aachen, 1995
Flughafen Düsseldorf, 11. April 1996 (17 Tote, 88 Verletzte[1])
Ausgehend von diesen spektakulären und großen Schaden anrichtenden Bränden, bei denen auch Personen betroffen waren, konnten Anstrengungen festgestellt werden, solche Vorkommnisse in Zukunft hintan zu halten beziehungsweise deren Auswirkungen zu minimieren.
Die deutsche Musterbauordnung 96 (MBO) erfuhr nach dem Flughafenbrand, in einer Sitzung am 4./5. Dezember 1997 eine Änderung und wurde zur MBO 1997.
Eine der wichtigsten bekannten Aktivitäten ist die neueMLAR(= Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen) in der Fassung aus dem Dezember 1998der Bundesrepublik Deutschland welche in der Zwischenzeit aktualisiert wurde und als MLAR März 2000 nach wie vor Gültigkeit hat.
Auch dieDIN 4102-12(= Norm zur Kabelanlage mit Funktionserhalt) wurde überarbeitet und mit Dezember 1998 gültig.
In Österreich hat der Brand in der Standseilbahn von Kaprun am 11. November 2000 mit seinen 155 Toten ein generelles Thematisieren des Brandschutzes nach sich gezogen.
So sind bundesweit wesentlich genauere Kontrollen zu bemerken und bei Neubauten ist das Thema Brandschutz nun mit einem anderen Stellenwert zu erkennen.
In der Elektrotechnikverordnung 2002 (222. Verordnung, ausgegeben am 13. Juni 2002, ETV 2002) sind mit der Thematik „Brandschutz“ folgende österreichischen Vorschriften für bindend erklärt:
ÖVE/ÖNORM E 8007/A1:2001-02-01 (Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern),
ÖVE/ÖNORM E 8001-4-50:2001-05-01 (Brandgefährdete Räume),
ÖVE/ÖNORM E 8001-4-58:2001-05-01 (Bauliche Konstruktionen aus oder mit brennbaren Baustoffen sowie Hohlwände),
ÖVE-EN 2 Teil 1 bis 6 und Teil 8:1993-02, ÖVE-EN 2 Teil 1a:1994-06 und ÖVE-EN 2 Teil 7: 1994-06 (Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen)
Aber nicht nur die Gesetzgeber und Normungsgremien sondern auch die Hersteller und deren Dachorganisationen haben erkannt, dass der Brandschutz (und damit der Schutz von Personen) verbessert werden kann und muss.
So hat der „Verband der Kabel- und Leitungsindustrie Österreichs“ im Juli 2001 die Errichter und Betreiber von Anlagen in einem Schreiben[2] davon informiert, dass „seit mehr als zwanzig Jahren Kabel und Leitungen mit über den Standard hinausgehenden Eigenschaften für den Brandfall“ angeboten werden, doch „diese bisher nur in wenigen, durch Vorschriften erzwungenen Fällen zur Anwendung“ kommen.
In dem Schreiben wird weiters darauf hingewiesen, dass auf europäischer Ebene die Kabelindustrie an diesbezüglichen Vorschriften und Prüfungen arbeite welche für die Aufnahme von „Kabeln und Leitungen mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall“ in die „Bauprodukten Richtlinie (CPD)“ vorgesehen sind.
Diese Arbeiten sollten 2001 abgeschlossen sein, die Umsetzung in nationales Recht sei aber nicht vor 2005 möglich.
Es sei „der österreichischen Kabel- und Leitungsindustrie daher ein Anliegen bereits jetzt, bevor ähnliche Unglücksfälle neuerlich Leid und Schaden bringen, Empfehlungen für die Verwendung höherwertiger Kabel und Leitungen auszuarbeiten“.
Es wird auf die Web-Site „www.kabel-vereinigung.at“ verwiesen, wo Empfehlungen zu finden wären.
Dort ist für den gegenständlichen Fall zu finden:
Interessant ist die Feststellung, dass „das Brandrisiko hoch sei und dieentstehende Säure ... die Funktionalität der Anlagen in kurzem Zeitraum nachhaltig schädigen“ kann.
Es wird mit keinem Wort die Gefährdung der in den Büros anwesenden Personen erwähnt.
Auch der Ansatz „Viele Ihnen bekannte Kabeltypen können durch Einsatz von halogenfreien Werkstoffen entscheidend verbessert werden“ stellt nur einen Lösungsansatz dar.
Der größte österreichische Elektro-Rohrhersteller Dietzel-Univolt bewirbt seine halogenfreien Elektrorohre wie folgt:
„Rauchgasvergiftung. Nein Danke!
Die meisten Verletzungen und Todesfälle werden durch das Einatmen ätzender und toxischer Rauchgase verursacht. Bei herkömmlichen Elektro-Rohren aus Kunststoff kommt es im Brandfall zu Gasbildung, die bei Menschen zu bleibenden Gesundheitsschäden führen können.
HFT-Rohre von Dietzel-Univolt sind die sicherste und einzige sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Rohren. Denn die von Dietzel-Univolt für die Herstellung halogenfreier Installationssysteme eingesetzten Kunststoffe enthalten kein Chlor und keine Schwefelstoffe und bieten daher entscheidende Vorteile. Wie z.B. wesentlich geringere Toxizität und keine ätzenden Rauchgase. Weiters kann bei HFT-Rohren keine Bildung von korrosiven und säurehaltigen Gasen entstehen. ... HFT-Rohre verringern auch die Rauchdichte. ... Der Einsatz von HFT-Rohren ist überall dort zu empfehlen, wo die Sicherheit und der Schutz von Menschen und anlagen im Vordergrund stehen, z.B. bei ... Flughäfen, Krankenhäusern oder Schulen. So macht Dietzel aktiven Brandschutz.“[3]