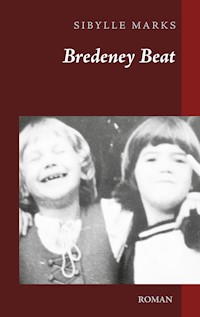
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Humorvoll und ohne Pathos erzählt Protagonistin Susanne von ihrer Familie, ihrer Kindheit und Jugend in den 70er- und 80er-Jahren. Zunächst macht sie eine Zeitreise zum Beginn des 20. Jahrhunderts, der Leser lernt ihre Vorfahren kennen und erfährt, wie sich die Wege ihrer Eltern im Ruhrgebiet kreuzen. Susanne erlebt das Erwachsenwerden mit all seinen Höhen und Tiefen im Essener Nobelviertel Bredeney. Sie macht Bekanntschaft mit den Tücken der Pubertät, mit Mobbing und mit erstem Liebeskummer. Sie findet ihren ganz eigenen Weg, damit fertig zu werden, indem sie eintaucht in eine Traumwelt aus Kitsch-Romanen und melancholischer Musik. Letztendlich macht Susanne die bittere Erfahrung, dass auch das vom Wohlstand und vermeintlichem Idyll geprägte Bredeney vor Schicksalsschlägen nicht verschont bleibt, gleichzeitig lernt sie eine ganz andere, ihr bis dahin völlig fremde Welt kennen- und lieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin: Sibylle Marks wurde 1970 in Heidelberg geboren und lebt in Essen. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Schriftsetzerin, im Anschluss studierte sie u. a. Theaterwissenschaften und Anglistik in Bochum. Nach der Geburt von Zwillingsmädchen brach sie das Studium ab, um sich ganz ihren Töchtern zu widmen. Später schloss sie ein Studium der Malerei und Grafik an der HBK Essen ab und entdeckte zudem ihre Leidenschaft für das Schreiben. „Bredeney Beat“ ist ihr erster Roman.
Für meine Eltern
»Auf dem Wipfel eines Waldbaums saß meine Jugend und rief: Fang mich, fang mich!
Und ich kletterte und strebte, sie zu erhaschen; doch lächelnd schwang sie sich höher und höher ...
Von der rosenroten Zinne eines schwebenden Wölkleins winkte sie nieder: Fang mich, fang mich!
Und ich stieg auf einen Berg, wo die Wolken wohnen, sie zu haschen.
Doch höher und höher schwang sie sich. Aus dem tiefgoldnen Glanz des Morgensterns sah ich ihr Antlitz winkend sich neigen: Fang mich, fang mich!
Auf denn, zu den Sternen!«
Maria Janitschek
Inhaltsverzeichnis
Marlene ’69
Elisabeth ’48
Susanne ’70
Susanne ’71
Christiane ’77
Plouescat ’78
Anna ’80
Herr Jablonski ’82
Sue Ellen ’83
Paul ’84
Lore ’86
Battle ’86
Acid ’87
Birthday ’88
Old House ’88
The Beasts ’88
Berlin ’89
Abi ’89
Bredeney ’89
Marlene ’69
Wäre es nach meiner Großmutter gegangen, hätte ich das Licht dieser Welt gar nicht erblickt. Allerdings waren ihre Maßnahmen meiner Mutter gegenüber, meine Existenz zu verhindern, eher kontraproduktiv.
Als Lore, meine Großmutter, eines Tages im Zimmer ihrer Tochter Marlene, genannt Lene, die Anti-Baby-Pille fand, war sie völlig entsetzt. Geradezu angeekelt nahm Lore das kleine Pillenpäckchen an sich und versteckte es an einem sicheren Ort.
Lene, die gerade die Semesterferien bei ihren Eltern im Ruhrgebiet verbrachte, kam am Abend nach Hause, und sofort gab es von ihrer Mutter eine Gardinenpredigt, die sich gewaschen hatte.
»Marlene! Wo hast du die denn her?«, schrie sie und fuchtelte wild mit der Pillenschachtel vor Lenes Nase herum. »Das ist wirklich das Letzte! Du bist schließlich nicht einmal verheiratet!«
Da spielte es für meine Großmutter überhaupt keine Rolle, dass meine Eltern schon seit über einem Jahr ein Paar waren. Alles, was über ein Händchenhalten hinausging, befand sich jenseits von Lores Toleranzgrenze und Vorstellungskraft. Zumal mein Vater in Lores Augen sowieso nicht »der Richtige« war für ihr einziges Kind.
»Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, dass du so einen Schweinkram zu dir nimmst, verbiete ich dir den Umgang mit diesem Versager. Warte ab, bis dein Vater nach Hause kommt, er wird bestimmt begeistert sein!«
Der Inhalt des Pillenpäckchens landete daraufhin in der Essener Kanalisation. Wir schreiben das Jahr 1969, die Zeit von Woodstock und freier Liebe, wenn Sie verstehen. Kurz, meine Mama pfiff offenbar auf die Vorschriften ihrer Eltern und meine Existenz war trotz des – oder besser gesagt – wegen des Einschreitens meiner Oma nicht mehr aufzuhalten.
Meine Mutter Marlene Mertens wurde an einem schwülheißen Tag im Juli 1947 in Mannheim geboren. Es glich zu dieser Zeit fast einem Wunder, denn meine Großmutter war 41 Jahre alt, als sie endlich schwanger wurde. Meine Großeltern hatten die Hoffnung auf ein Kind schon längst aufgegeben. Es schien zunächst so, als würden der Zweite Weltkrieg und die sich daraus ergebenden schweren Zeiten das Gründen einer Familie verhindern.
Mein Großvater Carl Mertens hatte das Glück, während des Zweiten Weltkrieges nicht zur Wehrmacht zu müssen. Er war aufgrund seiner Tätigkeit als promovierter Physiker bei der BASF damals viel im ganzen Deutschen Reich unterwegs und leistete mit seinen Physikerkollegen Forschungsarbeit. So blieb ihm die Front erspart, er musste stattdessen sein Wissen zur Entwicklung der Kernspaltung beitragen. Carl war eigentlich absoluter Pazifist und hat später nicht gerne über die dunklen Jahre des Nationalsozialismus gesprochen. Wenn jemand in seiner Gegenwart über den Zweiten Weltkrieg und den Abwurf der Atombomben über Hiroshima sprach, machte sich bei meinem Großvater sofort unendliche Traurigkeit breit. Auch wenn seine Arbeit natürlich nicht in direktem Zusammenhang stand, fühlte er sich irgendwie mitverantwortlich.
»Es war ja Krieg. Wenn ich mich der Forschung widersetzt hätte, säßen wir jetzt bestimmt nicht hier, Susannchen!« Susannchen. Das bin übrigens ich.
Lore blieb damals zurück im Hessischen und versorgte als Krankenschwester heimgekehrte, meist schwer verwundete und traumatisierte Soldaten, die ihr wie die Fliegen wegstarben. Die Grausamkeit, die Entbehrungen des Krieges und die Tatsache, dass sie so lange von meinem Großvater getrennt sein musste, machten sie schließlich sehr krank. Als 1945 endlich alles vorbei war, wog sie nur noch 45 Kilo und ihre Lebensfreude war erloschen. Carl kehrte heim und nun begann für das Paar – wie für so viele andere – der Wiederaufbau.
»Lorchen, es wird schon alles wieder. Nu’ iss mal was!«
Mein Großvater liebte seine Lore von Herzen und er setzte alles daran, sie wieder aufzupäppeln. Er nahm seine geregelte Arbeit wieder auf und es gelang ihm nach längerer Suche, eine kleine Wohnung in einem weniger zerbombten Teil von Mannheim zu finden. Ihre vorherige Wohnung in Ludwigshafen lag in Schutt und Asche. Lore und Carl standen vor dem Nichts.
Und obwohl sich liebestechnisch zwischen meinen Großeltern in diesem Chaos und bedingt durch den Umstand, dass für Lore der reine Akt ja sowieso »Schweinkram« war, nicht viel abgespielt haben kann, muss zumindest ein Mal doch etwas passiert sein, denn am 20. Juli 1947 kam meine Mutter zur Welt. Lore lag 26 Stunden in den Wehen und ging bei der Geburt von Lene fast selber drauf.
Somit hatte sich das Thema Kinderkriegen für sie ab sofort erledigt. »Sei froh, dass du überhaupt auf die Welt gekommen bist, Marlene. Bei deiner Geburt, das war knapp für uns beide, das kann ich dir sagen!« bemerkte sie bei vielen Gelegenheiten. Jaja, Lore konnte mitunter äußerst charmant sein.
Die kleine Marlene erlebte zunächst eine ziemlich eintönige Nachkriegskindheit, ihre Mutter führte ein recht strenges Regiment, und der liebevolle Vater war leider viel zu selten zu Hause. Aber seine berufliche Karriere ging voran und Carl bekam im Jahre 1952 die Einladung zu einem sehr gut dotierten Forschungsauftrag in Colomiers in Frankreich. Da er dieses Angebot auf keinen Fall ablehnen konnte, packte die kleine Familie ihre wenigen Habseligkeiten und siedelte um nach Toulouse. Es folgten zehn glückliche Jahre, geprägt vom französischen Savoir-vivre, welches dann auch Lore geradezu aufblühen ließ.
Während Carl sich in seiner neuen beruflichen Situation schnell zurechtfand, unternahm Lore mit Klein-Lene Streifzüge durch die Einkaufsstraßen von Toulouse und erfreute sich an der Haute Couture, den zahllosen Restaurants und Cafés.
»Schau doch nur, Marlene, das ist der Dernier cri!«, rief sie aufgeregt, wenn sie in einem Schaufenster ein todschickes geblümtes Kostüm entdeckte, das sie einfach nicht im Laden lassen konnte und gleich am nächsten Morgen stolz der Nachbarschaft präsentierte.
Meine Großmutter entwickelte nicht nur größten Eifer, die Landessprache zu erlernen, sondern hatte auch mächtig Spaß daran, einen Haufen Geld für teure Kleidung auszugeben. Carl ließ sie gewähren. Er war ja unendlich froh, sein »Lorchen« wieder glücklich zu sehen.
Von der französischen Küche ließ Lore sich weniger inspirieren. Kuchen und Plätzchen backen, das konnte sie, aber Kochen war einfach nicht ihr Ding, das übernahm mein Großvater. Bis heute befinden sich einige von Carls original französischen Kochbüchern in meinem Besitz, oft versehen mit seinen handschriftlichen Kommentaren.
Die Zeit in Frankreich machte aus ihm einen Meisterkoch, von seinem Talent durften wir viele Jahre profitieren. Er kredenzte uns regelmäßig die erlesensten Speisen: Hummersuppe, Hechtklößchen, Filet Wellington, Soufflé Glacé au Grand Marnier, um nur einige Leckerbissen zu nennen. Diese Völlerei hatte nicht unerhebliche Auswirkungen beim Gang auf die Waage, denn Carl »veredelte« die meisten seiner Gerichte mit Unmengen von Butter und Sahne. »Sonst schmeckt das doch nach nichts«, war er der Meinung.
Die Leidenschaft für das Kochen übertrug sich später auf meine Mutter. Sie stand Carl in Sachen Kochkunst in nichts nach. Meine Großmutter hingegen bekam höchstens einen lätschigen Pfannkuchen zustande. Aber gut essen, das konnte sie wieder.
Lore Emilie Schwabe wurde 1906 in Eisenach geboren. Sie stammte aus einer gut situierten, teilweise sogar adeligen Akademikerfamilie, und da legte sie auch Zeit ihres Lebens großen Wert drauf. Ständig bekamen wir die Geschichte ihrer Vorfahren aufgetischt. »Susannchen, dein Ur-Ur-Urgroßvater war der Oberbürgermeister von Weimar, und seine Frau stammte von einem alten Adelsgeschlecht ab! Freiherrin Friederike Christiane zu Weimar-Orlamünde. Ganz feine Leute waren das!«
Über die Familie ihres Mannes wurde im Übrigen nicht viel gesprochen, sie war in Lores Augen anscheinend nicht besonders erwähnenswert. Ich weiß nur, dass Carl am 29. Mai 1903 geboren wurde, eine Schwester hatte und Carls Vater, also mein Urgroßvater, einen Friseursalon irgendwo im Schwarzwald führte. Einmal erwähnte Lore, dass sie eine Cousine Carls in Triberg besucht hätten. Aber sie rümpfte diesbezüglich die Nase: »Was für ein ordinäres Weibsbild, diese alte Spinatwachtel! Kein Umgang für uns, pas du tout!«
Lediglich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Friseursalons meines Urgroßvaters dokumentiert die Existenz dieses Familienzweiges. Bedauerlich, denn gerne hätte ich mehr darüber erfahren, und ich frage mich bis heute, warum Carl nie Anekdoten aus seiner Jugend erzählt hat.
Lores Vater, Dr. cand. Rudolf Schwabe, führte als Geschäftsführer die Hofapotheke in Eisenach, ihre Mutter Marie lernte er durch regen Kontakt zu den ortsansässigen Ärzten kennen, sie arbeitete nämlich als Arzthelferin. Mein Urgroßvater war eine sehr imposante Erscheinung und die hübsche Marie sofort hin und weg von ihm. Sie heirateten im August 1903 und zogen in die Theaterstraße in ein Stadthaus, das sich im Schwabschen Familienbesitz befand.
Bei der opulenten »Hochzeits-Feyer« in der Loge »Carl zur Wartburg« wurde unter dem Motto »Ein froher Gast – Ist Niemands Last« ein großes Festessen zelebriert.
Man startete mit einer »gar schmackhafft Vorspeyß, so man esset im Lande der Schweden«, gefolgt von »Rebhühnern mit gut teutsch Sauerkraut« und endete mit »Sodann annoch Frücht, Mandeln aus Italia samt allerley Ergötzlichkeiten«.
Zunächst kam neun Monate später Lores Schwester Käthe zur Welt und mit der Geburt meiner Großmutter zwei Jahre darauf war die Familie komplett.
Die Kindheit der beiden Mädchen verlief sehr glücklich und unbeschwert. Rudolf war zwar ein ziemlich strenger Vater, aber diese Strenge glich Mutter Marie durch ihre herzliche, liebevolle Art aus.
Mein Urgroßvater, ein umtriebiger Mann, reiste leidenschaftlich gern und ließ sich zudem von sämtlichen Verwandten und Freunden Ansichtskarten aus aller Welt schicken. In meinem Besitz befinden sich mehrere Schuhkartons voller alter Fotos und Postkarten aus dieser Zeit, die ich hin und wieder hervorhole und mit Begeisterung betrachte. Darunter sind unter anderem Grüße aus Australien, Thailand, Indochina, Texas und Brasilien. Die Karten haben wunderbare nachträglich kolorierte Motive, wurden alle in Sütterlin beschrieben, und dies teilweise so winzig klein, dass man sie ohne Lupe kaum entziffern kann.
Eine Postkarte stammt zum Beispiel aus Manchester in England, geschrieben am 13.1.1901, und ist an meine Urgroßmutter gerichtet, offenbar von einem früheren Verehrer:
»Sehr geehrtes gnädiges Fräulein,
zu Ihrem Geburtstag am 20.1. gestatte ich mir Ihnen die besten Glückwünsche zu Füssen zu legen. Hoffentlich verleben Sie den Tag recht gesund und fröhlich und haben ein angenehmes freudenreiches Jahr vor sich. Zudem ich die Dreistigkeit zu verzeihen bitte, dass ich überhaupt ein Lebenszeichen von mir gebe, verbleibe ich mit bester Empfehlung und mit freundlichen Grüßen an Ihre Angehörigen und die mir bekannten Damen,
Ihr ergebener Eberhard« (Nachname unleserlich)
Und es schrieb Karl – ein Freund der Familie – am 09.12.1909 aus Sao Paulo:
»Lieber Rudolf, liebe Marie!
Viele Herzliche Weihnachtsgrüße! Daß es mir so sehr weihnachtlich zumute wäre, könnte ich gerade nicht behaupten: 35 Grad im Schatten! Aber man gewöhnt sich dran! Was machen Frl. Käthe und Frl. Lore? Hoffentlich seid ihr alle wohl und munter. Ich werde täglich fetter!
Herzlichen Gruß von Eurem Karl«
Am 28.3.1929 wurde eine Ansichtskarte aus Sundsvall in Schweden an meine Urgroßmutter verschickt:
»Herzlichsten Dank für Ihre gute Hilfe bei meiner Flucht von Eisenach! Ich bin froh, daß wir hier in ruhigeren Verhältnissen leben, wünsche nur, daß es auch bald in Deutschland besser wird. Grüßen Sie bitte die Herrschaften, die mich kennen!
Ihre Henny Boström«
Hier spielt die Autorin wahrscheinlich auf die Inflation an, die Deutschland 1929 in eine schlimme Wirtschaftskrise stürzte und ein Vorbote der politischen Veränderungen in den 30er-Jahren war.
Neben der Reiselust hatte Rudolf noch ein weiteres Steckenpferd: die Fotografie. Da konnte er sich auf seinen Reisen natürlich gänzlich austoben. Aber auch zu Hause in Eisenach suchte er immer wieder nach ausgefallenen Motiven. Nicht selten musste sich die gesamte Großfamilie am Sonntagnachmittag in festlicher Kleidung im Garten oder bei schlechtem Wetter im Wohnzimmer versammeln. Die Mädchen und Frauen hatten aufwendige Frisuren mit riesigen Schleifen im Haar; sie trugen gestärkte weiße Blusen mit Spitze und lange Röcke sowie den echten Goldschmuck, der nur zu ganz besonderen Anlässen aus der Schatulle geholt wurde. Den Jungen wurden meist Matrosenanzüge verpasst, die Herren trugen selbstverständlich Fliege und Frack.
Bis Rudolf das perfekte Foto inszeniert hatte, vergingen manchmal Stunden.
»Erwin, nu’ halt doch mal still! Lorchen, guck nicht so bescheiden!«, schimpfte er. Offenbar war eine ständige Regieanweisung, möglichst ernst dreinzublicken. Auf den meisten Fotografien, die ich von damals noch besitze, schauen die Protagonisten ausnahmslos »wie die Kuh, wenn’s donnert«. Und nach der Prozedur klagten nicht wenige kurzfristig über eingeschlafene Gliedmaßen und Rückenleiden.
Herrlich sind die Aufnahmen, bei denen mein Urgroßvater, inspiriert von seinen Reisen, ein Motto für den Fototermin vorgab. Dann bedurfte es besonderer Vorbereitung. Einmal mussten alle Mädchen für ein japanisches Motiv einen Kimono tragen und sich mit Stäbchen die Haare verzieren. Marie hatte zuvor Stunden damit verbracht, die Kleider aus asiatischen Stoffen zu nähen. Was hatten Lore und Käthe für einen Spaß! Das Leben war einfach wunderbar! Aber meiner Urgroßmutter wurde es manchmal zu bunt.
»Heiliger Bimbam! Woher soll ich denn jetzt Indianerkostüme kriegen?«, klagte sie, als Rudolf eine dramatische Szene in einem Wigwam darstellen wollte. Natürlich musste dafür im Garten auch ein großes Tipi errichtet werden. Man erkennt auf dem Foto ziemlich schnell, dass hierfür sämtliche Teppiche aus dem Fundus der Familie ins Freie gebracht worden waren.
Meine Urgroßeltern waren leidenschaftliche Gastgeber. Eine Eigenschaft, die sich übrigens bis heute in der Familie weitervererbt hat. Jeden Sommer erging an einem Wochenende eine Einladung an die gesamte Nachbarschaft der Theaterstraße, etliche Torten und Salate wurden zubereitet, der Garten festlich dekoriert, und auf dem Grill brutzelte ein saftiges Spanferkel. Der Schaumwein floss in Strömen. Es wurde gesungen, getanzt, und auf den eilig arrangierten Gruppenfotos sieht man sehr deutlich, dass der ein oder andere Gast schon recht tief ins Glas geschaut hatte. Ernst gucken konnte da jedenfalls niemand mehr.
Von den schlimmen Folgen des Ersten Weltkriegs wurde die Familie in Eisenach glücklicherweise weitgehend verschont. Rudolf durfte als Apotheker vor Ort bleiben und musste nicht beim Militär dienen. Zum Kriegsende 1918 bekam er das Angebot, als Chemiker bei der IG Farben in Höchst eine Abteilung zu leiten. Also siedelte man nach Hessen über, sehr zum Leidwesen von Marie und den Mädchen, denn sie hingen an ihrer Heimat, aber da gab es natürlich keine Widerrede, das Familienoberhaupt hatte entschieden.
Die Familie bezog ein schönes Haus am Stadtrand und lebte sich schnell ein, nur der hessische Dialekt bereitete zunächst Probleme.
»Mama, die sprechen hier alle so komisch. Ich verstehe in der Schule kein Wort. ›Eihorrschemaa!‹«, klagte Käthe. »Was soll denn das heißen?«
Aber sehr schnell war auch diese Barriere überwunden, und die Schwabschen Töchter fühlten sich pudelwohl in ihrer neuen Umgebung.
Lore entdeckte den Sport für sich und entwickelte sich zu einem richtigen Tennis-As. Sie gewann mehrmals die hessischen Jugend-Meisterschaften und brachte einen Pokal nach dem anderen nach Hause. Noch mit 89 Jahren, bis kurz vor ihrem Tod, schwang sie mit viel Elan den Tennisschläger.
Auf einen weiteren Titel war sie zeitlebens besonders stolz: Lore wurde zur »Höchster Kloßkönigin« gekürt, weil sie auf einem Stadtfest in kürzester Zeit sieben riesige Kartoffelklöße verputzte.
Nach einer eher mittelmäßigen Schullaufbahn begann sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und einige Herren der Schöpfung begannen, reges Interesse an meiner quirligen und hübschen Großmutter zu zeigen. Als mein Großvater, zu dieser Zeit Student in Frankfurt, sie an einem lauen Sommerabend des Jahres 1928 auf einem Weinfest an der Waterkant kennenlernte, war es sofort um ihn geschehen. Lore ließ ihn allerdings zunächst abblitzen.
Erst nach drei Jahren unermüdlichen Werbens um ihre Gunst hatte sie ein Einsehen. Carl, mittlerweile in einer respektablen und recht gut bezahlten Stellung, mit der er auch eine Familie würde ernähren können, hielt bei den Schwabes um Lores Hand an und im Sommer 1931 wurde Hochzeit gefeiert.
Nach der Zeit in Frankreich verschlug es Familie Mertens 1962 ins Ruhrgebiet: Carl wechselte zur Bergbauforschung nach Essen. Lore freute sich besonders über den erneuten Umzug, denn auch ihre Schwester Käthe lebte mit ihrem Mann und zwei Kindern im Essener Stadtwald. Und an deren Gartenzaun grenzte das Grundstück des Vaters meines Vaters.
Während eines sommerlichen Kaffeekränzchens anlässlich der fröhlichen Familienzusammenführung flog ein von meinem Vater etwas unsauber geschossener Fußball über den Zaun in Nachbars Garten und landete »mit Schmackes« direkt in Tante Käthes Schwarzwälder Kirschtorte.
»Na wartet! Euch werde ich es zeigen, ihr Bengel!«, fluchte Tante Käthes Gatte Egon, während er sich die Sahnespritzer aus dem rot angelaufenen Gesicht wischte. Meine Mutter kicherte verlegen und schaute meinem eilig türmenden Vater und dessen zwei Brüdern interessiert hinterher. So kam es zur ersten flüchtigen Begegnung meiner Eltern.
Elisabeth ’48
Die Kindheit meines Vaters Paul Lindner entwickelte sich nicht besonders erfreulich. Seine Mutter Elisabeth starb 1948 im Alter von 40 Jahren an Gebärmutterhalskrebs, da war mein Vater gerade zwei geworden. Mit ihm wurden seine Brüder, der 14-jährige Harold und der 12-jährige Johann, zu Waisen und mein Opa Wilhelm zum Witwer.
Diese Großmutter habe ich also leider nicht kennengelernt. Es hängt nur ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto von ihr in meiner kleinen Ahnengalerie. Sie hat dunkle Haare, sanfte Augen und lächelt einen freundlich an. Es wurde nur Gutes über sie berichtet. Sie muss eine ausgesprochen warmherzige Frau gewesen sein.
Vor einigen Jahren, kurz vor seinem Tod, erzählte mir Onkel Harold beim gemeinsamen Backgammon-Spiel, dass zu Elisabeths Begräbnis seine komplette Schulklasse erschien, einen herzergreifenden Chor anstimmte und er jedem einzelnen Kameraden am Grab die Hand schütteln musste.
»Das bedeutete mir viel, aber der Zustand war kaum auszuhalten«, sagte er, während Tränen seine Wangen herunterliefen. Harold hat sein ganzes Leben sehr unter dem Verlust der Mutter gelitten. Er wurde übrigens zu einem äußerst angesehenen Gynäkologen, und die Gebärmutterhalskrebsforschung hatte durch sein Mitwirken erhebliche Fortschritte zu verzeichnen.
Opa Wilhelm stand nun alleine da mit den drei Jungen, und zu Hause herrschte ab sofort das absolute Patriachat. Wilhelm war »von der alten Schule«, tief geprägt durch zwei Weltkriege und die Zeit des Nationalsozialismus.
Die Brüder wurden regelmäßig im Keller mit der Rute gezüchtigt, Schwäche zu zeigen war grundsätzlich nicht erlaubt. Das änderte sich auch nicht gravierend, als mein Großvater zum zweiten Mal heiratete.
Hedwig, so hieß seine Auserwählte, stammte aus einer wohlhabenden hanseatischen Familie. Er lernte sie im Sommer 1949 auf einem der seltenen Familienurlaube auf Norderney kennen, während er mit seinen Söhnen auf der Hotelterrasse Kaffee trank.
Die großgewachsene Frau war eine herbe blonde Schönheit, Anfang vierzig und zum Leidwesen ihrer Familie kurz davor, als alte Jungfer zu enden.
So war es eine Erlösung für alle Beteiligten, außer vielleicht für Paul, Harold und Johann, als der stattliche Steuerberater aus Essen die Hanseatin zur Frau nahm.
Hedwig zog also in Wilhelm Lindners Haus im Essener Stadtwald und brachte den Männerhaushalt gehörig durcheinander. Da sie mit hauswirtschaftlicher Arbeit nicht viel am Hut hatte, wurde eine patente Haushälterin eingestellt, die nebenbei auch die Erziehung der drei Jungen übernehmen musste. Hedwig widmete sich lieber ihrem Gatten und der Rosenzucht, wen wunderte es, schließlich hatte sie keine Ahnung von Kindererziehung, Wilhelms Söhne waren ihr fremd. Es gab unzählige Spannungen zwischen ihnen, ebenso zwischen Hedwig und Elsie, der Haushälterin, welcher jahrelang ein Verhältnis mit meinem Großvater nachgesagt wurde. Wenn sich die beiden Frauen mal wieder wie die Furien ankeiften, sprach Wilhelm ein Machtwort und haute ordentlich auf den Tisch, dann herrschte für ein paar Tage trügerischer Frieden.
Weihnachten 1950 passierte etwas, das eigentlich niemand mehr für möglich gehalten hatte. Hedwig verkündete am Heiligen Abend vor der versammelten Familie, dass sie im kommenden Spätsommer ein Kind erwarte. Wilhelm war außer sich vor Freude und tanzte um den Christbaum, die Begeisterung der drei Halbrüder hielt sich eher in Grenzen. Sie vermissten ihre richtige Mutter.
So wurde im darauffolgenden Spätsommer mein Halbonkel Bertold geboren, und der brachte ordentlich Schwung in die Bude. Er entwickelte sich schnell zu einem hübschen blondgelockten Knaben, der über eine Menge Charme verfügte (wenn er wollte) und diesen gezielt einsetzte, um seinen Willen durchzusetzten. Wenn seine Mutter ihm etwas verweigerte, quengelte er so lange bei Elsie, bis diese nachgab, und umgekehrt.
Seine Halbbrüder piesackte er ständig, und wenn Paul ihm in Form einer Backpfeife die Quittung gab, brüllte Bertold so lange, bis Wilhelm meinem Vater ordentlich den Hintern versohlte. Bertold nahm die Stellung des kleinen Kronprinzen ein, seine Brüder hatten meist das Nachsehen.
Meine Onkel Harold und Johann entflohen diesem Szenario und verließen das Elternhaus, sobald sie volljährig waren. Harold ging zum Medizin-Studium nach Erlangen und Johann begann kurz darauf in Frankfurt Musik und Religion auf Lehramt zu studieren.
Mein Vater musste sich das Leben im Elternhaus, geprägt von den kleinen Streitereien mit seinem Halbbruder noch einige Jahre antun, bevor auch er flügge wurde. Da kam die Bekanntschaft mit meiner Mutter am Gartenzaun gerade recht. Marlene und Paul wurden Freunde und nutzten jede Gelegenheit, gemeinsam durch die Nachbarschaft zu streunen, wenn Marlene bei Tante Käthe zu Besuch war.
Carl hatte mittlerweile ein Haus im Essener Süden gebaut. Im Rahmen seiner Forschungsarbeiten hatte mein Großvater mit einer Patentanmeldung schnell ein kleines Vermögen gemacht. Er hatte bereits in den 40er-Jahren ein Gasanalysegerät entwickelt, das Alarm auslöste, sobald der CO2-Gehalt in einem geschlossenen Raum gefährlich anstieg. Dieser Apparat wurde in den folgenden Jahrzehnten auf der ganzen Welt in U-Booten oder Bergbauschächten eingesetzt und rettete somit vielen Menschen das Leben. Ein kleines Modell dieses Geräts steht noch heute in meinem Arbeitszimmer.
Marlene ging auf das nächstgelegene Mädchengymnasium. Das Verhältnis zu ihrer Mutter gestaltete sich mittlerweile schwierig. Sie konnte es Lore einfach nie recht machen. Meine Großmutter war meistens sehr herzlich, das habe ich als Enkelin oft erleben dürfen, aber sie konnte auch anders: ihre eigene Tochter hat sie nicht besonders gut behandelt. Streicheleinheiten oder Zuneigungsbekundungen wurden zwischen Lore und Marlene immer mehr zur Seltenheit, stattdessen gab es ständig Streit. So war es für meine Mutter eine Erlösung, als sie direkt nach dem Abitur Mitte der Sechziger Jahre zum Jura-Studium nach Heidelberg ging und begann, auf eigenen Füßen zu stehen.
Meinen Vater verschlug es fast zeitgleich zum BWL-Studium nach West-Berlin. So fand die kleine Teenager-Romanze meiner Eltern zunächst ein Ende, obwohl sie weiter durch Briefwechsel in Kontakt blieben.
Das Studentenleben meines Vaters uferte aus. Auf Drängen Wilhelms wurde sein Sohn Mitglied in einer konservativen schlagenden Studentenverbindung. Diese hob sich in erster Linie dadurch hervor, dass die Studenten sich mit Degen oder Fäusten diverse Wunden am gesamten Körper zufügten oder sich bis zur Besinnungslosigkeit besoffen. Manchmal kombinierten sie diese beiden Disziplinen, was besonders schwere Folgen hatte. Viele der Kameraden zogen sich schlimme Schnittverletzungen im Gesicht zu, die sie ein Leben lang zeichneten. Meistens waren die Betreffenden sogar glücklich, »einen Schmiss« zu haben, und präsentierten ihre Narben voller Stolz.
Paul erkannte sehr schnell, dass dies nicht seine bevorzugte Welt war und suchte stattdessen die Nähe zu linksgerichteten Gruppierungen. Die marxistische Ideologie sagte ihm viel eher zu als die rechten Tendenzen der Verbindung, er sympathisierte mit den kommunistischen Thesen sowie der Studentenbewegung um Rudi Dutschke. Mein Vater zog sich den obligatorischen Parka über und ging regelmäßig zum Demonstrieren auf die Straße. Da war er in West-Berlin gerade richtig. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie unglaublich sauer er war, als meine Mutter viele Jahre später das gut gehütete Kleidungsstück ohne sein Wissen in den Müll befördert hatte.
»Das olle Ding! Fürchterlich!«, meinte sie. »Wie bitte? Das ist mein persönliches Andenken an eine immens wichtige Zeit. Daran haftet quasi das Blut von Benno Ohnesorg! Dieser Parka repräsentiert Zeitgeschichte!«, empörte sich mein Vater. »Wie kannst du nur?« Selbstverständlich fischte er den Parka wieder aus der Mülltonne raus, und der Haussegen hing gehörig schief.
Viel später erst habe ich erfahren, was mein Vater während der Zeit in West-Berlin sonst noch so alles getrieben hat. Da bewegte er sich allerdings jenseits der Legalität. Paul geriet nämlich an eine besonders linksradikale Gruppierung. Sie hatte es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, DDR-Flüchtlinge von Ost- nach West-Berlin über die Grenze zu schleusen. Also reiste mein Vater ein paar Mal regulär mit seinem Pass in den Osten. Dort wurde der Pass einem männlichen Flüchtling übergeben, der dann mit dem Dokument wieder ausreisen konnte.
Mein Vater wurde währenddessen in einem Auto im Hohlraum zwischen Kofferraum und Rückbank versteckt und zurück nach West-Berlin geschmuggelt. Einmal wurden sie an der Grenze besonders gründlich kontrolliert. Mein Vater konnte den hechelnden Atem des Spürhundes im Kofferraum hören und hatte eine Scheißangst. Nach dieser Erfahrung hat er die Karriere des Fluchthelfers an den Nagel gehängt, er war schließlich nicht lebensmüde.
Die tiefe Sehnsucht nach meiner Mutter trieb Paul immer wieder zu Stippvisiten nach Heidelberg. Er hatte sich in Berlin einen gebrauchten, klapprigen VW-Käfer zugelegt. Marlene und Paul fuhren mit der alten Rostlaube durch das Heidelberger Umland und machten Halt in den kleinen Weinorten. Dossenheim, Schriesheim, Ladenburg. Und überall wurden reichlich Schoppen probiert. Es kam nicht selten vor, dass mein Vater sich auch nach vier oder fünf Vierteln Wein noch ans Steuer setzte. Ganz ohne Folgen, denn die Promillegrenze lag damals bei 1,5. Heutzutage ist daran nicht zu denken. Ich könnte nach ähnlichem Konsum jedenfalls nur noch auf allen vieren nach Hause kriechen ...
Paul gefiel das Leben im beschaulichen Baden-Württembergischen viel besser als im grauen geteilten Berlin, und so entschied er, das BWL-Studium in Heidelberg fortzusetzen.
Sein Vater tobte. »Soso, dem feinen Sohn ist Berlin nicht mehr gut genug, jetzt muss es also die Provinz sein.
Na, dann sieh mal zu, wie du das finanzierst. Mein Wechsel an dich ist ab sofort gestrichen!«
Eigentlich missfiel meinem Großvater nur, dass Paul seinen eigenen Weg ging, ohne ihn um Erlaubnis zu bitten. Aber es sollte nicht das letzte Mal sein, dass dieser sich dem Vater widersetzte.
Was die weitere Finanzierung seines Studiums betraf, entwickelte Paul enorme Flexibilität. Er putzte Autos betuchter Herrschaften, schälte Kartoffeln in Restaurantküchen und verkaufte Schallplatten in einem kleinen Musikladen. Durch Letzteres bekam er erstaunliche Kenntnisse im gesamten Bereich der E- und U-Musik. Ein schöner Nebeneffekt, musikinteressiert war und ist mein Vater sowieso, bis heute.
Er wohnte in einem etwas trostlosen winzigen Zimmer eines Studentenwohnheims nahe der Universität, das wenigstens einen farbenfrohen »Anstrich« bekam, als meinem Vater einmal eine Dose abgelaufenes Tomatenmark beim Öffnen explodierte. Das Zimmer sah aus wie nach einem Massaker und der Vermieter war alles andere als erfreut.
»Herr Lindner, sehen Sie zu, wie Sie das wieder in Ordnung bringen! Beschränken Sie Ihr Abendbrot in Zukunft auf weniger gefährliche Speisen! So eine Sauerei! Und außerdem: Damenbesuch ist hier nur bis 18:00 Uhr gestattet!«
Paul musste die Wände dreimal hintereinander mit weißer Farbe streichen. Wenn man genauer hinsah, schimmerte das Zimmer ab sofort in einem zarten Rosaton. Meine Mutter blieb trotzdem länger als nur bis 18:00 Uhr, manchmal sogar heimlich über Nacht.
Im Sommer ’68 gestanden sich meine Eltern ihre gegenseitige Liebe und wurden offiziell ein Paar.
Auch an der Heidelberger Universität gab es eine im Untergrund aktive Linksbewegung, der Paul sich anschloss. Er und Gleichgesinnte entwarfen Flugblätter gegen den Vietnamkrieg und verteilten sie munter unter den GIs in der Kantine des US-Stützpunktes. Diese staunten nicht schlecht, als deutsche Studenten sie dazu aufforderten, zu desertieren. Noch bevor sie aus dem Staunen wieder raus waren, hatten die Linken die Kaserne längst wieder verlassen. Erwischt wurde niemand. Es war anscheinend jugendliche Leichtfertigkeit, gepaart mit kommunistischem Idealismus. Wie auch immer, mein Vater hat sich seine linksliberale Ader bis heute bewahrt und ich bewundere ihn für seinen Mut von damals. »Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch Sozialist ist, hat kein Hirn.« Dieses oft genutzte Zitat des französischen Politikers Georges Clemenceau hat mein Vater auch jenseits der 40 vehement dementiert.
»Auf mich trifft das nicht zu, Susannchen! Ich bin im Herzen Sozi und werde es immer bleiben!«
Als meine Mutter im Sommer ’69 nach eingangs erwähnter Intervention ihrer Mutter vergeblich auf ihre Menstruation wartete, war meinen Eltern schnell klar, dass sich Nachwuchs ankündigte und diese Neuigkeit in ihrem familiären Umfeld nicht unbedingt für frenetischen Jubel sorgen würde. Sie machten sich also im Käfer auf nach Essen, um zu Hause zu beichten.
Lore war fassungslos: »Wie konntet ihr nur? Ein Kind, in eurem Alter! Ihr seid noch in der Ausbildung und nicht einmal verheiratet! Oh Gott, was werden die Nachbarn denken ... Carl, sag du doch auch mal was!«
Aber Carl blieb ganz ruhig, denn er freute sich insgeheim auf sein erstes Enkelkind und war der Meinung, es würde sich schon alles regeln. »Na, dann feiern wir eben bald Hochzeit. Mein Enkel soll schließlich standesgemäß auf die Welt kommen.«
Und genauso wurde es gemacht. Nachdem auch Wilhelm und Hedwig sich vom ersten Schock erholt hatten, wurde das Aufgebot bestellt und an einem goldenen Oktobertag in Essen geheiratet. Carl ließ sich als Brautvater nicht lumpen, gefeiert wurde nach der Trauung mit 70 Gästen im vornehmen Parkhaus Hügel am Baldeneysee. Es wurden gebeizter Lachs, Rinderfilet in Senfsauce und eine Hochzeitstorte gereicht. Onkel Harold hielt zur späteren Stunde eine launige Rede, Johann spielte ein Ständchen auf dem Klavier und griff zur Belustigung aller Anwesenden bei der Chopin-Polonaise ein paar Mal ordentlich daneben. Bertold fand man irgendwann auf der Herrentoilette, schlafend, nachdem er eine Flasche Sekt und drei Schnäpse wieder ausgekotzt hatte. Am Ende des Abends hatten sich alle – außer Lore – damit abgefunden, dass meine Zeugung vor dem Trauschein statt gefunden hatte und ich gewissermaßen an der Party teilnahm.
Die anschließend geplanten Flitterwochen fielen leider ins Wasser, Paul musste sie zwangsläufig in einem Krankenhaus verbringen. Mein Vater litt nämlich seit seiner Kindheit unter einem genetisch bedingten Hüftleiden, das ihm direkt nach der Eheschließung so unerträgliche Schmerzen bereitete, dass er kaum noch laufen konnte. Der unbestrittene Hüftspezialist befand sich praktischerweise ausgerechnet an der Uniklinik Heidelberg, so konnte Marlene ihren frisch Angetrauten wenigstens ohne Probleme täglich besuchen. Paul musste sich einer komplizierten Operation unterziehen und lag danach vier Wochen von den Knien bis zum Bauchnabel in Gips. Seitdem ist das linke Bein meines Vaters etwa einen Zentimeter kürzer. Wenn er läuft, sieht es immer ein bisschen so aus, als schwanke er durchs Leben.
Die Zeit, die er ans Bett gefesselt war, nutzte Paul, um sich bestens auf sein Staatsexamen vorzubereiten, das er dann auch mit hervorragenden Noten absolvierte.
Gleich anschließend fand er eine Anstellung in einer Wirtschaftsprüfungssozietät in Heidelberg, und so war das erste Auskommen für die kleine Familie gesichert.
Susanne ’70
An einem verregneten Frühlingstag im Mai wurde meine Mutter um die Mittagszeit mit starken Wehen und Blaulicht in die Klinik gebracht. Wahrscheinlich konnte ich es gar nicht abwarten, Teil dieser chaotischen Welt zu werden und hatte es daher sehr eilig. Die Niederkunft verlief problemlos und dauerte keine drei Stunden. Offensichtlich war ich rundum gesund und brachte wenig zierliche 3850 Gramm auf die Waage. Paul, der sich gerade im Büro befand, ließ natürlich sofort alles stehen und liegen, um seine kleine Tochter zu begrüßen.
Er wurde schon erwartet von Marlene und Lore, die rechtzeitig eigens für die Geburt aus Essen angereist war und nun stolz ihre Enkelin auf der Entbindungsstation durch die Gänge trug. »Sie hat große Ähnlichkeit mit mir, die Kleine. Findest du nicht auch, Paul?«
Paul behielt seine tatsächliche Meinung lieber für sich und brummelte: »Ja, natürlich.« Er war nur froh, dass alles gut verlaufen war, und zeigte sich auch ganz hingerissen von dem Säugling, dessen verschrumpeltes Köpfchen mit dem dichten schwarzen Haarschopf allenfalls ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Schimpansenbaby hatte. Aber egal, vergessen waren in diesem Augenblick alle Ressentiments gegenüber der Schwiegermutter. Hauptsache, seine kleine Tochter war gesund.
Die jungen werdenden Eltern hatten kurz vor meiner Geburt ein gemeinsames Heim in Heidelberg bezogen.
Da das Geld denkbar knapp war – Pauls Einstiegsgehalt belief sich auf gerade mal 1.000 D-Mark – wählten sie eine kleine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus direkt am Neckar. Der Zustand des gesamten Hauses entpuppte sich, vorsichtig ausgedrückt, als baufällig. Es bestand aus drei Wohnungen auf drei Etagen. Marlene und Paul wohnten ganz oben. Im Wohnzimmer tropfte es bei starken Regenfällen regelmäßig durch das Dach und die Warmwasseranlage fiel ab und zu aus, was zur Folge hatte, dass das Duschen oft recht kurz und sehr frostig ausfiel.
Vom kleinen Wohnzimmer aus betrat man einen Balkon, den man aber besser gleich wieder verließ, angesichts der Tatsache, dass der Putz von allen Seiten nur so bröckelte. Lore war entsetzt: »Hier könnte ich es keinen Tag lang aushalten. Und so soll meine Enkelin aufwachsen? Jesses Maria!« Aber Paul und Marlene waren sehr genügsam. »Wenigstens haben wir einen wunderbaren Blick auf den Neckar«, bemerkte meine Mutter.
In der Wohnung unter ihnen »hauste«, wie es Lore verächtlich nannte, ein Studentenpärchen, Olaf und Sabine. Sie befanden sich mitten in der Hippie-Phase. Ihr momentanes Lebensmotto war buchstäblich »Make love, not war«, und das ließen sie die Nachbarschaft in Form ausgelassenen Stöhnens und Kreischens beim Liebesspiel auch nahezu täglich zur Kenntnis nehmen.
Hinzu kam ein nicht eben geringer Konsum von Cannabis, dessen Duft man schon im Hausflur nicht ignorieren konnte, es sei denn, man litt unter erkältungsbedingtem Verlust des Geruchsvermögens. Eben jenes Gewächs wurde bezogen von Knut aus der Parterrewohnung. Knut war Student der evangelischen Theologie im (ca.) 11. Semester und hatte sich im zum Neckar liegenden Garten ein kleines Gewächshaus gebaut, in dem er eine erquickliche Menge Gras heranzog, mit welchem er die gesamte Hausgemeinschaft versorgte. Paul kannte Knut vom Schallplattenverkauf, denn auch der Theologe in spe musste ja irgendwie zu Geld kommen. Die beiden jungen Männer fanden schnell heraus, dass sie nicht nur denselben Musikgeschmack teilten, sondern auch sonst ganz ähnlich tickten. So entstand eine langjährige, enge Freundschaft.
Jedenfalls verstanden sich die Bewohner grundsätzlich sehr gut. Das geräuschvolle Sexleben von Olaf und Sabine hatte ausreichend Konkurrenz durch mein bemerkenswert lautes und ausdauerndes Babygeschrei und den fast ständig laufenden Plattenspieler Knuts – da war man also quasi quitt.





























