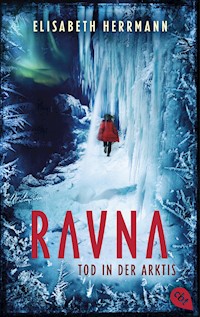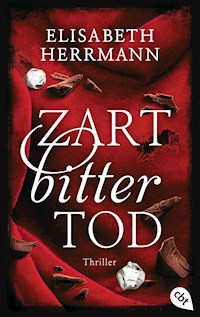12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Rasant, nervenaufreibend und genial – der neue Thriller von Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann
Als du in die Rolle von Jen schlüpfen und an ihrer Stelle das Eliteinternat Brightstone College besuchen sollst, musst du nicht lange überlegen. Einflussreiche Mitschüler, ein Elitepoloteam und Unterricht in einem alten Schloss – so eine lebensverändernde Chance lässt man nicht einfach verstreichen. Doch was glamourös erscheint, ist in Wahrheit eine schillernde Scheinwelt, in der jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Schon bald häufen sich Unfälle, die sich als gezielte Anschläge auf dich erweisen und dir wird klar: Jen hütet ein Geheimnis, für das nun du verantwortlich gemacht wirst.
Sei vorsichtig. Verrate nicht, wer du bist. Und vor allen Dingen: Vertraue niemandem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
ELISABETH HERRMANN
HINTER DER FASSADE
LAUERT DAS BÖSE
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
© 2025 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagkonzeption: Marie Graßhoff
unter Verwendung mehrerer Motive von © Adobe Stock (dta93, artvector-23, bigmouse108, Jag_cz, Unimodels, Charlie’s)
Innengestaltung unter Verwendung der Bilder von: © Adobe Stock (dakora)
FK · Herstellung: AnG / SaVo
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32818-4V003
www.cbj-verlag.de
Für Shirin
Prolog
Ein Schatten, verhüllt von der Nacht.
Eng an die Mauer gepresst, zwischen Eingangspforte und Garage. Die Dunkelheit war auf seiner Seite, der Mond ein Komplize, der sich hinter dicken Wolken versteckte. Das Messer lag schwer in seiner Hand. Ein tödliches Versprechen, das endlich eingelöst werden würde.
Ich hole dich.
Es hatte kurz aufgehört zu regnen. Sogar das Wetter spielte mit. Das Laub war durch den Regen aufgeweicht, der sich in tiefen Pfützen sammelte und den Gehweg in eine Rutschpartie verwandelte. Eine Nacht, in der man keinen Hund vor die Tür jagte und niemand freiwillig draußen unterwegs war. Außer denen, die einen Grund dazu hatten.
Einen sehr guten Grund.
Ich bin die dunkle Flamme der Rache.
Plötzlich stieß ein Vogel einen unheilvollen Laut aus. Der Schatten zuckte zusammen und spürte, wie das Adrenalin seine Fingerspitzen zucken ließ. Der Griff um den Messerschaft wurde fester. Noch bevor das Licht der Scheinwerferkegel die Dunkelheit zerschnitt und das leise Anrollen von Autoreifen die Stille veränderte, war klar: Sie kamen. Sein muskulöser und gestählter Körper war bis in die letzte Nervenzelle gespannt wie eine Bogensehne. Der Schatten war bereit. So bereit für das, was jetzt kommen würde.
Der Wagen, ein dunkles, schweres Modell, kam vor dem Garagentor zum Stehen. Ein verächtliches Grinsen zuckte um die Mundwinkel des Schattens, der, ganz in Schwarz gekleidet, mit der Dunkelheit geradezu verschmolz. Die Glieder wurden zu Stein, das Herz beruhigte sich wieder. Gleich hatte das reglose Warten ein Ende, denn der sorgsam ausgeklügelte Plan lief wie eine Maschine. Zahnrad fügte sich in Zahnrad.
Die Beifahrertür wurde geöffnet. Eine Frauenstimme war zu hören.
»Warum funktioniert die verdammte Fernbedienung schon wieder nicht?«
Weil ich das Garagentor blockiert habe? Weil ihr vom Galadinner eures Poloclubs kommt und du dir deine Pumps nicht ruinieren willst? Weil sie, deine Tochter, nun den gepanzerten Wagen verlassen muss und für einen kurzen Moment den Bürgersteig betritt, ungeschützt und verwundbar? Weil ich diesen Moment ausnutzen werde, um ihr endlich das zu geben, was sie verdient: den Tod.
»Ich mach schon.«
Ein Mädchen stieg aus, wippender Pferdeschwanz, dunkler Daunenmantel mit pelzverbrämter Kapuze, sündhaft teure Designerstiefel. Der Schatten machte sich bereit. Ein Hieb, ein Stich. Präzise ausgeführt.
Es ist so weit.
Jetzt wirst du büßen.
Eigentlich schade, dass es so schnell geht.
Er hob den Arm. Das Mädchen ging auf das Tor zu und musste für den Bruchteil einer Sekunde das Messer gesehen haben, dessen Klinge kurz aufblitzte, als sie das Licht der Straßenlaterne einfing.
»Was …«
Ihre Augen weiteten sich in namenlosem Schrecken, ihr Mund öffnete sich zu einem verblüfften Ruf, der zu einem panischen Schrei wurde. Das Messer sauste auf sie herab. Der Fluchtimpuls allein aber wäre zu langsam gewesen. Sie rutschte auf den nassen Blättern aus, schrie, als das Messer sie traf und der geschliffene Stahl auf Haut, Fleisch und Knochen traf und sie nach hinten stürzte. Ihr plötzlicher Fall ließ den Angriff halb ins Leere laufen. Sie war nicht tot. Rollte sich wie eine Katze zur Seite. Brüllte um Hilfe. Jaulte vor Schmerz.
Grelles Licht blendete auf. Die Scheinwerfer des Wagens erfassten eine grauenhafte Szene: eine dunkle Gestalt über das Mädchen gebeugt, den Arm mit dem blutigen Messer erhoben, um ein zweites Mal zuzustechen.
Hab ich dich.
Dieses Mal entkommst du mir nicht.
Das Mädchen schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Nein! Bitte nicht!«
Vergiss es.
»Warum?«
Das weißt du ganz genau. Gib mir noch drei Sekunden deiner Todesangst. Du hast sie verdient.
Das Mädchen warf sich zur Seite, kam rutschend auf die Beine und rannte los. Der Wagen machte einen Sprung nach vorne und landete mit einem hässlichen Geräusch in dem Garagentor. Die Hupe heulte auf, zwischen dem Angreifer und seinem Opfer befand sich nun eine vier Meter lange Limousine.
Im Haus hinter den hohen Mauern flammte Licht auf. Jemand öffnete in der Villa gegenüber ein Fenster im ersten Stock und brüllte: »Hallo? Ist was passiert?«
Der Schatten zerknirschte einen Fluch zwischen den Zähnen. Hatte dieses Mädchen denn sieben Leben? Wie lange wollte sie noch vor ihrem Schicksal davonlaufen?
Hinter der Scheibe der Limousine tauchte das bleiche, von Todesangst gezeichnete Gesicht der Mutter auf, ein Handy am Ohr. Sie rief die Polizei. Zeit, den Ort des Geschehens zu verlassen, seine Fehler zu analysieren und den nächsten Versuch vorzubereiten.
Das Mädchen aber stand, starr vor Schreck, auf der anderen Seite des Wagens und starrte zu seinem Angreifer hinüber. Blut lief aus einer klaffenden Wunde über ihr Gesicht. Sie hob die Hand, legte sie auf die Wange und zuckte zurück.
Blut.
Blut überall.
Das wird dich daran erinnern, dass du nirgends sicher bist.
Er wandte sich ab und rannte los. Das Mädchen blickte ihm fassungslos hinterher. Als ihre Mutter ausstieg – ein zitterndes Nervenbündel, dem das Handy aus der Hand rutschte –, trat es einen Schritt zur Seite, um der Gestalt hinterherzusehen.
»Jennifer! Um Himmels willen!«
Ihre Mutter nahm sie in den Arm. Für das Mädchen fühlte es sich an, als würden sich Schraubzwingen um sie legen.
»Das muss aufhören«, hörte sie ihre Mutter schluchzen. »Das muss endlich aufhören!«
Aber alle, die Mutter, die Tochter und der Schatten, der davonlief und wieder eintauchte in die Dunkelheit, wussten: Es hatte gerade erst begonnen.
1
Königreich der Krähen
Als ich Brightstone zum ersten Mal sehe, klopft mein Herz wie verrückt. Ein altes Schloss aus großen Sandsteinquadern mit vier Rapunzeltürmen an den Ecken und einem prächtigen barocken Eingangsportal. Dort hinauf führt eine breite Treppe, davor eine Auffahrt, die ursprünglich für Kutschen angelegt wurde. Die schönsten, prächtigsten Rosen, die ich je gesehen habe, klettern die Fassade empor und ranken sich um die Pfeiler des Portals. Sie müssen uralt sein, denn ihr Duft erinnert an Sommernachmittage am See, Earl-Grey-Tee im Herbst und gebügelte Taschentücher in vergessenen Schubladen.
Ob Brightstone wohl schon immer so hieß? Ich lasse den Anblick auf mich wirken. Es könnte der Beginn eines viktorianischen Liebesromans sein, würde ich nicht in einem Auto sitzen und mir schlicht der Mut fehlen, endlich auszusteigen. Außerdem hat das Schloss links und rechts zwei moderne Anbauten, riesige Flügel aus den Sechzigerjahren, als man das noch ohne viel Aufhebens durfte. Auf der Website von Brightstone steht, dass sich in ihnen die Schlafsäle der jüngeren und die Zimmer der älteren Schüler befinden. Die Klassenräume, der Speisesaal und die Verwaltung sind im Haupthaus. Aus der Nähe wirkt Brightstone fast noch imposanter mit diesen Türmen, in denen sich enge Wendeltreppen hochwinden, wo es in den Pausen und nach Schulschluss zu einem heillosen Gedränge kommen muss.
Doch an diesem Vormittag ist es ruhig. Der Unterricht hat bereits begonnen, als der Wagen vor wenigen Minuten in der Auffahrt zum Stehen gekommen ist. Nun steigt Connor, mein Chauffeur, aus und öffnet den Kofferraum. Kurz darauf stapeln sich drei Koffer und zwei Taschen neben der Limousine, und es wird auch für mich Zeit, auszusteigen. Ich fühle mich fremd in der Schuluniform, und als Connor vor meinen Augen das gesamte Gepäck auf einmal die Treppen hochträgt, auch noch überflüssig.
Geräusche nähern sich. Ein Schleifen, Fluchen und Zerren. Ich drehe mich um und sehe noch einen Rookie. Sie muss etwa so alt sein wie ich, mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken und einem ruckelnden Rollkoffer, den sie hinter sich herzieht und der es auf dem alten Kopfsteinpflaster schwer hat. Sie trägt Jeans und ein durchgeschwitztes knallblaues T-Shirt. Ihre Haare sind kurz und lockig, sie hat dunkle, leicht mandelförmige Augen und ein schmales Gesicht.
»Oh mein Gott! Ich bin nicht die Einzige, die zu spät ist! Eigentlich hat das Schuljahr ja schon vor vier Wochen angefangen … Hätte ich in Uniform kommen sollen?«
Ich habe keine Ahnung.
»Ich bin Shanti.« Sie lässt den Koffer los und reicht mir die Hand. »Ashanti, eigentlich. Stipendiatin. Neu hier. Abijahrgang. Und du?«
Sie will es nicht, aber ihr Blick wandert kurz zu dem riesigen, dunklen Wagen, mit dem ich gekommen bin.
Jetzt ist er da, der große Augenblick. Ich werde den Satz zum ersten Mal sagen, den ich so lange vor dem Spiegel, im Bett, im Bad und sogar noch auf der Fahrt hierher geübt habe.
»Ich bin Jennifer Curlandt. Nenn mich Jen.« Es kommt ungefähr so hochnäsig heraus, wie es klingen sollte. »Ich habe heute auch meinen ersten Tag.«
Letzteres war nicht geübt. Es hört sich trotzdem so an wie: Zwischen dir und mir liegen Welten.
Aber Shanti hat entweder kein Gespür für Untertöne oder ist einfach nur zu fertig, um auf sie zu achten. »Gibt’s hier irgendwas zu trinken? Ich sterbe vor Durst. Die Bushaltestelle ist meilenweit entfernt.«
Ich sehe mich um. »Bestimmt. Da müssen wir reingehen, glaube ich.«
»Dann sollten wir das tun.«
Sie greift nach ihrem Koffer und läuft leichtfüßig damit die Treppe hinauf. Oben bleibt sie stehen und sieht sich nach mir um. Ich habe das Gefühl, hölzern und ungelenk hinter ihr herzustaksen. In diesem Moment kommt Connor aus dem Haus und hält uns mit einem grimmigen Gesichtsausdruck, der bei ihm normales Wohlbefinden signalisiert, die Tür auf.
»Vielen Dank!« Shanti huscht hinein.
»Danke«, sage ich leise.
Am liebsten würde ich kehrtmachen und wieder zurückfahren. Das Gefühl von eben ist neu. Ich mag mich nicht.
»Soll ich noch etwas ausrichten?«, fragt Connor höflich.
»Sagen Sie ihnen …«
Die Einfahrt, über die wir gekommen sind, führt, gesäumt von uralten Buchen, schnurgerade auf Brightstone zu. Oder davon weg, je nach Perspektive. Eine hohe Mauer schirmt das Anwesen vor neugierigen Blicken ab. Das gewaltige schmiedeeiserne Tor zur Außenwelt steht noch offen. Es wird sich wie von Geisterhand schließen, sobald die Limousine der Curlandts mit Connor am Steuer hindurchgefahren ist.
»Sagen Sie ihnen …« Ich atme tief durch. »Nichts. Außer, dass ich gut angekommen bin und jetzt alles so läuft, wie es soll.«
Falls ihn diese Auskunft irritiert, lässt er es sich nicht anmerken. Ich glaube, Chauffeure kriegen eine Menge mit – genau wie Securityleute –, und die besten von ihnen sind nicht immer die, die auch am besten fahren.
»Alles Gute«, knurrt er noch und läuft die Treppen hinunter.
Die riesige hölzerne Eingangstür lässt sich hinter uns erstaunlich leicht schließen. Nach der Helligkeit draußen müssen sich meine Augen erst einmal an den dunklen Eingangsbereich gewöhnen. Ich stehe in diesem breiten Flur, von dem links und rechts kleinere Türen abgehen. Nach ein paar Metern allerdings mündet er in eine für mein Empfinden riesige Halle, in der Shanti steht und erstaunt die Blicke schweifen lässt.
Sie hört, dass ich näher komme, und dreht sich um. Der Rucksack überragt sie um Haupteslänge. »Krass, oder? Ich wusste ja, dass Brightstone 400 Jahre alt ist und einige Teile sogar noch älter. Aber das ist der Wahnsinn.«
Ich komme zu ihr. Vom Alter ausgedunkelte hölzerne Wandvertäfelungen glänzen matt in dem Licht, das durch bleiverglaste Fenster ins Innere fällt. Zwei Erker auf jeder Seite unterbrechen die Strenge, auch wenn die spiegelblank polierten eingebauten Bänke nicht sehr gemütlich aussehen. Links und rechts von ihnen führen Treppen hinauf in den ersten Stock, an denen sich spätmittelalterliche Steinmetze mit allem austoben konnten, was Verzierungen und Ornamente hergaben. Riesige Ölgemälde hängen so weit oben, dass man sich den Hals verrenken muss, um zu sehen, was auf ihnen abgebildet ist. Landesherren vermutlich, mit hohen weißen Perücken, Prunkjacken und Kniebundhosen über weißen Strümpfen. Manche sitzen auf einem Pferd, andere stehen, majestätisch auf einen Stock gestützt, in Landschaften herum.
Ein gewaltiger Kronleuchter hängt direkt über uns. Ich trete unwillkürlich einen Schritt zur Seite. Zu den wenigen ausgewählten Malen, die Mom es sich leisten konnte, mit mir irgendwohin zu gehen, hatte ein Besuch des Musicals Das Phantom der Oper gehört. Der spektakuläre Moment, wenn der Kronleuchter ins Publikum segelt, hat sich mir für immer eingebrannt.
»Ja«, sage ich. »Der Wahnsinn.«
Und ich meine nicht den Kronleuchter, sondern mich, hier, in diesem Haus.
»Jennifer Curlandt?«
Die helle, scharfe Stimme kommt von links, wo eine unscheinbare Tür fast mit der Wandvertäfelung verschmilzt. Dort steht eine hoch aufgerichtete Frau, die mich irgendwie an die todlangweiligen Poolpartys von Jennifers Mutter erinnert. Nicht, dass das Wort Poolparty bei Caren irgendetwas mit Wasser zu tun gehabt hätte. Die Curlandts haben zwar einen Pool, aber von dem hält man sich fern und sitzt allenfalls dekorativ in seiner Nähe herum, das Cocktailglas lässig in der Hand. Man schlürft Champagner und Langeweile.
Statt einem Glas hält die Frau ein Klemmbrett und wirft nun einen Blick durch ihre extrem seltsam geschnittene eckige Brille darauf. Ihr strenges Kostüm in den Schulfarben von Brightstone umschließt sie wie eine Rüstung. Dunkelblau, weinrot, Goldknöpfe. Ich in meiner Uniform und sie in ihrem Kostüm wären optisch ein unschlagbares Match.
»Jennifer Curlandt!«
»Ja!«, sage ich schnell.
Meinen Namen müsste ich doch mittlerweile kennen. Die Frau nickt und sieht nun missbilligend über den Rand ihrer Brille hinweg auf Shanti.
»Ashanti Wanjola?«
Jede andere wäre vermutlich bei diesem Blick zu einem Fleck auf den Steinfliesen geschmolzen. Nicht so Shanti.
»Jep«, sagt sie. »Wanjala.«
»Bitte?«
»Wanjala. Mit drei A.«
Sie hat den Rollkoffer direkt vor der Treppe abgestellt und schnappt ihn sich nun hastig. Die Frau kritzelt etwas auf ihr Klemmbrett und vermittelt nicht den Eindruck, als würde sie Fehler gerne zugeben.
»Ich bin Camilla Freude, Executive Secretary. Herzlich willkommen.« Es wundert mich, dass ihr bei dieser Stimme keine Eiszapfen an der Nase hängen. »Der Direktor will Sie sprechen. Es sind zudem noch einige Formalitäten zu erledigen. Kommen Sie bitte mit.«
Shanti und ich sehen uns an – und folgen diesem Spazierstock auf zwei Beinen durch die Tür in einen nicht ganz so spektakulären Flur. Linker Hand wurden nachträglich moderne Fenster in die meterdicken Mauern eingelassen. Im Vorübergehen werfe ich einen Blick hinaus. Das große Tor schließt sich gerade, von Connor und dem Auto ist allenfalls noch eine Staubwolke zu erahnen.
»Hier hinein.«
Sie führt uns in ein Büro mit einem Tresen, der wahrscheinlich bewusst so hoch gesetzt wurde, dass man sich hinter ihm klein fühlen muss. Frau Freude, die ihrem Namen zumindest uns gegenüber keine Ehre macht, verschwindet hinter einer weiteren Tür, nicht ganz so herrschaftlich, nicht ganz so Respekt einflößend wie der Eingangsbereich.
Shanti stellt den Rollkoffer neben dem einzigen Stuhl ab und streift sich mit einem Stöhnen die Riemen des Rucksacks von den Schultern.
»Jetzt geht’s los«, sagt sie. »Ich bin so aufgeregt. Wahrscheinlich werde ich alles falsch machen, aber egal. Du kannst mir ja Nachhilfeunterricht geben.«
Sie grinst mich an.
Verdammt.
Das ist genau das, wovor sie mich gewarnt haben. Lass niemanden an dich heran. Schließ keine engen Freundschaften. Sag wenig, tu wenig, dann passiert dir auch wenig.
»Nachhilfe in was?«, frage ich kühl.
»Wie man mit euch klarkommt.« Sie ist jetzt auch etwas distanzierter. »Hör zu, ich hab keine Lust, ein Jahr lang die Außenseiterin zu sein. Ich dachte, wo wir uns schon mal kennen …«
Die Tür geht wieder auf und Frau Freude wirft uns einen scharfen Blick zu.
»Herr Dr.Fröde erwartet Sie.«
Shanti sieht mich an, ich sehe sie an, und wir können uns noch in letzter Sekunde beherrschen, um nicht laut rauszuprusten. Sich über Namen lustig zu machen, ist ziemlich kindisch. Aber in diesem Moment löst es die Anspannung etwas, unter der wir beide stehen.
Dr.Fröde wirkt auf den ersten Blick sympathisch. Klein, rund, mit spiegelnder Halbglatze und einem professoralen Lächeln auf den Lippen, mit dem er uns in seinem überraschend modernen Büro willkommen heißt.
»Nehmen Sie Platz, die Damen. Herzlich willkommen in Brightstone! Sie sind sicher Frau Curlandt.«
Er nickt mir freundlich zu.
»Und Sie Frau …« Er sieht auf den Monitor seines Laptops, der links neben ihm steht. »Wanjola.«
»Wanjala.«
»Ah. So.«
Sein Nicken zu Shanti ist etwas reservierter, was ihn bei mir gleich ein paar Sympathiepunkte kostet. Die tendieren am Ende der nächsten Viertelstunde gegen null, als er nach ausschweifenden Erörterungen der Hausregeln, der Geschichte und der gesellschaftlichen Verantwortung von Schulen wie dieser schließlich sagt:
»Und da Sie beide über vier Wochen verspätet eingetroffen sind, bleibt uns leider nichts anderes übrig, als Sie vorübergehend in einem Doppelzimmer unterzubringen.«
»Was?«, frage ich entsetzt. »Das geht nicht. Ich kann mir mit ihr kein Zimmer teilen. Man hat mir versprochen, also mir wurde gesagt – haben nicht alle im Abijahrgang Einzelzimmer?«
Shanti presst die Lippen zusammen und meidet meinen Blick. Kein Wunder. Ich führe mich auf wie eine verwöhnte, reiche Göre, also die klassische Brightstone-Schülerin. Dazu noch eine Prise Alltagsrassismus, zumindest muss sie das annehmen.
In Wirklichkeit verpufft gerade das letzte kleine Gefühl von Sicherheit in mir. Wie soll ich den Schein aufrechterhalten, wenn ich nicht allein wohne? Wenn jemand mitbekommt, mit wem ich telefoniere? Wie ich heimlich aus dem Haus schleiche? Wie lange wird es dauern, bis meine Lüge durchschaut wird? Nicht, weil er oder sie die Regeln der oberen Zehntausend kennt und mich enttarnt – sorry, Shanti, von denen habe ich auch erst seit Kurzem eine vage Ahnung, und du kennst sie sicher nicht –, sondern weil ich nicht 24 Stunden am Tag Jennifer Curlandt sein kann.
Ich bin das nicht.
Ich schaffe das nicht.
Ich will hier weg.
Dr.Fröde scheint tiefes Mitgefühl für meine Situation zu empfinden.
»Es ist ja nur vorübergehend«, sagt er in perfektem pädagogischem Deeskalationston. »Erfahrungsgemäß verlassen immer ein oder zwei Schüler in den ersten Monaten Brightstone.«
»Warum?«, frage ich.
Das Schulgeld muss im Voraus bezahlt werden. Und es ist so hoch wie das Jahresgehalt meiner Mutter. Es ist alles, was wir haben, nachdem mein Dad sich abgesetzt hat und nie wieder etwas von sich hören ließ. Das Schulgeld wird nicht rückerstattet. Ich kenne mich aus. Ich habe die Schulregeln auswendig gelernt, seit ich entschieden habe, mich auf dieses Kamikaze-Unternehmen einzulassen.
»Mobile Familien«, sagt Dr.Fröde mit feinem Lächeln. »Diplomaten. Manager auf internationaler Führungsebene. In manchen Fällen auch politische Entwicklungen.«
Er neigt leicht den Kopf. Bitte keine Nachfragen, soll das heißen, ich habe die Welt nicht gemacht.
»Warum nicht?«, sagt Shanti. »Zu Hause wohne ich mit meiner kleinen Schwester in einem Zimmer. Mit Nervensägen kenne ich mich aus.«
Kleine Spitze in meine Richtung.
»Gibt es keine andere Möglichkeit? Immerhin zahlen wir viel Geld.« Meine Stimme schraubt sich in eine leicht angestrengte Tonlage. Ich wusste gar nicht, über welche Fähigkeiten ich in dieser Hinsicht verfüge. »Ich bin es nicht gewohnt, mein Zimmer zu teilen. Das wirkt sich bestimmt auf meine schulischen Leistungen aus.«
»Wir tun alles, damit Sie sich hier wohlfühlen. Vielleicht kann es ja auch eine ganz wunderbare Erfahrung für Sie sein, mit einer Stipendiatin zusammenzuwohnen?«
Großartig. Jetzt bin ich auch beim Schulleiter unten durch. Wahrscheinlich muss er die Starallüren seiner Schäfchen seit Jahren ertragen. Shanti sieht an mir vorbei auf das Porträt der Bundespräsidentin und die schwarz-rot-goldene Flagge in der Ecke, die schlapp nach unten hängt.
»Frau Freude wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Sie können die Hausordnung und alles Wissenswerte über die QR-Codes überall im Haus und in Ihren Räumen aufrufen. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr auf Brightstone. Sie werden in jeder Hinsicht profitieren.«
Er geleitet uns noch zur Tür. Während wir mit unserem Gepäck, beladen wie für eine Himalaja-Expedition, durch die leere Haupthalle wanken, gibt uns die Executive Secretary einen kleinen Überblick über das, was man hier mit seiner Freizeit anstellen kann.
»Der Tennisplatz liegt hinter dem Haus, ebenso wie die überdachte Schwimmhalle. Das Becken ist allerdings noch nicht beheizt. Die Stallungen für unsere Polopferde liegen neben dem Westflügel. Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich für die Workshop-Wochen an. Segeln, Golf, Hockey, Leadership. Die Summer School ist leider schon vorbei, aber für die Winter Classes gibt es noch einige freie Plätze und natürlich auch in den Guilds. Die Polomannschaft ist leider bereits komplett.«
»Komplett?«, frage ich.
Shanti sieht ebenfalls enttäuscht aus.
»Komplett.«
»Ich bin extra deshalb nach Brightstone gekommen!«
Das stimmt. Polo ist für einen Underdog wie mich eigentlich eine Unmöglichkeit. Aber ich jobbe, wann immer es geht, in einem Poloclub und darf deshalb ab und zu an den Trainings teilnehmen. Ich liebe dieses Spiel. Es verbindet Können mit Verantwortung. Nicht nur für dich selbst, sondern auch für das Pferd. Polo ist das Einzige, was mir Brightstone erträglich gemacht hätte.
»Ich auch!«, sagt Shanti.
Frau Freude scheint skeptisch, ob das eine passende Freizeitbeschäftigung für eine Stipendiatin ist. Polo ist zwangsläufig an Geld gebunden. Man muss mindestens drei Pferde haben, um bei Turnieren zu starten. Mom und ich können uns noch nicht mal ein Schaukelpferd leisten. Und erst recht nicht Xarax, für den ich genau drei Monate Gnadenfrist herausgehandelt habe. Deshalb bin ich hier. Deshalb wurde ich Jennifer Curlandt, Millionärstochter, Jetsetterin, Polospielerin. Um ein ausgemustertes Polopony vor dem Abdecker zu retten.
»Drei Jahre lang habe ich mich hier beworben.« Shanti ist am Boden zerstört. »Und jetzt hat es endlich geklappt! Mathe und Leadership kann ich überall belegen. Aber nicht Polo!«
»Kannst du es denn?«, keuche ich. Frau Freude steigt in einem mörderischen Tempo die Treppen hinauf. Vierter Stock. Das Haupthaus ist riesig und in jeder Etage gehen Flure in die beiden Neubauten ab. Die unteren Klassen haben noch Dormitorys, große Schlafsäle. Jahrgangsstufe elf hat Viererzimmer, in der zwölften wohnen die Schüler allein. Normalerweise.
»Nein. Aber ich kann reiten und hätte es gerne gelernt.«
Den einen Koffer und die zwei Taschen kann ich irgendwie schleppen. Aber spätestens nach der zweiten Etage frage ich mich, ob mir jemand Ziegelsteine in die anderen beiden Gepäckstücke gelegt hat. Und wo die Butler sind, die für dieses Schulgeld eigentlich am Fuß jeder Treppe stehen und uns unsere Wünsche von den Augen ablesen müssten.
»Nach Brightstone kommt man nicht nur wegen des hervorragenden Unterrichts und der Freizeitangebote«, erklärt Frau Freude scharf. »Es ist die Gemeinschaft, die weit über die Schulzeit hinaus wirkt und Ihr Leben entscheidend beeinflussen wird.«
Dazu gehört wohl auch gemeinschaftliches Gepäckschleppen. Shanti glaubt nicht an diese Prophezeiung, das ist ihr anzusehen. Stipendiaten in Regierungen oder der »Leadership of Tomorrow« kann man an einer Hand abzählen. Der wirkliche Inner Circle von Macht und Einfluss ist, wie der Adel, eine geschlossene Gesellschaft, der für alle anderen allenfalls mal zu Besuchszeiten öffnet.
»Und deshalb steht sie über allem. Regelverstöße werden nicht geduldet.«
Wir biegen ab in einen himmelblau gestrichenen Flur, von dem eine Vielzahl schmaler Türen abgehen. Ganz am Ende zückt Frau Freude eine Chipkarte und hält sie an die Klinke. Nichts passiert.
»Das gibt es doch nicht.« Sie versucht es mehrmals. Dann holt sie ihr Handy heraus und wählt eine Nummer. »Herr Schneider? Haben Sie die Tür zu Zimmer 413 nicht neu codiert?«
Herr Schneider scheint zu einer langen Rechtfertigung auszuholen, die von einem unwilligen Schnauben unterbrochen wird.
»Sofort. Bitte.« Die Executive Secretary dreht sich zu uns um, ein dünnes Lächeln um die Lippen. »Einen kleinen Moment noch.«
Wir stellen das Gepäck ab. Shanti holt jetzt auch ihr Handy heraus.
»Das stecken Sie bitte ganz schnell wieder weg. Von acht bis siebzehn Uhr ist die Nutzung von Mobilgeräten untersagt.«
»Sorry.«
Hätte ich ihr sagen können.
Wenn sie mich gefragt hätte.
Paragraf 16 Absatz 2 der Hausordnung, Nutzung von mobilen Endgeräten.
Ich gehe zu einem der schmalen Fenster, die am Ende des Flurs in die Wand eingelassen sind. Von hier aus sieht man die Rückseite von Brightstone. Ein weitläufiger Park, umhegt von einer romantischen Ziegelmauer, über die gerade ein Schüler klettert. Nicht, dass er abhaut. Er kommt zurück.
Eigentlich hatte ich geglaubt, die Schuluniform würde jeden entstellen. Aber wenn man die Statur eines griechischen Gottes hat, das Hemd drei Knöpfe zu weit geöffnet ist und man nach einem eleganten Sprung aus drei Metern Höhe wie eine Raubkatze auf die Beine kommt, kann man wohl alles tragen.
Er streicht sich die dunklen Haare aus der Stirn. Vielleicht hat er mal Werbung für Diet Coke oder Aftershave gemacht – ich habe das Gefühl, meine innere Kamera schießt im Stakkato und wird sich nie wieder von diesem Anblick befreien. Er schließt die Knöpfe seines Hemds und checkt, ob es auch korrekt im Bund steckt. Der Anstand gebietet, sich abzuwenden, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Anblick für schlechte Tage abspeichern sollte.
Sein Blick schweift umher. Zwei Hortensienbüsche werden nach seinem Sprung nie wieder so aussehen wie vorher. Aber die interessieren ihn nicht. Nur, ob seine Rückkehr beobachtet wurde. Die meisten Menschen beschränken sich dabei auf den Ausschnitt ihres Umfeldes, der sich vor ihnen befindet. Nicht über ihnen.
Aber er gehört nicht zu den meisten Menschen. Ganz langsam legt er den Kopf in den Nacken. Seine Augen wandern die Fassade empor. Unsere Blicke kreuzen sich. Es ist, als ob ich bei etwas Unredlichem ertappt worden wäre. Ich will zurücktreten, aber da lächelt er mich an und legt verschwörerisch den Finger auf die Lippen.
Und dann läuft er los und verschwindet aus meinem Blickfeld.
»Bitte sehr.«
Das Schloss öffnet sich mit einem Surren. Ich lasse Shanti den Vortritt. Bis ich mein Gepäck in den winzigen Raum gebracht habe, hat sie schon die Vorhänge zurückgezogen und sieht sich neugierig um.
»Nur ein Bett?«
Frau Freude lugt herein und hat schon wieder das Handy am Ohr.
»Herr Schneider! In Zimmer 413 fehlt ein Bett! Ja. Zwei Schülerinnen. Das war so besprochen. Sie sind gerade eingetroffen. Danke.«
Sie lässt das Handy in ihre Jackentasche gleiten. Ihr entschuldigendes Lächeln reicht nicht für eine überzeugende Performance.
»Nun, am besten packen Sie erst mal aus und gehen dann in die Mensa. Bis zum Ende des Nachmittagsunterrichts ist alles perfekt. Hier.«
Sie reicht uns zwei Schlüsselkarten. »Ihre Hausmutter ist Frau Conrad. Stellen Sie sich bitte heute im Laufe des Tages bei ihr vor. In Ihrer Jahrgangsstufe haben Sie zwei Vertrauensschüler, die hier Cornetts genannt werden. Die werden Ihnen alle weiteren Fragen beantworten.«
Wir nehmen die Karten. Sie sind dunkelblau mit einem roten Streifen. Zusammen mit dem goldfarbenen Chip ein absolutes Brightstone-Statement.
»Also dann: Gutes Gelingen.«
Noch nicht mal das kriegt sie ohne Raureif in der Stimme hin. Das Echo ihrer Pumps auf dem edlen Flurparkett hallt noch lange in unseren Ohren.
»Willst du?« Shanti deutet auf das Bett. Nicht bezogen.
Eine Schranktür steht offen. Der schmale Teppich vor dem Bett liegt schief. Ich mache die andere Schranktüre auf.
»Viel Platz ist das nicht.«
»Es wird schon reichen«, sagt meine neue Mitbewohnerin. »Notfalls kommt was unters Bett. Welches Fach willst du?«
»Die beiden oberen? Ist das okay? Ich bin größer als du.«
Shanti nickt. Ich öffne den ersten Koffer und pfeffere einen Stapel Unterwäsche auf die obere Ablage, entscheide mich dann aber doch dazu, sie in der unteren zu deponieren.
Die nächste halbe Stunde versuchen wir, uns beim Einräumen nicht allzu sehr in die Quere zu kommen. Shanti schlüpft in ihre Uniform und beklagt sich bitter, dass alle modischen Errungenschaften der letzten dreißig Jahre offenbar spurlos an diesen Outfits vorübergegangen sind. Dann tönt ein melodischer Gong durchs Haus. Türen werden geöffnet. Der Lärm von befreiten Schülern erfüllt das Haus und ein verheißungsvoller Duft zieht in unsere Nasen.
»Mittagspause. Ich hab Hunger wie ein Bär!«, verkündet Shanti.
Ich nicht. Am liebsten würde ich für immer in diesem Zimmer bleiben. Shanti könnte mir ab und zu etwas trockenes Brot mitbringen und ich sitze die ganze Sache einfach aus. Meine Aufgabe ist es, als Jennifer Curlandt dieses Schuljahr zu überstehen und dafür das Geld zu bekommen, um Xarax zu kaufen. Das kann ich auch hier oben.
Natürlich ist das ein absurder Gedanke. Wenn ich schon in die Rolle einer Elite-Internatsschülerin schlüpfe, sollte ich sie auch ausfüllen. In den Unterricht gehen, beispielsweise. Mich in der Mensa blicken lassen. In »Leadership of Tomorrow« eine Führungsrolle einnehmen. So tun, als hätte ich mein ganzes Leben nur unter ihresgleichen verbracht. Und nie, nie über Geld reden. Das hat man in diesen Kreisen und diese Gewissheit genügt.
»Wird schon nicht so schlimm.« Shanti muss mir angesehen haben, dass etwas nicht stimmt. Eigentlich sollte sie diejenige sein, die sich hier völlig fremd fühlt.
»Natürlich nicht«, sage ich. »Ich habe nur keinen Hunger.«
Ihre dunklen, fast schwarzen Augen funkeln mich fröhlich an. »Dann kann ich ja deine Portion mitessen.«
»Ich glaube, du kannst hier so viel essen, wie du willst«, sage ich und gehe zur Tür.
»Das will ich auch sehr hoffen bei dem Schulgeld, das ihr für mich zahlt.«
Sie grinst mich an. Ich lächele verhalten zurück. Es wird schon nicht so schlimm werden.
Denkt man das eigentlich immer, bevor man sehenden Auges in eine Katastrophe rennt?
2
Der fremde Freund
Bei Schulessen dachte ich bisher an gekochte Karotten, Spiegeleier mit Spinat und Nudeleintopf. Das ändert sich schlagartig, als wir die Mensa betreten und eine Auswahl auf uns wartet, mit der ich nicht gerechnet habe. Man nimmt ein Tablett und schiebt sich an Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichten und Desserts vorbei, nimmt sich, was man will, und alles ist inklusive! Nur Getränke, wenn sie nicht Tee und Wasser sind, müssen extra bezahlt werden. Das passiert mit derselben Chipkarte, die auch die Türen öffnet, wie wir beim Anstehen an der Kasse sehen. Ich frage mich, ob sie daran gedacht haben, ein Guthaben für mich zu hinterlegen.
Haben sie.
Wir steuern mit unseren Tabletts auf einen Tisch zu, auf dem ein Wimpel mit der Zahl 12 steht. Zwei Plätze sind noch frei, ausgerechnet in der Mitte. Die Leute sehen interessiert hoch, als wir auftauchen. Aber noch bevor wir uns setzen können, werden wir von hinten angesprochen.
»Entschuldigt bitte.«
Eine blonde nordische Schönheit schiebt sich elegant an mir vorbei und stellt ihr Tablett ab.
»Das sind unsere Plätze.«
Ihre Begleiterin ist ein unscheinbares Ding, vermutlich aus dem einzigen Grund in der Nähe dieser Königin geduldet, um ihren Glanz noch heller strahlen zu lassen. Sie ist etwas kräftiger und kleiner als ich, mit einem braunen Bubikopf, der ihr rundes Gesicht unvorteilhaft umrahmt.
»Habt ihr sie reserviert?«, frage ich ahnungslos.
Sie lächelt mich an und kopiert dabei Frau Freudes unterkühlte Art fast eins zu eins.
»Nein. Natürlich nicht. Du bist in der Zwölf?«
»Ja. Ich bin Jennifer Curlandt. Ich habe meine Eltern auf eine Geschäftsreise nach Chile begleitet und bin erst seit gestern wieder in Deutschland.«
Das hatten wir uns als Erklärung für die Zeit ausgedacht, die ich seit Schuljahresanfang versäumt habe. Nicht meine Schuld übrigens. Die Idee, Jennifer Curlandt zu werden und als sie nach Brightstone zu gehen, ist sagenhafte zwei Wochen alt. Da standen sie vor der Tür, strahlend reich und genauso freundlich herablassend, wie man das der armen Verwandtschaft gegenüber ist, um mir »die Chance meines Lebens« vorzuschlagen. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Bis sie mir Geld anboten.
Geld, mit dem ich Xarax retten kann. Ich habe für ihn eine Gnadenfrist bis Weihnachten bei seinem Besitzer ausgehandelt und werde ihn mit der ersten Hälfte des Geldes kaufen, die ich bekomme, wenn ich drei Monate überstanden habe.
»Curlandt!« Das Lächeln meiner Mitschülerin wird um einige Grad wärmer. »Ich bin Annabelle de Vries. Eine der Cornetts. Also wenn du was auf dem Herzen hast, dann komm zu mir.«
Was du niemals tun solltest, signalisiert ihr Blick mit einem angedeuteten Augenzwinkern.
»Als wir gehört haben, dass du nach Brightstone kommst, gab es kaum noch ein anderes Gesprächsthema.«
»Wirklich?«
Ich muss gar nicht so tun, als wäre ich verblüfft. Ich bin es. Wenn die Curlandts eines hassen, dann Gesprächsthema zu sein.
»Setz dich gleich neben mich. Delia? Ist das okay?«
Delia, ihr Trabant, nickt und sieht sich hektisch nach einem anderen Platz um.
Shanti steht hinter mir. Ich fühle mich immer noch schlecht, weil ich sie gleich am Beginn unseres Kennenlernens so von oben herab behandelt habe. Vorhin auf unserem Zimmer machte sie einen wirklich netten Eindruck. Sie jetzt einfach stehen zu lassen, wäre mindestens genauso mies.
»Ich bin nicht alleine.«
Ich trete einen Schritt zur Seite. Shanti sieht die Eisprinzessin freundlich an.
»Ich bin Shanti Wanjala. Hi.«
Annabelle mustert sie von oben bis unten. »Du bist die Stipendiatin. Shan… Chantal?«
»Shanti«, sagt Shanti, immer noch freundlich.
»Delia kann dich mitnehmen. Da hinten neben dem Kücheneingang sind noch ein paar Plätze frei.«
Dort sitzen schon drei Personen. Zwei Typen, der eine mit nerdiger Brille, spindeldürr, der wild mit seiner Gabel gestikuliert und damit auf sein Gegenüber zeigt, einen pummeligen Jungen, der seine Schuluniform eine Nummer zu klein gekauft hat und bald gar nicht mehr hineinpassen wird, wenn er jeden Tag so ein Gebirge aus Kartoffelbrei und Soße in sich hineinschaufelt. Und ein Mädchen, das, in ein Buch vertieft, mit der Gabel neben den Salat zielt.
Delia sieht nicht sehr glücklich aus, den Zwölfer-Tisch verlassen zu müssen. Aber Shanti lächelt ihr fröhlich zu.
»Ich liebe Kücheneingänge«, sagt sie. »Immer was los.«
Etwas sehnsüchtig sehe ich den beiden hinterher. Es ist alles neu, ungewohnt und sehr, sehr aufregend. Und das meine ich nicht im positiven Sinn. Ich fühle mich, als würde ich mit Schlittschuhen über einen zugefrorenen See fahren, in dessen Eis ich jederzeit einbrechen kann.
»Also.« Annabelle zieht mich auf den Stuhl neben sich.
Alle am Tisch haben ihre Unterhaltungen unterbrochen, um nichts zu verpassen. Vorsichtig stelle ich mein Tablett mit Salat und Vanillepudding ab und setze mich. Was nach Diät aussieht, ist eher der Umstand, dass mein Magen wie zugeschnürt ist. Shanti ist nett. Etwas verpeilt vielleicht, aber nett. Annabelle hingegen ist ein anderes Kaliber. Wenn sie mich durchschaut und mitbekommt, dass etwas mit mir nicht stimmt, ist meine Zeit in Brightstone schneller vorbei, als es allen Beteiligten lieb ist.
Sie nimmt neben mir Platz.
»Du bist zum ersten Mal auf einem Internat?«
»Ja.« Woher weiß sie das? Sie bemerkt meinen fragenden Blick.
»Wo ist denn deine Security?«
Ich sehe mich betont auffällig um. »Die hat Mittagspause. Warum?« Die Curlandts sind reich, sehr reich. Aber soweit ich weiß, nicht in den Sphären, die eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung erfordern würden.
Annabelle hebt nichtssagend die rechte Schulter. Ich habe das Gefühl, dass sie sich mehr von mir erwartet hat und ich in ihren Augen gerade etwas an Interesse verliere. »Also bist du ohne hier. Ich an deiner Stelle hätte ja darauf bestanden.«
»Wo ist denn deine?«
Ihr Lächeln ist jetzt nicht mehr ganz so freundschaftlich. »Eigentlich möchte man das in Brightstone nicht. Aber in deinem Fall …«
Sie nimmt eine Karaffe Wasser, wie sie überall auf den Tischen stehen, und schenkt sich ein. Ich bin ein kleines bisschen beunruhigt.
»In meinem Fall?«
Was zum Teufel soll das heißen? Aber Annabelle bekommt gerade den Eindruck, dass ich nur so unwissend tue, und das gefällt ihr nicht.
»Wir hatten eigentlich nicht erwartet, dass du so …« Sie überlegt kurz. »So bist, wie du bist«, schließt sie etwas lahm. »Du wirst dich sehr schnell eingewöhnen. Das Einzige, was etwas lästig ist, ist der Unterricht.«
Sie verdreht gespielt genervt die Augen, dann wandert ihr Blick an mir herab, als suchte sie etwas. Meine Schuluniform unterscheidet sich in nichts von den anderen. Aber an Annabelles Ohren funkeln kleine Diamanten. Ihre Schuhe tragen Schnallen mit einem Doppel-C. Ihre perfekt manikürten Finger sind mit Ringen geschmückt, die nur auf den ersten Blick aussehen wie Silber. Alles an ihr ist teuer. Die aschblonden Strähnchen in ihren gepflegten Haaren. Das dezente Make-up. Sogar ihre Kopfhaltung und wie sie die Schultern gerade hält, erwecken den Eindruck, als wäre sie von französischen Gouvernanten erzogen worden.
Als sie an mir nicht findet, was sie sucht, stößt sie einen leisen Seufzer aus und sieht hinüber zum Küchentisch.
»Habt ihr etwa das Zweierzimmer bekommen?«
Ich nicke.
»Das geht ja gar nicht. Du musst dich beschweren.«
»Es ist okay«, sage ich. »Für ein paar Tage.«
Jetzt wirkt sie besorgt. So, als hätte man mich in einem lichtlosen Bunker untergebracht.
»Wenn es länger dauert, sag mir Bescheid. Auch wenn dich irgendwas nervt.« Ihr Blick geht wieder zu Shanti, die neben der verstockten Delia sitzt und schon längst mit dem Essen angefangen hat.
Irgendetwas an ihrem Interesse an meiner Mitbewohnerin gefällt mir nicht.
»Was sollte mich denn nerven?«
Um uns herum fällt die allgemeine Aufmerksamkeit wieder ab von mir. Man hat mich gesehen, man weiß, wer ich bin, man wird sich später darüber unterhalten.
Annabelle senkt die Stimme. »Sie sind unglaublich anstrengend. Bitte glaub nicht, dass ich was gegen solche Leute habe. Aber sie sind eben anderes gewohnt.«
»Wer?«, frage ich ehrlich verwirrt.
Wieder lässt Annabelle diesen kleinen Seufzer über ihre Lippen schlüpfen. »Leute, die nicht zu uns gehören. Du warst bisher doch bestimmt auf einer Privatschule, oder?«
»Nein«, sage ich wahrheitsgemäß. Und dann, als ich das gelinde Entsetzen in ihren Augen bemerke, setze ich hinzu: »Meine Eltern wollten, dass ich mit der echten Welt in Verbindung komme. Das ist so ein Spleen von ihnen. Manchmal geht meine Mom auch alleine beim Discounter einkaufen.«
Annabelle sieht mich an, als hätte ich ihr gerade erzählt, dass wir über offenem Feuer Meerschweinchen grillen.
»Oh mein Gott! Wirklich? Ich dachte, die Curlandts sind so …« Sie sucht nach einem Wort, das den Ruf dieser Familie exakt umschreiben könnte. »Diskret.«
Ein fragendes Lächeln.
Diskret.
Ja, so könnte man sie nennen. Wie das mit einer öffentlichen Schule zusammengeht, ist mir auch schleierhaft. Ich sollte besser den Mund halten, statt witzig sein zu wollen und mich dabei um Kopf und Kragen zu reden. Aber Annabelle hatte bisher wohl selten Gelegenheit, Leute ihres Schlages zu treffen, die die »echte Welt« überlebt haben.
»Und weshalb bist du jetzt hier?« Sie ist ratlos.
»Sie sagen, nach so einer Erfahrung schaffe ich es überall in der Welt. Nur jetzt, wo beide im Ausland sind, wollten sie nicht, dass ich ein Jahr alleine zu Hause bin.«
»Natürlich.«
Sie sieht sich um, um sicherzugehen, ob auch alle mitbekommen haben, wie sehr sie sich um die Neuen gekümmert hat. Oder ob es jemanden gibt, der oder die sie aus diesem zähen Gespräch mit der freakigen Millionärstochter erlösen kann, die eine staatliche Schule besucht hat.
Ich mochte meine Schule. Ich hatte dort eine tolle Zeit.
In diesem Moment fokussiert sich die gesamte Aufmerksamkeit am Tisch auf etwas anderes.
Rund fünfundzwanzig Leute scheinen plötzlich aufzuwachen. Schülerinnen fahren sich durch die Haare und flüstern sich kichernde Bemerkungen zu. Die Jungens unterbrechen kurz ihre Gespräche und sitzen mit einem Mal gerader da.
Annabelle steht auf für jemanden, der die ganze Mensa auszufüllen scheint. Ich drehe mich um und sehe … den Einbrecher in Schuluniform, den ich vom Flurfenster aus beobachtet habe.
»Du wurdest vermisst«, sagt sie. Und man weiß nicht, ob sie damit von sich selbst oder einem drohenden Eintrag ins Klassenbuch spricht.
Er bleibt stehen. Das Hemd ist geschlossen, das Grinsen, mit dem er zu mir hochgesehen hat, ist verschwunden. Wenn es jemanden auf dieser Welt gibt, der aus Blau-Rot-Goldknopf die verruchteste Farbkombination der Welt machen kann und aus Schuluniformen ein Outfit, das aussieht, als könnte er damit in Mailand über den Laufsteg schlendern, dann er. Aus der Nähe betrachtet, übertrifft er das, was ich aus dem vierten Stock gesehen habe, noch einmal. Ein klar gezeichnetes, markantes Gesicht mit kräftigen Wangenknochen, verhangenen dunklen Augen, einer etwas zu breiten Nase, die das Romantische in seinen Zügen durch etwas Gefährliches bricht, und schmalen Lippen, die sich jetzt zu einem minimal sarkastischen Lächeln verziehen. Die dunklen Haare sind eine Spur zu lang und fallen auf den Kragen der Uniformjacke. Er muss sich häufig im Freien aufhalten, und das bei Sportarten wie Baumstammweitwurf oder Traktorziehen, denn man ahnt seinen athletischen Körper und dass er gewohnt ist, ihn auch einzusetzen.
Ich spüre, wie mir die Röte in die Wangen schießt und ich mich damit nahtlos in die Reihe meiner ihn anbetenden Mitschülerinnen einreihe. Aber er achtet gar nicht auf mich, weil Shanti von ihrem Tisch aufgestanden ist und sich an ihm vorbeidrängelt.
»Hast du deine Zimmerkarte dabei?«, fragt sie mich. »Ich will mir was zu trinken holen und hab meine oben vergessen. Kriegst es später wieder.«
»Klar.« Ich stehe auf, hole die Karte aus meiner Hosentasche und gebe sie ihr.
Sie dreht sich um und rennt fast wieder in Mathieu hinein.
»Sorry!«
»Shanti Wanjala?«
Er ist der Erste in diesem Haus, der ihren Namen richtig ausspricht. Shanti bleibt stehen und grinst ihn an.
»Ich bin Mathieu Manthey. Herzlich willkommen in Brightstone. Du bist Stipendiatin?«
»Ja?«
»Mach was aus diesem Jahr.«
»Werde ich.«
»Und wir Brightys beißen nicht.«
»Brightys?«
Annabelle schiebt sich einen Schritt vor. »Die Schülerschaft von Brighton«, sagt sie in einem Ton, als spräche sie mit einem Kleinkind.
Shantis Grinsen verschwindet hinter Verunsicherung und das tut mir weh. Mathieu aber schenkt ihr ein aufmunterndes, ehrliches Lächeln. Sie wirft mir einen kurzen Blick zu und reißt dabei gespielt die Augen auf. Ist der heiß, soll das sagen. Mit schwingenden Hüften macht sie sich auf den Weg zum Getränkeautomaten.
»Karte vergessen …«, sagt Annabelle leise, der Shantis Reaktion auf Mathieu nicht entgangen ist. »Das Geld siehst du nie wieder. So sind sie.«
Etwas in mir hat große Lust, ihr zu zeigen, wie man auf meiner Schule mit Leuten umgegangen ist, die mobben. Aber ich will mich nicht gleich am ersten Tag als reicher Rowdy outen, vor allem, wenn der coolste Typ, der mir jemals begegnet ist, darauf wartet, endlich an mir vorbei zu seinem Tisch zu kommen. Ich nehme mein Tablett wieder auf. Essen kann ich auch am Kücheneingang.
Er wendet sich an mich.
»Das ist Jennifer Curlandt«, sagt Annabelle.
Sein Blick geht durch mich hindurch. Entweder hat er mich nicht erkannt, oder er will, dass unsere Begegnung nicht publik wird.
Oder ich bin ihm einfach nur egal.
»Die Jennifer Curlandt.«
»Ach ja?« Er sieht zu Annabelle. »Sollte mir das etwas sagen?«
Annabelle zuckt mit den Schultern. »Ich dachte, ihr hattet mal was miteinander.«
Mir kippt das Tablett vornüber. Die Schale mit dem Vanillepudding schlittert in seine Richtung und landet wenige Zentimeter neben seiner Hose auf dem Boden. Borsalitglas. Unkaputtbar. Der Teller mit dem Salat rutscht nur bis zum Rand, ich kann ein zweites Desaster gerade noch verhindern.
F***!
Warum weiß ich das nicht? Ich hätte mich nie, niemals auf so ein Kamikaze-Unternehmen eingelassen, wenn klar gewesen wäre, dass einer der Schüler Jennifer Curlandt kennt. Und ganz abgesehen davon: Kennen ist das eine. Etwas miteinander haben was völlig, absolut desaströs anderes. Oder gehabt haben. Oder was auch immer.
Ich starre ihn an. Alle am Tisch und drum herum tun das. Gleich wird er mit dem Finger auf mich zeigen und behaupten, mich noch nie im Leben gesehen zu haben. Er wird mich outen. Dass ich eine Schwindlerin bin, dass ich unter falschem Namen hier auftauche, und er hat recht. Es ist vorbei, noch bevor es angefangen hat. Ich kann meine Sachen wieder einpacken und die Chipkarte abgeben.
Aber da sagt er: »Das ist verdammt lange her und ich will nicht daran erinnert werden.«
Und setzt sich.
Ich glaube, ich habe mich verhört. Meine Nerven vibrieren, mein Herz klopft bis zum Hals. So nah – und so schnell – an einer Entdeckung vorbeizuschrammen, damit habe ich nicht gerechnet. Weiß er, dass ich die falsche Jen bin? Nichts in seinem Blick, nichts an seinem Benehmen hat darauf hingewiesen. Was zum Teufel soll das denn für eine Beziehung mit ihm gewesen sein?
Annabelle setzt sich mit einem zuckersüßen Lächeln in meine Richtung neben ihn. Ich stehe mitten in der Mensa mit meinem Tablett vor einem zerschellten Pudding. Shanti taucht auf, eine Flasche in der Hand, und erfasst sofort die Situation.
»Komm.«
Und ich will nicht daran erinnert werden. What? Was habe ich ihm getan? Oder Jen. Oder wer auch immer.
Eine der Küchenhilfen eilt auf uns zu, Eimer und Putzlappen in der Hand.
»Ich mache das«, stammele ich und sehe mich hilflos nach einer Stelle um, an der ich das Tablett loswerden könnte. »Einen Moment.«
Ein Junge vom Zwölfer-Tisch sieht mich an, als hätte ich verkündet, eine Poledance-Einlage auf der Geschirrrückgabe hinzulegen. Ich gehe mit Shanti an zwei weiteren langen Tafeln vorbei zum Kücheneingang. Die Salatmörderin und die beiden Nerds schauen kaum hoch, als ich mein Tablett abstelle. Delia springt auf, murmelt etwas von »Ich darf nicht zu spät kommen« und verschwindet. Shanti schiebt ihr Tablett zur Seite, um Platz für meines zu machen. Dann will ich zurückgehen.
»Nein.« Shanti weist knapp mit dem Kopf zu den Zwölfern. »Du bist unten durch, wenn du das tust!«
»Aber man hat mir beigebracht …«
Shanti legt leicht den Kopf schief. Mit einem Mal ist alles Süße, Stipendiatenhafte verschwunden und hat einer Härte Platz gemacht, die man wohl braucht, um an so einem Ort zu überleben. »Du bist in Brightstone. Niemand nimmt hier einen Putzlappen in die Hand. Außer wenn man Stiefeldienst bei den Älteren hat. Und wir sind die Älteren. Also? Setz dich.«
Da die Küchenhilfe schon fast fertig ist, lasse ich mich auf den Stuhl neben dem Dünnen nieder. Der sieht nur kurz hoch und erläutert dann weiter irgendwas über bewegte Ladungen in Feldern.
»Wer war das eigentlich?«
Shanti will das Thema wechseln. Ich auch.
»Was sollte der Spruch mit den Stipendiaten?«, frage ich. »Und dass du was draus machen sollst?«
Sie pickt ein paar Harissabohnen auf. Sie ist ihrem Tablett nach zu urteilen Vegetarierin. Ich habe nur noch meinen gemischten Salat, nachdem mir dieser Mensch den Nachtisch quasi aus den Händen hat gleiten lassen.
»Wir müssen uns doppelt und dreifach anstrengen«, sagt sie und zieht ihren Stuhl näher an den Tisch, weil jemand aus der Küche mit einem großen metallenen Speisebehälter zur Theke will. »Du hast ja gehört: Es geht vor allem um die Gemeinschaft.«
»Ich dachte, um einen guten Abschluss.«
»Den brauchen nur die, die wirklich ganz nach oben wollen.«
Ich sehe zurück zu dem Zwölfer-Tisch, den wir verlassen haben. Alle reden miteinander, lachen, springen auf, um sich noch etwas zu holen, wechseln auch mal den Platz. Der Geräuschpegel in der Mensa ist hoch. Es ist ein schöner Raum, sehr modern, aber die gewaltigen Bogenfenster lassen erahnen, dass er vielleicht einmal ein Ball- oder Bankettsaal gewesen ist.
»Willst du das?«, frage ich. »Ganz nach oben?«
Sie denkt einen Moment nach. Vielleicht darüber, ob sie mich ins Vertrauen ziehen soll, was ihre Zukunftspläne betrifft. Denn dass sie klar umrissene Vorstellungen haben muss, um hier angenommen zu werden, erklärt sich von selbst.
»Ja«, sagt sie. »Das will ich.«
Es klingt weder eingebildet noch angeberisch. Ja. Ich will nach oben. Einen Moment überlege ich, was ich will.
Als Jennifer Curlandt hier wieder rauskommen, ohne aufgeflogen zu sein. Das wäre doch was.
»Und jetzt sag mir, wer dieser Typ ist, mit dem du was hattest.«
Ihre Augen leuchten. Sieh an. Neben all dem Streben und Bemühen ist doch noch Platz für ein bisschen Klatsch und Tratsch. Es macht sie gleich noch sympathischer. Annabelles abfällige Bemerkungen über Leute mit Stipendium rumoren immer noch in mir. Ich will nicht glauben, dass alle so sind. Es muss doch auch nette reiche Menschen geben.
Mich zum Beispiel. Jennifer Curlandt, Millionärstochter mit Discounter-Vergangenheit. Langsam beginnt mir meine Rolle zu gefallen.
»Das muss eine Verwechslung sein.« Logisch. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Kann es nicht geben. »Ich bin ihm noch nie im Leben begegnet.«
Darauf schwöre ich jeden Eid. Für die liebe Jen, für die ich all das hier tue, würde ich allerdings nicht meine Hand ins Feuer legen.
Der, von dem wir gerade reden, steht auf. Er kommt auf uns zu. Shanti lässt fast die Gabel fallen. Näher. Noch näher. Direkt auf uns zu. Aber er sieht mich nicht an. Er hebt die Hand mit seinem leeren Glas und stellt es bei der Geschirrrückgabe ab. Dann macht er kehrt und geht zum Ausgang.
Die Salatkillerin an unserem Tisch sieht ihm sehnsuchtsvoll hinterher. Ihr Blick hat etwas Entrücktes, eine Art Wegschweben aus den Niederungen von Unterricht, Hausaufgaben und den zwei Typen am Tisch, deren Gespräche man, in Flaschen abgefüllt, als Narkosemittel verkaufen könnte.
Auch Shanti fällt das auf.
»Wer ist das?«, fragt sie ihre Tischnachbarin.
Das Mädchen muss ein, zwei Jahrgänge unter uns sein. Sie sieht uns fast erschrocken an.
»Das ist Mathieu Manthey.« Sie beugt sich vor. Ihre schulterlangen, schnittlauchglatten Haare fallen fast in den Salat. »Seiner Familie gehört die Hälfte aller Privatkliniken in Europa. Und manche sagen, er ist ein Mörder.«
»What the fuck?«, entfährt es Shanti.
»Pssst!« Das Mädchen sieht fast ängstlich zum Zwölfer-Tisch, aber wir sind in unserer Ecke so gut wie unsichtbar für die anderen. »Der Verdacht wurde ausgeräumt. Aber …«
Sie legt die Gabel ab und holt ihre Haare aus der Salatsoße. »Mit Mord ist das ja immer so eine Sache …«
3
Amnesie und Eros
In den kommenden zwei Wochen habe ich gleich mehrere Ziele. Emotionales Multitasking, sozusagen. Zum einen: nicht enttarnt zu werden. Zum anderen, sehr viel früher als verabredet an meine Kontaktperson heranzukommen. Das ist Connor, der mich auch hierhergefahren hat. Ich muss herauskriegen, was Jen mit Mathieu am Laufen gehabt hat und mir hier buchstäblich das Genick brechen kann. Und zum Dritten, und das ist zu meiner Schande das, was mich am meisten beschäftigt: erfahren, wieso Mathieu schon jetzt einen Ruf hat, für den ehrbare Verbrecher Jahre arbeiten müssen. Er interessiert mich. Natürlich nur, weil er mich auffliegen lassen könnte.
Shanti und ich sind die Neuen. Die vier Wochen Verspätung haben einen großen Unterschied gemacht. Sie ist eine Nachrückerin, weil ihr Platz eigentlich an jemand anderen vergeben war, der oder die es sich dann anders überlegt hat. Ich habe mich verspätet, weil ich vor Kurzem noch gar nicht wusste, was auf mich zukommen würde. Es ging alles so schnell. Für mich fühlt sich jeder Moment absolut unwirklich an.
Anfangs habe ich morgens beim Aufwachen noch geglaubt, zu Hause zu sein. Das verschwindet so langsam, aber die Begegnung mit Mathieu hat mir klar gemacht, wie schnell meine Tarnung auffliegen kann. Insiderinformationen muss man sich verdienen, und viele Gelegenheiten, an sie heranzukommen, gab es bisher nicht. Und wenn, stelle ich mich zu ungeschickt an.
Aber die Klassen unter uns wissen nichts von den gruppendynamischen Prozessen der Abiturienten. Für sie sind wir die, die der Freiheit und einem aufregenden Leben an Ivy-League-Universitäten am nächsten sind. Fast schon erwachsen. Ganz weit oben in der Hierarchie.
Das nutze ich natürlich gnadenlos aus. Mein Opfer ist Caro, die es gar nicht fassen kann, dass ich seit unserer ersten Begegnung schon ein paarmal ihre Nähe am Kücheneingang gesucht habe. Heute passe ich sie in der Schwimmhalle ab.
Schwimmen ist freiwillig, aber es gibt Punkte dafür. Also treffen sich alle, die ihr Image beim Lehrkörper aufpolieren wollen, vor dem offiziellen Schwimmunterricht der unteren Klassen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, Leute zu treffen, denen man sonst nur selten über den Weg läuft.
Caro, eigentlich Caroline, ist das Salatmädchen mit dem Crush auf Mathieu. Womit sie nicht alleine ist, denn vor allem die neunten und zehnten Klassen scheinen ihren Hormonpegel an ihm einzunorden. Wenn er im Gang vorbeigeht oder die Wendeltreppe hinunterläuft, drücken sich die Mädchen an die Wand und fangen haltlos an, zu kichern oder hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln, um dann ins Kichern überzugehen. Die Jungen kriegen natürlich mit, dass sie im Vergleich zu diesem Schönling nur verlieren können, ziehen düstere Gesichter, ballen Fäuste in den Hosentaschen und gehen breitbeinig weiter.
Ab der Elften wird das etwas subtiler. Das Kichern mildert sich ab zu einem Lächeln oder verstohlenen Blicken, die sie ihm hinterherwerfen. Der Grimm bei den männlichen Schülern legt sich, da Mathieu nicht nur ein Crack im Rudern ist – ja, Rudern gehört zum Schulsport ebenso dazu wie Tennis –, sondern auch Team-Captain der Polomannschaft. Die besteht bei Turnieren aus vier Spielern, insgesamt aber gehören acht Brightstone-Schülerinnen und -Schüler zu den Auserwählten, zur Schulmannschaft.
Der Rest darf entweder beim Training zusehen oder die Zeit stoppen, die Glocke läuten oder die Anzeigetafeln bedienen. Oder sitzt schmachtend bzw. grimmig im Publikum. Shanti und ich haben versucht, den unbeliebtesten Job an den Banden zu ergattern, aber sogar das Aufstellen der umgerittenen Spielfeldbegrenzung haben sich schon zwei Mädchen aus der Zehnten gesichert. Wir sind einfach zu spät gekommen.
Zu spät für alles. Die guten Pulte in den Unterrichtsräumen, die besten Workshops, die Spinde in den Umkleiden der Sporthalle, die Sitzplätze am Zwölfer-Tisch. Und auch für den Gossip, der direkt nach den großen Ferien ausgetauscht wird und dem wir nun hinterherhecheln dürfen. Vor allem, was Mathieu betrifft.
»Das ist doch klar«, sagt Caro zähneklappernd in der Umkleide, nachdem wir eine halbe Stunde Eisschwimmen absolviert haben. »Seine Familie hat einfach viel Geld. Sie hat nicht nur den Freispruch erkauft, sondern auch mit einer riesigen Spende dafür gesorgt, dass er nach einem Jahr Aussetzen doch noch seinen Abschluss in Brightstone machen kann.«
Caro schlottert vor Kälte. Wahrscheinlich kippen sie morgens eine Lkw-Ladung Eiswürfel ins Schwimmbecken, just for fun.
»Was hat er denn gemacht?«
Sie sieht sich um. Shanti und ich sind wieder mal die Letzten, die auf einen Platz unter der heißen Dusche warten. Es ist laut. Das Wasser rauscht, in der Schwimmhalle ist nun der achte Jahrgang an der Reihe und verbreitet eine Geräuschkulisse, als hätte man ihm gerade zwei ausgehungerte Haie ins Becken gesetzt.
»Im Dorf gibt es auch eine Polomannschaft. Die hat sich gegründet, weil sie es dort nicht auf sich sitzen lassen wollten, dass bei Turnieren immer nur Brightstone glänzt. Das ist so ein Ding hier. Das Dorf gegen uns.«
Das Dorf heißt Vlins, womit eigentlich alles Wissenswerte gesagt ist. Ein paar Hundert Einwohner, wenn es hochkommt. Wir sind durchgefahren auf dem Weg nach Brightstone. Es hat immerhin eine Kirche, einen Bäcker und eine Bushaltestelle. Shanti, die dort angekommen ist und den Rest des Weges laufen musste, behauptet, Brightstone-Schüler dort beim Verzehr von Zimtschnecken gesehen zu haben.
Mathieu hat bei seiner heimlichen Rückkehr über die Mauer nicht so ausgesehen, als ob er sich beim Bäcker herumgetrieben hat.
»Und was ist passiert?« Shanti zieht ihr Handtuch noch enger um ihren Körper. Dampf steigt aus den Duschen, man kann keinen Meter weit sehen.
»Es gab eine Prügelei. Keiner weiß mehr, wer angefangen hat, aber Mathieu hat wohl einen rechten Haken gesetzt, der nicht von schlechten Eltern war.«
Boxen kann er also auch noch.
»Einer von denen aus dem Dorf, die sich geprügelt haben, ist in der Nacht gestorben. Es war der Anführer, der zuerst auf Mathieu los ist. Mathieu war hier in einem Fight-Club. Das wurde ihm zum Verhängnis.«
»Warum?«, fragt Shanti. Ich ahne die Antwort.
»Weil du, wenn du boxen kannst, nicht privat kämpfen darfst«, sage ich. »Nur aus Notwehr. – War es Notwehr?«
Caro zuckt die mageren Schultern. »Es stand Aussage gegen Aussage. Bei der Obduktion kam heraus, dass ein gezielt gesetzter Schlag wohl ein Subduralhämatom ausgelöst haben könnte. Eine Gehirnblutung. Meine Eltern sind Ärzte, deshalb kenne ich mich mit diesen Begriffen aus. Jedenfalls …«
Sie kommt etwas näher, um nicht so laut reden zu müssen. In der Schwimmhalle sind, dem Geschrei nach zu urteilen, erste Haiopfer zu beklagen.
»Es konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass Mathieu der Schuldige war. Er wurde freigesprochen. Die Mantheys haben der Familie des Toten angeblich eine unfassbare Summe gezahlt, um einen Zivilprozess zu vermeiden. Sagt man. Und Mathieu kam nach einem Jahr Aussetzen zurück nach Brightstone. Seine ehemaligen Mitschüler haben in der Zeit das Abi gemacht, aber die jüngeren kennen ihn natürlich noch.«
»Er war im Gefängnis?«, frage ich entsetzt.
»Er war einige Zeit weg vom Fenster«, antwortet Caro. »Reichtum schützt nicht vor Irrtum. Aber richtig im Knast war er nicht, nur drei Tage Untersuchungshaft.«
Das klingt nicht mehr ganz so nach einem Killer. Aber weiteren Fragen entzieht sie sich, weil endlich eine Dusche frei wird und sie keine Lust hat, während der Erörterung juristischer Fragen eine Lungenentzündung zu bekommen.
Ich gehe Mathieu, so gut es geht, aus dem Weg. Im Unterricht achte ich darauf, unter den Ersten zu sein und mich schnell nach hinten auf meinen Platz zu verdrücken, um ihm nicht direkt über den Weg zu laufen. Beim Polo allerdings sieht es anders aus. Die Trainings finden am Nachmittag statt, wenn alle sich in irgendwelchen Guilds herumtreiben.
Brightstone bietet jede Menge davon an. Guilds werden die Arbeits-, Lern- und Sportgruppen genannt. Es ist wichtig, an ihnen teilzunehmen, auch wenn sie nicht benotet werden. Segeln, Reiten, Leichtathletik, Töpfern, Tennis. Fließt alles mit in die Bewertung ein, bringt Punkte, vertieft oder korrigiert einen Eindruck, wie mir Annabelle verrät, als wir bei den Toastmastern zufällig nebeneinandersitzen.
In diesem Debattierclub darf jeder zu einem Thema ein paar Minuten auf Englisch referieren. Unser Lehrer, Herr Ziegler, bemüht sich sehr, einen interessierten Eindruck zu machen, als Delia einen grottenlangweiligen Monolog zur Rückkehr der Tradwifes als Role-Model hält. Delia sieht durchaus Vorzüge in diesem Lebensstil, kriegt aber am Ende gerade noch die Kurve, als sie behauptet, für sie wäre ein Leben als Hausfrau und Mutter nichts. Vorerst.
»Heute bist du dran«, flüstert Annabelle. »Wir waren alle schon mal an der Reihe. Du kannst so ganz ohne Stress deine mündliche Note in Englisch verbessern.«
»Aber ich habe gar nichts vorbereitet«, gebe ich ebenso leise wie panisch zurück.
»Wir wär’s damit?« Sie sieht sich kurz um. Außer Delia und uns ist niemand aus der zwölften Jahrgangsstufe dabei. Als ihre Gletscheraugen sich wieder an mich heften, schimmert eine kaum verhohlene Neugier in ihnen. »Sollte man einen Stalker verschweigen und andere damit in Gefahr bringen oder eher nicht?«
»Einen Stalker?« Ich frage mich, wie sie auf so ein Thema kommt, aber dann fällt mir auf, dass ihr Blick noch intensiver wird. Vielleicht hat sie bittere Erfahrungen damit gemacht. Oder jemand aus der Schülerschaft, der es ihr erzählt hat. »Ich weiß nicht, ob das bei den Toastmastern ein Thema sein sollte. Aber darüber reden würde ich auf jeden Fall. Vielleicht mit Leuten, die mich schützen könnten.«
»Also würdest du es nicht an die große Glocke hängen? Hier zum Beispiel?«
»In Brightstone? Ich weiß nicht. Vielleicht würde ich mich an jemanden wenden, dem oder der ich vertraue.«
Sie zieht die linke Augenbraue hoch. »Also an mich, zum Beispiel.«
Bestimmt nicht.
»Klar, an dich. Du bist ja Vertrauensschülerin. Aber wieso …«
In diesem Moment wird Herr Ziegler auf uns aufmerksam und räuspert sich vielsagend.
»Miss Curlandt? Would you, please?«
Zu Annabelles Enttäuschung verlege ich mich auf die Frage, ob man Horoskopen Glauben schenken oder sein Schicksal doch lieber selbst in die Hand nehmen soll. Unser geflüstertes Gespräch ist längst vergessen, denn es gibt Wichtigeres in Brightstone als unausgelastete Cornetts.
Polo, zum Beispiel.
Ich liebe Polo! Es ist ein rasantes, risikoreiches Spiel mit vielen Unwägbarkeiten, die man nur meistert, wenn man einen echten Draht zu Pferden hat.
Vor langer Zeit durfte ich in den Sommerferien Jen und ihre Mutter Caren in München besuchen. Jen spielt Polo. Sogar sehr gut. Sie besitzen drei Pferde, argentinische Poloponys mit einem Stockmaß von 1,50 Metern, und ich erinnere mich, dass ich in diesem Sommer einen Anflug von glühendem Neid auf Leute gespürt habe, die sich das leisten können. Zurück in Hamburg, habe ich meiner Mom so lange in den Ohren gelegen, bis ich nach der Schule im Alster Polo Club jobben durfte. Zum ersten Mal einen Stick in der Hand hatte ich mit fünfzehn. Immer dann, wenn während der Trainings jemand ausfiel, durfte ich einspringen. Ich kann spielen, aber ich bin meilenweit von Jens Klasse entfernt. Mir fehlt die Übung im Turnier. Das Messen von Kraft und Geschicklichkeit in einem Spiel, bei dem es um alles geht. Meine heimliche Hoffnung war, in Brightstone so gut zu werden, dass sie zu Hause gar nicht mehr darum herumkommen, mich in die Mannschaft aufzunehmen. Auch ohne Pferd. Diese Ausnahmen sind selten, aber es gibt sie. Ich will eine sein.