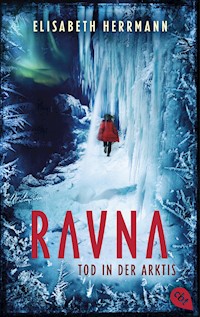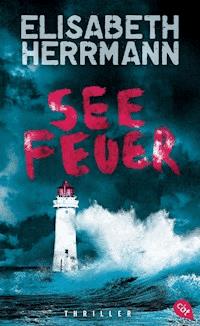Inhaltsverzeichnis
Widmung
Sommer
EINS
ZWEI
DREI
VIER
Copyright
cbt ist der Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
FürLoni und Friedrich Herrmann,Doris, Richard, Stefan und Shirin,die diese erste Seite mehr als verdient haben
Sommer
Diese tiefe, schwere Stille, die plötzlich zu atmen schien, als das leise Wispern und Raunen sich von ihr löste und sie flüsternd und raschelnd durchwob.
Er lag ausgestreckt in seiner Koje und starrte an die Decke. Es musste ein heller Mond draußen scheinen. Die zitternde Spiegelung von Wasser und Schilf tanzte über die Wände und tauchte die Kajüte in ein silbrig-fahles Licht. Der Wind knisterte im Röhricht. Ab und zu plätscherte etwas, als würde jemand einen Stein ins Wasser werfen. Das waren die Fische, die von der Sonne träumten.
Er schloss die Augen und versuchte zu schlafen. Das Schiff lag versteckt, niemand würde es finden. Es war eine gute Idee gewesen, an diesen Ort zurückzukehren. Lange hatte er überlegt, ob er es tun sollte. Er wusste nicht, wohin mit sich und dem Kahn, weder stromauf noch stromab konnte er lange an einem Platz bleiben. Er war ein Getriebener. Er war auf der Flucht. Er wusste nicht mehr, wie lange schon, sie kam ihm vor wie eine endlose Odyssee, und es gab keinen Hafen, in dem er Ruhe finden konnte. Schließlich war ihm diese Stelle in den Sinn gekommen.
Er hörte den vielen Stimmen der Stille zu. Manche nannten den Ort verwünscht, das waren die Romantiker. Die sahen die Geister über dem Wasser. Andere nannten ihn verflucht. Das waren die Realisten. Die erinnerten sich an das, was hier geschehen war, und an das Blut, das vom Deck getropft war und sich in schwerelosen Schleiern aufgelöst hatte wie Tinte in einem Glas Wasser. Keiner, weder die Romantiker noch die Realisten und schon gar nicht die, die so schnell vergaßen, würde ihn hier vermuten. Es lag jenseits aller Logik, sich ausgerechnet hier zu verstecken. Und genau deshalb fühlte er sich nach langer Zeit endlich sicher.
Das zitternde Licht störte ihn immer noch. Er stand auf und ging ans Fenster, um die Vorhänge zuzuziehen. Dabei warf er einen Blick hinaus in die Dunkelheit. Das Wasser stand ruhig. In seiner dunklen Oberfläche spiegelten sich die Berge. Der Wald hatte sich über sie gelegt wie ein schweres Tuch. Man konnte die Gipfel und die schroffen Hänge darunter erahnen und wie tief der Fluss sein musste und wie reißend seine Strömung da draußen, wenn er so von den steilen Uferfelsen eingezwängt wurde. Er hatte befürchtet, der alte Kahn würde es nicht mehr bis zu diesem Seitenarm schaffen. Die Fließgeschwindigkeit war selbst am Ufer noch hoch und das steinige Flussbett eine Herausforderung. Unruhig hatte er die Stromkilometer gezählt und sich mehrmals gefragt, ob er sich vielleicht doch geirrt hatte. Vielleicht gab es den Zugang auch gar nicht mehr?
Er war lange nicht mehr hier gewesen. Es war viel geschehen in den letzten Jahren entlang des Rheins. Sandbänke waren Spundwänden gewichen, Häfen geschlossen worden, Ufer begradigt und befestigt. Dörfer wurden Städte. Brücken hatten Fähren ersetzt. Inseln hatten Dämme bekommen und waren längst bebaut. Je näher er an Stromkilometer 614 herangekommen war, desto aufmerksamer hatte er das Ufer beobachtet. Bis er schließlich den fast überwucherten Zugang gefunden hatte.
Wie ein Geist war das Schiff hinter den Wald der Halbinsel geglitten und keine drei Minuten später vom Flussradar verschwunden. Wieder versuchte er sich zu erinnern, wie die Leute diese Ecke genannt hatten. Bis zu jenem schwarzen Tag war es die Namedyer Bucht gewesen. Doch dann hatten sie ihr einen neuen Namen gegeben. Einen Namen, der das Grauen schon beim Flüstern in sich trug; der erinnerte an das, was sich hier abgespielt hatte; den er vergessen hatte, so wie er auch lange Zeit verdrängt hatte, dass das Grauen immer noch in ihm lebte.
Er zog die Vorhänge mit einem Ruck zu und legte sich wieder hin. Es dauerte nicht lange und seine Ohren hatten sich an das Flüstern des Wassers gewöhnt. Ein Baumstamm rieb sich an einem anderen. Eine Rohrdommel schrie im Schlaf. Die Blätter rauschten und das Schilf wisperte. Er dämmerte weg in seine Träume. Bis die Schritte kamen und das Licht durch den Spalt unter der Tür kroch und der Duft ihn weckte. Dieser Hauch einer Erinnerung, wie er in selten betretenen Räumen haften blieb, in Schränken, die man lange nicht geöffnet hatte, oder in Betten, wenn man die Decke hob. Ein Duft, den er geliebt hatte und der nun ein dunkles Entsetzen auslöste; eine Erinnerung, die ihn selbst im Schlaf noch verfolgte; das Nahen der bestürzenden Erkenntnis, einen Schritt vor dem Abgrund zu stehen und die Balance zu verlieren; aus einem Albtraum aufzuwachen und zu merken, dass dies kein Albtraum war; die Sekunde vor dem Schrecklichen, der Moment vor der Tat, der letzte Gedanke im Angesicht des ewigen Nichts, die größte Furcht.
Und die Tür ging auf, und das gleißend helle Licht blendete ihn so sehr, dass er nichts erkennen konnte. Er hörte seinen eigenen keuchenden Atem. Er sah sich den Gang hinuntergehen bis zu jener Tür, die er nicht öffnen durfte, weil sonst das Schlimme geschehen würde. Doch er hielt sich nicht daran. Er sah seine Hand, bleich im Mondlicht, und seine Finger zitterten so stark, als stünde er unter Strom. Der Duft war so intensiv, dass ihm beinahe übel wurde. Schweiß rann über sein Gesicht. Oder waren es Tränen? Er stieß die Tür auf, und dann hörte er die Schreie, sah wirbelnde Schatten und eine Hand, die sich hob und niederfuhr. Wieder und immer wieder, bis etwas Metallisches aufblitzte und die Hilferufe in einem nassen Röcheln erstarben. Das Blut kroch über den Teppich, es fühlte sich warm an, und als er hinuntersah, erkannte er seine bloßen Füße inmitten eines rubinroten Sees und die abgebrochene Blüte einer Lilie, so weiß und unschuldig und tot wie alles in diesem Raum.
Er fuhr hoch. Der heisere Ruf einer Krähe musste ihn geweckt haben. Durch die Vorhänge kroch das fahle Licht des Morgengrauens. Mit einem Stöhnen griff er sich an den Kopf. Er hatte wahnsinnige Schmerzen. Wie immer, wenn er diesen Traum gehabt hatte und die Erinnerung wiederkam.
Der Name. Er hatte ihn nicht vergessen. Der Ort war verflucht. Sie nannten ihn: den toten Fluss.
EINS
Sabrina räkelte sich unter dem Bettlaken und fühlte, wie die Glückseligkeit in ihr wuchs wie ein Heliumballon. Es war der erste Tag der Sommerferien und es war ihr Geburtstag. Mehr konnte es eigentlich gar nicht geben. Sie blinzelte in Richtung Wecker und erkannte, dass sie zur selben Zeit wach geworden war wie immer. Halb sieben. Die Macht der Gewohnheit, die jetzt für sechs endlos lange Wochen unterbrochen war.
Sie schnupperte, aber noch lag kein Hauch von heißer Schokolade in der Luft. Normalerweise hörte sie um diese Uhrzeit ihre Mutter schon unten im Bad rumoren. Irgendwann klapperten die Teller in der Küche, Kaffeeduft zog durchs Haus, und spätestens dann wusste Sabrina, dass die Gnadenfrist abgelaufen war und sie aufstehen musste.
An ihren Geburtstagen aber war alles anders. Es gab Frühstück im Bett, und in jedem Jahr, an das sie sich erinnern konnte, hatte ihre Mutter eine Schale Kakao gekocht. So dick, dass der Löffel beim Umrühren beinahe stehen blieb.
Sabrina wälzte sich auf die andere Seite, aber der Schlaf kam nicht wieder. Sie war hellwach. Gestern Abend hatte Franziska Doberstein ihrer Tochter noch geheimnisvoll zugezwinkert und etwas von einer riesigen Überraschung gemurmelt. So groß, dass sie noch nicht einmal durch die Tür des kleinen Fachwerkhauses passen würde. Vergessen hatte sie den Geburtstag also nicht. Vielleicht verschlafen?
Unsinn. Franziska Doberstein verschlief nie. Sie war die perfekte alleinerziehende Mutter. Gestresst bis zum Umfallen, aber eine Familienlöwin, der Weihnachten, Ostern und Geburtstage heilig waren. Plötzlich strahlte Sabrina, sprang aus dem Bett und lief ans Fenster. Ihr Geschenk würde im Hof stehen, zwischen den alten Weinfässern, der kleinen Sitzgruppe und dem altersschwachen Opel, der alle zwei Jahre mit Gebeten und Schmiergeld doch noch irgendwie über den TÜV gebracht wurde. Vielleicht ein Mofa? Nein. Kein Geld, und den Führerschein könnte sie erst im nächsten Jahr machen. Ein Boot? Zu teuer. Vielleicht …
Sie riss die Vorhänge zur Seite und erstarrte. Die Überraschung war perfekt, aber anders, als Sabrina sie sich vorgestellt hatte. Unten stand ihre Mutter, küsste einen fremden Mann und schien alles um sich herum vergessen zu haben. Sogar, dass sie ein Nachthemd trug. Dazu noch eines von der Sorte, das Sabrina allenfalls an ihrer Großmutter geduldet hätte. Den Mann hatte Sabrina noch nie gesehen. Er war groß und kräftig, hatte strubbelige Haare, die ihm in alle Richtungen abstanden, und sein Hemd hing lose über einer ausgebeulten Jeans. Er schien sich an dem Nachthemd nicht zu stören, im Gegenteil. Wenn Sabrinas verschlafene Augen sie nicht täuschten, streichelte er gerade sehr genießerisch den Po ihrer Mutter. Die schmiegte sich in seine Arme und schien alles um sich herum zu vergessen.
Auch Sabrinas Geburtstag.
Sie warf das offene Fenster zu. Es war ihr egal, ob die beiden da unten mitbekamen, dass sie sie gesehen hatte. Sollten sie. Der Mann hatte doch nicht etwa hier übernachtet? Seit ihr Vater vor sechs Jahren ausgezogen war, war das nicht mehr vorgekommen. Man hätte sie wenigstens vorwarnen können. Eine Sekunde überflutete sie der ganze Schmerz noch einmal, bis sie ihn hinunterschluckte.
Du bist jetzt sechzehn, dachte sie. Du solltest langsam über diesen Dingen stehen.
Aber das Stechen blieb, irgendwo in einer Ecke ihres Herzens. Als sie wenig später hinunter ins Bad ging, hatte es sich schon in eine gesunde Wut auf ihre Mutter verwandelt. Keine Schokolade ans Bett, dafür ein fremder Kerl im Haus. Wenigstens hatte er genug Anstand, vor dem Frühstück zu verschwinden.
»Sabrina?«
Statt eine Antwort zu geben, drehte sie die Dusche auf. Sie stand so lange unter dem heißen Wasser, bis ihre Fingerspitzen ganz schrumpelig waren. Sie wusste, dass ihre Mutter das vor allem morgens nicht sehr gerne sah. Es war Anfang Juli. Die grüne Lese stand an, das Entblättern, der Pflanzenschutz. Die Tage begannen früh und endeten spät. Sommerferien war auch der Weinberg. Zumindest an den Vormittagen. Das war schon so, seit Sabrina denken konnte, und da verschwendete man weder Wasser noch Zeit.
Sie war immer noch enttäuscht und wütend, als sie in ihrem Bademantel, das Handtuch zu einem Turban um die langen, braunen Haare geschlungen, in die Küche tappte. Auf dem Herd brodelte ein Topf mit verführerisch duftender Schokolade.
Franziska Doberstein rührte um und achtete darauf, dass nichts anbrannte. Sie machte die Gasflamme aus, drehte sich um und breitete die Arme aus. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
Sie wollte sie an sich drücken, doch Sabrina wich ihr aus und setzte sich an den großen Küchentisch, an dem eigentlich bis zu acht Personen Platz hatten. In dieser hektischen Phase des Jahres, in der der Wein und nicht die Ordnung wichtig war, bedeckten Kataloge, Rechnungen, Prospekte und Preislisten fast die gesamte Tischplatte. Nur eine Ecke war frei, die für zwei gedeckt war. Vor Sabrinas Teller stand eine kleine Vase mit Sommerblumen.
»Wer war das? Etwa meine Überraschung?«
Franziska nahm den Herd vom Topf und goss die dunkle Flüssigkeit in zwei Müslischalen. Vorsichtig, um sich nicht zu verbrennen, balancierte sie sie hinüber zum Tisch. »Michael. Michael Gerber.«
»Sollte ich ihn kennen? Habe ich irgendetwas verpasst?«
Ihre Mutter strich sich verlegen eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Es fiel Sabrina schwer, sich vorzustellen, was sich zwischen ihr und diesem Herrn Gerber abgespielt hatte. Franziska Doberstein war eine hübsche Frau Mitte vierzig, und Sabrina hatte von ihr das herzförmige Gesicht mit den leicht schrägen Augen, die so charakteristisch für die Dobersteins waren.
»Meine Elfen«, hatte ihr Vater sie immer genannt. »Ihr habt mich verhext.«
Wenn Sabrina an ihre Eltern dachte, hatte sie immer ein Bild vor Augen: Ihr Vater, wie er ihre Mutter zu sich hinunter in den Sessel zog und sie sich lachend an ihn schmiegte. Ihre dunkelbraunen Locken fielen offen über die Schulter und das Sonnenlicht malte spinnenfeines Kupfer in ihre Haare hinein. Er war ein fast schmaler, blonder Mann, von ihm hatte Sabrina ihre sportliche Figur und die langen, überschlanken Beine. Immer wenn sie ihre Eltern so zusammen gesehen hatte, wollte sie mit hinein in diese Umarmung. Ein Teil dessen sein, was eine Familie miteinander verband.
Vielleicht hatte er sich tatsächlich zu eingeengt gefühlt. Je älter Sabrina wurde, desto mehr versuchte sie zu verstehen, warum ihr Vater gegangen war. An Tagen wie diesen vermisste sie ihn plötzlich wieder so sehr, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen.
Ihre Mutter rührte die Schokolade um und pustete hinein. »Ich wollte nicht, dass du etwas davon mitbekommst. Es tut mir leid.«
»Ist es was Ernstes?«
»Ich weiß es nicht.« Ihre Mutter tunkte den Löffel in die Schokolade, hob ihn hoch und beobachtete, wie der dünne Strahl zurück in die Tasse floss.
»Also entschuldige mal bitte«, sagte Sabrina. Sie wusste selbst, wie empört sich ihre Stimme anhörte, aber sie hatte keine Lust, sich zu verstellen. »Ich würde gerne wissen, ob ich Herrn Gerber in Zukunft öfter hier sehe. Dann kann ich mich darauf einrichten. Zum Beispiel im Bad.« Sie nahm einen Schluck und verbrannte sich natürlich die Zunge.
»Es wird nicht mehr vorkommen. Okay? Ist es überhaupt schon einmal vorgekommen? Nein. Aber so alt bin ich nun auch wieder nicht, dass ich die Hoffnung endgültig aufgeben müsste. Oder?«
Da war er wieder, der kleine, verbitterte Zug um Franziskas Mundwinkel. Es war genau diese Regung, die den Ärger in Sabrina augenblicklich verpuffen ließ und in ihr nur den einzigen Wunsch weckte, ihre Mutter in den Arm zu nehmen. Franziska war nicht alt. Sie war nur ziemlich allein.
»Wo hast du ihn denn kennengelernt?«
»Im Internet.«
Auch das noch. Da wurde man täglich vor den Gefahren dieses virtuellen Monsters eindringlich gewarnt: Chatte nie mit Fremden! Suche dir deine Freunde im echten Leben! Verbringe deine Zeit mit etwas Nützlichem! Und dann erfuhr man von seiner eigenen Mutter, dass die sich ihre Lover am Computer aussuchte.
Franziska Doberstein musste die Missbilligung in der Luft gespürt haben. Sie versuchte ein entschuldigendes Lächeln. »Ich habe ja sonst keine Gelegenheit.«
Das war natürlich glatt gelogen. Fast an jedem Wochenende war ihre Mutter auf einem anderen Winzerfest. Natürlich mit ihrem Weinstand, Dobersteins Grauburgunder Mittelrhein, Steillage. Seit 1651 in Familienbesitz. Aber wenn sie spät abends zurückkam, leuchteten ihre Augen nicht wie an diesem Morgen. Dann war sie meistens müde, setzte sich mit sorgenvollem Gesicht über die Bestellungen, kalkulierte und rechnete, bis sie fast über den Büchern eingeschlafen war. Im Grunde genommen war nicht nur ihr Vater gegangen. Er hatte Sabrina auch die Mutter genommen.
»Ist er nett?« Sabrina pustete und trank einen weiteren Schluck.
Ihre Mutter dachte nach. »Ich glaube, ja.«
»Weißt du sonst noch was über ihn?«
»Wird das jetzt ein Verhör? Ich dachte, du willst etwas ganz anderes wissen. Wo dein Geburtstagsgeschenk ist, zum Beispiel.«
»Wo ist es denn?«
Ihre Mutter stellte die Tasse ab. »Zieh dich an und komm mit raus. Dann zeige ich es dir.«
So schnell war Sabrina selten fertig gewesen. Sie hielt sich nicht lange mit Föhnen auf, schlüpfte nur in ihre Jeans und ein knappes T-Shirt und folgte ihrer Mutter auf den Hof. Franziska Doberstein hatte die Zeit genutzt und sich ebenfalls geduscht und angezogen. Sie trug das Gleiche wie immer: ein hochgekrempeltes Hemd, eine ausgeblichene Latzhose und leichte Turnschuhe. Normalerweise wäre Sabrina auch in die Arbeitskluft gestiegen. Aber heute hatte sie frei und gute Chancen, den ganzen Tag in Krippe 8 zu verbringen, der Sandbucht am anderen Ufer des Rheins, wo sich alle trafen.
Die schmale Straße führte steil bergauf. An dieser Stelle des Flusses rückten die Berge so nahe an das Ufer heran, dass kaum Platz blieb für mehr als zwei bis drei Häuserreihen hintereinander. Die Bahnschienen lagen fast in den Vorgärten. Was Leutesdorf nicht an Breite schaffte, glich es durch Länge wieder aus. Sabrina hatte des Öfteren überlegt, es als »längstes Dorf Deutschlands« vorzuschlagen. Man lebte wirklich in einem winzigen Nest, aber wenn man vom Bäcker auf der einen zum Supermarkt auf der anderen Seite musste, hatte man eine ordentliche Strecke zu bewältigen. Dafür war man schnell im Weinberg, der lag fast direkt hinter dem Haus. Sabrina und Franziska brauchten keine drei Minuten für den kurzen Aufstieg bis zum Ende des Weges, der in eine kiesbestreute schmale Straße mündete.
Sie führte an Hängen entlang, die große Namen trugen: Salinger, Ebeling, Kreutzfelder. Die Rieslingkönige. Uralte Dynastien großer Gewächse. Und schließlich, ganz am Ende der bewirtschafteten Steilhänge, Doberstein. Vom Rhein aus betrachtet war ihr Hang der letzte auf der rechten Seite. Dahinter begannen die aufgegebenen Weinberge, verwilderte Stöcke, bröckelnde Terrassen. Genau an dieser Stelle blieb Franziska stehen. Mit einem stolzen Lächeln drehte sie sich zu ihrer Tochter um.
Sabrina bekam ein mulmiges Gefühl im Magen. Sie konnte doch nicht … Das würde sie niemals tun!
Aber Franziska griff in die Tasche ihrer Latzhose und holte ein Schreiben hervor, das sie Sabrina entgegenhielt. »Herzlichen Glückwunsch. Frag mich nicht, was mich das gekostet hat.«
Bei dieser Feststellung ging es nicht um Geld. Seit ewigen Zeiten schwelte ein Streit um den aufgegebenen Steilhang. Martin Kreutzfelder, einer der reichen Bimsbarone aus Andernach und ganz nebenbei auch noch der Besitzer eines der renommiertesten Weingüter der Gegend, hatte sich diesen Hang in den Kopf gesetzt. Genauso lange schon versuchte Franziska Doberstein, den Berg zu bekommen. Er lag direkt neben ihrem Anbaugebiet und vor langer Zeit einmal hatte er auch der Familie gehört. Immer wieder war der Gedanke aufgetaucht, ihn von der Gemeinde zurückzukaufen. Doch neben dem Preis gab es noch ein anderes Problem, das im Raum stand: Wer sollte ihn übernehmen? Franziska war jetzt schon am Rande ihrer Kräfte. Und Sabrina …
»Ich glaub das einfach nicht«, sagte sie. »Du hast das hinter meinem Rücken entschieden?«
»Es war eine einmalige Gelegenheit«, rechtfertigte sich Franziska. »Kreutzfelder hat sich mit seiner Beteiligung in Rheinhessen übernommen. Er hat sein Angebot zurückgezogen. Das war der Moment, auf den ich gewartet habe.« Mit leuchtenden Augen trat sie einen Schritt näher. »Sabrina, das ist dein Berg. Der Dobersteiner Rosenberg. Ich schenke ihn dir zum Geburtstag. Und du darfst ihm einen Namen geben. Wie wäre es mit Dobersteins Jüngster?«
Wieder hielt sie ihr die Urkunde entgegen.
Doch Sabrina trat einen Schritt zurück und hob abwehrend die Hände. »Ich will das nicht! Du kannst mir doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg einen Weinberg kaufen!«
»Pachten«, antwortete ihre Mutter mit tonloser Stimme. Erst jetzt schien sie zu bemerken, dass ihr Geschenk eine andere Wirkung zeigte, als sie wohl erhofft hatte. »Ich habe ihn nur gepachtet. Für dreißig Jahre.«
»Dreißig Jahre!« Sabrina hatte Tränen in den Augen. »Ich bin sechzehn, Mama. Das ist fast doppelt so lange, wie ich auf der Welt bin. Du klaust mir mein Leben, verstehst du das denn nicht?«
Sabrina konnte nicht begreifen, dass all die Diskussionen der letzten Monate nichts genutzt hatten. Die Urkunde war wie ein Gerichtsurteil, gegen das sie noch nicht einmal Berufung einlegen konnte. Ihre Mutter stellte sie einfach vor vollendete Tatsachen und sie wurde noch nicht einmal gefragt.
Franziska Doberstein senkte den Kopf. Sie ging zu der kleinen Mauer aus Feldsteinen, die die Straße zum Hang hin abgrenzte. Dort blieb sie stehen und sah hinauf bis zum Gipfel der schrundigen Lavaberge, zu denen sich die Terrassen der Weinhänge in sanften Wellen hochgegraben hatten. Er war ihr Sehnsuchtsberg. Wenn sonst schon nichts heil war in ihrem Leben, dann sollte wenigstens der Anbau wieder eins sein. Sabrina konnte das verstehen. Aber sie wollte nicht die Sehnsüchte ihrer Mutter ausbaden.
»Ich gehe schwimmen«, sagte sie nur. »Damit ich von meinem Geburtstag wenigstens ein bisschen was habe.«
Ihre Mutter nickte, drehte sich aber nicht um. Verdammt. Musste sie immer diese schreckliche Kümmer-dich-nichtum-mich-ich-schaff-das-schon-Tour fahren? Damit erreichte sie nur, dass Sabrina sich wie eine Verräterin fühlte. Ein tolles Gefühl für so einen Tag. Aber genau genommen hatte er ja schon ziemlich mies begonnen. Dann musste man ihn wenigstens nicht so enden lassen.
ZWEI
Krippe 8 befand sich zwischen der Namedyer Werth, einer ehemaligen Flussinsel, und Andernach. Sie lag auf der linken Rheinseite, also genau gegenüber von Leutesdorf. Wenn nicht gerade das Echo der Züge, Autos oder Motorschiffe einen Heidenlärm machte, konnte man sogar über den Rhein hinüberrufen. Früher, als die Winter so kalt waren, dass sogar die Luft knackte, lief man einfach auf die andere Seite. Oder man benutzte die Fähre, die irgendwann eingestellt wurde, weil mittlerweile jeder ein Auto besaß und lieber einen 30 Kilometer langen Umweg über die Brücke von Neuwied in Kauf nahm. Am Wochenende konnte man manchmal auf die Ausflugsdampfer von Andernach zum Geysir aufspringen. Die machten einen Abstecher quer über den Rhein, um Touristen aus Leutesdorf abzuholen. Aber an diesem Tag war kein Wochenende, also nahm Sabrina den Bus. Es war schon erstaunlich, dass man fast eine Stunde unterwegs war, um in eine Stadt zu kommen, die in einer Luftlinie von nicht einmal 300 Metern lag.
Krippe 8 war die letzte der Badebuchten flussaufwärts. Die blumengeschmückten Uferpromenaden von Andernach endeten an den Basalteisbrechern und dem Alten Krahnen, einem runden Turm aus dem 16. Jahrhundert. Dahinter begann das Naturschutzgebiet der Werth, einer Insel, die vor langer Zeit schon zum Festland hin aufgeschüttet worden war. Hier durfte der gezähmte Fluss für ein paar Kilometer wieder wilder werden und formte sich sein Ufer selbst. Die letzte Krippe lag kurz vor der zugewucherten Einmündung eines stillen, fast vergessenen Seitenarms. Ihr sichelförmiger Sandstrand fiel flach in den Rhein. Silberweiden säuselten sanft im Wind, ihre langen Äste hingen herunter wie ein Vorhang von Perlenschnüren.
Die kleine Liegewiese war an diesem Vormittag schon ziemlich voll. Seit man im Rhein wieder schwimmen konnte - auch wenn das gefährlich war und gar nicht gern gesehen wurde -, waren die Krippen im Sommer zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Sabrina entdeckte Amelie auf einem bunten Badetuch gleich vorne in der ersten Reihe. Ihre Freundin schaute verträumt auf den Fluss, wo gerade ein über hundert Meter langes Containerschiff hoch Richtung Duisburg oder Rotterdam fuhr.
Shipspotting, nannte Amelie das. Im letzten Jahr hatte sie ein Schiffer mitgenommen. Nach drei Tagen war sie wieder da gewesen, doch von der Reise zehrte sie noch heute.
»Hi!« Sabrina ließ sich neben sie auf das Tuch fallen. In der Mitte prangte ein großes Hanfblatt. Obwohl Amelie noch nicht einmal rauchte, ließ sie keine Gelegenheit aus, die Umwelt ein wenig zu provozieren.
Ihre Freundin strahlte sie an. »Happy birthday, meine Kleine!«
»Moment, ich bin jetzt sechzehn!«
»Einmal Küken, immer Küken.«
Amelie rückte zur Seite und deutete auf das Schiff. »Das ist die Maxima. Siehst du die niederländische Flagge? Sie ist eine der wenigen, die die ganze Strecke bis runter zum Schwarzen Meer schafft.«
Sie winkte, doch der Schiffer auf dem Stand war zu weit weg und fuhr unbeirrt weiter. Es war Amelies Traum, eines Tages um die ganze Welt zu reisen. Immer wenn das Fernweh mit ihr durchging, spürte Sabrina einen kleinen Stich im Herzen. Sie hatte das Gefühl, ihre Freundin dann für immer zu verlieren. Amelie war zwar in Andernach geboren, doch sie kam Sabrina vor wie ein Gast auf Durchreise, der immer auf gepackten Koffern saß; bereit, auf und davon zu gehen, sobald sich die Gelegenheit bot. Amelie redete sehr häufig vom Weggehen. Sie hatte keinen Plan, und ihre Ziele wechselten ständig; vielleicht war die Sprunghaftigkeit ihrer Ideen der Grund, weshalb sie immer noch nicht fortgegangen war. Mit ihren knapp achtzehn Jahren sah sie wesentlich älter aus. Das lag nicht nur an ihrer Figur, sondern vor allem an dem leicht spöttischen Zug um ihre vollen Lippen, der mehr Lebenserfahrung versprach, als Amelie eigentlich haben konnte. Sie hatte ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen und braune Augen, denen ihr geschicktes Make-up etwas Katzenhaftes verlieh. Auch heute drehten sich alle jungen Männer nach der dunkelhaarigen Schönheit in ihrem knappen Bikini um. Und Amelie gab ihnen auch einiges zum Hinsehen, als sie sich auf dem Laken ausstreckte und ihr Oberteil zurechtrückte. Sabrina kam sich neben ihr blass und unscheinbar vor.
»Sorry, ich hab kein Geschenk für dich. Ich geb dir ein Eis aus, ja? Kommst du nachher?«
Amelie hatte einen der begehrten Ferienjobs in einem Eiscafé am Marktplatz ergattert. Der Besitzer wusste, was er tat, denn seit Amelie dort arbeitete, hatte sich der Umsatz verdoppelt. Auch wenn ihre Freundin über die Arbeit stöhnte, sie hatte doch Spaß daran, unter Menschen zu sein und ab und zu ein bisschen zu flirten. Jetzt aber versteckte sie ihre Augen hinter einer großen, schwarzen Sonnenbrille. Nur wer sie so gut kannte wie Sabrina, hörte auch an ihrer Stimme, dass etwas nicht stimmte.
»Klar komme ich. Einen Nougatbecher aufs Haus lasse ich mir nicht entgehen.«
Sabrina sah sich um. Ein paar Gesichter kannte sie aus der Schule, eine Großfamilie weiter unten Richtung Werth und zwei ältere Damen waren Kunden ihrer Mutter. Anders als die großen Betriebe lebten die Dobersteins nicht von Lieferungen an Supermärkte, sondern von kleinen Weinhandlungen, Gastronomen und Privatleuten, die gerne persönlich vorbeischauten. Sabrina nickte ihnen zu und grüßte freundlich, als sie in ihre Richtung sahen.
Amelie bemerkte das und grinste. »Bist du wieder ein braves Mädchen, das seiner Mutter keine Schande macht?«
»Lass mich in Ruhe mit meiner Mutter.«
»Oh-oh. Das hört sich nicht nach einem relaxten Morgen an.«
»Sie hat mir einen Weinberg geschenkt.«
Amelie schob die Sonnenbrille hoch in ihre pechschwarzen, glänzenden Locken, um die Sabrina sie glühend beneidete. Auf den mitleidigen Blick aus Amelies Augen hätte sie aber gerne verzichtet. »Ein Weinberg? Was ist das denn? Hast du ihr nicht gesagt, dass du mit dem ganzen Krempel nichts am Hut hast? Wir wollten doch irgendwann gemeinsam nach Argentinien!«
Argentinien, New York, Australien, Malaysia. Immer mal wieder hatten sie geträumt, auszuwandern. Aber mehr als Träume waren das auch nicht, zumindest keine konkreten Zukunftsperspektiven.
»Ich weiß«, antwortete Sabrina. »Aber bis es so weit ist, muss ich entweder weiter zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen.«
Das schnaubende Geräusch aus Amelies Nasenlöchern verriet, was sie von diesen Alternativen hielt. »Bei deiner Mutter. Als Weinbauerin. Na gute Nacht.«
Sie hatten endlos diskutiert. Sabrina wusste, dass sie sich bis Ende der Ferien entscheiden musste. Eine Lehre bei einem anderen Winzer kam gar nicht in Frage. Das ging gegen die Familienehre. »Man kehrt keinen fremden Hof«, hatte ihre Mutter kategorisch erklärt. Ausgebildet wurde im eigenen Betrieb. Natürlich gab es Ausnahmen: Söhne und Töchter, die Önologie studierten und dann in Kalifornien oder Südafrika landeten, in goldenen Tälern, weit weg vom Mittelrhein mit seinen hohen Bergen, die schon am Nachmittag lange Schatten über das Tal und den Fluss warfen.
Doch Sabrinas Schulleistungen waren nicht so, dass sie ein Studium unbedingt nahelegten. Dabei wusste sie genau, dass sie viel mehr schaffen konnte. Aber in den letzten zwei Jahren hatte sie die Lust verloren, sich anzustrengen. Wenn es nichts gab, was man sich erkämpfen musste, wenn der Lebensweg bereits vorgezeichnet war, noch ehe man überhaupt angefangen hatte, darauf Fuß zu fassen - wofür lohnte es sich dann, sich Mühe zu geben? Die Einzige, mit der sie darüber reden konnte, war Amelie. Vielleicht wurde die deshalb so von ihrer Mutter abgelehnt. Franziska Doberstein mochte Amelie Bogner nicht. Viele Leute mochten »das Fräulein Bogner« nicht. Allein schon die Art, wie sie »Fräulein« aussprachen, sagte alles. Sabrina war das egal. Amelie war ihre Freundin, seit sie durch Zufall vor zwei Jahren auf dem Neuwieder Weinfest gemeinsam eine Geisterbahn-Gondel bestiegen hatten. Anschließend bekamen sie lebenslanges Mitfahrverbot. Diese Verrückte war während der Fahrt ausgestiegen und hatte eine Gruppe betrunkener Bayern und zwei Sechstklässler zu Tode erschreckt. Sabrina hatte noch nie in ihrem Leben so viel Spaß auf einem Weinfest gehabt, und das ganz ohne Wein.
»Was soll ich denn jetzt machen?« Sie stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus. »Sie hat den Rosenberg für dreißig Jahre gepachtet. Bis dahin bin ich doch scheintot!«
»Das bist du jetzt schon, wenn du so weitermachst.« Amelie setzte sich auf und holte die Sonnenmilch aus ihrer Strandtasche. »Lebe deine Träume! Aber dazu musst du natürlich erst mal welche haben.« Sie rieb sich die Arme und Schultern ein und achtete dabei darauf, dass die Jungs drei Badetücher weiter auch jede ihrer Bewegungen mitbekamen. »Ich habe Ziele. Ich arbeite dafür. Scheiß was auf die Schule. Ich will die Welt sehen! Wenn die Saison vorbei ist, habe ich fast zweitausend Euro auf der hohen Kante. Dann hält mich hier nichts mehr.«
Sabrina seufzte wieder. Ihre Mutter würde nie erlauben, dass sie arbeiten ging. Schon gar nicht in solchen Gelegenheitsjobs, wie Amelie sie hatte.
»Komm mit!«
Die tiefbraunen Augen ihrer Freundin glitzerten vor Abenteuerlust. Doch anders als so viele Male zuvor hatte Sabrina keine Lust, sich von ihr anstecken zu lassen. Ihr Leben kam ihr, verglichen mit dem, das Amelie führte, plötzlich unendlich schwer vor. Es war einfach, allem den Rücken zu kehren, wenn man nichts hatte, für das man sich verantwortlich fühlte.
Wieder spürte Sabrina, dass der Ärger sich in ihr zusammenballte. Ein eigener Weinberg. Noch eine Last, noch eine Verantwortung, die man ihr aufgebürdet hatte, ohne dass man sie überhaupt gefragt hatte. Ich habe das alles nicht mehr ertragen. Ich wusste nicht, was es heißt, eine Winzerin zu heiraten. Das war die Antwort, die ihr Vater ihr vor langer Zeit einmal gegeben hatte, als sie ihn nach den Gründen für sein Weggehen gefragt hatte. Damals konnte sie ihn nicht verstehen und hatte Schuldgefühle, weil sie sich als Teil des Unerträglichen gefühlt hatte. In letzter Zeit telefonierten sie wieder öfter miteinander. Er lebte jetzt in Berlin und war Direktor an einer Gesamtschule. Ihr Halbbruder war mittlerweile fünf.
»Hast du mir nicht zugehört?«
Amelies Frage schreckte sie hoch.
»Pack deine Sachen und komm mit. Wir finden schon einen Job. In zwei Tagen sind wir in Rotterdam. Dann nehmen wir uns ein Schiff nach Buenos Aires. Und dann …«
»Hi Lilly!«
Drei alberne Spätpubertierer schlenderten an Amelies und Sabrinas Badetuch vorbei. Der mittlere blieb kurz stehen. Die beiden anderen platzten beinahe, so lustig fanden sie, dass ihr Anführer sich traute, ein Mädchen anzusprechen. Amelie streifte sie mit einem hochmütigen Blick und drehte sich auf den Rücken.
»Lust auf ein Eis? Oder was anderes?«
Die beiden Jungens, dünn und blass wie Spargel, prusteten los.
»Verschwinde, Michi,« gab Amelie gelangweilt von sich. »Du fällst noch unter den Jugendschutz. Ich will mich doch nicht strafbar machen.«
Michi, der größte von den dreien, war im gleichen Alter wie Sabrina. Andernach war klein, man lief sich immer irgendwo über den Weg. Sabrina hatte das Gefühl, dass sie ihn schon einmal gesehen hatte. Michi ereilte diese Eingebung wohl im gleichen Moment. Er spürte, dass seine Schlappe mehr Zeugen bekam, als er erwartet hatte, und wurde rot bis zum Haaransatz.
»Hey, das war nur nett gemeint. Kein Grund, gleich auszurasten.«
Er reihte sich wieder in die Mitte ein und suchte sich mit seinen Freunden einen Platz außer Sichtweite.
»Was ist denn los mit dir?«, fragte Sabrina. »Das war doch ein netter Versuch.«
Amelie setzte sich wieder auf. »Eben. Und nicht der erste. Warum glaubt eigentlich jeder, ich wäre ein Experimentierkasten? Dich quatscht keiner blöd an.«
Sabrina seufzte. Sie wurde weder blöd noch intelligent, sondern schlicht gar nicht angequatscht.
Amelie schob die Sonnenbrille wieder herunter auf ihre unvergleichliche Nase. Sie war schmal und gerade, genau so, wie ein Klassiker auszusehen hatte. Nicht knubbelig wie eine Waldgnom-Nase, dachte Sabrina verbittert und erinnerte sich an die vielen Male, die sie vorm Spiegel gestanden und versucht hatte, irgendetwas an ihr in Form zu bringen. »Was hast du eigentlich? Ist was mit Lukas?«
Lukas Kreutzfelder, der Sohn des Bimsbarons. Etwas schien zu laufen zwischen den beiden, jedenfalls hatte Amelie verträumt von einigen Treffen berichtet. Das letzte sollte am vergangenen Abend stattgefunden haben. Und es hatte, dem verschlossenen Gesichtsausdruck Amelies nach zu urteilen, nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
»Wie war es denn?«
»Schön«, sagte Amelie. Es klang nach dem genauen Gegenteil.
»Wie schön? Nun sag schon!«
»Er wollte mir an die Wäsche. Aber ich habe keine Lust mehr auf One-Night-Stands. Ich kenne doch das ganze Programm. Erst holen sie dir die Sterne vom Himmel, und wenn sie haben, was sie wollen, siehst du sie nie wieder.« Eine kleine, steile Falte bildete sich auf Amelies Stirn.
Sabrina seufzte. Sie hätte sich so gewünscht, dass Amelie auch einmal Glück in der Liebe gehabt hätte. Tatsächlich waren fast alle nach kurzer Zeit auf und davon gegangen. Vielleicht lag es daran, dass sie sich immer die Falschen ausgesucht hatte. Immer ein bisschen zu laut, immer mit Auto, Geld und einer schnodderigen Lässigkeit, wie sie nur Kerle hatten, für die das Leben ein Freizeitpark mit endlosen Öffnungszeiten war.
»Und deshalb fahre ich jetzt eine andere Strategie.«
»Ah, eine Strategie? Gibt es die?«
»Ja«, antwortete Amelie zufrieden. »Ich schweige wie ein Grab und halte mich zurück. Wenn er was von mir will, muss er schon ein bisschen mehr investieren als eine Flatrate-SMS.«
Sie holte ihr Handy heraus und zeigte Sabrina den Nachrichteneingang.
Sehen wir uns heute Abend?
Warum meldest du dich nicht?
Hey, meine Sonne, wo steckst du?
Amelie schüttelte den Kopf. »Meine Sonne, pfffff. Wo hat er das denn her?«
Vom Fluss her drang ein brüllendes Röhren. Ein Motorboot schoss wie ein Pfeil in die Strommitte, genau dorthin, wo es verboten war. Der Fahrer wendete und ließ eine breite Fontäne Wasser aufspritzen.
Amelie legte die Hand vor die Augen. »Spinner.«
Auch die anderen wurden aufmerksam. Das Boot vollführte einige waghalsige Manöver, bevor es die Krippen entlang das Ufer abfuhr. Der aufdringliche Lärm kam näher. Immer wieder heulte der Motor auf, bis selbst die Letzten hinter den Silberweiden die Hälse reckten. Nur Amelie tat so, als ob sie mit ihrem Handy im Internet surfen würde. Der Lärm brach ab. Sabrina sah, wie der Bootsführer das Ufer absuchte und sein Blick ausgerechnet an dem Hanfbadetuch hängen blieb.
»Amelie!«
Lukas Kreutzfelder. Er trug eine dieser unerträglichen Kombinationen aus rosa Poloshirt zu weißen Jeans. Um die Schultern hatte er einen dünnen Pullover geknotet, was wohl ungeheuer lässig aussehen sollte, aber ziemlich schnöselig wirkte. Er war ein im landläufigen Sinne gut aussehender Mann, einen Tick zu füllig, ein bisschen zu blond, mit einem etwas breit wirkenden Gesicht und hellen, blauen Augen. Dafür war Lukas Kreutzfelder eine der besten Partien Andernachs. Heimlich wünschte sich Sabrina, dass Amelie sich unsterblich in ihn verlieben würde. Dann bliebe sie nämlich, würde bei ihren Eltern aus- und in eine schöne Villa am Hügel einziehen und ihre wilden Träume zu hübschen Urlaubsreisen zähmen, von denen sie auch immer wieder zurückkäme. Lukas wäre genau der Richtige, um ihr Sicherheit zu geben. Auch wenn es ihr schwerfiel, sich ihre quirlige Freundin in den Armen eines Mannes vorzustellen, der rosa Polohemden trug.
Sie gab Amelie einen leichten Schubs. »Dein Mond wartet.«
Amelie warf einen Blick über die Schulter. »Soll er. Dann nimmt er wenigstens irgendwann ab.«
»Hey! Amelie! Kommst du mit?«
Sabrina entging nicht, wie neidisch die Jungs vom Badetuch links zu dem Boot starrten. Es musste ein neues und teures Modell sein. Zumindest kam man damit in zwei Minuten von der einen auf die andere Rheinseite.
»He, nun lass mich doch nicht warten vor allen Leuten. Soll ich vielleicht auf die Knie gehen?« Lukas warf einen Blick auf sein Publikum. »Sie will nicht«, erklärte er überdeutlich betrübt. Alle starrten gespannt zu ihm wie auf den Hauptdarsteller eines aus dem Nichts herbeigezauberten Theaterstücks. »Amelie!«
Endlich bequemte sich die Angesprochene, sich umzudrehen. Betont gelangweilt nahm sie die Sonnenbrille ab. Das Boot schaukelte keine fünf Meter vom Ufer entfernt auf den Wellen. Lukas verbeugte sich und ging dann tatsächlich in die Knie. Die Badegäste applaudierten.
Um Amelies Mundwinkel zuckte ein Lächeln. »Okay. Aber nur eine halbe Stunde. Und Sabrina kommt mit.«
»Nein, geh du nur«, sagte Sabrina. Sie wollte auf keinen Fall stören.
»Kommt gar nicht in Frage.« Amelie stand auf und begann, ihre Sachen zusammenzusuchen.
Schließlich erhob sich auch Sabrina.
»Hi, Sabrina!« Lukas grüßte sie freundlich. Zu ihr war er anders. Höflicher, respektvoller. Wahrscheinlich, weil sein Vater und ihre Mutter im gleichen Winzerverband waren.
Er half ihnen ins Boot. Kaum hatten sie sich gesetzt, brauste er los. Die Gischt durchnässte sie in wenigen Sekunden. Amelie kreischte vor Vergnügen, und als das Boot hinausstob auf den breiten Strom und der Wind Sabrinas Haare zerzauste, hatte sie das Gefühl, dass es doch noch etwas werden könnte mit diesem Tag.
DREI
»Willst du auch mal?«
Lukas drehte sich zu Amelie um. Sie sprang auf und tastete sich über das schwankende Deck nach vorne. Sabrina konnte wegen des lauten Motors nicht verstehen, was er sagte, aber vermutlich erklärte er ihr, wie alles funktionierte. Amelie hatte keinen Bootsführerschein, trotzdem ließ er sie ans Steuer.
Sei doch nicht immer so spießig, schimpfte Sabrina im Stillen mit sich selbst. Es wird schon nichts passieren. Lukas wird schon darauf achten, das Ding ist ja teuer genug.
In diesem Moment machte das Boot einen gewaltigen Satz nach vorne. Sabrina musste sich an der Reling festhalten und hatte in den nächsten Minuten ständig das Gefühl, gleich von Deck gefegt zu werden. Amelie legte den Kopf in den Nacken und lachte. Für sie war das alles ein Riesenspaß. Sie gab noch einmal Gas und wie ein Pfeil schossen sie flussaufwärts. Lukas stand hinter Amelie. Seine Hand wanderte ihren Rücken hinunter bis zu ihrer Bikinihose. Amelie schüttelte sich unwillig, das Boot machte einen gewaltigen Schlenker. Lukas behielt seine Hand ab jetzt bei sich.
Sie hat recht, dachte Sabrina. Er ist es nicht. Er ist auch nur einer von denen, die ein bisschen Spaß haben wollen, bevor sie sich eine Frau suchen, die ihre rosa Polohemden bügelt. Er musste jetzt Anfang zwanzig sein, studierte in Koblenz und würde irgendwann den Betrieb seines Vaters übernehmen. Auch so ein vorgeschriebener Lebenslauf. Aber im Gegensatz zu Sabrina schien Lukas absolut damit einverstanden zu sein. Sie fühlte sich immer noch hintergangen und manipuliert, wenn sie an ihr Geburtstagsgeschenk dachte. Vor ihren Augen mutierte der zufriedene Lukas zum idealen Feindbild. Erstes Auto zum Abi, hübsches Boot von Papa, und den Weinberg haben sie sowieso nur zum Angeben, dachte sie. Immer wenn es ans Arbeiten ging, krochen Polen und Tschechen den Steilhang hoch. Die Kreutzfelders selbst hatte sie jedenfalls noch nie in Latzhosen gesehen.
Amelie drückte das Gaspedal durch. Lukas wurde nervös. Vor ihnen tauchte die Maxima auf, das gewaltige, 160 Meter lange Containerschiff, auf dem die Ladung wie riesige, eiserne Bauklötze aufeinandergestapelt war. Vom Wasser aus wirkte es fast noch eindrucksvoller als vom Land. Im Steuerhaus konnte Sabrina einen Mann erkennen. Ein anderer, offenbar ein Leichtmatrose, hangelte gerade backbord die Reling entlang und spritzte dabei mit einem Schlauch Wasser auf die schmale Schanzung.
»Wo ist die Hupe?«, rief Amelie aufgeregt.
»Hey, lass das!«
»Sag schon! Die Hupe! Oder das Horn, oder wie heißt das Ding denn?«
Amelie drückte auf alle erreichbaren Knöpfe. Ein heller Ton erklang, der im Vergleich zu einem so großen Pott wie der Maxima eher ein empörtes Quieken war. Amelie drosselte das Tempo, um nicht auf das Heck des Containerschiffes aufzufahren, das sich wie eine riesige, eisengraue Wand vor ihnen aus dem Wasser hob. Sie hupte wieder, aber der Einzige, der reagierte, war der Leichtmatrose. Er zeigte ihr einen Vogel und machte ziemlich obszöne Handbewegungen, die letztendlich den Schluss nahelegten, sich so schnell wie möglich aus der Nähe der Schiffsschraube zu verdrücken.
»Lass mich jetzt wieder.«
Lukas wollte den Steuerknüppel übernehmen, doch Amelie ließ das nicht zu. Sie schob ihn weg, gab Gas und schoss links an der Bordwand vorbei direkt in die Mitte der Fahrrinne. Sabrina konnte sich gerade noch das Spritzwasser aus den Augen wischen, als sie erkannte, auf was sie da gerade zurasten. Ein großer Tanker kam ihnen entgegen. Augenblicklich ging Amelie vom Gas, doch es war zu spät. Das Boot lag direkt auf Kollisionskurs.
»Weg da!«
Lukas gab Amelie einen Stoß und sprang ans Steuer. In letzter Sekunde bekam er das Boot in den Griff, rechts rauschte die Maxima vorbei, links der Tanker, in der Mitte ihre winzig kleine Nussschale, hin- und hergeworfen von den aufspritzenden Wellen. Die Bordwände der gewaltigen Transportschiffe hätte Sabrina mit ausgestrecktem Arm berühren können. Lukas’ Boot konnte jeden Moment an eine der beiden Stahlwände krachen. Die Motoren der gewaltigen Maschinen zerrissen Sabrina fast das Trommelfell. Das Horn des Tankers dröhnte dazu so laut, dass sogar noch Sabrinas Magen zitterte. Hundert Meter dauerte der Höllenritt, eingezwängt zwischen den beiden riesigen Schiffen, dann war der Tanker vorbei und der Weg steuerbord frei. Lukas riss das Boot nach links und geriet in die gewaltige Bugwelle der Maxima. Es war wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Sabrina, die von der Seekrankheit bis jetzt verschont geblieben war, wurde schlecht wie noch nie in ihrem Leben. Der Schiffer sandte ihnen noch einen bösen Gruß mit seinem Schiffshorn nach, dann erreichten sie das seichte Ufer, der Motor ging aus, und Lukas ließ sich aufatmend in den Sitz zurücksinken.
Zitternd kam Sabrina auf die Beine. Sie war klitschnass. Ihre Zähne klapperten und ihr Magen rebellierte. Lukas stierte vor sich hin, Amelie kauerte auf dem Boden neben ihm und hatte zum ersten Mal, seit Sabrina sie kannte, einen sehr kleinlauten Gesichtsausdruck.
»Mannomann«, stieß Sabrina aus. Sie beugte sich nach vorne über die Reling, um sich im Falle eines Falles nicht auch noch auf den teuren Walnussboden zu übergeben. »Habt ihr sie noch alle?«
Jedes Kind wusste, dass die Mitte der Fahrrinne ausschließlich für den Schwerlastverkehr reserviert war. Was sie gerade gemacht hatten, war ähnlich witzig wie mit einem Rad in entgegengesetzter Richtung auf der Autobahn herumzugondeln. Wäre die Wasserschutzpolizei in der Nähe gewesen, wäre das Lukas’ vorerst letzter Bootsausflug gewesen. Ganz zu schweigen von den Folgen, wenn es tatsächlich zu einer Kollision gekommen wäre.
Aber Amelie hatte schon wieder ganz andere Sorgen. Sie kramte in ihrer Badetasche, holte einen Spiegel heraus und musterte sich kritisch. »Gott sei dank ist meine Wimperntusche wasserfest. Wow, das war doch mal was! Findet ihr nicht?« Sie sprang auf und reckte sich. »Das Ding macht ja richtig Fahrt. Darf ich jetzt wieder?«
»Nein. Nicht jetzt.«
Lukas ließ den Motor an und gab im Leerlauf ein paar Mal Gas. Alles funktionierte. Nichts war passiert. Außer den Schrecksekunden da draußen, die Sabrina in ihrer Todesangst wie Stunden vorgekommen war.
»Der Tank ist fast leer. Rennfahren verbraucht zu viel Sprit.«
Amelie verzog den Mund. »Schade. Dann ein anderes Mal?«
»Heute Abend?« Lukas war wohl gerade auf die Idee gekommen, die eine Gunst mit der anderen zu erkaufen.
»Ich muss arbeiten.«
»Ich hol dich ab.«
»Das kann aber spät werden.«
»Besser spät als nie.«
Er stand auf und versuchte, Amelie in den Arm zu nehmen, was diese halbherzig gestattete. Sabrina drehte sich weg. Sollten sie von ihr aus knutschen ohne Ende, ihr war kalt. Die Übelkeit war fast vorbei, aber sie lagen im Schatten des steilen Ufers, und ein kühler Wind strich über das Wasser. Weit oben, auf hässlichen Betonstelzen, führte die B9 nach Mayen und Köln. Sie konnte den Lärm der vorüberrasenden Autos bis hier unten hören. Dichtes Gestrüpp wucherte bis ans Wasser. Sie waren flussaufwärts, fast an der Spitze der Namedyer Halbinsel, gelandet. Mitten im Naturschutzgebiet.
Sabrina hielt Ausschau, ob sie von jemandem entdeckt werden konnten, doch sie waren die einzigen Menschen weit und breit. Ein paar Meter weiter verschwand der stille Seitenarm des Rheins hinter den Bäumen. Wie nannten ihn die Leute noch mal? Er hatte einen komischen Namen. Irgendetwas war dort passiert, etwas Schlimmes, das sich herumgesprochen hatte. Ein paar Jahre musste das her sein. Sabrina erinnerte sich an Blaulicht und langsam vorbeifahrende Polizeiwagen. Über Leutesdorf und Andernach hatte plötzlich etwas Böses seine Flügel ausgebreitet, das sich wie ein dunkler Schleier über die Fröhlichkeit dieses Sommers gelegt hatte. Kaum einer lachte. Auf dem Markt standen sie zusammen, schauten über ihre Schultern und flüsterten dann miteinander. Eltern holten ihre Kinder von der Schule ab. Die Spielplätze waren verwaist, die Straßen nachts verlassen. Ihr Vater hatte noch bei ihnen gelebt, und eines Abends, als sie nicht schlafen konnte, war sie hinuntergeschlichen bis zur Küchentür.
Es war einer von hier, hatte ihr Vater gesagt. Hoffentlich finden sie das Schwein.
Sabrina konnte sich nicht erinnern, um was es gegangen war. Ein Schwein war offenbar gestohlen worden, das hatte sie sich in ihrer kindlichen Fantasie zusammengereimt. Sie hatte ihre Mutter danach gefragt, und die hatte den Diebstahl bestätigt - erleichtert, wie es Sabrina schien, dass sie ihrer Tochter eine Erklärung geben konnte. Später war Sabrina zwar schon klar gewesen, dass es bei all dem nicht nur um ein Schwein gegangen sein konnte. Aber irgendwann hatten die Leute aufgehört zu flüstern. Sie durfte wieder alleine zur Schule gehen und auf den Spielplätzen lachten und schrien die Kinder. Es war, als ob die Sonne nach einem langen Regen die Wolken vertrieben hätte. Fragte noch jemand, woher die Wolken gekommen waren? Wohin sie zogen? Die Erinnerung verblasste, und alles, was blieb, war ein Name.
Der tote Fluss.
Plötzlich war ihr, als ob eine kalte Hand über ihren Nacken streifte. Sie fröstelte und schaute wieder nach den beiden anderen, die immer noch miteinander herumkasperten.
»Lass das!«
Amelie klang ziemlich genervt. Lukas hing an ihrem Hals und wollte sie küssen.
»Ich hab gesagt, du sollst das lassen!«
Aber er hörte nicht auf.
Sabrina fand, dass Amelie ihm klar und deutlich gesagt hatte, was sie wollte und was nicht. Sie räusperte sich, dann streckte sie den Arm zum Ufer aus. »Schaut mal! Das ist ja komisch.«
Lukas Aufmerksamkeit war abgelenkt, Amelie schlüpfte aus seiner Umklammerung und stellte sich neben Sabrina.
»Da vorne. Sieht aus, als ob einer mit einem Mähdrescher übers Wasser gefahren wäre.«
Die Büsche links und rechts der Einmündung des Seitenarms waren ziemlich zerrupft. Sogar ein Teil der Böschung war in Mitleidenschaft gezogen. Etwas sehr Breites musste sich durch diesen engen Zugang übers Wasser geschoben haben.
»Oh-oh.« Amelie runzelte die Stirn. »Ist ja krass. Das wird unserem Ranger gar nicht gefallen.«
Der Ranger war der Chef des Naturschutzgebietes und er nahm seine Arbeit ziemlich ernst. Sabrina kannte ihn vom Sehen, wenn er den Touristen auf streng abgegrenzten Pfaden den Weg zum Geysir zeigte, der nicht weit von hier fast hundertsechzig Meter hoch aus der Erde schoss. Es war die älteste und zugleich die neueste Attraktion von Andernach, denn nachdem man den Sprudel aus der Eiszeit vor über dreißig Jahren zubetoniert hatte, war man im letzten Jahr darauf gekommen, ihn doch wieder aus seinem vulkanischen Gefängnis zu befreien. Seitdem erfreuten sich unzählige Schulklassen und Tagestouristen an der schwefeligen Brühe.
Amelie drehte sich zu Lukas um. »Du bist auch ziemlich nah am Ufer. Pass auf, dass du nicht noch einen Strafzettel bekommst.«
»Was kann denn das gewesen sein?«, fragte Sabrina.
»Die Bestie von Andernach«, antwortete Amelie kichernd. »Vielleicht kommt zu unserem Urzeit-Geysir auch noch ein Dinosaurier?«
Lukas warf den Motor an und wendete das Boot. Amelie und Sabrina setzten sich auf die Rückbank. Der Fahrtwind war so kalt, dass Sabrina wieder anfing zu zittern.
Amelie legte ihr den Arm um die Schulter. »Du kommst mit zu mir nach Hause und ziehst dir was Trockenes an.«
Eng aneinandergeschmiegt erreichten sie den verwaisten Fähranleger. Lukas half ihr von Bord.
»Danke«, sagte Sabrina.
»Bitte sehr. Grüß deine Mutter. Hab gehört, ihr habt jetzt den Weinberg. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute damit.«
Wieder wunderte sich Sabrina, wie höflich und zuvorkommend er sein konnte.
Amelies Arm dagegen hielt er fest. »Also was ist nun mit heute Abend?«
»Weiß ich noch nicht«, antwortete sie.
Jeder andere hätte das genau so verstanden, wie es gemeint war: als eine Absage. Aber Lukas war eben nicht wie alle anderen.
»Dann bis später«, sagte er, stieg zurück in sein Boot und brauste davon.
»Er kapiert es nicht«, sagte Amelie und sah ihm hinterher. »Er kapiert es einfach nicht.«
VIER
Amelies Eltern wohnten im Waldviertel von Andernach, in das sich selten Touristen verirrten. Mehrstöckige, nicht mehr ganz taufrische Mietshäuser prägten das Bild. Dazwischen verdorrten lieblos angelegte Vorgärten, durch die Hunde und Kinder streunten. Die Fürsorge ihnen gegenüber wurde auch genau in dieser Reihenfolge erteilt. An der Ecke befand sich ein Wirtshaus, »Zur Sonne«, aber Sabrina bezweifelte, dass durch die braunen Butzenscheiben und die vergilbten Gardinen jemals auch nur ein Lichtstrahl nach innen gedrungen war. Die Tür stand offen, und an Amelies schnellem Schritt merkte sie, dass sie so schnell wie möglich vorbei wollte, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Ihr Vater saß oft schon ab mittags am Tresen.
Amelies Eltern waren nette, aber irgendwie hilflose Leute. Ihr Vater, Wilfried Bogner, war ein schmächtiger Mann mit unruhigen Augen in einem raubvogelhaften Gesicht. Er hatte eine Vorliebe für verschossene Unterhemden und war schon seit Jahren arbeitslos. Immer wenn Sabrina ihn traf, versuchte er sich dafür zu rechtfertigen und fand dabei eine Menge Gründe, warum es mit ihm und gleichzeitig auch mit diesem Land so schieflief, denn beides hing für ihn irgendwie zusammen. Mal waren es die Polen, die den Deutschen die Arbeitsplätze wegnahmen, mal »die da oben«, die sich immer nur die Taschen vollstopften, dann wieder die Bimsbarone auf dem Martinsberg, für die der Tagebau nicht mehr lukrativ genug war, weshalb im Hafen kaum noch Schiffe lagen. Früher hatte er dort gearbeitet, aber auch wenn er sich gerne als ehemaliger Hafenmeister sah - so weit hatte er es nie gebracht.
Amelies Mutter Wanda war unglaublich dick. Sogar ihre Finger sahen aus wie rosige Würstchen. Alles an ihr war rund und prall wie ein zum Platzen aufgeblasener Luftballon. Die einzige Ähnlichkeit mit ihrer Tochter bestand darin, dass sie die gleichen lockigen Haare hatte. Im Gegensatz zu Amelie, die ihre Mähne sorgfältig hegte, pflegte und auf Überschulterlänge gezüchtet hatte, waren die Haare ihrer Mutter aber kurz und merkwürdig strubbelig. Sabrina glaubte, dass sie sie selbst schnitt, denn Wanda Bogner verließ die Wohnung so gut wie gar nicht. Sie saß schon am frühen Vormittag vor dem Fernseher, ein rosiger, sacht wogender Berg, der alles Wichtige in greifbarer Nähe um sich herum geschichtet hatte. Das Allerwichtigste war die Fernbedienung. Wanda ließ sich von Wiederholungen, Mittagsmagazinen, Gerichtssoaps und Gewinnspielen durch den Tag treiben, schaffte es aber immer auf geheimnisvollen Wegen, genug Essbares im Haus zu haben.
Auch an diesem Tag empfing die beiden Mädchen das hysterische Geschrei eines inszenierten Rechtsstreits schon in dem Moment, in dem sie die kleine Drei-Zimmer-Wohnung betraten.
»Sabrina ist da!«, rief Amelie, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten.
Wanda saß im Wohnzimmer, das viel zu klein war für die Polstersitzgruppe und die schwere Anbauwand aus besseren Zeiten. Ein riesiger Bildschirm verzerrte das Gesicht einer jungen Frau, die tränenüberströmt ein Geständnis ablegte, das von dem aufgestachelten Publikum im Gerichtssaal mit niederträchtigem Zischen und Zwischenrufen unterbrochen wurde.
Wanda griff zur Fernbedienung und stellte den Ton leiser. Sie schnaufte ein bisschen wegen der Anstrengung, strahlte aber über ihr ganzes, rundes Gesicht. »Hallo, meine Süße. Sabrina! Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Wie geht es dir?«
»Danke, gut. Endlich Ferien.«
»Wollt ihr was essen? Ich mach euch schnell was.«
Wanda machte Anstalten, sich aus dem Sessel zu wuchten, aber Amelie schüttelte den Kopf. »Nein, wir ziehen nur schnell andere Klamotten an. Wir waren mit Lukas und seinem Boot unterwegs und sind nass bis auf die Knochen.«
»Ah, Lukas.« Wandas kleine Augen strahlten und verrieten, was sie von der Bekanntschaft ihrer Tochter mit einem Sohn aus bester Familie hielt. Aber sie fragte nicht weiter, denn Amelie war schon aus dem Zimmer geschlüpft.
Sabrina folgte ihr und fragte sich wieder einmal, welches von Wandas Problemen wohl zuerst da gewesen war: das Fernsehen oder ihr Gewicht. Beides hatte jedenfalls miteinander zu tun.
Doch sie behielt ihre Gedanken für sich. Amelie sprach nicht darüber. Sabrina war die Einzige, die sie ab und zu auch einmal zu Hause besuchte. Sabrina hatte den Verdacht, dass Amelie nicht sehr stolz auf ihre Eltern war. Das führte dazu, dass Sabrina immer, wenn sie aus dem Waldviertel zurück nach Leutesdorf kam, das Gefühl hatte, in eine trotz Scheidung heile Welt zu kommen. Sie gab Franziska dann einen besonders schallenden Kuss und spürte, dass es wenige Dinge gab, die wirklich wichtig waren. Sich seiner Eltern nicht zu schämen, war eines davon.
Amelie hakte das Bikinioberteil auf, zog es aus und wühlte in ihrem Kleiderschrank herum. »Das hier?«
Die beiden Mädchen waren trotz des Altersunterschiedes gleich groß. Aber Sabrina hatte eine schlanke, sportliche Figur und zu ihrem heimlichen Kummer nichts, was auch nur annähernd die Anschaffung eines BHs in Körbchengröße B berechtigt hätte. Amelie hingegen war sehr weiblich und hatte einen wunderschönen, vollen Busen, den sie gerne mit tief ausgeschnittenen, eng anliegenden Kleidern betonte.
»Geht gar nicht«, antwortete Sabrina. Sie würde aussehen, als hätte sie zwei leere Einkaufstüten vor der Brust.
Mit einem Schulterzucken hängte Amelie das Kleid wieder auf die Stange. »Ach, guck mal. Aus dem bin ich raus.« Sie hielt Sabrina ein gewagtes Oberteil in Hibiscusrot entgegen.
Die nahm es mit spitzen Fingern vom Bügel und hielt es hoch. »Das geht auch nicht. Ich hab doch nichts, was da reinpasst.«
»Probier es einfach mal an. Hier, die Jeans. Mit einem Gürtel müsste sie dir passen.« Sie warf die Hose auf ihr Bett und wühlte gleich wieder im Schrank herum, um für sich selbst etwas Passendes zu finden.
Sabrina zog die feuchten Sachen aus und legte sie über die Lehne eines Stuhls, der vor einem unaufgeräumten Schreibtisch am Fenster stand.
Amelies Zimmer war cool. Zumindest kannte Sabrina niemanden, dem man ein solches Chaos hätte durchgehen lassen. Die Wände waren über und über mit Postern behängt. Meist waren es Heavy-Metal-Gruppen oder Filmstars wie Heath Ledger und Johnny Depp in gruseliger Aufmachung. Auf dem Boden neben dem Bett stapelten sich Zeitschriften und auf dem Kleiderschrank hockte ein zerrupfter Teddybär. Sabrina hatte Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was ein Lukas Kreutzfelder zu diesem Stil sagen würde. Aber dank Amelies »Strategie« schien Lukas derart Feuer gefangen zu haben, dass ihm auch das wohl egal wäre.
»Seht ihr euch nun heute Abend oder nicht?«
Amelie warf ein weiteres, in Frage kommendes Outfit zu den anderen aufs Bett. »Ich weiß nicht. Er ist nett. Aber …« Nachdenklich setzte sie sich neben den Kleiderhaufen. »Er hat mir richtig weg getan.« Sie deutete auf einen kleinen blauen Fleck an ihrem Oberarm.
»Er wollte dich nur daran hindern, mit siebzig Sachen in ein Containerschiff reinzukrachen.«
»Ja, ich weiß. Aber mit dir hätte er das nicht gemacht.«
Sabrina zog gerade die Jeans an und hopste auf einem Bein auf ihre Freundin zu. »Wie, mit mir nicht?« Sie setzte sich zu Amelie. »Mich hätte er wahrscheinlich direkt über Bord geworfen. - Die ist übrigens zwei Nummern zu groß.«
»Zu dir ist er anders.«
»Quatsch. Weil er in dich verknallt ist und nicht in mich.«
»Nein. Du bist … aus einer anderen Familie.«
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
1. Auflage 2010
© 2010 cbt/cbj Verlag, München
Alle Rechte vorbehalten Gedicht auf S. 114/115: Charles Bukowski: Layover; zitiert nach: Run With the Hunted. A Charles Bukowski Reader. edited by John Martin. © HarperCollins Publishers: New York 1993 Umschlagfoto: © corbis, Bettmann / shutterstock, crystalfoto SK · Herstellung: AnG
eISBN : 978-3-641-03859-5
www.cbt-jugendbuch.de
Leseprobe
www.randomhouse.de