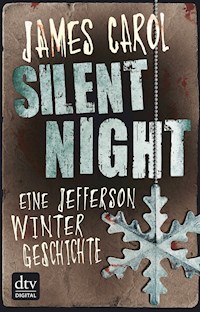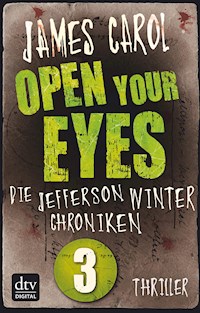7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Jefferson Winter-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der erste Fall für Jefferson Winter Er ist kein gewöhnlicher Ermittler. Jefferson Winter ist Profiler. Und der Sohn eines berüchtigten amerikanischen Serienmörders. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, grausame Täter wie seinen Vater zur Strecke zu bringen. Doch manchmal fragt er sich, ob er etwas von dessen dunkler Seite geerbt hat. Ob das der Grund dafür ist, dass er sich so gut in sadistische Mörder hineinversetzen kann … Für einen besonders verstörenden Fall wird er nach England gerufen: Bereits vier junge Frauen sind einem perfiden Täter in die Hände gefallen, der seine Opfer nicht tötet, sondern ihnen einen Teil des Gehirns entfernt – womit er ihr Leben faktisch vernichtet. Jetzt ist eine fünfte Frau verschwunden. Jefferson muss und wird alles daransetzen, den Täter zu finden, bevor auch ihre Seele zerstört wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
James Carol
BROKEN DOLLS
Er tötet ihre Seelen
Thriller
Deutsch von Wolfram Ströle
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Karen, Niamh und Finn.
Ich liebe euch.
Prolog
Als ich meinen Vater das letzte Mal lebend sah, lag er angeschnallt auf einer gepolsterten Gefängnisliege, die Arme seitlich ausgestreckt, als sollte er gekreuzigt werden. Die Berufungsmöglichkeiten waren ausgeschöpft, eine Aussetzung der Hinrichtung in letzter Minute war nicht zu erwarten. In seinen beiden Armen steckten Katheter, an denen bereits die Injektionsschläuche hingen. Für den Vollzug reichte einer, der zweite diente nur als Reserve. Ein Monitor zählte seine letzten Herzschläge, entspannte fünfundsiebzig pro Minute trotz der Umstände.
Im Zuschauerraum warteten ein paar Dutzend Zeugen. Eltern der Opfer, Gefängnisbedienstete, ein Mann in einem nüchternen Anzug als Vertreter des Gouverneurs von Kalifornien. Kleider raschelten, man machte es sich für das große Ereignis bequem, doch ich nahm das nur am Rand wahr.
Mein Vater sah mich durch die dicke Plexiglasscheibe an, sein Blick durchbohrte mich. Wir waren in diesem Augenblick nur zu zweit. Ich starrte zurück und fragte mich, was ihm durch den Kopf ging. Ich hatte genug Psychopathen kennengelernt und untersucht, um zu wissen, dass ihm nichts leidtat, dass er unfähig war, Reue für seine Verbrechen zu zeigen.
Mein Vater hatte über einen Zeitraum von zwölf Jahren fünfzehn junge Frauen ermordet. Er hatte sie entführt, in die hügeligen Wälder Oregons gebracht, dort freigelassen und mit einem Hochleistungsgewehr niedergestreckt, ohne eine Spur von Mitgefühl. Für ihn waren diese jungen Frauen Spielzeug.
Ich erwiderte seinen Blick und hielt ihn. Seine Augen leuchteten grün, mit einem Kranz goldgelber Sprenkel um die Pupillen. Sie sahen genauso aus wie meine, eins der vielen genetischen Merkmale, die wir teilen. Ihn anzusehen war, als würde ich in einen langen, dunklen Tunnel blicken, der in meine Zukunft mündete. Wir waren beide einen Meter sechsundsiebzig groß und schlank und tranken zu viel Kaffee, und wir hatten beide infolge eines Gendefekts irgendeines Vorfahren schneeweiße Haare. Ich habe sie mit Anfang zwanzig bekommen, mein Vater noch früher.
Dass er so viele Jahre morden konnte, hatte vor allem drei Gründe. Erstens war er seinen Verfolgern aufgrund seiner Intelligenz immer einen Schritt voraus. Zweitens hatte er eins dieser Gesichter, die man sofort wieder vergisst, die in der Menge untergehen. Drittens hatte er sich die Haare gefärbt. Ein Durchschnittsgesicht nützte einem ja nichts, wenn man an den Haaren sofort erkannt wurde.
Ein Lächeln zuckte um seinen Mund und verschwand sofort wieder. Ein grausames, brutales Lächeln. Stumm formten seine Lippen vier Worte, und ich erstarrte. Die vier Worte trafen direkt auf eine Stelle tief in mir, die ich gut versteckt hielt, sogar vor mir selbst. Er muss gesehen haben, dass sich etwas in meinem Gesicht veränderte, denn er feuerte noch ein kurzes sarkastisches Lächeln in meine Richtung ab. Dann schloss er die Augen.
Der Gefängnisdirektor fragte nach letzten Worten, aber mein Vater ignorierte ihn. Der Direktor wiederholte die Frage, ließ meinem Vater fast eine ganze Minute Zeit für eine Antwort und gab dann, als keine kam, das Zeichen zum Vollzug der Hinrichtung.
Zuerst wurde Pentobarbital durch den Katheter gepumpt, ein rasch wirkendes Betäubungsmittel, das meinen Vater innerhalb von Sekunden bewusstlos machte. Als Nächstes bekam er eine Dosis Pancuroniumbromid, die seine Atemmuskulatur lähmte. Zuletzt folgte Kaliumchlorid, das sein Herz zum Stillstand brachte. Sechs Minuten und dreiundzwanzig Sekunden später wurde mein Vater für tot erklärt.
Hinter mir schluchzte die Mutter eines Opfers laut auf und wurde von ihrem Mann getröstet. Sie hatte den glasigen Blick derer, die zur Selbsthilfe mit Medikamenten greifen. Mit ihrer chemisch herbeigeführten Lethargie war sie nicht die Einzige, wie ein flüchtiger Blick durch den Zuschauerraum bestätigte. Das schwere, leidvolle Erbe, das mein Vater hinterließ, würde noch lange nachwirken, weit über seinen Tod hinaus. Der Vater eines anderen Opfers sagte leise, er sei zu leicht davongekommen, ein Gefühl, das von den meisten Anwesenden geteilt wurde. Ich hatte die Tatortbilder gesehen und die Obduktionsberichte gelesen und konnte ihnen nicht widersprechen. Die fünfzehn jungen Frauen waren einen langsamen, qualvollen Tod gestorben, der das genaue Gegenteil vom Tod meines Vaters war.
Ich ging mit den anderen nach draußen und machte mich auf den Weg zum Parkplatz. Eine Weile saß ich reglos in meinem Mietwagen, den Schlüssel schon im Zündschloss, und kämpfte gegen den Nebel in meinem Kopf an. Die vier Worte, die mein Vater mit den Lippen geformt hatte, wiederholten sich wie in einer Endlosschleife. Ich wusste, dass es nicht stimmte, dass er mich damit nur fertigmachen wollte. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Worte vielleicht doch einen Funken Wahrheit enthielten. Aber wenn es so war: Wozu machte mich das? Wir bauen unser Leben auf Bruchlinien und Treibsand auf, und mein Vater hatte mein Leben in seinen letzten Momenten mit einem Erdbeben der Stärke neun erschüttert und alles zerstört, was ich bis dahin für wahr und richtig gehalten hatte.
Ich ließ den Motor an, legte den Gang ein und fuhr in Richtung Flughafen. Mein Flug nach Washington D.C. ging erst um halb sieben am nächsten Morgen, aber ich verpasste ihn trotzdem. Ich fuhr einfach an der Abzweigung zum Flughafen vorbei und weiter, die ganze Strecke bis nach Virginia. Grund zur Eile bestand nicht, in Quantico wurde ich erst in der Woche darauf zurückerwartet. Aber ich wollte nur noch weg, so schnell wie möglich raus aus Kalifornien, und in Bewegung bleiben.
Ich wollte mir die alptraumhafte Monotonie einer Abflughalle ersparen, die Minuten, die sich zu Stunden hinzogen, die Stunden, die zu Tagen, und die Tage, die zu Jahren wurden. Zumindest redete ich mir das ein, während die Tachonadel höherkroch. Und es stimmte ja auch, selbst wenn es Teil einer größeren Wahrheit war, die darin bestand, dass ich vor den letzten Worten meines Vaters floh. Das Problem war nur, dass ich ihnen nicht entkommen konnte, egal, wie weit oder wie schnell ich fuhr.
Noch heute, fast anderthalb Jahre später, verfolgen sie mich und drängen sich in mein Bewusstsein, wenn ich am wenigsten damit rechne. In der Erinnerung höre ich sie inzwischen in dem breiten kalifornischen Akzent meines Vaters, in derselben leutseligen Stimme, mit der er seine Opfer um den Finger wickelte. Ich höre sie so deutlich, als würde er neben mir sitzen.
Du bist wie ich.
1
Die Frau in dem Krankenhausbett hätte tot sein können. Es wäre besser für sie gewesen. Dass sie lebte, war nur am beharrlichen Piepen des Herzmonitors und am sachten Heben und Senken der Bettdecke zu erkennen. Ihr Gesicht zeigte keinerlei Regung, aber es war nicht entspannt wie bei einer Schlafenden, sondern mehr wie bei einer Toten, so als wären alle Gesichtsmuskeln dauerhaft abgeschaltet worden. Vor mir hätte genauso gut eine Leiche auf einem Seziertisch liegen können. Ein Teil von mir wünschte, es wäre so.
Detective Inspector Mark Hatcher blickte starr auf die Frau hinunter und murmelte: »Mein Gott.« Dann schüttelte er den Kopf und seufzte, kleine Gesten, die Bände sprachen. Ich hatte Hatcher auf einem Profiling-Seminar kennengelernt, das ich in Quantico für Polizisten aus Übersee gehalten hatte. Er war mir aufgefallen, weil er in absolut jedem Vortrag in der ersten Reihe gesessen und unablässig Fragen gestellt hatte. Ich hatte ihn damals gemocht und tat es immer noch. Er gehörte zu den besten Beamten von Scotland Yard. Wer dreißig Jahre lang in Nietzsches Abgrund geblickt hatte und trotzdem noch etwas fühlte, hatte meinen Respekt.
Aber die Jahre hatten ihren Tribut gefordert. Sie hatten alle Farbe aus ihm herausgesogen, alle Lebensfreude. Seine Haare waren grau, seine Haut ebenfalls. Dasselbe galt für seine Lebenseinstellung. Er hatte diesen speziellen Zynismus, wie man ihn nur bei Polizisten findet, die schon zu lange im Beruf sind. Sein trauriger Hundeblick sagte alles. Seine Augen hatten mehr gesehen, als für einen Menschen gut ist.
»Patricia Maynard ist also das vierte Opfer, richtig?« Eine rhetorische Frage, die aber gestellt werden musste, um Hatcher ins Zimmer zurückzuholen.
»Ja.« Hatcher gab einen langen, müden Seufzer von sich und schüttelte noch einmal den Kopf. Dann sah er mich an. »Seit sechzehn Monaten bin ich hinter diesem Dreckskerl her, und soll ich Ihnen mal was sagen? Wir sind nicht näher an ihm dran als am Anfang. Es ist wie beim Leiterspiel, nur dass jemand die ganzen Leitern geklaut hat und auf jedem zweiten Spielfeld eine Rutsche nach unten ist.« Wieder ein Seufzer und ein Kopfschütteln. »Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, Winter, aber das … ist etwas Neues.«
Was eine Untertreibung war. Serientäter denken sich Gräuel ohne Ende aus, aber trotz all meiner Erfahrung musste ich zugeben, dass selbst ich so etwas noch nicht gesehen hatte. Es gibt Dinge, die schlimmer sind als der Tod, dafür war Patricia Maynard der lebende Beweis.
Ich sah sie an, wie sie da in diesem Zimmerchen lag, in dem man Platzangst kriegen konnte, angeschlossen an all die Apparate und mit einem Infusionsschlauch in dem Katheter an ihrem Handrücken, und dachte wieder, dass sie tot besser dran wäre. Ich wusste auch, wie ich ihr dazu verhelfen könnte. Ich brauchte nur den Schlauch herauszuziehen und mit einer Spritze Luft in den Katheter zu drücken.
Die Luftblase wandert zuerst in die rechte Herzhälfte und von dort in die Lunge. Die Blutgefäße der Lunge ziehen sich zusammen, und der Druck in der rechten Herzhälfte steigt, bis die Embolie in die linke Hälfte gedrückt wird. Von dort hat sie durch den Blutkreislauf Zugang zum restlichen Körper. Wenn sie sich in einer Koronararterie festsetzt, löst sie einen Herzinfarkt aus; wenn sie ins Gehirn hinaufwandert, einen Schlaganfall.
Eine einfache, saubere Lösung. Solange nicht jemand ganz genau hinschaute, bestand kaum ein Risiko, dafür ins Gefängnis zu wandern. Und so genau würde niemand hinschauen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Menschen meist nur das sehen, was sie sehen wollen. Patricia Maynard hatte die letzten dreieinhalb Monate in einem Gefängnis verbracht und die Hölle durchgemacht. Und wenn sie jetzt starb? Dann wollten wir doch alle glauben, dass ihr Körper endlich aufgegeben hatte, fertig, aus. Fall abgeschlossen.
»DNA?«, fragte ich.
»Reicht für eine Verbindung zu den anderen drei Frauen, aber kein Treffer in unserer Datenbank.«
»Neue Erkenntnisse zu unserem unbekannten Tätersubjekt?«
»Unserem unbekannten Tätersubjekt«, wiederholte Hatcher. »Das klingt ja wie im Fernsehen.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, nichts.«
»Wir haben also vier Opfer, die uns nichts mehr sagen werden, und absolut keine Ahnung, wer der Täter ist.«
»So kann man es zusammenfassen«, sagte Hatcher. »Wir müssen ihn kriegen, bevor er sich ein neues Opfer sucht.«
»Das schaffen wir nicht. Zwischen der Freilassung des ersten Opfers und der nächsten Entführung vergingen zwei Monate. Zwischen der Freilassung des dritten Opfers und Patricia Maynards Entführung lagen nur noch drei Tage. Für gewöhnlich gibt es eine emotionale Abkühlphase, in der die Fantasien des Täters noch so stark sind, dass er nicht erneut zuschlägt. In unserem Fall haben sie diese Wirkung verloren. Sie sind kein ausreichender Ersatz mehr für die Tat, und der Täter hat sich schon zu sehr an die Tat gewöhnt. Er hat sich nicht mehr in der Hand. Da Patricia Maynard vorgestern Abend gefunden wurde, vermute ich, dass er sein nächstes Opfer schon heute Abend entführt.«
»Genau das, was ich brauche, noch eine schlechte Nachricht.« Hatcher seufzte wieder und rieb sich das müde Gesicht. »Und was wäre die gute, Winter? Wehe, Sie haben keine. Deshalb habe ich Sie schließlich hergeholt.«
»Die gute Nachricht ist, je weniger er sich in der Hand hat, desto eher macht er Fehler. Und je mehr Fehler er macht, desto leichter schnappen wir ihn.«
»In der Theorie schön und gut. Das Problem ist nur, dass bald irgendwo eine Frau einen schrecklichen Albtraum erleben wird und ich es nicht verhindern kann. Obwohl ich sie doch davor beschützen sollte.«
Darauf gab es keine Antwort. Ich war oft genug selbst in Hatchers Lage gewesen und wusste genau, wie ihm zumute war. Ich kannte die Hilflosigkeit, das Bedürfnis, etwas zu tun, aber nicht zu wissen, was. Am schwersten zu ertragen war allerdings die Wut. Die Wut auf sich selbst, weil man das Puzzle nicht zusammensetzen konnte, und die Wut auf eine Welt, die solche Puzzles überhaupt zuließ.
Eine Weile standen wir in respektvollem Schweigen da und betrachteten die schlafende Patricia. Der Herzmonitor piepte, die Bettdecke hob und senkte sich und die Uhr an der Wand zählte die Sekunden.
Patricia war achtundzwanzig und hatte braune Augen und braune Haare. Die braunen Augen konnte man nicht sehen, weil sie zugeschwollen waren, die braunen Haare nicht, weil der Täter sie abgeschnitten hatte. Die Haut um die Augen war blutunterlaufen, der kahl rasierte Schädel glänzte im grellen Licht des Krankenhauszimmers wie eine rosige Kugel. Nicht der kleinste Haarflaum war zu sehen, die Rasur war erst vor kurzem ausgeführt worden, wahrscheinlich direkt bevor der Täter sein Opfer freigelassen hatte. Offenbar törnten Erniedrigung, Schmerzen und Folter ihn an.
Ich hatte schon Dutzende von Mördern interviewt, um ihre Motive kennenzulernen. Es gehörte zu meinem Job, zu verstehen, warum ein Mensch Lust dabei empfindet, wenn er einem anderen wehtut. Trotzdem war mir völlig unbegreiflich, warum der Täter an Patricia Maynard eine Lobotomie durchgeführt hatte.
Die Atmung wird von der Medulla oblongata gesteuert, einem Teil des Gehirns, der bei Patricias Lobotomie nicht beschädigt worden war. Solange sie lebte, würde ihre Medulla oblongata dafür sorgen, dass ihre Lungen atmeten und ihr Herz schlug. Patricia war noch nicht einmal dreißig. Gut möglich, dass sie noch vierzig oder fünfzig Jahre vor sich hatte. Ein halbes Jahrhundert, eingesperrt in einem dämmrigen Gefängnis, in jeder Beziehung auf die Hilfe anderer angewiesen, unfähig, zu essen oder die Toilette zu benutzen, unfähig, einen Gedanken zu denken oder einen Satz zu formulieren. Die Vorstellung war unerträglich.
»Und der Schädel zeigt keine Narben?« Noch eine rhetorische Frage, diesmal notwendig, um mich selbst zurückzuholen.
»Der Zugang zum Gehirn erfolgte durch die Augenhöhlen.« Hatcher blickte immer noch unverwandt auf Patricia Maynard. »Haben Sie genug gesehen, Winter?«
»Mehr als genug.« Auch ich starrte die junge Frau an, ich konnte nicht anders. »Okay, unser nächstes Ziel ist St Albans. Ich muss mit Graham Johnson sprechen.«
»Ist das notwendig? Meine Leute haben ihn schon verhört.«
Ich riss mich von Patricia Maynard los und sah Hatcher an. »Und sie haben bestimmt hervorragende Arbeit geleistet. Aber Johnson hat Patricia gefunden, was heißt, dass er über nur zwei Schritte mit dem Täter verbunden ist. Und da unsere Opfer nichts mehr sagen, komme ich dem Täter durch ihn vorerst am nächsten. Deshalb muss ich mit ihm sprechen.«
»Okay. Ich rufe im Büro an und organisiere Ihnen einen Fahrer.«
»Das kostet zu viel Zeit. Fahren lieber Sie mich.«
»Geht nicht. Ich werde im Büro zurückerwartet.«
»Aber Sie sind der Boss, Sie können doch tun, was Sie wollen.« Ich grinste. »Na los, Hatcher, lassen Sie uns ein bisschen Spaß haben.«
»Spaß! Wirklich, Winter, Sie haben einen merkwürdigen Humor. Spaß hat man vielleicht bei einer Party auf einer Milliardärsjacht oder von mir aus mit einer zwanzigjährigen Blondine. Nicht bei dem, was wir tun.«
»Wissen Sie, was Ihr Problem ist, Hatcher? Sie sitzen schon viel zu lange an einem Schreibtisch. Wann haben Sie zum letzten Mal vor Ort ermittelt?« Ich grinste wieder. »Und wenn wir schon dabei sind, Ihr letztes Mal mit einer zwanzigjährigen Blondine ist möglicherweise auch schon eine Weile her, oder?«
»Ich muss ins Büro.«
»Und ich bin gerade über den Atlantik geflogen, um Ihnen den Arsch zu retten. Und habe ich schon erwähnt, dass ich seit sechsunddreißig Stunden auf den Beinen bin?«
»Das ist emotionale Erpressung.«
»Und?«
Hatcher stöhnte. »Also gut, ich fahre Sie.«
2
Hatcher fuhr schnell und konzentriert. Die Nadel stand meist flatternd bei hundertvierzig und fiel selten unter hundertdreißig. Wir fuhren auf der M1, einer in Richtung Norden aus London hinausführenden Ausfallstraße, gesäumt von tristen grauen Gebäuden, die im matten Dezemberlicht noch trostloser wirkten.
Es waren nur noch ein paar Tage bis Weihnachten, aber nicht einmal die bunten Lichterketten, die hinter den Fenstern blinkten, an denen wir vorbeifuhren, kamen gegen die Trübsal an. Der Nachmittag war bereits fortgeschritten, in einer Stunde würde die Sonne untergehen, und am schiefergrauen Himmel waren dunkle Wolken aufgezogen. Laut Wettervorhersage sollte es schneien, und es wurden bereits Wetten auf weiße Weihnachten abgeschlossen. Dass jemand gerne wettete, verstand ich, Schnee dagegen hatte für mich überhaupt keinen Reiz. Er war kalt, nass und deprimierend. Im Herzen würde ich immer Kalifornier bleiben. Ich lechze nach Sonne wie ein Drogensüchtiger nach Crack.
»Ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie mir bei diesem Fall helfen«, sagte Hatcher. »Ich weiß, wie beschäftigt Sie sind.«
»Ich freue mich, hier zu sein«, sagte ich. Eine faustdicke Lüge. Ich hätte jetzt in Singapur oder Sydney oder Miami sein können, an einem warmen, sonnigen Ort. Stattdessen fuhr ich an einem eisigen Dezembertag durch London und kämpfte gegen Erfrierungen und Unterkühlung. Und jetzt musste ich mich auch noch gegen einen Schneesturm wappnen.
Aber ich war selbst schuld. Der Vorteil davon, sein eigener Chef zu sein, ist ja vor allem, dass man selbst bestimmen kann, was man tut. Und ich hatte mich für London entschieden, aus dem einfachen Grund, dass es sich um einen ungewöhnlichen und deshalb interessanten Fall handelte, und ein interessanter Fall gehörte für mich zu den wenigen Dingen, die Sonnenschein ausstechen konnten.
Seit meinem Ausscheiden aus dem FBI reise ich durch die Welt und jage Serientäter. Es geht jeden Tag ein neuer Hilferuf bei mir ein, manchmal auch zwei oder drei. Zu entscheiden, welche Fälle ich übernehmen werde, fällt mir schwer, denn eine Ablehnung kann das Todesurteil für einen Menschen bedeuten, oft auch für mehrere, da Serienmörder in der Regel so lange weitermachen, bis man sie stoppt. Dieses Dilemma hatte mir während meiner Zeit beim FBI viele schlaflose Nächte bereitet. Jetzt schlafe ich besser, allerdings nur dank einer Kombination von Schlaftabletten, Whisky und Jetlag.
Monster, die zur Strecke gebracht werden müssen, gibt es leider genug. So war es schon immer gewesen, seit Kain Abel getötet hatte. Serientäter sind wie Unkraut. Wenn man einen fängt, nehmen gleich zehn neue seinen Platz ein. Allein in den USA treiben geschätzte hundert Serienmörder ihr Unwesen. Und diese Zahl bezieht sich nur auf Mörder, nicht auf Brandstifter und Vergewaltiger und andere Ungeheuer, deren einziges Ziel im Leben ist, anderen Schmerzen und Leid zuzufügen.
Ich war zu meiner Zeit beim FBI ein typischer Agent gewesen. Schwarzer Anzug, Schuhe gewienert, bis sie glänzten wie Spiegel, Haare hinten und seitlich kurz geschnitten. Damals hatte ich noch schwarze Haare gehabt, gefärbt, um nicht aufzufallen. Man hätte mich neben tausend andere Agenten stellen können, ich wäre nicht aufgefallen.
Inzwischen kleide ich mich salopper. Die gestärkten weißen Hemden und förmlichen Anzüge sind verschwunden, ersetzt durch Jeans, T-Shirts mit Bildern toter Rockstars und Kapuzenpullis. Die glänzenden Schuhe habe ich gegen bequeme, abgewetzte Stiefel getauscht, das Haarfärbemittel endete im Müll. Ich sehe vielleicht nicht mehr so smart aus, dafür fühle ich mich um einiges wohler. Die FBI-Anzüge waren wie Zwangsjacken gewesen.
»Können Sie schon etwas sagen?« Hatcher streifte mich mit einem Blick, eine Hand am Steuer. Die Nadel stand bei hundertsechzig, Tendenz steigend.
»Nur zweierlei kann diesen Typen stoppen. Entweder Sie schnappen ihn oder er stirbt. Eines natürlichen oder eines unnatürlichen Todes. Er hat so viel Gefallen an dem gefunden, was er tut, dass er nicht freiwillig aufhört.«
»Bitte, Winter, Sie sprechen hier nicht mit einem Anfänger. Ihre Beschreibung trifft auf neunundneunzig Komma neun Prozent aller Serientäter zu.«
Ich lachte. Er hatte recht. »Okay, wie wär’s dann damit: Wenn Sie ihn erwischen, wird er sich nicht ergeben. Eher provoziert er Sie dazu, ihn zu erschießen.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Gefängnis wäre die Hölle für ihn.«
»Warum?«
»Unser Mann ist ein Kontrollfreak. Er will das gesamte Leben seiner Opfer unter Kontrolle haben. Was sie anhaben, was sie essen, alles. Und er könnte es nicht ertragen, wenn ihm jemand die Kontrolle entzieht. Selbstmord zu begehen, indem er einen Polizisten dazu provoziert, ihn zu erschießen, wäre für ihn insofern attraktiv, als er Zeitpunkt und Ort seines Todes selbst bestimmen könnte. In seiner Vorstellung hätte er immer noch alles unter Kontrolle.«
»Hoffentlich irren Sie sich.«
»Ich irre mich nicht.«
Während Hatcher fuhr, ging ich in Gedanken Patricia Maynards Entführung noch einmal in allen Einzelheiten durch. Ich hätte gern mehr Informationen gehabt, aber das ist ja die Regel. Egal, wie viele Informationen man hat, man hat nie genug.
Den Polizeiberichten zufolge hatte Martin Maynard seine Frau am 23.August als vermisst gemeldet und sich dadurch zum Hauptverdächtigen gemacht. Die meisten Mörder kennen ihre Opfer. Oft handelt es sich um den Ehepartner, einen Verwandten oder einen Freund. Aber noch ging es nicht um Ermittlungen in einem Mordfall, sondern nur um reguläre, gründliche Polizeiarbeit. Man wollte nichts versäumen.
Martin Maynard hatte eine Reihe von Affären gehabt, und das Ehepaar machte gemeinsam eine Therapie als letzten Versuch, eine Ehe zu retten, die schon längst nicht mehr zu retten war. Dazu kam noch eine ansehnliche Lebensversicherung, der Mann hatte also durchaus jede Menge Motive. Mord passte ins Bild.
Martin Maynard wurde zwei Tage lang verhört und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei hatte in den darauffolgenden Monaten ein Auge auf ihn gehabt, aber auch das eher, um nichts zu versäumen und sich nichts zuschulden kommen zu lassen. Aus verschiedenen Puzzleteilen wurden Patricia Maynards letzte Aufenthaltsorte rekonstruiert, und man schloss, dass sie am 22.August gegen Abend verschwunden sein musste.
Martin hatte ein perfektes Alibi in Gestalt seiner Sekretärin. Zwar hatte er seiner Frau versichert, die Beziehung zu ihr sei beendet, und war in der Nacht von Patricias Verschwinden angeblich geschäftlich in Cardiff gewesen, doch in Wirklichkeit hatte er sie mit seiner Sekretärin in London verbracht. Hotelunterlagen und Augenzeugenberichte bestätigten das.
In den dreieinhalb Monaten danach geschah nichts. Es gab keinen Erpresserbrief, keine telefonische Lösegeldforderung, keine Leiche. Patricia Maynard blieb spurlos verschwunden, und man ging davon aus, dass sie tot war. Doch dann war sie vor zwei Tagen abends in einem Park in St Albans aufgetaucht, einer kleinen, etwa eine halbe Stunde nördlich von London gelegenen Kathedralstadt. Sie machte einen verwirrten, abwesenden Eindruck und konnte nicht einmal die einfachsten Fragen beantworten. Graham Johnson war mit seinem Hund Gassi gegangen und hatte sie allein durch den Park irren sehen. Er rief die Polizei, die die Unbekannte rasch als Patricia Maynard identifizierte. Sie wurde ins Londoner St Bartholomew’s Hospital gebracht, und Hatcher übernahm den Fall.
Während ihrer Gefangenschaft war Patricia Maynard wiederholt gefoltert worden. Ihr Körper war mit alten und neuen Narben und Blutergüssen übersät. Offenbar hatte der unbekannte Täter was für Messer übrig. Ein Bluttest ergab, dass er Patricia mit Hilfe von Drogen hellwach gehalten hatte, während er sich so amüsierte. Er hatte ihr nacheinander alle Finger abgeschnitten, mit Ausnahme des Ringfingers der linken Hand. Die Stümpfe waren sorgsam kauterisiert. Merkwürdigerweise hatte er sie im Gesicht nicht verletzt, und noch merkwürdiger waren die nicht vollständig abgewischten Spuren von Make-up. Außerdem war Patricia, von den Verletzungen abgesehen, körperlich in einem auffallend guten Zustand. Ihr Gewicht entsprach ihrer Größe und Statur, und es gab keine Anzeichen für Flüssigkeitsmangel.
Wir erreichten die Ausfahrt St Albans und Hatcher setzte den Blinker und bog nach links ab. Fünf Minuten später fuhren wir durch St Michael’s, einen Stadtteil mit Reihen von kleinen Postkartenhäuschen und größeren Anwesen, die bestimmt ein Vermögen gekostet hatten. Wir kamen an vier Pubs vorbei, zu viele, gemessen an der Zahl der Einwohner und der demografischen Schicht, der sie angehörten. Offensichtlich eine Touristengegend.
Die Kälte schlug mir in dem Moment entgegen, als ich aus dem Auto stieg, ein Gefühl, als wäre ich mit dem Kopf gegen eine Wand aus Eis geprallt. Dabei hatte ich schon meine dickste Jacke angezogen. Innen Lammfell für die Wärme, außen imprägniertes Wildleder gegen Wind und Nässe. Genauso gut hätte ich kurze Hosen und T-Shirt tragen können. Ich zündete mir eine Zigarette an, und Hatcher warf mir einen missbilligenden Blick zu.
»Wir sind im Freien«, sagte ich. »Ich breche kein Gesetz.«
»Die Dinger bringen Sie um.«
»Wie vieles andere auch. Ich könnte schon morgen von einem Bus überfahren werden.«
»Oder die Diagnose Lungenkrebs bekommen und eines langsamen, qualvollen Todes sterben.«
Ich grinste ein wenig verkniffen. »Nicht unbedingt. Mein Urgroßvater hat zwei Schachteln am Tag geraucht und ist hundertdrei geworden. Ich hoffe einfach mal, dass ich ihm nachschlage.«
Das Haus von Graham Johnson stand gegenüber einem Pub namens Six Bells. Wie bei den anderen Häusern an der Straße führte die Haustür direkt auf den Gehweg. Jemand von Hatchers Leuten hatte uns angemeldet, Johnson erwartete uns. Die Wohnzimmergardine bewegte sich, als wir uns dem Haus näherten, und die Tür ging auf, bevor Hatcher auf die Klingel drücken konnte. Vor uns stand Johnson, um seine Füße sprang aufgeregt kläffend ein Jack-Russell-Terrier. Johnson war durchschnittlich groß und von durchschnittlicher Statur und streifte mit dem Kopf den niedrigen Türrahmen.
Laut Polizeibericht war er fünfundsiebzig Jahre alt, und jedes einzelne dieser Jahre hatte sich tief in sein faltiges, sorgenvolles Gesicht gegraben. Die wenigen Haare, die er noch besaß, waren genauso weiß wie meine, und unter seinen wässrigen blauen Augen lagen schwere Tränensäcke. Aber trotz der Außentemperatur um den Gefrierpunkt bewegte er sich für sein Alter erstaunlich geschmeidig und überhaupt nicht steif, was wohl eher regelmäßiger körperlicher Betätigung als Vitaminen und Aufbaupräparaten zu verdanken war. Jedenfalls wirkte er auf mich nicht wie einer, der so etwas nahm.
»Kommen Sie rein.«
Er trat zur Seite, um uns einzulassen. Der Hund rastete aus, kläffte, drehte sich im Kreis und jagte seinen eigenen Schwanz. Johnson rief ein scharfes »Barnaby, aus!«, und der Hund verstummte und sprang mit schuldbewusster Miene auf einen Stuhl. Ich trat meine halb gerauchte Zigarette auf dem Gehweg aus und ging hinter Hatcher nach drinnen. Der Blick des Hundes folgte uns durch das Wohnzimmer. Johnson winkte uns zum Sofa, und wir setzten uns. Im Kamin brannte ein wärmendes Feuer, das einen behaglichen orangefarbenen Schein verbreitete.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten?«, fragte Johnson. »Tee? Kaffee?«
»Kaffee wäre prima«, sagte ich. »Schwarz, zwei Zucker, danke.«
Hatcher lehnte ab, und der Alte verschwand in der Küche. Ich machte es mir bequem und sah mich im Zimmer um. Mein erster Eindruck war der eines Museums. Schon an der Tür war mir Johnsons Ehering aufgefallen, und das Wohnzimmer war ganz offensichtlich von einer Frau eingerichtet worden. Nur die Frau selber fehlte. Überall stand irgendwelcher verstaubter Nippes, auf Sesseln und Sofa lagen verblichene geblümte Kissen, an den Fenstern hingen verschossene geblümte Vorhänge. Den Ehrenplatz auf dem Kaminsims nahm ein altes gerahmtes Hochzeitsfoto ein, an allen möglichen anderen Stellen standen Familienfotos mit jeder Menge lächelnden Kindern und Enkeln. Anhand von Frisuren und Kleidern konnte man die Fotos datieren, die jüngsten mochten vier Jahre alt sein. Vermutlich war damals Johnsons Frau gestorben.
Johnson kehrte mit zwei dampfenden Kaffeetassen zurück, gab mir eine und setzte sich in den Sessel am Kamin. Der Kaffee war stark und mit viel Koffein, genau nach meinem Geschmack.
»Können Sie uns schildern, wie Sie Patricia Maynard gefunden haben?«, fragte Hatcher.
»So hieß sie also«, sagte Johnson. »Ich habe seit Montagabend bestimmt mit einem Dutzend Polizisten gesprochen, aber keiner hat sich die Mühe gemacht, mir zu sagen, wie sie heißt. Andererseits habe ich auch nicht gefragt, also ist es genauso sehr meine Schuld. Es kam mir nur irgendwie nicht richtig vor. Nicht zu wissen, wie sie heißt.«
»Mr Johnson«, sagte Hatcher.
Der Alte zuckte ein wenig zusammen und kehrte in die Gegenwart zurück. »Tut mir leid«, sagte er.
Hatcher wischte die Entschuldigung mit einer Handbewegung weg. »Können Sie uns beschreiben, was an diesem Abend passiert ist?«
»Ich bin mit Barnaby wie immer abends noch einmal Gassi gegangen. Also so gegen zehn. Ich gehe abends immer um dieselbe Zeit mit ihm raus. Zwei- oder dreimal am Tag gehe ich mit ihm spazieren, sonst verwüstet er mir das Haus.«
»Sie waren im Verulamium Park, oder?«
»Stimmt, im Verulamium Park. Auf dem Weg hierher sind Sie wahrscheinlich am Eingang vorbeigefahren. Ich bin bis zum Ende des Sees gegangen, und dort habe ich die Frau gesehen. Dass sie mir überhaupt aufgefallen ist, lag daran, dass ich glaubte, sie wollte ins Wasser.« Er brach ab und nahm einen Schluck Kaffee. »Wissen Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe das der Polizei schon alles erzählt. Es macht mir nichts aus, es noch einmal zu tun, ich habe nur das Gefühl, dass ich Ihre Zeit verschwende.«
»Das tun Sie nicht.« Ich warf einen Blick auf den Jack Russell. »Ich würde gern etwas ausprobieren, wenn Sie nichts dagegen haben. Glauben Sie, Barnaby hat Lust auf einen Spaziergang?«
Der Hund stellte die Ohren auf, als er seinen Namen und das Wort »Spaziergang« hörte. Er sprang von seinem Stuhl, begann zu bellen und drehte sich wie ein Zirkushund in einer Pirouette im Kreis. Johnson lachte. »Das dürfte ein Ja sein«, sagte er.
3
Wir brauchten zu Fuß fünf Minuten zum Park, genau eine Zigarettenlänge. Barnaby sprang die ganze Zeit neben uns her, zerrte an der Leine, erwürgte sich dabei fast und führte sich auf, als hätte er noch nie ein so aufregendes Abenteuer erlebt. Es dämmerte rasch und die Straßenlaternen schimmerten in einem kränklichen Schwefelgelb-Orange durch das fahle Zwielicht. Es roch nach Schnee und die Luft war feuchtklamm und drückend. Ich zog meine Jacke fester um mich, aber es nützte nichts. Die Kälte eines feuchten britischen Wintertags würde auch durch einen Polarforscheranzug dringen.
»Gehen Sie immer dieselbe Strecke?«, fragte ich Graham Johnson.
Er schüttelte den Kopf. »Wir gehen verschiedene Runden, je nach Wetter und je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Der Park ist groß.«
Das war er tatsächlich. Nach rechts erstreckte sich eine Wiese, soweit ich sehen konnte. Die Markierungen leerer Fußballfelder hoben sich weiß von dem grauen Untergrund ab. Links thronte in einiger Entfernung auf einem Hügel die Kathedrale. Vor uns lag ein kleiner See, der von dem großen See durch eine bogenförmig geschwungene Brücke getrennt war. Auf dem Wasser schwammen Enten und Schwäne. Die Kälte schien ihnen nichts auszumachen.
Außerdem war der Park dunkel und verlassen und damit der ideale Ort für unseren Täter, Patricia Maynard abzusetzen.
»Welchen Weg sind Sie an dem Abend gegangen, an dem Sie Patricia Maynard gefunden haben?«
Johnson zeigte auf die der Kathedrale zugewandte Seite des Hauptsees. »Eine kleine Runde. Wir sind gegen den Uhrzeigersinn um den See gelaufen.«
»Und wo haben Sie Patricia Maynard gesehen?«
Der Alte deutete auf das andere Ende des Sees.
»Okay, gehen wir hin.«
Nach weiteren fünf Minuten waren wir dort. Ich bedeutete Johnson, sich auf eine leere Bank zu setzen, und nahm neben ihm Platz. Barnaby zog hechelnd an der Leine und scharrte mit den Pfoten. Er wollte einer Ente nachjagen. Ich sah Hatcher an, der sofort verstand. Je weniger Johnson abgelenkt wurde, desto besser für unsere Arbeit. Hatcher nahm Barnabys Leine und ging mit ihm außer Hörweite.
Ein kognitives Interview unterscheidet sich insofern von einem normalen, als der Befragte die Ereignisse der Vergangenheit noch einmal anhand der damals empfundenen Gefühle und Eindrücke erleben soll. Man kommt nicht direkt auf das Thema zu sprechen, sondern umkreist es und betrachtet es durch verschiedene Sinne. Die dadurch wachgerufenen Erinnerungen sind nachweislich viel zuverlässiger als das, was herkömmliche Befragungstechniken zutage fördern. Ich hätte Johnson dafür nicht unbedingt hierherbringen müssen, aber da er praktisch um die Ecke wohnte, konnte es auch nicht schaden.
»Schließen Sie jetzt bitte die Augen, Mr Johnson, dann stelle ich Ihnen einige Fragen. Antworten Sie, was Ihnen spontan einfällt, auch wenn es vielleicht verrückt klingt. Sagen Sie einfach, was Ihnen in den Sinn kommt.«
Johnson sah mich misstrauisch an.
»Keine Sorge, ich mache das nicht zum ersten Mal.«
Johnson musterte mich noch einmal zweifelnd, dann schloss er die Augen.
»Denken Sie bitte an Montagabend zurück. Sie gehen wie immer mit Barnaby spazieren. Wie spät ist es?«
»Ungefähr zehn. Ich gehe immer so gegen zehn mit ihm nach draußen.«
»Vor zehn oder danach?«
Der Alte runzelte angestrengt die Stirn, dann verschwand die Anspannung wieder. »Nach zehn. Ich hatte noch eine Fernsehsendung gesehen, und die Nachrichten sollten gleich anfangen.«
»Wie ist das Wetter?«
»Es regnet.«
»Beschreiben Sie den Regen. Ist er stark? Oder nur leicht?«
»So ein feuchter Nieselregen, Sie wissen, was ich meine. Er ist nicht stark, aber am Ende ist man trotzdem nass.«
»Sind noch andere Spaziergänger unterwegs?«
»Bei diesem Wetter und so spätabends?« Johnson schüttelte den Kopf. »Nein, nur ich und Barnaby. Und natürlich Patricia.«
Ich ging nicht auf den Namen ein, weil wir noch nicht so weit waren. »Wie fühlen Sie sich?«
»Um die Wahrheit zu sagen, ich war ziemlich verärgert. Ich hatte den Wagen in die Werkstatt gebracht und eine Rechnung über sechshundert Pfund präsentiert bekommen. Und jetzt ging ich im Regen mit meinem Hund Gassi. Ich hab schon schönere Tage erlebt, sagen wir es so.«
»Was riechen Sie?«
»Nasse Erde. Holzrauch aus meinen Kleidern.«
»Was sehen Sie?«
»Die Risse auf dem Gehweg. Ich habe den Kopf gesenkt, damit ich den Regen nicht ins Gesicht bekomme.«
»Gehen Sie schnell oder langsam?«
»Schnell. Ich will nur nach Hause und ins Trockene.«
»Was macht Barnaby?«
Ein Lächeln. »Er zerrt wie immer an der Leine. Wenn er nicht angeleint wäre, wäre er in zwei Sekunden im See.«
»Wie werden Sie auf Patricia aufmerksam?«
»Ich sehe aus den Augenwinkeln eine Bewegung auf dem Weg am Ufer, der vom Fighting Cocks in den Park führt.«
Johnson bewegte kaum merklich den Kopf, und ich blickte in die Richtung, die er angezeigt hatte. Auch im spätnachmittäglichen Dämmerlicht sah der dunkle, schmale Weg nicht einladend aus.
»Wie bewegt sie sich?«
»Unsicher. Sie schwankt, als sei sie betrunken. Mein erster Gedanke war, dass sie im Fighting Cocks einen zu viel getrunken hat. Ich will nicht neugierig sein, aber Sie wissen ja, wie es ist, wenn man einen Krankenwagen am Straßenrand stehen sieht. Man muss einfach hinschauen. Jedenfalls sehe ich zu, wie sie zwischen den Bäumen hervorkommt, und finde es seltsam, dass sie allein ist. Keine Spur von einem Freund. Oder einer Freundin. Es ist Nacht und schon spät. Eine Frau sollte hier nicht allein unterwegs sein. Ich sehe genauer hin, weil ich mir allmählich Sorgen mache, und merke, dass sie geradewegs auf den See zugeht. Ich renne zu ihr, bekomme sie gerade noch am Arm zu fassen und reiße sie zurück. Wenn sie um diese Jahreszeit in den See gegangen wäre, hätte sie sich eine schwere Unterkühlung zugezogen.«
Wie es weitergegangen war, wusste ich aus dem Polizeibericht. Johnson hatte die Frau angesprochen, und als sie nicht antwortete, hatte er sie ins Fighting Cocks gebracht und den Wirt veranlasst, die Polizei zu rufen. Graham Johnson war ein Relikt einer längst vergangenen Zeit. Ich hatte seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen, der kein Handy besaß.
»Gehen Sie bitte noch einmal ein paar Schritte zurück, Mr Johnson, und erinnern Sie sich, wie Sie Patricia zuerst bemerkt haben. Sagen Sie nichts, Sie sollen sich die Szene nur in Gedanken vorstellen, so genau wie möglich und mit allen Details, egal wie klein oder unwichtig. Was sehen Sie? Was hören Sie? Was riechen Sie? Was spüren Sie?«
Ich gab Johnson einige Augenblicke Zeit, dann bat ich ihn, die Augen wieder zu öffnen. Auf seinem Gesicht lag ein seltsamer Ausdruck.
»Was ist?«, fragte ich.
»Sie halten mich bestimmt für paranoid.«
»Paranoid oder verrückt, das ist mir egal. Ich will hören, was Ihnen eingefallen ist.« Ich lächelte ermutigend und wartete, bis er zurücklächelte. »Was ist passiert? Wurden Sie von Außerirdischen entführt und zu einem Raumschiff gebracht?«
Johnsons Lächeln verschwand sofort wieder, und er wirkte fast ein wenig ängstlich. Er zeigte auf einige schwarze Bäume und Büsche weiter rechts. Als er sprach, klang seine Stimme fest. Zweifellos glaubte er jedes Wort, das er sagte.
»Jemand hat uns von dort beobachtet.«
4
tesla: hi du
ladyjade: hi ☺
tesla: viel zu tun?
ladyjade: und wie
tesla: bleibts bei heute abend
ladyjade: klar
tesla: kanns kaum erwarten dich zu sehen
ladyjade: ich auch nicht
tesla: muss aufhören hab auch viel zu tun
ladyjade: ok dann bis acht x
tesla: x
Rachel Morris schloss das Chatfenster und ihr Lächeln wurde zu einem Stirnrunzeln. Was machte sie da eigentlich? Sie war dreißig, warum um alles in der Welt führte sie sich auf wie ein liebeskranker Teenager? Das war doch verrückt. Sie sah durch das Fenster ihres Minibüros, überzeugt, dass alle Blicke auf sie gerichtet waren, aber die anderen hielten die Köpfe gesenkt. Durch die Glasscheibe hörte sie den Lärm des Callcenters, das Klingeln der Telefone und das Murmeln einseitiger Gespräche.
Sie starrte auf den Bericht auf ihrem Bildschirm und versuchte den Sinn der Sätze zu entschlüsseln, aber vergeblich. Sie konnte nur an heute Abend denken. Zu Jamie hatte sie gesagt, sie würde nach der Arbeit noch mit Kolleginnen auf einen Geburtstag anstoßen. Was ihn sowieso nicht interessierte. Selbst wenn sie gesagt hätte, sie wollte nach Australien auswandern, hätte sie dasselbe gleichgültige Brummen anstelle einer Antwort bekommen. Das war nicht immer so gewesen. Am Anfang ihrer Beziehung hatten sie nächtelang miteinander geredet und ihre Träume und Geheimnisse geteilt. Doch diese Zeit war längst vorbei, zerstört durch den Alltagstrott von sechseinhalb Jahren Ehe.
Unter ihrem Schreibtisch stand eine Tasche, in die sie ihr teures Parfüm, ihre beste Unterwäsche und ihr kleines rotes Lieblingskleid gepackt hatte. Das Kleid betonte ihre Vorzüge und versteckte die Schwachstellen und war sexy, aber nicht nuttig. Was wichtig war. Denn sie glaubte nicht, dass Tesla nuttig mochte. Er hatte etwas Altmodisches, war ein Kavalier, ein Gentleman. Vor allem sein Einfühlungsvermögen hatte sie angezogen, wahrscheinlich mehr als alles andere. Es war so schön, jemanden zu haben, der ihr zuhörte, der ihr das Gefühl gab, dass ihm wichtig war, was sie sagte und dachte. Jemanden, der sie als ganze Person wertschätzte.
Rachel starrte auf das Durcheinander von Worten auf dem Bildschirm. Noch konnte sie aussteigen. Doch dann dachte sie an Jamie, daran, wie er sie immer wieder gekränkt und verletzt hatte, und sie wusste, dass sie keinen Rückzieher machen würde. Sie chattete seit zwei Monaten mit Tesla, und je mehr sie ihn kennenlernte, desto besser gefiel er ihr. Sie war ihm noch nie begegnet und kannte nicht einmal seinen richtigen Namen, aber trotzdem stand unumstößlich fest, dass er sie auf eine Art verstand, wie bisher niemand sie verstanden hatte. Er war ein Seelenverwandter. Jamie hatte sie nie so vollständig verstanden, nicht einmal am Anfang, in ihrer guten Zeit.
Sie blickte auf die Uhr auf dem Bildschirm. Erst halb vier. Noch viereinhalb Stunden bis zu ihrem Treffen. Viereinhalb Stunden, die sich hinziehen würden wie der letzte Schultag vor den Ferien.
5
Ich stand mit Hatcher am Ufer des Sees und sah Barnaby nach, der Graham Johnson nach Hause zerrte. Es hatte angefangen zu schneien, und dicke Schneeflocken schwebten in Zeitlupe durch den Schein der Laternen. Das war nur ein Vorgeschmack. Der Wetterbericht hatte Schneestürme vorausgesagt und die Nachrichten hatten chaotische Zustände in Aussicht gestellt, und ich sah keinen Grund, daran zu zweifeln. Johnson hatte den See schon zur Hälfte hinter sich gelassen. Offenbar wollte er zu Hause sein, bevor es mit dem Schnee richtig losging. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Niemand würde gern hier im Park von einem Schneesturm überrascht werden. Ich klopfte eine Zigarette aus der Schachtel, zündete sie mit meinem alten Messingfeuerzeug an und ignorierte die von Hatcher ausstrahlende Missbilligung.
»Der Täter war hier«, sagte ich.
»Hat Johnson das gesagt?«, fragte Hatcher.
»Nicht ausdrücklich.«
»Was hat er dann gesagt?«
»Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was er gespürt hat. Und er hat gespürt, dass ihn jemand beobachtet.« Ich wies mit einem Nicken auf das Wäldchen. »Von dort drüben, um genau zu sein.«
»Gespürt«, wiederholte Hatcher. »Ich weiß nicht, ob das vor Gericht zählt, Winter.«
»Genau das ist das Problem von euch Polizisten heutzutage. Ihr denkt zu sehr wie Anwälte und nicht wie Detektive.«
Ich ging zu den Bäumen und spähte in das Dunkel. Schwarze Schatten bewegten sich im Rhythmus der schwankenden Äste, und der Wind pfiff gespenstisch. Bevor Hatcher mich über die fachgerechte Sicherung eines Tatorts aufklären konnte, zwängte ich mich schon durch das Unterholz und verschwand zwischen den Bäumen. Zweige schlugen mir ins Gesicht und schnalzten gegen meinen Körper, Schlamm spritzte über meine Stiefel und Hosenbeine. Hatcher folgte mir schimpfend und fluchend in einigen Schritten Abstand und wollte wissen, was zum Teufel in mich gefahren sei.
Ich blendete ihn aus und stand einige Augenblicke bewegungslos zwischen den Bäumen, ohne auf die kalten Schneeflocken zu achten, die wie Nadelstiche auf meinem Gesicht prickelten. Ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass der Täter am Abend vor zwei Tagen hier gewesen war. Mein Jagdinstinkt sagte es mir.
Als ich ein Kind war, hatte mein Vater mich zum Zelten in die endlosen hügeligen Wälder Oregons mitgenommen, dieselben Wälder, in die er später auch seine Opfer brachte. Dort hatte er mir Schießen und Fährtenlesen beigebracht und wie man die Tiere ausnahm, die wir getötet hatten. Und er hatte mich gelehrt, dass überall auf der Welt die Starken überlebten und die Schwachen umkamen. Ich habe nicht mitgezählt, wie oft ich mir das anhören musste, dieses Bruchstück seiner zynischen Lebenseinstellung, das nach seiner Verhaftung so viel mehr Sinn ergab.
Ich duckte mich, bewegte mich hin und her und suchte nach dem besten Blickwinkel. Der Täter hatte von hier einen hervorragenden Blick auf den See und den Weg, der vom Fighting Cocks in den Park führte. Die Kathedrale ragte weiter rechts auf. In einiger Entfernung sah ich auch noch Johnson und Barnaby, zwei schattenhafte Gestalten. Hatchers Stimme verschmolz mit den anderen Hintergrundgeräuschen, während ich mich konzentrierte und in Gedanken an jenen Abend zurückversetzte. Die Szene stand mir so deutlich vor Augen, als wäre ich dabei gewesen.
Graham Johnson wird von Barnaby am Seeufer entlanggezogen. Er hält den Kopf gesenkt, denn der Regen schlägt ihm ins Gesicht, und blickt nur hin und wieder auf, um zu sehen, wohin er geht. Da bemerkt er auf dem Weg weiter links eine Bewegung und bleibt stehen. Er entspannt sich ein wenig, als er sieht, dass es sich um eine Frau handelt und dass sie allein ist. Was für eine Bedrohung kann schon eine einzelne Frau darstellen?
Doch ein Rest Anspannung bleibt. Der Teil des Gehirns, der unseren in Höhlen wohnenden Vorfahren das Überleben ermöglichte, warnt ihn, und obwohl wir auf diese Stimme schon seit vielen Generationen nicht mehr hören, hat sie immer noch die Macht, uns zum Anhalten und notfalls zum Umkehren zu bewegen, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Graham sieht zu Patricia hinüber und dann zu den Bäumen, hinter denen ich mich verstecke. Er sieht mich nicht, aber er spürt meine Gegenwart. Ich bin nur ein Schatten unter vielen. Patricia torkelt wie betrunken zum See, und Graham hält sie gerade noch fest, bevor sie in das schwarze, eisige Wasser fällt, eine spontane Handlung, die ihn zum Helden der Stunde macht.
Ich zwängte mich aus den Büschen hinaus, zog meine Sachen zurecht und nahm einen tiefen Zug von meiner Zigarette. Der Schnee fiel dichter, die Flocken waren dicker und schwerer. Der kalte Wind, der aus der Arktis zu uns heranblies, ging mir durch sämtliche Knochen. Ich setzte die Kapuze meines Sweatshirts auf und zog den Kopf ein, aber es nützte nichts. Hatcher hatte es aufgegeben, mich anzublaffen, und sprach stattdessen am Handy mit jemand von der Spurensicherung.
»Okay, ich habe eine Frage«, sagte ich. »Sie sind der Täter. Warum verstecken Sie sich hier? Warum setzen Sie nicht einfach das Opfer ab und verschwinden auf dem schnellsten Weg?«
Hatcher beendete den Anruf und steckte das Handy ein. »Genau deshalb zahlen wir Ihnen ein so gutes Honorar. Damit Sie solche Fragen beantworten.«
»Und warum bringen Sie es an einen so öffentlichen Ort?«, füge ich hinzu, ohne auf ihn einzugehen. »Bei den anderen Opfern war es genauso. Alle drei wurden in öffentlichen Parks abgesetzt. Warum dieses Risiko eingehen? Warum sie nicht an irgendeinem einsamen Ort aussetzen?«
Ich zog wieder an meiner Zigarette und dachte an den unbekannten Täter, der sich an einem regnerischen Abend in diesem Gebüsch versteckt hatte. Und auf den Park hinausblickte und wartete. Aber worauf? Dann fiel der Groschen. Ich lächelte. »Er will, dass sie gefunden werden.«
»Angenommen, Sie haben recht, dann beantwortet das Ihre zweite Frage«, sagte Hatcher. »Aber was ist mit der ersten? Warum versteckt er sich hier?«
»Weil er sich vergewissern will, dass sie gefunden werden.«
»Okay, einverstanden. Die nächste Frage lautet vermutlich: Warum ist das für ihn so wichtig?«
Hatcher sah mich an, als erwarte er eine Antwort, die uns geradewegs zur Lösung des Falls führte. Damit konnte ich leider nicht dienen. Noch nicht.
Es war fast vier. Vor achtundvierzig Stunden war ich noch in Maine gewesen und hatte mit einer schusssicheren Weste bekleidet zugesehen, wie ein SEK eine verschneite Scheune umzingelte, in der sich ein Kindermörder versteckte. Am Schluss war der Mörder tot, erschossen von einem Scharfschützen, was immerhin ein Ergebnis war. Ein Kindermörder weniger auf der Welt, das kann immer als Erfolg gewertet werden.
Damit war der Fall für mich abgeschlossen. Der Bösewicht war tot, ich konnte zum nächsten Fall übergehen. Für mich zählt immer nur der Fall, an dem ich gerade arbeite. Alles andere ist Geschichte und dafür fehlt mir die Zeit. Vergangene Erfolge aufzuwärmen hat noch niemandem das Leben gerettet, genauso wie das Wiederkäuen von Misserfolgen selten konstruktiv ist. Ich hatte Maine verlassen, noch bevor das Schulterklopfen anfing, und war ohne einen Blick zurück mit dem ersten Flug von Logan International nach Heathrow geflogen. Fünftausend Kilometer und fünf Zeitzonen später hatte sich im Grunde nichts geändert. Es schneite immer noch, und ich jagte den nächsten Mörder.
»Gehen wir im Fighting Cocks was trinken«, sagte ich.
6
Dagegen hatte Hatcher erwartungsgemäß nichts einzuwenden. Ich erinnerte mich von seinem Besuch in Quantico noch daran, dass er immer der Erste in der Bar gewesen war. Wir folgten demselben schmalen Weg, auf dem Patricia Maynard am Montagabend zum See geschwankt war. Auf halber Strecke überquerten wir einen angeschwollenen kleinen Fluss. Das Rauschen des Wassers dröhnte mir in den Ohren.
Der Weg verbreiterte sich zur Abbey Mill Lane, einem engen, ursprünglich für Pferde und Handkarren angelegten Sträßchen. Auf dem Stadtplan hatte ich gesehen, dass die Abbey Mill Lane die einzige Straße war, die dieses Ende des Parks mit der Stadt verband. Von ihr zweigte rechts die Abbey Mill End ab, eine Sackgasse. Ich sah mich rasch um und versetzte mich in die Lage des Täters. Die ruhige Lage war ein Vorteil, die eingeschränkte Parkmöglichkeit eher ein Nachteil.
Auf der anderen Straßenseite stand das Fighting Cocks, ein wirklich uraltes Haus. Es sah aus wie die Fantasie eines Hollywood-Bühnenbildners, erbaut im Tudorstil mit schiefen Winkeln und schwarzen Balken. Wir traten ein und gingen an gerahmten Zeitungsartikeln vorbei, denen zufolge es sich um den ältesten Pub Großbritanniens handelte, und weiter durch ein Gewirr von Räumen zur Hauptbar.
An dem Tisch am Kamin saß ein altes Paar, die einzigen Gäste. Auf dem Tresen stand ein kleiner künstlicher Weihnachtsbaum mit silbernen Ästen, nur zwei roten Christbaumkugeln und einem windschiefen Stern auf der Spitze. An einer Schnur hinter der Bar hingen Weihnachtskarten. Mehr Schmuck gab es nicht, und er wirkte auch nicht besonders festlich, sondern eher trist, so als sollte man Weihnachten am besten ganz vergessen.
Hinter der Bar stand ein magerer, glatzköpfiger Typ mit einem breiten, ungezwungenen Lächeln. Er hatte die Hände auf den Tresen gestützt, und aus seiner selbstgewissen Haltung konnte man mit ziemlicher Sicherheit schließen, dass es sich um den Besitzer des Pubs handelte. Er trug Designerkleidung und am Handgelenk eine Rolex Submariner. Hatcher bestellte ein Pint London Pride, ich einen Whisky. Die Getränke kamen, und ich leerte mein Glas zur Hälfte. Der Alkohol brannte einen Teil der Schneekälte weg, die mir in den Knochen saß.
Ich stellte das Glas auf den Tresen. »Sie sind Joe Slattery, der Inhaber dieses Pubs, richtig?«
»Hängt davon ab, wer fragt. Wenn Sie hinter Geld her sind oder meine Exfrau Sie schickt, kenne ich keinen Joe Slattery.« Er hatte einen irischen Akzent und ein ansteckendes Lachen.
»Sie haben Montagabend die Polizei gerufen.«
Er sah mich an und wurde wieder ernst. »Seid ihr Journalisten? Wenn ja, würde ich euch höflich bitten, auszutrinken und zu verschwinden. Von Journalisten habe ich die Nase voll.«
Hatcher intervenierte und zeigte seinen Ausweis. »Ich bin Detective Inspector Mark Hatcher, und das ist mein Kollege Jefferson Winter.«
»Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« Slatterys Lächeln kehrte so plötzlich zurück, als sei es gar nicht weg gewesen. »Vielleicht hätte ich Ihnen sogar einen ausgegeben.«
Das bezweifelte ich. Slattery hatte zwar ein breites Lächeln, aber bis in seine Taschen reichte es nicht. Er gehörte zu den Leuten, die genau ausrechnen, was für sie herausspringt, und den Profit fest im Blick haben. Deshalb konnte er sich die Rolex leisten. »Laut Ihrer Aussage ist Ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen.«
Slattery nickte. »Es war ein ganz normaler Montagabend. Das heißt, bis Graham mit dieser Frau kam. Dann war nichts mehr normal. Polizisten, Sanitäter, Journalisten, ein richtiger Affenzirkus, kann ich Ihnen sagen. Was dieser Freak mit der armen Frau angestellt hat.« Slattery schüttelte den Kopf. »Jesus, Maria und Joseph«, flüsterte er. »Eine Lobotomie soll er an ihr ausgeführt haben. Das ist doch krank.«
»Mich interessiert, wie es um die Parkmöglichkeiten hier steht«, sagte ich.
Slattery blickte ungläubig hoch. »Diese Drecksau schnippelt Leuten im Gehirn rum, und Sie denken an Parkplätze?«
»Seien Sie so nett.«
Slattery starrte mich mit zusammengekniffenen Augen an. Ich erwiderte seinen Blick und hielt ihn, bis er begriff, dass ich es ernst meinte.
»Das Parken hier ist ein Albtraum«, sagte er. »Besonders im Sommer. Mein Parkplatz ist immer von Touristen belegt. Und wenn er voll ist, parken sie die Straße zu. Wie gesagt, ein Albtraum.«
»Und deshalb haben Sie auf Ihrem Parkplatz eine Überwachungskamera installiert.«
»Auch noch aus anderen Gründen, aber vor allem deshalb.« Slattery nickte. »Aber Sie wissen ja, dass die Kamera am Sonntagabend zerstört wurde. Zuerst dachte ich, Jugendliche hier aus der Gegend wären das gewesen, aber jetzt weiß ich es natürlich besser.«
Die Polizei ging davon aus, dass der Täter die Kamera zerstört hatte. Nach ihrer Theorie war er irgendwann am Sonntagabend gekommen und hatte sie funktionsunfähig gemacht, weil er den Parkplatz des Pubs benutzen wollte, wenn er am folgenden Abend Patricia Maynard aussetzte. Ich dankte Slattery für seine Mühe, leerte meinen Whisky auf einen Zug und sagte Hatcher, er solle ebenfalls austrinken. Durch die engen Gänge mit ihren niedrigen Decken kehrten wir zum Eingang zurück und traten in die Kälte hinaus.
»Ich gehe auch davon aus, dass der Täter die Kamera zerstört hat«, sagte ich. »Aber geparkt hat er hier am Montagabend auf keinen Fall. Das wäre zu riskant gewesen. Und zu offensichtlich. Unser Mann geht raffinierter vor.«
»Was glauben Sie also?«, fragte Hatcher.
Ich blieb stehen und blickte die Abbey Mill Lane hinunter zum Park. Es war inzwischen Nacht geworden, und die Straße leuchtete im Schein der Straßenlaternen orange. Es schneite heftiger, und der eisige Wind blies die Flocken in Wirbeln vor sich her. Der Schnee blieb bereits liegen und bedeckte Straße und Gehweg.
»Dass er am Montagabend diese Straße genommen hat, ist völlig ausgeschlossen«, sagte ich. »Es wäre wirklich viel zu riskant gewesen. Schließlich ist das hier die einzige Zufahrt zum Park.«
»Wie hat er die Frau dann hergeschafft? Durch Teleportation?«
Ich ignorierte die Frage und Hatchers Ironie, drehte mich um und marschierte die Abbey Mill End entlang bis zum Ende der Gasse. Dort blieb ich stehen und versuchte mir vorzustellen, wie der Täter hier mit Patricia Maynard entlanggegangen war, wie er ihr eine Hand auf die Schulter gelegt und sie behutsam weitergeschoben hatte. Die Vorstellung fühlte sich richtig an. Richtiger als die Vorstellung, er könnte mit dem Auto gekommen sein und vor dem Fighting Cocks geparkt haben.
Vor mir führte ein kleiner Weg weiter. Ich betrat ihn. Hatcher folgte einige Schritte hinter mir, beschwerte sich laut über den Schnee und die Kälte und betonte mehrmals, dass wir in die andere Richtung gehen sollten, zum Auto zurück, weil er nicht über Nacht in St Albans festsitzen wollte. Ich blendete ihn wieder aus und ging weiter.
Der Weg führte zur Pondwicks Close, einer weiteren Sackgasse. Links kam eine Schule, den bunt angemalten Spielgeräten nach zu schließen eine Grundschule. Die Pondwicks Close mündete in die Grove Road. Die nächste Straße war schon die A5183, eine Hauptzugangsstraße zur Innenstadt. Sie war so nah, dass man den Verkehrslärm hörte. Ich blieb einen Moment in der Mitte der Grove Road stehen. Schnee fiel mir auf Kopf und Schultern, nadelte mir ins Gesicht und blieb an meinen Augenlidern hängen, doch ich spürte es kaum. Ich nickte und drehte mich zu Hatcher um.
»Er hat hier geparkt«, sagte ich.
7
Rachel war so aufgeregt wie bei ihrem allerersten Date. Oder fast so aufgeregt. Da sie kein Teenager mehr war, mischte sich in ihre Aufregung eine gewisse Beklemmung. Sie hatte genug erlebt, um zu wissen, dass die Realität nur selten so schön war wie die Fantasie und man sich immer mehr erhoffte, als sich erfüllen konnte. Sie wusste, wie schrecklich es war, wenn einem die Enttäuschung das Herz zerriss. Aber das rote Kleid lag an genau den richtigen Stellen eng an, und das gab ihr einfach ein gutes Gefühl. Dass ihr immer wieder ein Hauch ihres Lieblingsparfüms in die Nase stieg, hob ihre Stimmung noch mehr.
Sie trat aus der U-Bahn-Station in die kalte Nacht hinaus. Es schneite nicht mehr so heftig, und die Flocken trieben träge tanzend und kreiselnd durch die Luft. Als Kind hatte Rachel den Schnee geliebt, und daran hatte sich im Grunde nicht viel geändert. Schnee verwandelte die Welt in einen märchenhaften, romantischen Ort. Morgen würde davon nur noch Matsch übrig sein, aber für den Moment war die Illusion perfekt. Sie zog ihren Mantel fester um sich und ging schneller, die Handtasche schlug im Rhythmus ihrer raschen Schritte an ihre Hüfte.