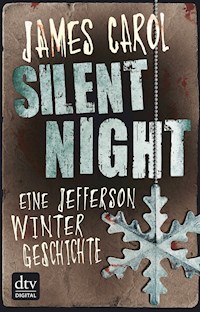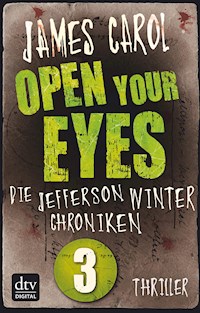7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Jefferson Winter-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wenn du mir folgst, werde ich dich töten Jefferson Winter, der Profiler mit dem unheimlichen Gespür dafür, wie Serienkiller ticken, hat gerade einen Job in New York zu Ende gebracht. Vor der Abreise nach Paris zu seinem nächsten Fall geht er in einem Diner etwas essen. Es ist zwei Uhr nachts, der einzige andere Gast ist eine platinblonde Frau mit Lederjacke. Als Winters Essen serviert wird, steht sie auf - und ersticht vor seinen Augen den Koch. Dann geht sie seelenruhig davon ... Eine Provokation, die Winter nicht ignorieren kann: Paris muss warten. Das Spiel ist eröffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Ähnliche
James Carol
Prey
Deine Tage sind gezählt
Thriller
Deutsch von Franka Reinhart
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Niamh.
Du bist mein Lichtblick – jeden Tag aufs Neue.
1
Jefferson Winter bemerkte die blonde Frau sofort, als er das Imbisslokal betrat. Sie saß in einer Ecke hinter einer aufgeschlagenen Zeitung und hatte einen Kaffeebecher vor sich stehen. Er kam nun schon die dritte Nacht in Folge hierher und seitdem war sie der erste Gast außer ihm. Sie ließ die Zeitung sinken und sah ihn an. Ihr Blick war ohne Ausdruck. Keine Neugier, kein Lächeln, nichts Einladendes. Genauso schnell, wie die Zeitung sich gesenkt hatte, hob sie sich wieder und der Moment war vorüber.
Er schloss die Tür hinter sich und ging an die Theke – froh, der Kälte entflohen zu sein. Anfang Oktober waren die Tage in New York zwar noch recht mild, doch nachts wurde es bereits empfindlich kalt. Das Lokal war winzig, nur acht Tische und ein Typ, der die Bestellungen aufnahm und die Speisen zubereitete. Der Gastraum war lang und schmal. Die Tische standen hintereinander entlang der einen Wand, an der anderen befanden sich Theke und Grill, in der Mitte der Gang. Es roch ungesund appetitlich und der fettige Dunst, der in der Luft hing, schlug sich förmlich auf der Haut nieder. Der Geruch wurde mit jedem Schritt köstlicher. Aus einer kleinen Musikanlage auf einem Regal fast in Deckenhöhe erklang leise »Love Me Tender« – kontrapunktisch zum Röcheln eines altersschwachen Heizlüfters.
Winter beobachtete die Frau im Spiegel hinter der Theke. Da die Zeitung im Weg war, konnte er lediglich ein Paar schwarze Lederhandschuhe und den oberen Teil ihres Kopfes sehen. Die Handschuhe waren so eng, dass sich die Konturen ihrer Finger abzeichneten. Wie es schien, trug sie weder auffällige Ringe noch einen Ehering, aber genau ließ sich das nicht sagen. Durch die grelle Beleuchtung wirkte ihr platinblondes Haar beinahe weiß.
Nichts deutete darauf hin, dass sie in Begleitung war. Die drei freien Stühle waren dicht an den Tisch herangerückt, auf dem nur eine Tasse stand. Warum war sie dann hier? Vielleicht wartete sie auf jemanden, obwohl das um zwei Uhr morgens eher unwahrscheinlich war. Am Tag hätte sich diese Frage gar nicht gestellt, da wäre eine Frau, die um die Mittagszeit einen Kaffee trank, ein ganz normaler Anblick. Doch mitten in der Nacht allein in einem Lokal, das war etwas anderes. Vielleicht war sie durch die Clubs gezogen oder sie arbeitete im Schichtdienst, überlegte Winter. Es könnte natürlich auch sein, dass sie hin und wieder unter Schlaflosigkeit litt. Genau wie er.
»Wie immer?«
Er wandte den Blick vom Spiegel ab. Der Koch stand vor ihm und wischte sich die Hände an seiner fleckigen Schürze ab. Er sprach mit starkem Akzent und war kaum zu verstehen. Seinem dunklen Haar und der Hautfarbe nach zu schließen kam er aus dem südlichen Mittelmeerraum. Er war etwa Mitte fünfzig, groß und schlank und lief leicht gebeugt, als ob er sich für seine Körperlänge entschuldigen wollte.
»Wie immer«, antwortete Winter.
»Komplett?«
»Komplett.«
Eine gemurmelte Antwort beendete das Gespräch. Der Koch schenkte Kaffee ein, Winter gab zwei Portionen Zucker dazu und suchte sich dann einen Platz. Eigentlich zog es ihn nach ganz hinten, weil es dort wärmer war, aber dann siegte doch die Macht der Gewohnheit und er entschied sich für den Tisch am Fenster. Er beobachtete gerne, wie die Welt an ihm vorbeizog. Obwohl es draußen im Moment nicht viel zu sehen gab. Um diese Zeit war selbst in New York wenig los.
Winter zog seine Jacke aus, hängte sie über eine Stuhllehne und machte es sich bequem. Diese Jacke begleitete ihn schon seit Jahren. Außen Wildleder, innen Lammfell und so angenehm zu tragen wie ein paar gut eingelaufene Sneakers. Er holte sein Zippo-Feuerzeug heraus, klappte den Deckel auf und ließ es aufflammen. Einen Moment lang saß er einfach nur da und beobachtete die tanzende Flamme, dann klappte er den Deckel wieder zu. Klick, klack, klick. Das Rauchverbot war wirklich eine Zumutung.
Der Koch machte sich am Grill zu schaffen und sang wenig melodisch den Elvis-Song mit. Unbeholfen formte er die Worte, die er sich vermutlich nach dem Gehör eingeprägt hatte. Winter blendete ihn aus und wickelte sein Besteck aus der Serviette. Er legte Messer und Gabel sorgfältig vor sich auf den Tisch, dann schaute er aus dem Fenster und ließ seine Gedanken in die von Neonlichtern durchzogene Dunkelheit eintauchen.
Eine Weile saß er einfach nur da und starrte ins Leere. Er war jetzt seit acht Tagen in New York und hatte die örtliche Polizeibehörde bei der Jagd nach Ryan McCarthy unterstützt, einem Serienmörder, dessen Opfer junge Geschäftsmänner waren. Sosehr er die Stadt mochte, nach der Festnahme von McCarthy gab es für ihn keinen Grund, noch länger hierzubleiben. Seine nächste Station war Paris, wo es den nächsten Mörder zu stellen galt. So sah sein Alltag aus, seit er dem FBI den Rücken gekehrt hatte. Sobald ein Fall abgeschlossen war, kam schon der nächste. Ehrlich gesagt war es beim FBI nicht viel anders gewesen. Leider lebte er in einer Welt, der es an Monstern niemals mangeln würde.
Während er seinen Kaffee trank, ging ihm der Pariser Fall durch den Kopf. Er hatte schon eine grobe Vorstellung zum Vorgehen, aber noch keinen ausgereiften Plan. Die Akten, die er von der Polizei bekommen hatte, waren nicht sehr detailliert und warfen mehr Fragen auf, als Antworten zu geben. Das war nichts Neues. In den schriftlichen Berichten fehlten oftmals wichtige Einzelheiten, weil die Beamten, die sie verfassen mussten, heillos überarbeitet waren.
Das Geräusch eines weggeschobenen Stuhls holte ihn aus Paris zurück in das Lokal. Er sah im Fenster das Spiegelbild der blonden Frau. Sie lief den schmalen Gang zwischen den Tischen und der Theke entlang Richtung Tür. Sie bewegte sich elegant und geschmeidig.
Als Erstes fiel ihm auf, wie schmal sie war. Ihre Wangenknochen standen hervor und die Lederjacke war ihr etliche Nummern zu groß. Sie war keine blendende Schönheit, aber auch nicht unattraktiv. Ein bisschen Make-up hätte sicher einiges bewirkt. Er schätzte sie auf Mitte zwanzig und sie war in etwa so groß wie er, 1,75 Meter. Sie trug abgewetzte Levi’s und hatte den Reißverschluss der Jacke bis zum Kinn hochgezogen. Ihre Converse Chucks waren alt und ausgetreten.
Wieder fragte er sich, warum sie hier war. Ihre Kleidung bot kaum Anhaltspunkte – sie schien für die Arbeit ebenso geeignet wie für einen Kneipenbesuch. Falls Schlaflosigkeit der Grund war, hatte sie nach dem Aufstehen vermutlich die erstbesten Sachen angezogen, die sie zu fassen bekam. So hätte er es jedenfalls gemacht. Er sah sich ihr Spiegelbild genauer an und kam zu dem Schluss, dass sie nicht getrunken hatte. Sie lief sicher geradeaus und hatte ihren Körper gut unter Kontrolle. Auch stand kein Essen auf ihrem Tisch. Nach einer durchfeierten Nacht suchte man ein solches Lokal vor allem deshalb auf, um den Alkohol mit einer großen Portion Kohlehydrate zu absorbieren.
Im Grunde genommen spielte es keine Rolle, warum sie hier war. Er stand kurz vor der Abreise nach Paris und sie würde in Kürze wieder in die Nacht verschwinden. So würde es ablaufen. Das Leben bestand aus einer Vielzahl von Begegnungen, die gelegentlich bedeutsam waren, meistens jedoch nicht. Für einen kurzen Moment überschnitt sich ihr Lebenskreis mit seinem. Doch in einer Welt mit sieben Milliarden Menschen war es unwahrscheinlich, dass sich ihre Wege je wieder kreuzen würden.
Drei Schritte von der Tür entfernt, machte sie unvermittelt kehrt und blieb an seinem Tisch stehen.
»Darf ich?«
Sie blickte auf den leeren Stuhl, der ihm gegenüberstand. Winter brauchte beinahe eine geschlagene Sekunde, um zu begreifen, dass die Frage an ihn gerichtet war.
»Bitte, nur zu.«
Sie setzte sich mit einem verspielten, strahlenden Lächeln. Aus der Nähe betrachtet schien ihre Augenfarbe zu grün, um als natürlich durchzugehen. Interessant, sie kleidete sich ohne große Sorgfalt und verbarg ihre Augen hinter farbigen Kontaktlinsen. Ihr platinblondes, halblanges Haar war eindeutig gefärbt und wirkte wie mit der Küchenschere geschnitten. Sie starrte auf sein T-Shirt, das mit dem Bild eines toten Rockstars bedruckt war, auf die verschlissene Kapuzenjacke und seine weißen Haare. Dann legte sie die zusammengefaltete Zeitung auf den Tisch und darauf ihre behandschuhte Hand. Winter sah erst auf die Zeitung und dann in ihr Gesicht.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Jefferson.«
Damit hatte er nicht gerechnet. Er betrachtete sie genauer. Gesehen hatte er sie noch nie, da war er sich ganz sicher. »Wer sind Sie? Und vor allem: Woher kennen Sie meinen Namen?«
»Das behalte ich lieber für mich.«
»Gut, da Sie schon wissen, wer ich bin, könnten Sie mir auch Ihren Namen nennen.«
Die Frau sagte eine Weile gar nichts. Sie starrte ihn über den Tisch hinweg an, taxierte ihn, prüfte ihn. Winter wartete, bis sie etwas sagte.
»Also, ich hatte ja erwartet, dass Sie größer sind und eindrucksvoller. Aber so ist es ja meistens. Man macht sich eine Vorstellung von jemandem, und wenn man ihm dann gegenübersteht, ist es immer eine Enttäuschung.«
Winter schwieg und die Frau lachte.
»Ich habe auch ein bisschen Ahnung von Psychologie, Jefferson. Wenn man schweigt, fühlt sich der andere dazu genötigt, das Schweigen zu durchbrechen. Genau das läuft doch hier, stimmt’s? Sie treiben Psychospielchen mit mir und wollen mir auf den Zahn fühlen.«
Winter lächelte. »Was erwarten Sie denn? Da Sie wissen, wer ich bin, gehe ich davon aus, dass Ihnen auch mein Beruf bekannt ist.«
»Was haben Sie denn bisher so herausgefunden? Und tun Sie nicht so unschuldig. Ich weiß genau, dass Sie mich beobachtet haben, seit Sie hier reingekommen sind.«
»Das Gleiche könnte ich Sie fragen.«
»Ts, ts, ts«, machte die Frau und schüttelte langsam den Kopf. »Ich habe zuerst gefragt. Und ich will die Wahrheit hören. Glauben Sie mir, ich bin schon groß und vertrage sie.«
Den letzten Satz hatte sie absichtlich so bedeutungsschwer formuliert. Steckte hier etwas dahinter oder wollte sie sich nur wichtigmachen? Winter wartete ein paar Sekunden ab, falls sie noch etwas hinzufügen wollte, doch sie lächelte nur aufmunternd und sah ihn aus weit geöffneten Augen an. Jetzt konnte er den Rand ihrer gefärbten Kontaktlinsen erkennen.
»Sie sind eine Spielerin«, begann er. »So viel ist bis jetzt klar. Es geht immer um Zug und Gegenzug. Außerdem haben Sie einen Hang zum Narzissmus. Sie gehen davon aus, dass die Welt sich nur um Sie dreht, und treten hier als die große Rätselhafte auf, die von mir analysiert werden will.«
»Haben Sie in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Diese Beschreibung könnte auch auf Sie zutreffen.«
»Sie kennen mich doch gar nicht.«
»Da täuschen Sie sich aber. Ich weiß genau, wer Sie sind. Oder genauer gesagt: was Sie sind.«
»Und das wäre?«
»Sie sind ein unfertiges Projekt.«
Winter lachte. »Und was zum Teufel soll das bitte heißen?«
Die Frau antwortete nicht. Sie tippte mit den Fingerspitzen auf die Zeitung, hob dann den Kopf und blickte über seine Schulter hinweg in den Raum. Winter wartete darauf, dass sie weitersprach. Längere Gesprächspausen machten ihm überhaupt nichts aus. Auch der Umgang mit Verrückten war für ihn nichts Ungewohntes. Im Moment versuchte er herauszufinden, welcher Kategorie von Irren sie zuzuordnen war.
»Haben Sie sich schon mal gefragt, wie es ist, jemanden umzubringen?«, fragte sie.
»Nein.«
»Lügner. Es ist doch Ihr Job, sich in Serienmörder hineinzuversetzen. Das funktioniert nur, wenn man sich ihre Taten genau vorstellt.«
»Das mag schon sein, aber Sie sprechen von einem tatsächlichen Mord. Mein Beruf ist Lichtjahre davon entfernt.«
»Lügner.«
»Glauben Sie, was Sie wollen.«
An der Theke tat sich etwas. Winter wandte den Kopf und sah den Koch mit einem Teller in der Hand durch die niedrige Pendeltür kommen. Die Frau drehte sich ebenfalls in diese Richtung. Dann sah sie Winter an und wartete, bis sich ihre Blicke trafen.
»Wir könnten ihn umbringen«, flüsterte sie. »Das wär ein Spaß, was?«
Winter sagte nichts.
»Jeder bringt es fertig zu töten, wenn’s sein muss.«
»Da täuschen Sie sich. Jeder hat die Wahl, ob er einen Mord begeht oder nicht. Ein Täter muss nicht abdrücken, sondern er entscheidet sich dafür.«
Sie zuckte die Schultern. »Da werden wir wohl verschiedener Meinung bleiben, Jefferson.«
Der Koch trat an den Tisch und stellte den Teller ab. Winter bedankte sich abwesend und wandte sich dann wieder der Frau zu. Doch ehe er etwas sagen konnte, zog sie ein Küchenmesser aus ihrer Tasche und stand auf. Sie packte den Koch, zog ihn zu sich heran und bog mit der linken Hand seinen Kopf weit zurück. Ihre Augen funkelten und sie biss sich auf die Unterlippe. Dann atmete sie hörbar ein und rammte das Messer bis zum Griff in das Auge des Kochs. Entsetzen flammte in dessen unversehrtem Auge auf, dann wurde sein Gesicht schlaff und er sackte zu Boden. Als sein Körper auf den Fliesen aufschlug, sprang Winter auf. Doch bevor er in den Gang treten und sich auf die Frau stürzen konnte, war sie bereits mit einem schrillen Lachen zur Tür hinaus in die Nacht verschwunden.
2
Winter lief zur Tür und sah noch, wie sie um ein paar Autos herumrannte und um die nächste Straßenecke verschwand. Er blieb kurz stehen, dann kehrte er zu seinem Stuhl zurück, setzte sich wieder und zündete sich eine Zigarette an. Er inhalierte den Rauch tief und atmete ihn mit einem langgezogenen Seufzer wieder aus. Der Frau auf gut Glück allein hinterherzurennen war sinnlos. Außerdem wollte er den Tatort nicht unbeaufsichtigt zurücklassen, das Risiko, dass er von ahnungslos eintretenden Kunden kontaminiert wurde, war trotz der späten Stunde zu groß.
Der Koch lag nur wenige Meter von ihm entfernt in einer grotesken Verrenkung auf dem gefliesten Fußboden. Es war sinnlos, nach einem Puls zu fühlen. Er trug einen Ehering, es gab also vermutlich eine Frau, die auf ihn wartete. Ob er Kinder hatte? Irgendjemand da draußen würde ihn vermissen und um ihn trauern, so viel war sicher. Wieder einmal war ein Mensch zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
Er wusste genau, dass ihn keine Schuld am Tod des Kochs traf, doch wissen war nicht das Gleiche wie glauben. Natürlich war ihm klar, dass niemand für das Verhalten anderer zur Verantwortung gezogen werden konnte. Schließlich hatte er den Koch nicht erstochen. Das Verbrechen ging einzig und allein auf das Konto dieser Frau. Sie hatte sich entschlossen, so zu handeln, und ihre Tat konsequent umgesetzt.
Trotzdem blieb die ungute Erkenntnis, dass sie den Koch vermutlich deshalb getötet hatte, um seine, Winters, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Anders war diese Inszenierung nicht zu erklären. Ohne Publikum hätte das alles keinen Sinn ergeben. Warum hatte sie das getan? Und was hatte sie noch Grausames vor, um ihn auf sich hinzuweisen? Paris würde er wohl einstweilen aufschieben müssen. Denn erst wenn sie gefasst war, erschien es ihm ansatzweise vorstellbar, mit diesem schrecklichen Erlebnis abzuschließen.
Das Intro zu »Heartbreak Hotel« brachte Winter wieder zur Besinnung. Die Stimme von Elvis empfand er im Normalfall schon als Zumutung, aber jetzt konnte er sie überhaupt nicht ertragen. Er stand auf, stieg über die Leiche und trat hinter die Theke, wo er die Musik ausschaltete. Er nahm sich eine kleine Schale, um sie als Aschenbecher zu benutzen, ging dann zu dem Tisch, an dem zuvor die Frau Platz genommen hatte, und setzte sich.
Der einzige Beweis für ihre Existenz war die Kaffeetasse auf dem Tisch und ein Hauch von ihrem Duft, der sich nur noch erahnen ließ. Er fragte sich, ob das alles vielleicht nur Einbildung gewesen war. Prüfend strich er mit dem Finger über die Tasse. Sie war nicht mehr warm. Demnach hatte die Frau ohne etwas zu trinken so lange hier gesessen, dass er abkühlen konnte. Außerdem hatte sie Handschuhe getragen und somit weder DNA noch Fingerabdrücke hinterlassen.
Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück und versuchte ihre Perspektive einzunehmen. Der Platz war geschickt gewählt. Die Tür an der Rückwand war vermutlich ein Hinterausgang. Wenn man schnell verschwinden wollte, war es immer wichtig, sich mehrere Optionen offenzuhalten. Zudem hatte sie von hier aus sämtliche Tische und die Eingangstür gut im Blick. Egal wo er sich hingesetzt hätte, sie konnte ihn von ihrem Platz ausgezeichnet beobachten.
Wie auch immer, Tatsache war, dass er hier nicht im Alleingang ermitteln konnte. Er brauchte für die Recherche Zugang zu den Datenbanken der Polizei und ein Auto.
Letzteres war am einfachsten zu organisieren. Dazu müsste er lediglich bei Avis oder Hertz anrufen, das schnellste Fahrzeug reservieren, das sie im Angebot hatten, und es vor Ort in Empfang nehmen. Die Sache mit den Daten war schwieriger zu regeln, aber nicht unmöglich. Nach Abschluss des McCarthy-Falls hatte Carla Mendoza noch gesagt, dass sie sich gern für seine Arbeit revanchieren würde. Dem Tonfall nach zu schließen, war das eine reine Anstandsfloskel gewesen. Andererseits war sie Mordermittlerin. Wenn sie erfuhr, was hier passiert war, würde sie sich hoffentlich sofort einschalten.
Winter drückte seine Zigarette in dem Schälchen aus und holte sein Handy hervor. Er suchte Mendozas Mobilnummer heraus und wählte sie. Es meldete sich nur die Mailbox. Kein Wunder. Sie hatten acht lange Tage gebraucht, bis sie Ryan McCarthy aufgespürt hatten, jetzt holte sie wahrscheinlich ihren wohlverdienten Schlaf nach.
Er tippte mit dem Telefon gegen sein Kinn und überlegte, was nun zu tun war. Hätte er ihre Festnetznummer, würde er sie darüber anrufen. Doch leider hatte sie ihm die nie gegeben. Er wusste, dass sie in Brooklyn wohnte, kannte aber die genaue Adresse nicht. Sonst wäre er einfach in ein Taxi gestiegen und zu ihr nach Hause gefahren. Noch einmal ging er im Kopf alle Optionen durch und überlegte, ob er die Sache vielleicht doch allein durchziehen konnte. Aber das war unmöglich. Er brauchte Carla Mendoza oder genauer gesagt die Ressourcen, auf die sie Zugriff hatte. Er versuchte sie noch einmal anzurufen, erreichte jedoch wieder nur ihre Mailbox. Er legte noch während der Ansage auf und wählte dann den Notruf 911.
»911, welchen Notfall möchten Sie melden?«, fragte eine Männerstimme. Der Aussprache nach zu urteilen stammte der Mitarbeiter aus dem Mittleren Westen.
»Ich möchte, dass Sie eine Nachricht an Sergeant Carla Mendoza weiterleiten. Sie arbeitet in der Zentrale des New York City Police Department, Police Plaza 1. Richten Sie ihr aus, dass sie umgehend bei Jefferson Winter anrufen soll. Und sagen Sie dazu, dass es sehr dringend ist.«
»Sir, Sie haben 911 gewählt. Wir sind nicht dafür zuständig, Nachrichten zu übermitteln.«
»Bei allem Respekt, aber genau das ist Ihre Aufgabe. Sie nehmen Informationen von Anrufern entgegen und leiten sie an die zuständigen Stellen weiter – je nach Bedarf an Polizei, Notarzt oder Feuerwehr. Diesmal ist die Nachricht für die Polizei bestimmt.«
»Sir, ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Missbrauch des Notrufs 911 strafbar ist.«
»Schön für Sie. Hören Sie, wenn Sie Sergeant Mendoza erreichen, wird Sie Ihnen die Ohren volljammern, dass es mitten in der Nacht ist und sie nicht gestört werden will. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sie anfängt, Sie anzuschreien oder sogar zu fluchen. Sagen Sie ihr, dass ein Mord geschehen ist und meine Fingerabdrücke überall am Tatort sind. Übrigens befinde ich mich gerade in einem Imbisslokal namens O’Neal’s drüben in der Lower East Side.«
Winter legte auf, steckte sein Telefon in die Hosentasche, ging dann noch einmal zur Theke und holte sich ein sauberes Messer. Auf dem Weg zurück zu seinem Tisch stieg er wiederum vorsichtig über die Leiche, um nicht in die Blutlache zu treten. Anschließend setzte er sich hin und begann zu essen.
Die Frau hatte ihre Zeitung dagelassen. Sie lag sorgfältig zusammengefaltet auf dem Tisch. Winter schlug sie auf und breitete sie vor sich aus. Hartwood Gazette stand in geschwungenen Lettern oben auf der ersten Seite und gleich darunter stand in fetten Lettern die Überschrift »Ehepaar brutal ermordet«. Der Artikel war von einem gewissen Granville Clarke verfasst. Winter schaute genauer hin und stellte fest, dass das Papier sich bereits gelblich verfärbt hatte. Die Zeitung stammte laut Erscheinungsdatum von Januar vor sechs Jahren.
Rechts neben dem Beitrag war ein Bild der Opfer abgedruckt. Sie sahen jung und gesund aus und in ihren Gesichtern spiegelte sich der Traum von einer schönen Zukunft. Es war kein Schnappschuss, sondern ein professionelles Porträtfoto. Obwohl es etwas steif und gestellt wirkte und die beiden nur verhalten lächelten, konnte man erkennen, dass sie glücklich miteinander gewesen waren. Laut Überschrift hießen sie Lester und Melanie Reed.
Im Text stand, dass die beiden Anfang zwanzig waren, als sie umgebracht wurden. Beide hatten ihr kurzes Leben in Hartwood verbracht. Erwähnt wurde auch das Sheriff Department des Monroe County, womit klar war, dass Hartwood im nördlichen Teil des Bundesstaates New York lag. Lester hatte im Laden seiner Eltern gearbeitet und Melanie als Lehrerin in der örtlichen Grundschule. Erst ein Jahr zuvor hatten sie geheiratet. Ihr gemeinsames Leben hatte gerade erst begonnen, als es jäh zu Ende ging.
Der Artikel glänzte weniger mit Fakten als mit schmückendem Beiwerk und machte auf Winter den Eindruck, als ob er in großer Eile verfasst worden wäre. Wie die meisten Morde war vermutlich auch dieser kurz vor Redaktionsschluss geschehen. Um diese Zeit herrschte immer großes Chaos und niemand kam dazu, genauere Informationen zu beschaffen.
Kein Zweifel, diese Zeitung war mit Bedacht auf dem Tisch hinterlassen worden. Wäre es die neueste Ausgabe der New York Times gewesen, dann hätte Winter es für einen Zufall halten können. Aber das konnte nicht sein. Die Zeitung war uralt. So etwas ließ man nicht einfach so herumliegen. Sie war ganz gezielt hier platziert worden. Während ihrer Unterhaltung hatte die Frau immer wieder mit den Fingern auf das Blatt getippt, um ihn darauf hinzuweisen.
Rasch blätterte er die übrigen Seiten durch. Aber der einzig interessante Beitrag war der über den Doppelmord. Ansonsten ging es nur um typische Kleinstadtthemen: Geburten, Eheschließungen, Todesfälle, lokale Ereignisse. Sie wollte ihn also über den Doppelmord informieren. Aber wozu? Die einzig plausible Erklärung schien ihm, dass sie etwas damit zu tun hatte. Angesichts ihrer brutalen Attacke auf den Koch war das nicht von der Hand zu weisen.
Er holte sein Telefon hervor und googelte rasch. Die Hartwood Gazette besaß keine eigene Website. Stattdessen stieß er auf den Rochester Democrat & Chronicle. In Rochester hatte der zuständige Sheriff sein Büro, also lag es nahe, hier weiterzusuchen. Leider reichte das Online-Archiv nicht weit genug zurück und war somit auch keine Hilfe.
Winter war noch beim Essen, als ein Polizeifahrzeug mit heulender Sirene angerast kam und die dunkle Nacht in blau-rot flackerndes Licht tauchte. Zwei Beamte sprangen heraus, die Pistole im Anschlag. Mendoza war nicht dabei, was ihn nicht überraschte. Das siebte Polizeirevier war nur wenige Straßen entfernt und die beiden kamen vermutlich von dort. Mendoza hingegen musste sich erst aus Brooklyn auf den Weg machen und würde sicher noch eine Weile brauchen, ehe sie hier war.
Die Glocke läutete dumpf, als die Tür aufgerissen wurde. Der Polizist, der am Steuer gesessen hatte, stürmte zuerst herein, dicht gefolgt von seinem Kollegen, der ihm Deckung gab. Als er die Leiche sah, schrie er Winter an: »Auf den Boden! Hände hinter den Rücken!«
Doch Winter schüttelte den Kopf. »Vergessen Sie’s.«
Der Polizist warf ihm einen Blick zu, wie er ihn schon gewohnt war: ungläubig, perplex und wütend zugleich. Der Mann war kleiner als sein Kollege, aber offenbar älter und erfahrener. Mitte vierzig, schwarze Haare, blaue Augen und permanent gerunzelte Stirn. Dem Schild an seiner Jacke zufolge hieß er Pritchard. Der Name seines Partners war Collins. Winter schnitt ein Stück von dem Spiegelei auf seinem Teller ab und schob es in den Mund. Pritchard legte seine Waffe an und zielte auf ihn.
»Ich sagte: Auf den Boden.«
»Ansonsten? Wollen Sie mich erschießen?« Wieder schüttelte er den Kopf. »Sicher nicht. Genauso wenig, wie Sie herkommen und mich von diesem Stuhl zerren werden. Wir befinden uns an einem Tatort, und wenn Sie den kontaminieren, kriegen Sie richtig Ärger. Bei mir ist das egal, denn ich war sowieso hier. Wenn Sie also nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern zu Ende frühstücken, da ich wohl so schnell nichts wieder kriegen werde, schätze ich mal.«
Er schob ein Stück Kartoffelrösti auf seine Gabel und kaute herzhaft. Pritchard stand mit offenem Mund wie erstarrt da, die Waffe immer noch auf Winter gerichtet. Dann ließ er sie sinken und besprach sich mit Collins.
Während sie diskutierten, beendete Winter hastig sein Frühstück und spülte es mit einem letzten Schluck Kaffee hinunter. Er wischte sich Mund und Hände an der Serviette ab, faltete diese sorgfältig zusammen und legte sie auf den Tisch. Dann lehnte er sich zurück und kippte mit seinem Stuhl ein Stück nach hinten. Am meisten machte ihm die Sinnlosigkeit des Mordes zu schaffen. Es war so himmelschreiend ungerecht. Der Koch hätte noch viele Jahre lang Burger braten und Elvis-Songs mitsingen sollen. Stattdessen wurde sein Leichnam nun für den Sarg vermessen und schließlich den Flammen übergeben.
Er schaute die beiden Polizisten so lange an, bis sie es bemerkten und verstummten. Wortlos erhob er sich und stieg über den toten Koch hinweg. Dann drehte er sich um, nahm die Hände auf den Rücken und wartete, dass ihm Handschellen angelegt wurden.
3
Die Handschellen klickten und Pritchard belehrte ihn routinemäßig über seine Rechte. Winter blendete ihn aus. Nach seiner Schätzung würde es etwa eine halbe Stunde dauern, bis man Mendoza benachrichtigt und hierher beordert hätte. Seit seinem Notruf waren fünf Minuten vergangen. Blieben also nur noch fünfundzwanzig Minuten. Er musste daher nichts weiter tun als sich kooperativ zu verhalten und nicht unangenehm aufzufallen.
Pritchard war inzwischen fertig mit seinem Monolog und fragte zum Abschluss, ob Winter nun über seine Rechte Bescheid wisse. Nachdem er dies bejaht hatte, sah Collins seinen Einsatz gekommen. Er packte Winter am Arm, führte ihn nach draußen und schob ihn auf den Rücksitz des Polizeifahrzeugs. Im Innenraum stank es, als ob sich kürzlich jemand übergeben hätte. Die Ledersitze waren zwar sauber, rochen aber immer noch suspekt. Zwischen den Vordersitzen und der Rückbank verlief eine Trennwand. Durch die dicke Scheibe aus Plexiglas hatten ihn die Beamten gut im Blick, und ein seitlich angebrachtes Gitter erlaubte es ihnen, mit ihm zu sprechen und ihn zurechtzuweisen, falls er Ärger machte. Türgriffe und Fensterheber waren abmontiert.
Ein zweites Polizeifahrzeug bog mit eingeschalteten Signalleuchten in die Straße ein und kam frontal vor dem Wagen zum Stehen, in dem Winter saß. Durch das Plexiglas war der Blick durch die Frontscheibe zwar leicht verzerrt, doch er konnte einigermaßen erkennen, was vor sich ging. Pritchard und Collins waren ausgestiegen, gingen auf die beiden uniformierten Beamten zu und schüttelten ihnen die Hand. Sie wechselten ein paar Worte, es wurde gestikuliert und gelacht. Pritchard informierte die beiden Neuen offensichtlich darüber, was sich im Lokal abgespielt hatte.
Als das Gespräch beendet war, kehrten seine beiden Bewacher in den Wagen zurück. Pritchard ließ den Motor an, gab Gas und fuhr rückwärts aus der engen Straße heraus. Nach fünfzig Metern riss er das Lenkrad nach links und setzte zum Wenden zurück in eine Einfahrt. Sein Fahrstil war so forsch, dass Winter fast vom Rücksitz rutschte. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, fuhr der Wagen vorwärts und beschleunigte stark.
»So ein Arschloch, was?«
Pritchard antwortete nicht sofort, sondern drehte sich nach hinten, um Winters Blick aufzufangen.
»Ja, ein richtiger Scheißkerl.«
Es störte ihn nicht, wenn sie ihn beleidigten. Das war er aus seiner Kindheit gewohnt. Nach der Verhaftung seines Vaters war seine Mutter ständig auf der Flucht gewesen im vergeblichen Versuch, die Schande hinter sich zu lassen. Zwischen seinem elften und siebzehnten Lebensjahr hatten sie in fünfzehn Städten in zehn verschiedenen Bundesstaaten gewohnt. Und in jeder neuen Schule hatte ihn neuer Ärger erwartet.
Pritchard und Collins wandten sich anderen Themen wie den Football-Ergebnissen der New York Giants zu und wenige Minuten später erreichten sie den Parkplatz vor dem roten Ziegelgebäude des siebten Polizeireviers. Trotz der nächtlichen Stunde war das Areal hell erleuchtet. Die Hintertür des Wagens wurde aufgerissen und Winter stieg langsam aus. Einen Augenblick blieb er stehen, atmete die Nachtluft ein und lauschte dem Großstadtlärm, der durch die Dunkelheit drang. Er rechnete fest damit, in zwanzig Minuten wieder auf freiem Fuß zu sein.
»Los, Bewegung!«
Pritchard stieß ihn an und sie liefen in Richtung Eingang. Die erkennungsdienstliche Behandlung nahm zwanzig Minuten in Anspruch: Foto, Fingerabdrücke, Papierkram. Er behielt die Uhr im Auge und versuchte künstlich Zeit zu schinden, als diese zwanzig Minuten so gut wie um waren. Von Mendoza immer noch keine Spur. Nach achtundzwanzig Minuten wurde er in einen Vernehmungsraum geführt, wo er sich auf einen Stuhl setzen musste. Die Tür schloss sich wieder und er blieb allein zurück. Er hatte nicht damit gerechnet, dass es so weit kommen würde.
Mendoza hätte längst da sein müssen. Für den Dispatcher in der Leitstelle war es kein Problem, sie zu kontaktieren, schließlich hatte er ihm ausreichend Informationen geliefert. Wo zum Teufel blieb sie also? Sie ausfindig zu machen war nun wirklich nicht besonders anspruchsvoll. Ein einziger Anruf in der Polizeizentrale hätte bestätigt, dass sie tatsächlich dort arbeitete. Die Kollegen hätten ihre Privatnummer parat gehabt und sie umgehend benachrichtigt. Selbst wenn sie ihr Handy ausgeschaltet hatte, war ein Festnetzklingeln in der Regel nicht zu überhören. Vorausgesetzt, sie hatte den Telefonstecker nicht gezogen.
Auch an diese Möglichkeit hatte Winter gedacht. In einem solchen Fall hätte man einen Streifenwagen vorbeigeschickt und so lange bei ihr geklingelt, bis sie die Tür geöffnet hätte. Um diese Nachtzeit war auf der Brooklyn Bridge und den Straßen kaum Verkehr. Insofern würde die Fahrt von Brooklyn bis hierher nicht mehr als zwanzig Minuten dauern, wahrscheinlich sogar weniger.
Er versuchte durchzuatmen. Sie würde schon noch kommen. Dann kam ihm in den Sinn, dass sie auch bei ihrem Freund übernachten könnte. Oder bei ihrer Freundin. Aber das war eigentlich unwahrscheinlich. Während der gesamten Zeit ihrer Zusammenarbeit hatte er keinerlei Anzeichen dafür bemerkt, dass sie in einer Beziehung lebte, welcher Orientierung auch immer. Nie telefonierte sie in scheinbar unbeobachteten Momenten oder tippte verstohlen kurze Textnachrichten. Sie trug auch keine Ringe. Falls sie verheiratet war, dann zeigte sie es nicht öffentlich. Arbeit und Privatleben konnte sie sehr gut trennen, so viel war sicher. Trotzdem hätte Winter von einer etwaigen Liaison etwas mitbekommen, davon war er überzeugt. Selbst wenn ihm die entscheidenden Anzeichen entgangen waren, hätten ihre Kollegen ganz bestimmt etwas bemerkt. Immerhin war sie tagtäglich von Kriminalermittlern umgeben und da ließ sich so etwas nur schwer verbergen. Geheimnisse existierten in einem solchen Umfeld praktisch nicht. Deshalb hätte in ihrer Dienststelle auf jeden Fall jemand gewusst, wo sie zu finden war.
Er lehnte sich an und versuchte, es sich einigermaßen bequem zu machen. Seine Hände waren immer noch hinter dem Rücken gefesselt und die Arme wurden ihm allmählich taub. Er streckte sich und versuchte durch Schütteln die Durchblutung wieder anzuregen. Dabei sah er sich um. Es sah aus wie in jedem anderen der zahllosen Vernehmungsräume, in denen er schon gearbeitet hatte. Auf dem Fußboden billig aussehender, ausgetretener Linoleumbelag, die Wände in tristem Grau gestrichen. Der Tisch war im Boden verschraubt und auf jeder Seite standen zwei Stühle. Der Beschuldigte und sein Rechtsbeistand wurden mit dem Gesicht zu einem großen Einwegspiegel platziert, während die Vernehmer diesem den Rücken zukehrten.
Der Raum hinter dem Spiegel war garantiert besetzt. Vermutlich mit mehr als einer Person. Winter hatte oft genug auf der anderen Seite des Vernehmungstisches gesessen, um zu wissen, wie so etwas ablief. Im Moment waren alle damit beschäftigt, ihn genau zu beobachten und Strategien zu diskutieren, wie man bei der Vernehmung so viel wie möglich in Erfahrung bringen konnte. Sie legten sich einen Schlachtplan zurecht und hielten Ausschau nach Schwachstellen, die sie ausnutzen konnten.
Er hatte das starke Bedürfnis aufzustehen und vor den Spiegel zu treten. Das hatte er unzählige Male erlebt. Nahezu alle Verdächtigen – wenn sie nicht gerade am Tisch oder Fußboden fixiert waren – standen auf, stellten sich vor den Spiegel und starrten hinein. Die meisten von ihnen klopften gegen das Glas. Obwohl sie sicher genügend Krimis gesehen hatten und somit Bescheid wussten, wollten sie sich offenbar vergewissern, dass sich dahinter tatsächlich noch ein Raum befand, von dem aus sie beobachtet wurden.
Die Minuten vergingen und ihn überkam ein Anflug von Angst. Was, wenn er es übertrieben hatte und Mendoza nicht erreichbar war? In dem Fall hätte er möglicherweise ein echtes Problem. So eine Vernehmung dauerte nicht ewig. Sobald sie abgeschlossen war, würde man ihn hinunter in eine Zelle bringen, und diese Aussicht beunruhigte ihn mehr als alles andere. Er hatte berufsbedingt genügend Gefängnisse von innen gesehen, um zu wissen, dass er mit seinen 1,75 Metern, nicht ganz 65 Kilogramm und seiner Schwäche in puncto Selbstverteidigung dort nichts zu lachen hätte.
Im Moment war er nicht nur der Hauptverdächtige, sondern zudem der einzige. Genau das war sein Problem. Aus welchem Grund sollte die Polizei nach der tatsächlichen Täterin fahnden, wenn sie schon jemanden in Gewahrsam hatte? Alles lief auf den Weg des geringsten Widerstands hinaus. Wenn sich der Mensch Arbeit vom Hals halten konnte, dann tat er das in aller Regel. Und wenn er dazu noch Nachtdienst hatte, war das mit Sicherheit so.
Winter holte tief Luft und versuchte nicht daran zu denken. Er konnte den Lauf der Dinge nicht beeinflussen, musste sich also auch keine Gedanken darüber machen. Alles, was er tun konnte, war abzuwarten und sich überraschen zu lassen, was als Nächstes auf ihn zukam. Am Ende würde die Wahrheit stehen – egal ob mit Mendoza oder ohne sie. Er rutschte auf seinem Stuhl herum beim Versuch, eine bequeme Haltung zu finden, und schüttelte noch einmal die Arme, um die Blutzirkulation in Gang zu bringen. Dann schloss er die Augen und zählte die Sekunden.
4
Die Tür ging auf und ein dunkelhäutiger Beamter kam herein. Alles an ihm war reiner Durchschnitt: mittelgroß, normale Statur und eines von den Gesichtern, in die man kein zweites Mal blickt. Dass er keine Uniform trug, wies ihn als Kriminalermittler aus. Sein Anzug war ein schlecht sitzendes Modell von der Stange, marineblau und zerknittert. Seine rote Krawatte hing leicht schief. In der linken Hand hielt er Papier und Stift und in der rechten einen schmalen Hefter und ein kleines digitales Aufnahmegerät.
Er nahm ihm gegenüber Platz, legte den Hefter und das Aufnahmegerät auf den Tisch, drückte auf die rote Taste und nahm die üblichen Formalien auf – Datum, Uhrzeit und dass Winter unter Mordverdacht stand. Er nannte seinen Namen, Darryl Hitchin, und gab als Dienstrang Sergeant an.
Hitchin schob ein kopiertes Blatt über den Tisch und Winter beugte sich nach vorn, um es sich durchzulesen. Langsam und in aller Ruhe. Es war wieder die Standardbelehrung über seine Rechte. Die hatte er schon so oft gesehen, dass er den Text auswendig hätte aufsagen können. Trotzdem studierte er ihn, als ob es die wichtigsten Informationen wären, die er je bekommen hatte. Er ließ die Handschellen hinter seinem Rücken klirren, um Hitchin darauf aufmerksam zu machen.
»Wenn ich das unterschreiben soll, dann müssen Sie mir die schon abnehmen.«
»Natürlich, aber danach kommen sie gleich wieder dran.«
»Ernsthaft? Sehe ich so gefährlich aus?«
»Aussehen kann täuschen.«
Der Beamte gab sich gelassen, doch Winter ließ sich davon nicht täuschen. Innerlich triumphierte er vermutlich. Schließlich hatte er einen Mordverdächtigen vor sich sitzen, der sich ohne Anwalt vernehmen lassen wollte. So etwas passierte nicht alle Tage. Zunächst hatte Winter in Erwägung gezogen, einen Rechtsbeistand einzufordern, damit dieser veranlassen konnte, dass Mendoza einbezogen wurde. Das Problem war die nächtliche Stunde. Falls der Anwalt sich verspätete, würde man ihn vielleicht schon vorher in eine Zelle bringen. Ganz abgesehen von der Sorge um die eigene Sicherheit würde das einen erneuten Zeitverlust mit sich bringen. Je umfassender die Maßnahmen gegen ihn ausfielen, desto länger würde es dauern, da wieder herauszukommen. Jede einzelne Minute dieser idiotischen Aktion war verlorene Zeit. Auf diesen ganzen Unsinn hätte er liebend gern verzichtet und die Zeit konstruktiver genutzt, zum Beispiel um etwas über die Reed-Morde herauszufinden.
Hitchin stand auf, ging um den Tisch herum und schloss die Handschellen auf. Es war ein befreiendes Gefühl, sie loszuwerden, wenn auch nur vorübergehend. Das Metall hatte unangenehm gegen seine Knochen gedrückt und Abdrücke auf der Haut hinterlassen. Winter rieb sich die Handgelenke, griff dann zum Stift und unterschrieb das Formular. Statt die Hände wieder hinter den Rücken zu legen, streckte er sie nach vorn aus. Hitchin starrte ihn nur wortlos an.
»Kommen Sie«, sagte Winter. »Ich bin die Ruhe in Person. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie Ihre Kollegen. Bisher war ich ein Gefangener wie aus dem Bilderbuch. Null Stress.«
Hitchin sah ihn an. Er ließ seinen Blick von den weißen Haaren über die Kapuzenjacke und die abgewetzten Jeans bis hinunter zu den ausgetretenen Sneakers gleiten. Dann legte er ihm die Handschellen an, ging zurück zur anderen Tischseite und setzte sich wieder.
Winter wartete, bis er wieder Platz genommen hatte, und fragte dann: »Wie hieß der Koch eigentlich?«
»Wie bitte?«
»Der tote Koch, wie war sein Name?«
»Was geht Sie das denn an?«
»Weil es so sinnlos ist, dass er nicht mehr lebt. Er war nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort.«
Hitchin hob fragend eine Augenbraue.
»Keine unnötige Aufregung. Das war kein Geständnis. Nicht mal ansatzweise.« Er überlegte kurz. »Ich weiß schon, wie das hier läuft: Sie stellen die Fragen und ich beantworte sie. Von daher kann ich nachvollziehen, dass Sie unsicher sind, ob Sie mir den Namen nennen dürfen.«
Hitchin beobachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen von der anderen Seite und sagte kein Wort.
»Okay, ich erklär’s noch mal mit ganz einfachen Worten. Wenn Sie meine Frage beantworten, werde ich Ihnen ganz bereitwillig alles sagen, was Sie von mir wissen wollen. Egal was, ich erzähl es Ihnen. Auch wenn Sie den ganzen Tag mit mir plaudern wollen, ist mir das recht. Falls Sie mir jedoch keine Antwort auf meine Frage geben, dann muss ich leider von meinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen und Sie erfahren von mir null Komma nichts.« Er machte eine Pause, lächelte und wartete, bis Hitchin ihn ansah. »Also, wie sieht’s aus? Ist doch nur eine klitzekleine Frage. Was kann das schon schaden?«
Der Beamte saß einen Moment lang schweigend da, schlug dann seine Akte auf und blätterte darin. Sie war noch nicht sehr umfangreich.
»Er hieß Omar Harrak. Ursprünglich stammte er aus Marokko und lebte seit fast zehn Jahren in den USA. Verheiratet, zwei Kinder – ein Mädchen und ein Junge. Bei der Einwanderungsbehörde registriert. Hat vor reichlich vier Jahren seine Greencard bekommen. Keine Vorstrafen, nicht einmal ein Verkehrsdelikt.«
Winter schloss die Augen und flüsterte den Namen mehrmals vor sich hin. In Gedanken sah er noch einmal den Moment vor sich, als Omar erstochen wurde. Er öffnete die Augen und sah hinüber zu Hitchin. »Danke.«
»Jetzt sind Sie an der Reihe. Was wollten Sie mitten in der Nacht in diesem Lokal?«
Winter antwortete nicht. Stattdessen stand er auf und trat vor den Einwegspiegel, wohl wissend, dass Hitchin ihn mit wachsamem Blick verfolgte. Dass dieser ihn nicht umgehend anbrüllte, sich sofort wieder hinzusetzen, bestätigte seinen Verdacht. Er betrachtete kurz sein Spiegelbild und sah, wie seine Mundwinkel ein leichtes Grinsen umspielte. Dann schlug er heftig gegen die Scheibe.
»Kommen Sie raus, Mendoza! Ich weiß genau, dass Sie da drin sind!« Er hämmerte erneut an das Glas und das dumpfe Geräusch schallte durch den Raum. »Ich zähle jetzt bis zehn und dann komme ich rüber und hole Sie. Eins, zwei, drei.«
»Hinsetzen!« Hitchin war aufgesprungen und mit wenigen Schritten bei ihm.
»Vier, fünf, sechs.«
Eine schwere Hand landete auf seiner Schulter und schob ihn zurück an den Tisch. Hitchin drückte ihn unsanft auf den Stuhl, setzte sich dann wieder und starrte ihn vorwurfsvoll an.
»Ich habe Sie etwas gefragt. Was wollten Sie in dem Lokal?«
Winter lächelte ihn verhalten an und wandte dann den Blick zur Tür. »Sieben, acht, neun, zehn«, flüsterte er.
5
Die Tür zum Vernehmungsraum öffnete sich und diesmal war es tatsächlich Mendoza. Sie hatte ihre schwarzen Locken wie üblich zum Pferdeschwanz gebunden und ihr olivbrauner Teint erinnerte an den längst vergangenen Sommer. Sie sah noch verärgerter aus als üblich, was zweifelsohne daran lag, dass sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde, um sich mit Winter zu beschäftigen.
Langsam durchquerte Mendoza den Raum. Es war jetzt noch nicht einmal halb vier Uhr morgens und sie sah trotzdem tadellos aus. Ihre Kleidung war kein bisschen zerknittert und ihre Schuhe aus schwarzem Lackleder glänzten. Die linke Seite ihrer Jacke wurde vom Schulterhalfter für ihre Dienstwaffe leicht ausgebeult. Bei ihrer ersten Begegnung hatte er sie gleich als Streberin abgestempelt, eine, die den Wortführerinnen der Schule immer die Hausaufgaben gemacht hatte, um dazuzugehören. Doch er hatte sich getäuscht. Carla Mendoza scherte sich kein bisschen darum, was andere von ihr dachten.
Mendoza blieb neben Hitchin stehen und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich übernehme. Danke, Sergeant.« Ihr Akzent klang ganz nach Brooklyn, hart und drohend. Obwohl sie nicht rauchte, hörte sich ihre Stimme so rau an, als würde sie täglich mehrere Schachteln Zigaretten inhalieren.
Hitchin stand auf und schnaubte: »Ach so? Na dann viel Spaß.«
Mendoza setzte sich auf den Stuhl, von dem ihr Kollege soeben aufgestanden war, und wartete, bis er den Raum verlassen hatte. »Warum waren Sie in dem Lokal?«
»Ich habe gefrühstückt.«
»Um zwei Uhr morgens?«
»Meine innere Uhr ist völlig aus dem Takt. Nachts bin ich wach wie am helllichten Tag. Eindeutig ein Nachteil, wenn man ständig um die halbe Welt fliegt.«
»Und warum waren Sie gerade im O’Neal’s? Der Laden ist ja ziemlich abgelegen.«
»Ich habe ihn vor ein paar Tagen zufällig entdeckt. Da bin ich in der Nacht aufgewacht, hatte Hunger und ging los, um etwas zu essen aufzutreiben – einfach so, ohne Plan. Weil das Essen so gut war, bin ich in der nächsten Nacht wiedergekommen und in der darauffolgenden auch.«
»Wenn es Ihnen dort so gut geschmeckt hat, wie Sie sagen, warum haben Sie dann den Koch getötet?«
»Omar«, korrigierte sie Winter. »Sein Name war Omar.«
Mendoza nickte kurz. »Okay, warum haben Sie Omar also umgebracht?«
»Ich habe ihn nicht umgebracht.«
»Wenn Sie es nicht gewesen sind, wer war es dann?«
Winter zögerte. Das war der heikelste Teil. Er konnte es immer noch nicht fassen, dass Omar direkt vor seinen Augen erstochen wurde. »Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen einfach berichte, was passiert ist, und dann sehen wir weiter«, schlug er vor.
Mendoza lehnte sich zurück. »Ich gebe Ihnen eine halbe Minute Zeit, mich zu überzeugen.«
Winter hielt kurz inne, sortierte mit geschlossenen Augen seine Gedanken und berichtete dann, was er erlebt hatte – von dem Moment an, als er das Lokal betreten hatte, bis zu dem Augenblick, als die Frau in die dunkle Nacht verschwand. Während er sprach, liefen die Ereignisse vor seinem inneren Auge noch einmal bis ins kleinste Detail ab. Er roch das Fett, hörte den röhrenden Heizlüfter und den Gesang von Elvis. Als er seine Schilderung beendet hatte, öffnete er die Augen. Es hatte zwar länger gedauert als eine halbe Minute, aber Mendoza hatte ihn ausreden lassen. Die Skepsis war ihr deutlich anzusehen. Sie legte die Stirn in Falten und schüttelte langsam den Kopf.
»Und Sie erwarten ernsthaft, dass ich Ihnen das alles glaube?«
Winter antwortete nicht.
»Sie wollten jetzt eigentlich im Flugzeug nach Rom sitzen.«
»Ich fliege erst um sechs. Übrigens nicht nach Rom, sondern nach Paris.«
»Nebensächlich. Wissen Sie, ich erinnere mich noch sehr genau an unser letztes Gespräch. Darin habe ich Ihnen gesagt, dass es mir lieber wäre, wenn wir uns nicht so bald wiedersehen würden. Und das war mein voller Ernst.«
»Tja, das habe ich nun ganz anders im Gedächtnis. Ich weiß noch, wie Sie mir Ihren ewigen Dank für meine Unterstützung bei der Jagd nach Ryan McCarthy ausgesprochen haben. Wie haben Sie es gleich formuliert? Wenn Sie mal irgendetwas für mich tun könnten, sollte ich einfach durchklingeln?«
»Von ›ewigem Dank‹ war ganz bestimmt nicht die Rede. Und die Formulierung ›durchklingeln‹ würde ich niemals verwenden.«
»Mir ist schon klar, dass das alles sehr merkwürdig erscheint. Aber ich weiß auch, dass Sie mich nicht für schuldig halten.«
Mendoza schüttelte den Kopf. »Ich weiß nur, dass Sie denken wie ein Serienmörder. Das war zwar durchaus hilfreich bei der Suche nach Ryan McCarthy, aber gleichzeitig auch einigermaßen unheimlich.« Sie machte eine kurze Pause. »Aber es könnte ja auch sein, dass in Ihrem Kopf irgendetwas ausgehakt hat und Sie ihn deshalb erstochen haben.«
Winter lachte. »Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder?«
Mendoza schwieg.
»Ich habe Omar nicht umgebracht. Wenn ich der Täter wäre, hätte ich mich doch völlig anders verhalten. Erstens hätte ich bestimmt nicht vor Ort gewartet, bis die Polizei anrückt. Und ich hätte mir ein vernünftiges Alibi ausgedacht. Davon können Sie ausgehen. Und glauben Sie mir, das wäre absolut wasserdicht gewesen.«
»Und was soll ich davon halten, wenn Sie so etwas sagen?« Mendoza beugte sich nach vorn. »Jetzt werden Sie mir bestimmt gleich ein Dutzend unterschiedliche Methoden beschreiben, wie Sie den Koch hätten töten können, ohne dass es Ihnen nachzuweisen wäre. Und weshalb? Weil Sie sehr ausführlich darüber nachgedacht haben. Sie stellen sich tagtäglich vor, wie ein Mörder tickt. Aber was, wenn Ihnen die Fantasie nicht mehr ausreicht? Wenn Sie es endlich selbst einmal erleben wollten und deshalb beschlossen haben, diese Grenzen zu überschreiten?«
»Er hieß Omar«, antwortete Winter leise. »Und ich verstehe nicht, warum wir hier wertvolle Zeit verschwenden. Wir sollten längst unterwegs sein und nach dieser Frau fahnden. Deshalb habe ich Sie mitten in der Nacht aus dem Bett holen lassen. Sie ist eine Mörderin und wir sollten dafür sorgen, dass sie schleunigst gefasst wird.«
»Stopp, stopp, stopp«, unterbrach ihn Mendoza. »Hier gibt es kein ›Wir‹. Dieser Schlamassel ist ganz allein Ihre Sache, Winter.«
»Ich habe Omar nicht umgebracht.«
»Schön. Dann beweisen Sie es.«
Er hob die Hände und rasselte mit den Handschellen. »Das ist nicht so ganz einfach, wenn einem die Hände gebunden sind.«
Mendoza lehnte sich noch weiter zurück und verschränkte die Arme. Winter ließ seine Hände sinken und legte sie mit den Handflächen nach unten auf dem Tisch ab.
»Okay«, fuhr er fort, »die gute Nachricht ist, dass wir nach dieser Frau nicht suchen müssen, weil sie uns von sich aus finden wird. Bevor sie gegangen ist, hat sie zu mir gesagt, dass wir uns schon sehr bald wiedersehen werden. In der Zwischenzeit sollten wir versuchen, so viel wie möglich über diese Hartwood-Morde herauszufinden. Wir müssen Kontakt zur zuständigen Polizeidienststelle aufnehmen und hören, was sie uns dazu sagen können. Mit der Zeitung hat sie uns diesen Wink gegeben, daher sollten wir uns davon leiten lassen. Und den Mord an Omar müssen wir ebenfalls untersuchen. Ich gehe nicht davon aus, dass eine direkte Verbindung zwischen ihm und dieser Frau besteht, aber seine Familie erwartet völlig zu Recht Antworten.«
»Sie irren sich in so vielen Punkten, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.« Mendoza griff nach ihrem Pferdeschwanz und wickelte die Strähnen so fest um ihre Finger, dass die Kuppen ganz weiß wurden, weil die Blutzufuhr unterbrochen war. Energisch zog sie an ihrem Haarband, um es wieder zu richten, und hielt dann ihre linke Faust in die Höhe. »Erstens.« Bedächtig streckte sie den Zeigefinger aus. »Das alles basiert auf der Annahme, dass Ihre mysteriöse Frau tatsächlich existiert. Im Moment haben wir dafür außer Ihrer Aussage keinerlei Beweise. Zweitens.« Sie klappte langsam den Mittelfinger aus. »Wie ich schon sagte, gibt es kein ›Wir‹. Was auch immer hier vor sich geht, es hat nichts mit mir zu tun.«
»Kommen Sie, Mendoza. In Handschellen und allein kann ich nichts ausrichten. Ich brauche Ihre Hilfe. Und dass wir ein großartiges Team sind, können Sie doch nicht bestreiten.« Er lächelte sie aufmunternd an. »Und außerdem ist es keine Frage, dass diese Frau existiert.«
»Winter, ich habe ein Flugticket für heute Nachmittag nach Las Vegas und werde dort auch hinfliegen. Nicht weil ich unbedingt Urlaub machen will, sondern weil es eine Anweisung ist – und die befolge ich im Gegensatz zu Ihnen. Soll ich ganz ehrlich sein? Wenn ich ans Verreisen denke, wird mir ganz schlecht. Selbst eine Woche ist mir viel zu lang.«
»Okay, dann habe ich einen Vorschlag für Sie. Wenn Sie angewiesen wurden, Urlaub zu machen, könnten Sie ihn doch auch einfach in Hartwood verbringen. Um diese Jahreszeit soll es herrlich dort oben sein, habe ich mir sagen lassen. Sie könnten dort ein bisschen wandern gehen und ein gutes Buch lesen.« Er machte eine Pause und sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Und wenn Sie sich dabei irgendwann langweilen, könnten Sie mir ein bisschen bei den Ermittlungen in einem sechs Jahre zurückliegenden Mordfall unter die Arme greifen.«
Mendoza musste lachen. Sie versuchte zwar, es zu unterdrücken, konnte sich aber nicht zurückhalten. »Meine Güte, Sie lassen nicht locker, was?«
»Geben Sie ruhig zu, dass Sie auch neugierig geworden sind. Und, was halten Sie davon?« Als sie eine Antwort schuldig blieb, lächelte er sie gewinnend an. »Sie sind schon in Versuchung, das sehe ich doch.« Er hob seine Hand und deutete mit Daumen und Zeigefinger ungefähr einen Zentimeter an. »Ein winzig kleines bisschen in Versuchung.«
»Falsch. Sie liegen meilenweit daneben.«
Winter lehnte sich zurück und sagte nichts. Mendoza schwieg ebenfalls. Fast eine Minute lang starrten sie sich wortlos über den Tisch hinweg an. Schließlich durchbrach Winter die Stille.
»Hören Sie, wenn wir nichts tun, wird diese Frau wieder töten. Das wissen Sie genauso gut wie ich.«
»Vorausgesetzt, es gibt sie.«
»Glauben Sie allen Ernstes, dass ich etwas mit Omars Tod zu tun habe?«
»Wollen Sie die Wahrheit hören?« Mendoza zuckte die Schultern und schüttelte den Kopf. »Im Moment weiß ich wirklich nicht, was ich glauben soll, Winter.«
6
Mendoza verließ den Raum und Winter blieb allein zurück. Nachdem die Tür sich leise hinter ihr geschlossen hatte, blieb ihm nun schon zum zweiten Mal an diesem Tag nichts anderes übrig, als abzuwarten. Es fühlte sich genauso an wie zuvor in dem Imbisslokal, als er durch das Ladenfenster der blonden Frau hinterherschaute.
Er betrachtete die Handschellen und sah dann hinauf zu seinem Spiegelbild auf der Einwegscheibe. Es lief nicht so, wie er sich erhofft hatte, und das machte ihm zu schaffen. Er war davon ausgegangen, dass Mendoza ihn hier herausholte und dass sie ihm – zwar wie üblich schlecht gelaunt und reichlich genervt – diese elenden Handschellen abnehmen würde, um sich dann gemeinsam mit ihm dem Mord an den Reeds zuzuwenden.
Doch die Realität sah leider völlig anders aus.
Mendoza hatte ihm nicht gesagt, warum oder wohin sie ging, und auch sonst keine weitere Bemerkung gemacht. Sie war einfach aufgestanden und hatte den Raum verlassen. Das war natürlich ihr gutes Recht. Winter hatte oft genug auf der anderen Seite des Tisches gesessen und wusste genau, wie das Spiel funktionierte. Jetzt stand sie sicher hinter dem Spiegel, beobachtete ihn und plante das weitere Vorgehen. Und er konnte in der Zwischenzeit nichts weiter tun, als dazusitzen und abzuwarten, und das zehrte zunehmend an seinen Nerven.
Dennoch war es nicht gänzlich überraschend, dass sie so agierte. Eine der ersten Erkenntnisse, die er über Mendoza gewonnen hatte, war, dass sie nichts als gegeben hinnahm. Das war zwar meistens hilfreich, aber eben nicht immer. Die momentane Situation bewies das deutlich.
Mendoza war ihm als Person noch immer ein Rätsel. Er hatte ein paar Recherchen über sie angestellt, aber nicht viel herausgefunden. Alles, was er in Erfahrung bringen konnte, bezog sich auf ihre Arbeit. Über ihr Privatleben wusste er rein gar nichts. Ein weiterer Beweis dafür, wie gut sie darin war, Berufliches und Privates strikt zu trennen.
Dass sie eine sehr gute Polizistin war, darüber waren sich alle einig. Winter hatte gerade am eigenen Leib erfahren, wie kompromisslos sie vorging. Auch im Fall McCarthy hatte sie das eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie war nach dem College in den New Yorker Polizeidienst eingetreten und Winter ging davon aus, dass sie hier bis zu ihrem Ruhestand arbeiten würde. Im Laufe der Jahre hatte Winter eine Menge Polizeibeamte kennengelernt. Manche von ihnen schoben eher Dienst nach Vorschrift, für andere war die Arbeit so etwas wie eine Berufung. Für Mendoza galt ohne Frage Letzteres.
Wieder und wieder war er den Mord an Omar in Gedanken durchgegangen, auf der Suche nach Details, die er übersehen hatte und die ihm helfen konnten, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Aber egal wo er anfing, es führte alles zu nichts.
Der Vernehmungsraum erschien ihm jetzt viel kleiner als am Anfang und wurde ihm allmählich zu eng. Er hatte den starken Drang, aufzustehen und umherzulaufen. Am liebsten hätte er sich erneut vor den Spiegel gestellt und mit der Faust dagegengehämmert. Wie gerne würde er alles das tun, was er unzählige Male von der anderen Seite der Scheibe aus beobachtet hatte. Obwohl er unschuldig war, wurde er zunehmend unsicher. Der Raum hatte genau die Wirkung auf ihn, die beabsichtigt war. Er diente dazu, Schuldgefühle hervorzulocken. Auch wenn an der Tür die Aufschrift »Vernehmungsraum« stand, war das hier nichts anderes als eine Zelle, nur ohne Bett und Toilette. Streng genommen war dieser Raum eine Art Vorhölle, denn wenn es schlecht für ihn lief, kam er ins Gefängnis, was dann die wahre Hölle wäre. Entwickelte sich jedoch alles in seinem Sinne, wäre er schon bald wieder auf freiem Fuß. Diese Ungewissheit fühlte sich an wie Folter.