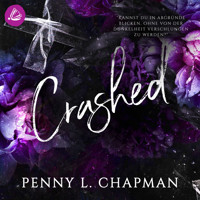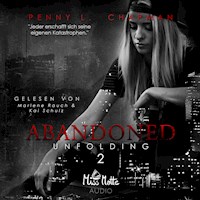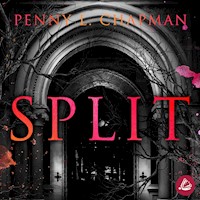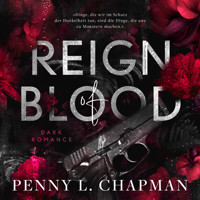5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
AUBREY Vergib mir Vater, denn ich habe gesündigt. Ich habe ihn in mein Haus gelassen. Ich habe ihm erlaubt, mit mir zu spielen. Ich habe ihn in meinen Kopf gelassen. Mit jeder Sünde gleite ich tiefer in den Abgrund. So tief, dass ich den Weg zurück nicht mehr finde. Er will mir wehtun. Er will ihm wehtun. Er will uns zerstören. Ich habe unterschätzt, was passiert, wenn man mit dem Teufel spielt. Aber ich bin bereit. Die Tür steht offen, komm mich holen ... DARIO Ich stehe längst hinter dir, Babydoll. Dreh dich nicht um, sieh nicht hin. Lauf! Denn ich habe die Hölle gesehen und überlebt. Ich bin das Monster, das er erschaffen hat, und ich werde euch allen zeigen, zu was ich fähig bin. Ich werde dir die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben nehmen. Deinen Glauben. Deine Unschuld. Deinen Vater. Achtung! Das Buch enthält sensible Themen und Gewalt. Solltest du ein traumatisches Erlebnis gehabt haben oder empfindlich gegen Gewalt, Sex und viele andere Dinge sein, lies es bitte nicht. Du brauchst eine Triggerwarnung? Hiermit erhälst du sie. Überarbeitete Version. Die Protagonisten sind volljährig. Broken Saint ist der zweite Band von Penny L. Chapmans Confined (Dark Romance) Reihe. Jedes Buch ist in sich abgeschlossen, aber für das beste Lesevergnügen wird empfohlen, zuerst Band eins, Nightfall, zu lesen. Das Taschenbuch enthält 521 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Broken Saint (Sinners of Blackwood 2)
University Dark Romance / Enemies to Lovers
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenGuide to Contents
BROKEN SAINT
SINNERS OF BLACKWOOD #2
Penny L. Chapman
Alle Rechte bei Verlag/Verleger
Copyright © Penny L. Chapman September 2019
c/o Autorenservice Patchwork
Schlossweg 6
A-9020 Klagenfurt
Inhaltsverzeichnis
PlaylistKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27EpilogTo be continued ...BonuskapitelInterview mit den SkullsDanksagungFür meine Leser
Playlist
Hier die Songs, die mich zu Szenen und Charakteren inspirierten und mich während des Schreibens von
Broken Saint begleitet haben. Viel Spaß!
Milck – Take me to church
Evanescence – Haunted
Lana Del Rey – Dark Paradise
Apocalyptica – I don’t care
Slipknot – Snuff
Samuel Barber – Agnus Dei
Lungs and Limbs – Grim Ranger (Acoustic Version)
Beyonce – Sweet Dreams
Written by Wolves – Not afraid to die
Family Band – Night Song
Bloodhound Gang feat Ville Valo – Something Diabolical
Drowning Pool – Tear away
Three Days Grace – Chalk outline
Theory of a Deadman – Angel
Clint Mansell – Lux Aeterna (Darios Song)
Lana Del Rey – Gods & Monsters
Valerie Broussard – A little wicked (Aubreys Song)
Foxes – Devils Side (Theme Song)
Breaking Benjamin – Dance with the Devil
Unlike Pluto – Villain Of My Own Story
Hypnogaja – Here comes the rain again
Slaves – I’d Rather See Your Star Explode (Acoustic)
Breaking Benjamin – Feed the Wolf
Oh Land – Wolf & I (Credits)
Let him that is without sin cast the first stone
- Jesus Christ
Widmung
Für alle, die nie Kinder sein durften.
Das, was früher war, hat dich geformt, aber es definiert dich nicht. Die Narben sind ein Teil deiner Geschichte. Sie erinnern dich daran, dass du überlebt hast.
Was dich ausmacht, sind deine Entscheidungen und die Menschen, die dich begleiten.
Nutze deine Wunden und wandele sie in Stärke. Blicke mit Stolz auf deine Narben, denn du bist stark.
Lass deine Vergangenheit hinter dir und sieh in die Zukunft.
Einer Zukunft, über die du alleine bestimmst.
- Penny L. Chapman
Kapitel 1
AUBREY
»In der Unschuld des Reinen verbirgt sich das Paradies. Einmal verloren wird dir nie wieder Einlass gewährt. Bist du bereit, für deine Sünden zu zahlen?«
Die sanfte Frauenstimme aus den Lautsprechern erstarb. Für einen Moment sah ich ins Publikum. Fast jeder Tisch an der Bühne war besetzt. Überall saßen Männer in teuren Anzügen. Sie nippten an ihren Champagnergläsern und musterten mich wie hungrige Tiere. Ich lächelte, blendete ihre Blicke aus und strich den grau karierten Rock meiner Schuluniform zurecht.
Dieser Moment gehörte mir.
Mein Auftritt.
Mein Stück Freiheit für diese Nacht.
Die ersten Töne von Milcks Take me to church erklangen und ich begann, langsam die Hüften im Takt der Musik zu bewegen. Das schummrige Licht der Kerzenleuchter an den mit rotem Samt bespannten Wänden, der Qualm von Zigarren, der die Luft stickig machte, und die Musik ließen mich schweben.
Mit jeder Sekunde verschwand die Welt um mich herum. Wie durch einen Tunnel nahm ich den Applaus und die Rufe der Männer wahr. Ich tanzte, bis Schweiß über meinen Rücken lief und meine Beine zitterten. Als die Musik verblasste, verbeugte ich mich, strich meine blonden Zöpfe zurecht, was mit tosendem Applaus belohnt wurde, und ließ meinen Blick wieder durchs Publikum wandern, in der Hoffnung, sein Gesicht zu sehen. Seit zwei Jahren hoffte ich darauf, ihn hier zu sehen. Seit zwei Jahren vermisste ich ihn. Aber er war nicht hier.
Ich zwang mich zu einem Lächeln, winkte den Zuschauern zu und schwebte von der Bühne.
Zehn Minuten später ließ ich mich an der Bar nieder. Ich trank einen großen Schluck Cola aus dem Glas, das Lucky, der Barkeeper, nach der Show immer für mich bereitstellte, und sah auf mein Handy. Es war ein Uhr.
»Ich hab in einer Stunde Feierabend«, sagte Lucky. »Trink noch was, lass uns quatschen und dann fahr ich dich nach Hause. Mir gefällt nicht, dass du mit dem Bus fährst.«
Lucky war drei Jahre älter als ich und eine Verbindung zwischen der realen und meiner Welt. Schon deswegen mochte ich ihn. Ich mochte seine knallblauen Haare, sein schiefes Lächeln und seinen verkorksten Humor.
Wie gerne hätte ich sein Angebot angenommen, aber mir blieb keine Stunde.
Ich trank die Cola aus und glitt vom Barhocker. »Ich komme klar.« Ich beugte mich über die Theke, küsste seine Wange und lächelte, obwohl mir nicht danach zumute war. »Ich mag das Busfahren.«
»Du bist echt merkwürdig, Aubrey.« Lucky musterte mich mit einem nachdenklichen Blick, der silberne Ring in seiner rechten Braue funkelte wie ein Diamant im Kerzenschein.
»Was hast du gegen -«
»Süße.« Jemand gab mir einen Klaps auf den Hintern.
Ich schoss herum und schlug die Hand des Mannes weg. »Finger weg.«
Lucky kam hinter der Theke hervor, wollte dazwischengehen, aber ich schüttelte den Kopf, ohne den grauhaarigen Typen vor mir aus den Augen zu lassen. »Schon gut, ich habe das im Griff.« Ich sah dem Mann in die Augen, ein Schleier von Alkohol lag über ihnen. »Wenn Sie mich noch einmal anfassen, schneide ich Ihnen die Finger ab, haben wir uns verstanden?«
»Ich wollte nicht … Die Show war klasse, Kleine und ich -«
»Haben wir uns verstanden?«
»Entschuldigung.«
»Das ist ein Burlesque-Klub, keine schmierige Stripbar. Wenn Sie grapschen wollen, gehen Sie auf den Markt. Die Melonen sollen ziemlich prall sein.«
Hinter der Theke hörte ich Lucky lachen. »Amen Schwester.«
Ohne ein weiteres Wort ging der Mann an mir vorbei, zog seine Brieftasche hervor und legte – mit einem entschuldigenden Blick über die Schulter – einige Scheine auf die Bar, ehe er den Klub verließ.
Lucky nahm das Geld, zählte es und riss die Augen auf. »Du bist wie eines dieser Schoßhündchen. Klein und bissig.« Er hielt mir die Scheine unter die Nase. »Beeindruckend, fünfzig Dollar für einen verbalen Tritt in die Eier. Mario sollte dich als Türsteher einstellen.«
Einen Moment lang überlegte ich, das Geld zu nehmen, aber Lucky lebte in einem Ein-Zimmer-Apartment und finanzierte sich das Studium, indem er Drinks im Milk and Blush servierte. Er besaß nicht viel Geld, aber er war glücklich.
Ich schüttelte den Kopf und schob seine Hand zurück. »Behalt du es, ich habe heute genug verdient.«
Bescheuerte Ironie.
Allein meine Handtasche von Balenciaga kostete mehr als die Miete für sein Apartment. Trotzdem brauchte ich jeden Cent, den ich im Milk and Blush verdiente, denn ohne Geld konnte ich meinen Plan vergessen. Dad würde mir mein Vorhaben nicht nur ausreden wollen, er würde versuchen, mich mit aller Macht davon abzuhalten, und mir Steine in den Weg legen.
Aber wie alle hier musste auch Lucky nichts davon wissen. Für ihn war ich einfach Aubrey, das blonde Mädchen, das nachts tanzte, alleine durch die Stadt fuhr und rote Chucks zur Schuluniform trug.
Er musterte mich nachdenklich und steckte die Scheine zögerlich in seine Hosentasche. »Ich revanchiere mich.«
»Bring mir einfach das nächste Mal einen Burger mit.«
Noch immer etwas verlegen, nickte er und wechselte das Thema. »Hat Mario dich schon gefragt?«
»Hat er mich was gefragt?«
»Katja und Lacey bekommen jetzt das Doppelte. Nicht schlecht für ein paar Minuten Nippel zeigen.«
Ich lachte, nahm meine hellbraune Hängetasche von der Theke und hängte sie über eine Schulter. »Mario riskiert schon genug für mich. Er wird mich nicht fragen und ich würde es nie machen.«
Mario, der Besitzer des Milk and Blush, hatte mich ohne viele Fragen eingestellt, obwohl er wusste, wessen Tochter ich war.
Lucky zuckte mit den Schultern, sein schiefes Lächeln spendete etwas Trost und für einen Moment fühlte ich mich zugehörig. »Ist wahrscheinlich besser so.« Er ließ einen Blick über meine roten Chucks, grauen Kniestrümpfe und den passenden Rock wandern. »Die alten Säcke stehen auf die Schulmädchennummer.«
Schulmädchen. Fast hätte ich gelacht. Wäre zu schön, um wahr zu sein.
»Ich muss los, wir sehen uns morgen.«
»Pass auf dich auf, Kleine.«
Ich hob die Hand zum Abschied und warf einen Blick auf Candy. Sie schwebte an einem Seil, das über der Bühne hing, und winkte dem Publikum zu, während ihre knallroten Lippen mit ihrem Korsett um die Wette strahlten.
Selbst hier bekam ich eine Sonderbehandlung. Während die anderen Mädchen die extravaganten Nummern bekamen, bestand mein Auftritt darin, in meiner Schuluniform die Hüften im Takt der Musik zu schwingen. Ja nichts Gewagtes oder zu Ausgefallenes. Mario konnte nicht riskieren, dass ich mich während der Arbeit verletzte oder Dad von meinem Job erfuhr.
Ich seufzte und verließ das Milk and Blush.
Als ich den Gehweg betrat, legte ich den Kopf in den Nacken und atmete tief durch.
In der Luft lag der Duft von bevorstehendem Regen und Herbstlaub. Nur noch vereinzelt fuhren Wagen durch die Straßen. Die roten Lampen ihrer Rücklichter und die Leuchtreklamen der Klubs gegenüber erhellten die Dunkelheit und ich blieb kurz stehen, um mich zu sammeln, wie ich es immer tat, wenn meine Scheinwelt mit der Realität kollidierte.
Mein Haar roch nach Zigaretten, meine Füße taten weh vom Tanzen und in meinen Ohren dröhnte noch immer Musik, aber ich war glücklich.
Dieses Gefühl konnte er mir nicht wegnehmen, dieser Moment gehörte mir alleine.
Ich zog die graue Jacke meiner Schuluniform dichter an meinen Oberkörper und setzte mich in Bewegung. Bis zur Bushaltestelle waren es nur ein paar Meter. Ich bog nach rechts um die Ecke und lief ein Stück an der Hauptstraße entlang. Ein Scheppern ließ mich zusammenschrecken. Ich fuhr herum, entdeckte eine Katze, die auf einer umgestürzten Mülltonne balancierte, und verzog den Mund. Meine Aktion Dario gegenüber war nicht nur unfair, sondern auch dumm gewesen. Seitdem ich vor vier Wochen die Gerüchte über die Skulls im Internet gestreut hatte, erschrak ich bei jeder Kleinigkeit. Ich hatte behauptet, dass sie Mädchen gegen ihren Willen anfassten, dass sie einen Laden überfallen hatten und andere Dinge, auf die ich nicht stolz war. Aber das war nicht das Schlimmste. Die Enttäuschung darüber, dass er nicht aufkreuzte, quälte mich, denn ich kannte Dario und hatte gehofft, dass ihn meine Provokation hervorlocken würde.
Ich erreichte die Haltestelle, stellte mich unter und zog Der rote Engel, eines meiner Lieblingsbücher, aus der Tasche. Als mich fünf Minuten später Scheinwerfer blendeten, stieg ich in den Bus. Ich legte die Hände in den Schoß und sah aus dem Fenster.
Die Leuchtreklamen der Bars spiegelten sich im Glas, als verspotteten sie mich. Als wollten sie mich daran erinnern, wie bunt das echte Leben war, während meines aus vier Nuancen von Weiß und Beige bestand.
Der Bus bog links ab, verringerte das Tempo und hielt an der Lancaster Avenue.
Ich hetzte den Gehweg entlang, vorbei an schicken Einfamilienhäusern mit weißer Fassade und ebenso weißen Zäunen und bog nach rechts in unsere Seitenstraße ab. Bäume, deren Laub wie Flammen erstrahlte, säumten rechts und links den Weg, aber hier parkten keine Wagen auf der Straße. Hier ragten meterhohe Eisenzäune in die Luft, dichte Hecken versperrten die Sicht auf die dahinterliegenden Villen und an jedem Tor summte eine Kamera, wenn sie einen Besucher erspähte.
Eine sichere und gepflegte Gegend, in deren Palästen Frauen und Männer lebten, die jedem Menschen in Stepford Konkurrenz machten.
Es war unfair, aber ich verachtete sie. Ihre beschränkten Sichtweisen, verstaubten Moralvorstellungen und ihr falsches Lächeln, das verschwand, sobald sie einander den Rücken zuwandten. Reichtum machte korrupt.
Ich steuerte auf die Einfahrt vor unserem Tor zu, duckte mich im Schatten der Backsteinmauer, als die Kamera in meine Richtung drehte, und wartete, bis sie wieder nach rechts wanderte.
Ich lief rechts am Tor entlang, wo dichte Hecken wuchsen, und stellte einen Fuß auf die Querstreben. Ich griff nach oben an eine weitere Strebe und zog mich am Zaun hoch. Die zwei Meter stellten kein Problem mehr dar, in weniger als drei Minuten hatte ich ihn überwunden und schlich wie ein Dieb über den Rasen unseres Anwesens bis zur Einfahrt.
Auch hier gab es Kameras, aber ich wusste, an welchen Stellen sie sich befanden, und duckte mich oder wartete ein paar Sekunden, bis die Luft rein war.
Als ich das Haus erreichte, lief ich zur rechten Hauswand. An dieser Seite unserer Villa im Kolonialstil rankte dichtes Efeu und ich grub meine Hand zwischen die Blätter, bis ich die Leiter ertastete, die ich vor anderthalb Jahren dort angebracht hatte und seitdem fast jede Nacht benutzte. Ich schob einen Fuß zwischen das Efeu, spürte die erste Stufe unter meiner Schuhsohle und stieg bis in die zweite Etage. Das Fenster war nur angelehnt, ich legte meine Hand gegen die Scheibe, drückte es auf und kletterte in mein Zimmer. Dort angekommen, stieß ich einen Seufzer aus, hängte meine Tasche über den Schreibtischstuhl und sah auf die Uhr.
Zwanzig Minuten.
Ich streckte die Arme über dem Kopf aus, drehte das Gesicht zur Seite und gähnte. Mein Haar roch noch nach Zigaretten und ein kurzer Stich durchfuhr mich.
Der Geruch erinnerte mich an ihn. An sein Parfüm, seine Dunkelheit und das, was er in mir ausgelöst hatte. Aber Dario hatte mich im Stich gelassen und mit ihm war auch meine Freiheit verschwunden.
Von einem Tag zum anderen hatte sich alles geändert und selbst jetzt, zwei Jahre später, fragte ich mich noch immer, ob es meine Schuld war.
Nicht jetzt, beeil dich. Ich schüttelte den Kopf, als könnte ich damit die Gedanken loswerden, und ging zum Schreibtisch. In der Tasche kramte ich das Geld heraus, zählte es und ärgerte mich, dass Mr. Miller nicht da gewesen war. Er saß immer in der ersten Reihe und gab Trinkgeld, das manchmal sogar meinen Lohn überstieg.
Aber nicht heute. Heute hatte ich nur einhundert Dollar verdient und obwohl mir noch acht Monate blieben, fragte ich mich, ob meine Ersparnisse jemals genügen würden, um meinem Gefängnis zu entkommen.
Ich ordnete die Scheine, drehte mich zum Bücherregal und zog die Schmuckausgabe von Grimms Märchen hervor. Ich schlug Seite einhundertzwanzig auf und legte die Scheine zwischen die Seiten meines Lieblingsmärchens, Rotkäppchen. Er kommt nicht, vergiss ihn.
Aber wie sollte ich ihn vergessen? Dario war seit meiner Geburt ein Teil meines Lebens gewesen.
Selbst jetzt konnte ich den Gedanken an ihn nicht entkommen.
Ich stellte das Buch zurück an seinen Platz, zog meine Sachen aus und duschte. Danach schlüpfte ich in ein weißes, knielanges Nachthemd mit Spitze am Saum und legte mich ins Bett. Ich verkroch mich mit dem Handy unter der Decke, wischte übers Display und öffnete Facebook, um mir die Einträge auf der Fanseite der Skulls anzusehen.
Der neuste Beitrag war ein Video mit der Überschrift: Eskalation am Freitag: Die Skulls liefern bombastische Feuershow.
Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich auf Play klickte.
Ganz in Schwarz gehüllt, mit Totenkopftüchern vor Nase und Mund und einem Molotowcocktail in jeder Hand schlenderten die drei Skulls auf ein Gebäude zu.
Ich hielt den Atem an und versuchte, anhand der Größe auszumachen, wer von ihnen Dario war. Aber die Aufnahmen waren verwackelt und unscharf. Wahrscheinlich hatten ihre Groupies sie heimlich gemacht.
Ein Knacken ließ mich aufschrecken. Ich schob die Decke von mir und sah mich um. Mondlicht schien ins Zimmer und beleuchtete einen schmalen Teil des Bodens, aber es war noch nicht zwei Uhr und Dads Wecker klingelte erst in ein paar Minuten.
»Hallo?«, flüsterte ich in die Dunkelheit und hoffte, mein großer böser Wolf tauchte endlich auf. Seit Wochen wartete ich auf ihn.
Der Vorhang vor meinem Fenster wehte im Wind, aber sonst regte sich nichts.
Ich legte mich wieder hin und schob die Enttäuschung beiseite, als ich ein weiteres Knacken des Dielenbodens hörte.
»Hast du Angst?«
Seine tiefe Stimme ließ mich hochschrecken. Ich sprang aus dem Bett, stürmte auf den riesigen Schatten zu, der gegen mein Bücherregal lehnte, und fiel ihm um den Hals. Wie früher trug er schwarze Jeans, Combatboots, einen schwarzen Hoodie und das Tuch vor dem Mund.
»Dario.« Ich schlang meine Arme um seinen Nacken, drückte mich an ihn und küsste seine Wange. Wie früher roch er nach Zigaretten und Abenteuer. »Endlich.«
Aber er umarmte mich nicht oder gab mir einen Kuss auf die Wange, wie er es sonst immer getan hatte.
Er stand einfach nur da, als ließe er es über sich ergehen. Wahrscheinlich war er wütend, aber das war ich auch. Wir hatten uns so lange nicht gesehen und ich hatte ihn vermisst. Mehr als alles andere, aber jetzt war nicht der passende Moment, um zu reden, denn der Alarm an meinem Handy schrillte auf – zwei Minuten vor zwei.
»Wir müssen uns beeilen.« Ich nahm seine Hand und zog ihn zum angrenzenden Badezimmer. »Warte hier und sag kein Wort.«
Dario verschränkte die Arme vor der Brust, lehnte sich gegen die Wand und schwieg.
Ich rannte zu meinem Bett, legte mich hinein und zog die Decke bis unters Kinn. Auf die Sekunde genau quietschte meine Zimmertür und Dads Schritte näherten sich dem Bett. Er legte eine Hand auf die Decke und tastete nach meiner Schulter, um sicherzugehen, dass ich wirklich da war.
Es war paranoid, vielleicht sogar etwas krank und wie immer fühlte ich mich unwohl, aber es war Dads Art sicherzustellen, dass mir nichts geschah. Denn mein Vater liebte nichts auf der Welt mehr als mich. Weder seine Arbeit noch sein Vermögen und wahrscheinlich noch nicht einmal sein eigenes Leben. Seine Liebe war der Grund für meine Gefangenschaft.
Ich täuschte ein gleichmäßiges Atmen vor, obwohl mein Herz raste, und betete, er würde schnell verschwinden. Dario ist wieder bei mir.
»Mein kleines Mädchen«, murmelte Dad und strich über mein Haar. »Möge Gott dich schützen.«
Er zog die Decke hoch bis zu meinen Ohren, als könnte sie mich vor Monstern unter meinem Bett beschützen, und verschwand wieder.
Als seine Schritte sich entfernten, warf ich die Decke zurück und wollte aufspringen und erschrak. Dario stand direkt vor meinem Bett.
Er wirkte noch größer und breiter als in meiner Erinnerung, aber ich hatte keine Angst vor ihm so wie alle anderen.
Ich stand auf, drängte mich zwischen Bett und Dario und verschränkte die Arme vor der Brust. Es gab noch etwas zu klären. »Du bist ein Arschloch.«
Er lachte freudlos. »Ist Daddy auf die nächste Sicherheitsstufe umgestiegen?«
Es gab so viel zu erzählen, so viel zu sagen und doch wusste ich nicht, wo ich beginnen sollte. Fast unser ganzes Leben hatten wir miteinander verbracht und egal, was er tat, ich hatte ihn bewundert. Aber jetzt war ich erwachsen und die Zeiten, in denen er mich mit einem Zwinkern um den Finger wickeln konnte, waren vorbei.
»Das Letzte, was du zu mir gesagt hast, war: bis morgen. Das ist zwei Jahre her«, flüsterte ich. Wahrscheinlich lag Dad schon wieder im Bett, aber ich durfte nichts riskieren.
»Und du hast versprochen, ein braves Mädchen zu bleiben. Aber brave Mädchen lügen nicht.«
Ich setzte mich aufs Bett und sah zu ihm auf. »Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich habe versucht, deine Schwestern zu erreichen, aber eure Nummern waren nicht mehr verfügbar. Ich habe Briefe geschickt und bin zu deinem Vater gefahren, weil ich nicht verstanden habe, was los ist. Aber er hat nur gesagt, dass du nicht gefunden werden willst.«
»Wieso kommst du nach zwei Jahren auf die Idee, mich öffentlich zu provozieren?« Seine Stimme klag kühl, ruhig. »Das war sehr dumm, Süße.«
Natürlich war es das. Im Nachhinein betrachtet war es kindisch, aber ich hatte mir nicht anders zu helfen gewusst. Als ich vor vier Wochen ein altes Foto von uns gefunden hatte, waren alle Erinnerungen, alle Gefühle wieder hochgekommen und ich beschloss, einen letzten Versuch zu unternehmen, ihn zu kontaktieren. Meine Idee war vielleicht kindisch gewesen, aber sie hatte funktioniert.
Dario schlenderte zum Schreibtisch, hob meine Bluse vom Boden auf und roch daran. »Von wem hast du dich ficken lassen?«
Wie bitte? Seine Worte trafen mich wie ein Giftpfeil. Ich stand auf und riss ihm die Bluse aus der Hand. »So redest du nicht mit mir.«
»Tut mir leid, ich habe vergessen, wie anständig Daddys Prinzessin ist.«
Deine Unschuld ist das Wertvollste, das du besitzt.
Ich ballte die Hände zu Fäusten und presste sie gegen meine Oberschenkel, um die Wut unter Kontrolle zu halten. Er war verärgert und besaß jedes Recht dazu, aber das war keine Entschuldigung für sein Verhalten. »Es tut mir leid, was ich im Internet über die Skulls gesagt habe. Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen.«
»Aubrey, Aubrey.« Er schüttelte den Kopf, als tadelte er ein ungezogenes Kind. »Du machst dir doch nicht selbst die Hände schmutzig.«
Auch damit lag er falsch. In den letzten zwei Jahren hatte ich gelernt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Er wandte den Blick ab und betrachtete mein Zimmer. Es war zu dunkel und die Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, ließ mich den Ausdruck darin nicht erkennen, aber selbst seine Stimme zeigte keine Emotionen. Wenn er früher wütend gewesen war, hatte er mich gepackt und geschüttelt.
Aber jetzt war er ruhig und emotionslos. Warum war er so anders?
Er lief zum Bücherregal, hockte sich hin und zog ein Buch hervor. Als er sich zu mir drehte und das Mondlicht auf ihn fiel, erkannte ich den Titel: Grimms Märchen. Er hielt es in der Hand und blätterte darin. Geldscheine fielen zu Boden, Dario bückte sich, hob sie auf und hielt sie mir vor die Nase.
»Deine Sachen riechen nach Kippen und du versteckst Geld. Bist du ungezogen, Babydoll?«
Babydoll. Mein Herz tat einen Satz, stolperte und schlug schneller. Früher hatte er mich so genannt. Ich war fünf Jahre jünger als er. Klein, zierlich und trug Zöpfe, wie die Puppen, mit denen ich spielte. Ich hatte es geliebt, wenn er mich so nannte.
Es war etwas, das nur uns gehörte. So viele Rituale hatten uns gehört.
Ich riss ihm das Geld aus der Hand und hoffte, er würde mir nicht anhören, wie sehr mich seine distanzierte Art verletzte. »Warum bist du hier? Anscheinend nicht, weil ich dir gefehlt habe.«
Dario legte den Kopf schief, streckte seine Hand aus und nahm eine meiner Haarsträhnen zwischen zwei Finger. »Eigentlich bin ich hergekommen, um dir zu sagen, dass wir uns nicht provozieren lassen.« Er zog mich an meinen Haaren näher zu sich. »Niemand legt sich mit den Skulls an.«
»Eigentlich?« Ich versuchte, meine Haare aus seinem Griff zu befreien, aber Dario zog so fest daran, dass meine Kopfhaut schmerzte. »Du tust mir weh.«
Er schob das Tuch von seinem Mund und lächelte. »Ich werde ihm wehtun.«
»Wem?«
Statt zu antworten, ließ er mich los und schlug das Buch in der Mitte auf. Er ließ einen Finger über die bunten Bilder gleiten und richtete den Blick auf mich. »Du hast keine Angst mehr vor dem großen, bösen Wolf.«
Es klang nicht wie eine Frage und ich schwieg, weil ich nicht wusste, worauf er hinauswollte.
»Das war ein Fehler. Du hast ihn herausgefordert. Jetzt kommt dich sein Rudel holen.«
Er beugte sich zu mir herunter. Seine Zungenspitze berührte mein Ohrläppchen, ein Schauer lief über meinen Rücken. Früher hatte ich mir gewünscht, dass er mich berührte. Aber er hatte immer Abstand gewahrt und sich von mir ferngehalten. In meiner Fantasie hatte es sich anders angefühlt. Geborgen, warm und vertraut.
Vorsichtig wandte ich das Gesicht zur Seite. Meine Nasenspitze berührte seine Wange und ich hielt den Atem an. »Es tut mir leid.«
»Zu spät.«
Kapitel 2
AUBREY
Noch immer schwirrten die Gedanken um mein unerwartetes Wiedersehen mit Dario durch meinen Kopf. Die halbe Nacht hatte ich mich im Bett gewälzt, über seine Worte und sein Verhalten gegrübelt, aber egal, wie sehr ich versuchte, mir einzureden, dass er nur wütend war, es ergab keinen Sinn. Nie hatte er mich so behandelt wie gestern. In den letzten zwei Jahren hatte ich mir immer wieder vorgestellt, wie unser Wiedersehen verlaufen würde. In meiner Fantasie nahm er mich in die Arme, entschuldigte sich für sein Verschwinden und wir machten da weiter, wo wir aufgehört hatten. Als Freunde, vielleicht mehr.
Aber die Realität hatte mir ihre Faust ins Gesicht geschleudert und mir bewusst gemacht, dass sich alles zwischen uns verändert hatte.
Ich stieg die Treppe hinab, strich meinen Rock zurecht, schob die Gedanken an Dario beiseite und umfasste das zusammengerollte Dokument fester. Für das, was ich vorhatte, benötigte ich einen klaren Kopf. Ich konnte später über Dario nachdenken, schließlich hatte ich den ganzen Tag Zeit.
Die Innenfläche meiner Hand klebte an dem Papier und in meinem Magen bildete sich ein Knoten, der sich bei jedem Schritt enger zuzog.
Als ich die letzte Stufe erreichte, stieg mir der Duft von gerösteten Kaffeebohnen und warmen Croissants in die Nase. Augenblicklich knurrte mein Magen und erinnerte mich daran, dass ich seit mehr als zwölf Stunden nichts mehr gegessen hatte.
Dad saß in der Mitte unseres riesigen Esstisches über seine Zeitung gebeugt, die Augen waren zusammengekniffen und tiefe Falten zeichneten sich auf seiner Stirn ab. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck, er studierte die Aktien.
»Morgen, Dad.«
Er sah von der Zeitung auf, sein Blick fiel auf meine roten Chucks und augenblicklich verzog er den Mund. »Wie oft müssen wir noch darüber diskutieren, Aubrey?«
»Von mir aus gar nicht.« Ich wusste, wie er darüber dachte, aber ich liebte die roten, abgetragenen Chucks, die Leo mir zu meinem siebzehnten Geburtstag geschenkt hatte. »Mach, was du willst, aber ich behalte sie an.«
»Sie schicken sich nicht zur Schuluniform. Du siehst so ordentlich aus, aber diese … Schuhe verderben alles.« Er betonte das Wort, als sei es giftig, aber gab sich wie immer geschlagen. Zumindest dabei ließ er mir meinen Willen. Seine Miene wurde weicher. »Warum bist du schon wach? Was ist los?«
»In Frankreich ist es schon mittags.« Ich ging zu ihm und küsste seine Wange. »Mom fehlt mir, ich habe sie angerufen.« Ich setzte mich an die Kopfseite, legte die Hand, in der ich das Anmeldeformular hielt, in den Schoß und schüttete mir Orangensaft ein. Hoffentlich bemerkte Dad meine Lüge nicht. Natürlich fehlte mir Mom, aber ich hatte sie heute noch nicht angerufen. Vor drei Jahren hatten sich meine Eltern getrennt und seitdem wohnte ich mit Dad alleine. Sie hatten beschlossen, mich in meiner gewohnten Umgebung zu lassen, damit ich hier weiter zur Schule gehen konnte. Aber selbst, als Dad mich von der Highschool nahm, fragte niemand, bei wem ich lieber wohnen würde. Für meine Eltern stand von Anfang an fest, dass es hier, direkt bei Dad, am sichersten für mich war. Noch so eine Logik, die ich nicht verstand.
Dad musterte mich mit demselben nachdenklichen Blick, mit dem er Sekunden zuvor die Aktien studiert hatte. »Geht es dir gut?«
»Klar, alles bestens.«
Nichts war bestens. Weder die Unruhe, die seit letzter Nacht wie ein Sturm in mir tobte, noch die Verwirrtheit über Darios Verhalten. Aber wenn ich nicht demnächst mit Gittern vor den Fenstern aufwachen wollte, musste ich schweigen.
Dad runzelte die Stirn, sein Blick bohrte sich in meinen Kopf, als suche er nach einer Lüge. »Es ist gerade mal hell und du bist schon wach, also was ist los?«
Ich umklammerte das Anmeldeformular, legte es auf den Tisch, schob es meinem Vater zu und hielt die Luft an.
Er senkte den Blick. »Was ist das?«
»Die Anmeldung für das College.«
Ohne einen weiteren Blick schob er die Unterlagen beiseite und faltete die Hände. »Das sehe ich, aber ich dachte, wir hätten das geklärt.«
»Ich bin neunzehn. Ich müsste dich nicht mal um Erlaubnis fragen.«
Sein Blick verschärfte sich. »Solange du hier wohnt, solange du kein eigenes Einkommen hast, tust du, was ich sage. Haben wir uns verstanden?« Er biss die Zähne zusammen. »Hör zu, Aubrey, ich will dir nicht drohen müssen, aber wenn du nicht gehorchst, bekommst du später keinen Cent. Und es würde mir das Herz brechen, meine einzige Tochter zu verlieren.«
Ich schluckte. Es war lächerlich, fast schon peinlich. Ich war neunzehn Jahre alt und ließ ihn über mein Leben bestimmen, als wäre ich ein Kind. Aber so sehr ich es auch hasste, so sehr ich mir eine eigene Wohnung und Freiheit wünschte, es war unmöglich. Ich besaß weder Geld noch Freunde. Wo sollte ich hin? Als ich vor einem Jahr heimlich einen Job in einem Café angenommen hatte und er es herausfand, drohte er mir nicht nur mit Enterbung. Dad hatte mich eine Woche kaum angesehen, nicht mit mir geredet und war eiskalt gewesen. Ich wollte ihn nicht verlieren, er war der Einzige, der mir noch geblieben war.
Ich seufzte und versuchte, meine Wut herunterzuschlucken. »Du hast versprochen, noch mal darüber nachzudenken.« Als ich das Thema vor einigen Wochen angesprochen hatte, vertröstete mich mein Vater auf einen späteren Zeitpunkt. Ich wartete jeden Tag auf seine Entscheidung, aber nichts geschah und ich hatte das Warten satt.
»Ich habe auch versprochen, dich zu beschützen.«
Ich starrte auf meine zu Fäusten geballten Hände und presste die Lippen zusammen. Natürlich hatte ich diese Antwort erwartet, aber sie wirklich zu hören, traf mich härter, als gedacht. »Dad, ich will nur zum College und nicht der Mafia beitreten. Ich bin alt genug.«
Wollte ich ihn überzeugen, musste ich mich zusammenreißen. Bei einem Ausbruch würde er mich aufs Zimmer schicken und die Sache wäre erledigt.
Ich straffte die Schultern und zwang mich zu einem Lächeln, als ich ihn ansah. »Bitte Dad, ich vermisse die Schule.«
»Wenn dir die Stunden bei Rosie nicht genügen, bitte ich sie, den Unterricht auszudehnen.«
Rosie war unser Hausmädchen und gleichzeitig meine Lehrerin, die mich täglich fünf Stunden unterrichtete. Manchmal fragte ich mich, warum jemand mit ihrem Bildungsstand als Dienstmädchen arbeitete, aber sie hatte keine Familie und fühlte sich wohl hier.
Natürlich unterrichtete sie mich in unserem Haus, wo es sicher war und mich niemand entführen oder ermorden konnte. Der einzige Ort, den ich alleine aufsuchen durfte, war die Kirche.
Ich schüttelte den Kopf, der Knoten in meinem Magen verwandelte sich in Feuer. Hitze stieg in mein Gesicht und ich presste die Fäuste gegen die Tischplatte, damit ich nicht das Glas griff und es auf den Boden donnerte. »Du weißt, was ich meine. Eine richtige Schule mit Leuten in meinem Alter. Mit Debattierklubs, Footballspielen und Kaugummi, das die Böden verklebt.«
Partys, Knutschen und Sex.
»Du weißt, dass es zu gefährlich ist.«
»Bitte Dad.«
»Ich muss in ein paar Wochen für eine Weile nach Portland. Der Mayer-Fall zieht sich, wir müssen uns zusammensetzen und die Verteidigung planen. Lass uns danach reden.«
Nur beim Gedanken daran, eine Weile ohne seine Überwachung auszukommen, schlug mein Herz schneller. »Das ist … schade. Aber du kannst dich auf mich verlassen.«
»Natürlich sind Pyro und Robert informiert und vorbereitet. Du musst dir keine Sorgen machen, dass etwas passiert.«
Ich sank im Stuhl zurück. Von einer Sekunde zur nächsten zerstörte er meine Aussicht auf ein paar Wochen Freiheit. Ich wartete einen Moment, bis ich sicher war, dass er mir meine Enttäuschung nicht anhörte, und lächelte. »Okay. Aber warum besprechen wir das mit meiner College-Anmeldung nicht sofort?«
»Die Sturheit hast du von deiner Mutter.« Dad seufzte. »Es tut mir leid, aber das ist einfach zu gefährlich, Aubrey.«
»Warum? Wovor hast du Angst?«
»Mach dich nicht lächerlich, alles ist in Ordnung.«
»Ja? Warum darf ich dann verdammt -«
»Achte auf deine Wortwahl, Aubrey.«
Ich musste es sagen, ich musste wissen, ob ich mit meiner Vermutung richtig lag. »Ist es, weil Dario zurück ist?«
Einen Moment schien die Zeit stillzustehen, alles verlangsamte sich und die Stille wurde so laut, dass mir die Ohren schmerzten.
»Was?« Dads Augen waren weit aufgerissen. »Woher weißt du davon?«
In Sekundenschnelle ging ich die Möglichkeiten durch.
Ich hatte kaum Kontakt zu Leuten außerhalb dieser vier Wände. Zumindest nicht nach Dads Wissen. Internet und Handy waren erlaubt, aber wenn er erfuhr, dass ich diesen Bonus nutzte, um die Skulls zu verfolgen oder um anderen zweifelhaften Dingen nachzugehen, würde er mir auch diese Freiheit entziehen.
»Woher weißt du es?«, wiederholte er.
»Als Mr. Lieberman zu Besuch war, muss ich etwas aufgeschnappt haben.«
Du sollst nicht lügen, Gott sieht alles.
Dad sah mich einige Sekunden an, als erkannte er meine Lüge, aber dann senkte er den Blick. »Lieberman.« Er rieb sich über das Kinn. »Er hat auch Ärger mit den Santocas, warum also sollte er Carlos’ Sohn erwähnen?«
Carlos’ Sohn. Die Gleichgültigkeit, mit der mein Vater über Dario sprach, traf mich. Früher war er wie ein eigenes Kind für Daddy gewesen.
Unsere Väter hatten nicht nur zusammengearbeitet, unsere Familien waren eng befreundet gewesen. Carlos Santoca, hohes Tier im Stadtrat, und Dad, einer der bekanntesten Richter in Atlanta, hatten sich perfekt ergänzt. Im Gerichtssaal waren sie ein eingespieltes Team, privat feierten wir Gartenpartys zusammen. Unsere Familien verbrachten den jährlichen Karibikurlaub zusammen und Carlos’ Kinder, Melissa, Leo und Dario waren wie Geschwister für mich gewesen. Jetzt sprach mein Vater von Dario, als kannte er ihn nicht.
»Ich höre, Aubrey.«
Seine Stimme riss mich aus den Gedanken und ich versuchte, mich an seine Frage zu erinnern. »Wie bitte?«
»Warum sollte Lieberman Dario erwähnen?«
»Keine Ahnung.«
»Und wie kommst du darauf, dass seine Rückkehr etwas mit meiner Entscheidung gegen deinen Collegebesuch zu tun haben könnte?«
»Sag du es mir.« Die Hitze kribbelte wie Luftblasen unter meiner Haut, aber ich hielt meine Wut, so gut es ging, zurück. »Bitte sag mir, was zwischen Carlos und dir vorgefallen ist.«
»Er hat mich um fünf Millionen betrogen.«
Diesen Teil der Geschichte kannte ich bereits, aber ich war sicher, das mehr dahintersteckte. »Was hat das mit Dario und mir zu tun? Warum durften wir uns nicht weiter sehen? Warum hältst du mich seitdem hier gefangen?«
»Ich halte dich nicht gefangen, ich beschütze dich.«
»Indem du mir alles verbietest?« Meine Stimme zitterte, aber ich musste es loswerden, bevor ich den Mut verlor. »Ich weiß vielleicht nicht, was wirklich passiert ist, aber ich weiß, dass Dario mir nie etwas tun würde.«
»Aubrey …« Er schüttelte den Kopf und nahm meine Hände in seine. »Ich habe dir gesagt, dass ich nicht darüber rede -«
»Weil du mich beschützen willst«, unterbrach ich ihn. »Aber ich muss es wissen. Ich will endlich wissen, warum ich so leben muss.«
In Dads grauen Augen blitzte etwas auf, das ich als Mitleid deutete. Ich wusste, dass er es nicht tat, um mich zu bestrafen. Er versuchte, mein Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Innerhalb unseres Anwesens durfte ich tun, was ich wollte, solange ich mich benahm. Ich durfte den ganzen Tag Filme im Kinosaal sehen und durfte Pizza bestellen, wann immer ich wollte. Meistens lud ich Pyro und Robert – unsere Bodyguards – dazu ein, um ein wenig Gesellschaft zu haben.
Die Regeln waren einfach. Kein Alkohol, Bettruhe ab zehn Uhr und jeden Sonntag ein Kirchbesuch. Nicht, dass die Kirche nicht allgegenwärtig war. Neben seiner Tätigkeit als Richter diente Dad als Priester in St. Angelic. Was im ersten Moment widersprüchlich erschien, war nichts Ungewöhnliches. Viele ortsansässige Pfarrer gingen neben ihrem Dienst an Gott auch gewöhnlichen Berufen nach.
Je länger er schwieg, desto gewaltiger wurde die Druckwelle in meiner Brust. Mit jeder Sekunde breitete sie sich aus und drohte, meinen Brustkorb zu sprengen. »Bitte, ich muss es wissen.«
»Aubrey …«
»Bitte Daddy. Ich verspreche, dass ich danach nie wieder fragen werde, aber sag mir, was los ist.«
Er atmete tief ein, rieb sich über die Stirn und presste die Lippen zusammen. »Du hast recht, es geht nicht nur um mein Zerwürfnis mit Carlos. Auch Dario hat etwas Schreckliches getan.«
»Was denn?«
Dad schwieg.
Ich drückte seine Hand. »Was hat Dario getan?«
Mein Vater atmete laut aus und schüttelte den Kopf. »Seit zwei Jahren habe ich mich vor diesem Moment gefürchtet.«
Die Angst vor der Wahrheit kroch durch meine Zellen und lähmte mich wie Gift. »Egal, was es ist, ich komme klar.«
»Dario hat einen Menschen getötet.«
Wie eine Kugel schossen die Worte meines Vaters durch mein Gehirn.
Sie rauschten durch meine Synapsen und färbten die Sommertage schwarz, an denen Dario und ich durch den Garten getobt waren.
Unsere Klavierstunden.
Dario hat einen Menschen getötet.
Unsere heimlichen Filmabende, wenn das ganze Haus schlief und es nur ihn und mich gegeben hatte.
Dario hat einen Menschen getötet.
Die Berührungen, wenn er seine Hand mit meiner verglich und darüber lachte, wie klein ich war.
Dario hat einen Menschen getötet.
»Es tut mir leid, mein Schatz.« Dad wischte mit dem Daumen über meine Wange. »Jetzt kennst du den Grund für meine Sorge. Ich wollte dir das alles ersparen, weil ich weiß, wie sehr du dich mit ihm verbunden gefühlt hast. Er war besessen von dir und ich bin sicher, dass er dir auch etwas antun würde.«
Noch immer rauschten Erinnerungen an den Jungen von damals durch meinen Kopf. Seine braunen Augen, in denen immer Dunkelheit gelegen hatte. Schon als Kind bemerkte ich, dass Dario anders als die Jungs in meiner Schule war. Im Sommer ging er nie mit uns schwimmen. Nie erhellte ein Lächeln sein Gesicht. Ich erwischte ihn öfter nachts in Dads Heimkino mit einem Joint in der Hand, weil er nicht schlafen konnte.
In manchen Nächten nahm ich ihn mit auf mein Zimmer, weil es ihm Frieden gab, wenn er mich beim Schlafen beobachtete. Wenn ich morgens aufwachte, saß er noch immer auf dem Boden vor meinem Bett und starrte ins Leere.
Dario war mein dunkler Engel mit zerbrochenen Flügeln gewesen.
Satan war auch ein Engel, bevor er aus dem Himmel verbannt wurde, sagte er immer und ich lachte darüber, denn für mich war Dario immer Gott gewesen. Mein Freund, meine Sonne, meine Welt – mein ganzes Universum.
Die Schlagzeilen aus dem Internet schlichen sich in meine Gedanken.
Junge verschwindet nach Aufnahmeprüfung der Skulls. Dario Santoca – die Hölle wollte ihn nicht.
Bisher hatte ich über die reißerischen Überschriften gelacht. Ich hatte selbst ein paar erfunden. Aber nie hatte ich auch nur eine Sekunde geglaubt, es könnte die Wahrheit sein.
Dads Lippen bewegten sich, er sprach, aber meine Gedanken waren so laut, dass ich mich anstrengen musste, um ihn zu verstehen.
»Bitte sag etwas, Schatz.«
»Ich …« Tausend Fragen schossen durch meinen Kopf. »Bist du sicher? Ich meine, wen? Woher weißt du das und warum ist er dann nicht im Gefängnis? Warum sollte er mir etwas tun?«
Dad warf einen Blick auf seine Armbanduhr, trank einen Schluck Kaffee und nahm meine Hand wieder. »Quäle dich nicht noch mehr, Aubrey. Das, was du weißt, genügt.«
Er erhob sich, schob seinen Stuhl zurück und stellte sich neben mich. Mit einer Hand griff er nach der feinen Goldkette um meinem Hals und umfasste den Kreuzanhänger. »Gott ist bei dir. Er kennt alle Antworten und erhört all deine Gebete.«
Er ließ die Kette los, beugte sich herunter und küsste meine Stirn. »Vielleicht solltest du heute am Gottesdienst teilnehmen, dann bist du bei mir.«
»Nein, schon gut.« Ich zwang mich zu einem schwachen Lächeln. »Rosie wollte heute einen Test mit mir schreiben und ich will nicht umsonst gelernt haben.«
»Gut, nimm dir Zeit, um damit klarzukommen.«
Er rief Rosie, damit sie den Tisch abräumte, und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Wahrscheinlich bat er sie, ein Auge auf mich zu haben.
Dad verließ den Wohnbereich, kurz darauf fiel die Haustür ins Schloss und ich blieb mit meinen Gedanken zurück.
Es konnte nicht stimmen. Dad musste sich täuschen.
Was, wenn Dario wirklich ein Mörder ist?
Ich starrte zu Boden und versuchte die Worte, die durch meinen Kopf wirbelten, zu sortieren.
Ich musste die Wahrheit herausfinden.
Falls Dario unschuldig war, und daran wollte ich noch immer glauben, konnte ich Dad vielleicht davon überzeugen, mich ein normales Leben leben zu lassen.
Kapitel 3
AUBREY
Ich schloss meine Zimmertür, warf die Anmeldeformulare für das College in den Papierkorb und setzte mich mit dem Laptop aufs Bett. Ich starrte eine Weile auf den Bildschirm, überlegte, ob es vernünftig war, und stieß ein heiseres Lachen aus. Seit wann war ich vernünftig?
Das, was ich vorhatte, würde mir beim Beichten wahrscheinlich drei Ave Marias einbringen oder einen direkten Weg in die Hölle. Aber meine Angst hielt sich in Grenzen. Mehr Angst bereitete mir Dads Geständnis. Es konnte nicht stimmen. Dario war düster, aber er war kein Mörder.
Zögerlich tippte ich im Browser die ersten Buchstaben ein. Der Computer ergänzte das Wort von alleine. Täglich chattete ich dort, kommentierte in Buchgruppen oder sah nach, was es Neues gab. Es war meine Verbindung zur Außenwelt. Wenn ich im Internet surfte, gehörte ich dazu.
Ich ging auf die Fanseite der Skulls, klickte auf »neuer Gast Beitrag« und schrieb: Rotkäppchen hat sich vom großen bösen Wolf fressen lassen. Aber ich bin nicht Rotkäppchen, ich bin diejenige, die mit dem Wolf auf die Jagd geht.
Einen Klick später ging der Beitrag online.
Dario war auf meine anderen Posts angesprungen und ich war sicher, dieser reizte ihn besonders. Er liebte Spielchen.
Minuten vergingen, aber nichts geschah. Normale Leute haben ein Leben außerhalb des Internets. Er ist unterwegs.
Als ein Kommentar einging, tat mein Herz einen Satz.
Denver21: Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich … heiß. Niemand kennt meinen Namen, aber du wirst ihn heute Nacht schreien.
»Idiot.« Ich verdrehte die Augen und wartete, aber bis auf ein paar witzige oder eindeutige Kommentare reagierte niemand.
Es überraschte mich nicht. Dario würde sich die Vorlage nicht entgehen lassen, ich brauchte nur Geduld.
Nicht gerade meine Stärke, aber beim Gedanken an unser bevorstehendes Treffen kribbelte es in meinem Magen.
Ich klappte den Laptop zu, zog mich an und schob mein Handy in die Rocktasche. Selbst wenn ich nicht zur Schule ging, trug ich meine alte Uniform. Ein grauer Rock mit dem grün-weißen Emblem der St. Antonius High, eine weiße Bluse, darüber eine graue Weste. Weiße Kniestrümpfe mit Spitzen und rote Chucks vervollständigten mein Outfit. Es war ein schwacher Versuch, etwas Kontrolle und Widerstand in meinen Alltag zu bringen. Ich band meine hellblonden Haare zu einem hohen Pferdeschwanz und verließ mein Zimmer.
»Sehr gut.« Rosies grüne Augen strahlten, als sie mich auf der Treppe entdeckte. »Dein Dad meinte, du bist nicht gut drauf. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das ändern können.« Die Grübchen um ihren Mund vertieften sich, als ich unten ankam und sie umarmte.
Sie schob mich sanft von sich und musterte mich. »Wir haben uns heute schon gesehen. Alles okay?«
Rosie kannte mich gut genug, um sich zu wundern. Normalerweise kam ich zu spät und begrüßte sie mit einem »Wusa.«
Eine alberne Anspielung auf einen Film, den wir mochten. Im Laufe der Jahre waren wir Freundinnen geworden. Mit ihren fünfunddreißig Jahren hätte sie fast meine Mutter sein können, aber auch, wenn sie sich große Mühe mit meiner Ausbildung gab, hatte sie nicht verlernt, Spaß zu haben.
Ich sah mich rechts und links nach Pyro und Robert um, die immer irgendwo im Haus umherschwirrten, griff ihren Arm und zog sie hinter mir her.
Als wir das Wohnzimmer hinter uns gelassen hatten und die Bibliothek erreichten, schloss ich die Tür hinter uns und überlegte, wie ich beginnen sollte.
Rosie nahm an dem großen Tisch aus dunklem Holz in der Mitte der Bibliothek Platz, wartete, bis ich mich auf dem Stuhl ihr gegenüber gesetzt hatte, und schob mir ein Mathematikbuch zu.
»Fangen wir mit dem Schlimmsten an und arbeiten uns zu den angenehmeren Fächern durch«, sagte sie.
Ich schlug das Buch auf, blätterte zu der Seite, auf der wir gestern stehen geblieben waren, und atmete tief aus. »Kann ich dich mal was fragen?«
Bisher hatte ich mit ihr nur über die Probleme mit Dad gesprochen. Mehr als einmal hatte sie bewiesen, dass ihre Loyalität trotz des stolzen Gehalts, das mein Vater ihr zahlte, nicht bei ihm lag. Ich konnte ihr vertrauen, aber trotzdem fiel es mir schwer, über Dario zu reden. Unsere Vergangenheit, unsere Verbindung war etwas Intimes und ich hatte das Gefühl, dass ich es entehrte, wenn ich darüber sprach.
Rosie klappte mein Buch zu und runzelte die Stirn. »Klar, alles, das weißt du doch.«
»Ich habe noch nie davon erzählt und du musst mir versprechen, dass -«
Das Klingeln meines Handys unterbrach mich. Ich zog es aus meiner Rocktasche, genoss eine Sekunde das warme Kribbeln in meinem Bauch und hob den Finger, um mich bei Rosie zu entschuldigen. Ich stand auf, eilte zu einem deckenhohen Regal in der hintersten Ecke des Raumes und nahm ab.
»Hallo?«
»Du kannst mich nicht kontrollieren.« Darios Stimme klang bedrohlich ruhig. »Diesmal bestimme ich die Regeln.«
Ich warf einen Blick über die Schulter und sah Rosie noch immer am Tisch sitzen, aber in meine Richtung sehend. Ich drehte den Kopf zum Regal und straffte die Schultern. »Wer hat denn immer bestimmt, was wir spielen und wie ich mich benehmen soll? Ich will dich nicht wütend machen, ich will nur mit dir reden.«
»Du machst mich nicht wütend. Du bringst mich auf Ideen. Eigentlich wollte ich dich aus meinem Rachefeldzug heraushalten, aber dank deiner kleinen Aktion ist mir etwas Besseres eingefallen.«
»Was ist los mit dir verdammt noch mal? Mehr als entschuldigen kann ich mich nicht. Ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen, ich will mich nicht streiten.«
»Ich streite mich nicht. Ich zeige dir nur, dass dein Handeln Konsequenzen hat.«
Das warme Kribbeln in meinem Magen wandelte sich in Wut. Er hatte kein Recht, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. »Gut, spiel dich von mir aus auf, aber es reicht. Wahrscheinlich schert es dich auch nicht, was Dad mir erzählt hat.«
Er schwieg eine Weile, doch als er sprach, war der letzte Rest Vertrautheit darin verschwunden. »Du redest mit Daddy über mich? Hast du ihm erzählt, was wir damals in seinem Kino gemacht haben?«
Die Erinnerung an diese Nacht traf mich wie ein Blitz. Es war der intimste Moment gewesen, den wir miteinander geteilt hatten. Dario hatte mich immer wie eine kleine Schwester behandelt, doch nicht in dieser Nacht. In dieser Nacht hatte er für einen Moment eine Erwachsene in mir gesehen. »Er hat mir gesagt, was passiert ist.«
»Aubrey.« Rosies Stimme hallte durch den Raum. Mit Sicherheit fragte sie sich, mit wem ich während des Unterrichts telefonierte. Oder warum ich überhaupt mit jemandem telefonierte.
Ich drehte mich zu ihr, hielt das Handy herunter und warf ihr einen entschuldigenden Blick zu. »Ich beeile mich, bitte gib mir noch eine Minute.«
Sie tippte auf ihre Armbanduhr und nickte.
Ich legte das Handy wieder an mein Ohr. »Aber ich will nicht glauben, dass es stimmt. Wir müssen darüber reden.«
Stille schlug mir entgegen und gerade, als ich dachte, dass er aufgelegt hatte, hörte ich ihn am anderen Ende atmen.
»Können wir uns heute Abend am Park treffen?«, sagte ich und senkte die Stimme. »So gegen elf?«
Doch auch jetzt schwieg er und mein Magen zog sich zusammen. Darios plötzlicher Stimmungswechsel beunruhigte mich mehr als seine Distanziertheit. »Bitte Dario, du kannst mit mir reden, daran hat sich nichts geändert.«
Am Ende der Leitung klickte es. Er hatte aufgelegt.
Das Druckgefühl, das ich schon beim Frühstück gespürt hatte, legte sich um meine Brust und erschwerte das Atmen. Eine Mischung aus Trauer und Angst stieg in mir auf. Ich seufzte, drehte mich um und lief zum Tisch, an dem Rosie noch immer saß und mich mit großen Augen ansah.
»Was ist los?«, fragte sie, als ich mich neben sie setzte und die Hände in den Schoß legte.
Aber auf einmal war mir nicht mehr nach reden. Der Mensch, mit dem ich sprechen wollte, behandelte mich wie eine Fremde und ich wusste nicht, warum.
Als ich nicht antwortete, legte Rosie eine Hand auf meine Schulter. »Ich mache mir Sorgen, zuerst die Begrüßung, dann willst du mir etwas sagen und jetzt bist du traurig. Wer war das am Telefon?«
»Jemand, der mir wichtig ist.« Ich starrte auf meine Hände. Würde ich den mitleidigen Ausdruck in ihren Augen sehen, der auch in ihrer Stimme lag, würde ich anfangen zu heulen. Etwas, das ich mir abgewöhnt hatte.
Die Leute hielten mich für ein verwöhntes, zerbrechliches Mädchen. Jeder in diesem Haus behandelte mich wie ein rohes Ei. Ob es aus Respekt Dad gegenüber war oder an meiner Erscheinung lag, wusste ich nicht. Aber sie unterschätzten mich.
Ich war weder schwach noch zerbrechlich. Ich wuchs an den Hindernissen in meinem Weg und betrachtete sie als Abenteuer. Wenn Dario dachte, dass ich mich einschüchtern ließ, irrte er sich.
»Wenn du willst, verschieben wir den Unterricht.« Rosie rieb mir über den Rücken, ließ mich los und klappte das Buch zu.
»Nein, Ablenkung ist gut. Ich habe keine Lust, nur im Zimmer rumzusitzen.«
»Ich verstehe, dass sich dein Vater Sorgen macht.« Sie seufzte und schwieg einen Moment. »Aber dass er dich hier wie in einem Käfig hält, ist einfach falsch.«
Dad tat es aus noblen Gründen, aber sie rechtfertigten sein Handeln nicht.
***
Vier Stunden später verließ ich die Bibliothek. Den Englischtest und die Matheaufgaben hatte ich hinter mich gebracht, genauso wie Rosies mitleidiges Gesicht, als sie mich vom Unterricht entließ. Ich lief durchs Wohnzimmer, öffnete den Kühlschrank und nahm mir eine Flasche Cola heraus.
Als ich die Tür schloss, erschien Robert, einer der Bodyguards, neben mir. Er grinste, nahm mir die Flasche aus der Hand und trank einen großen Schluck, bevor er sie mir wieder reichte. »Na, warst du fleißig?«
Er streckte den Arm nach oben und legte die Hand an einen Hängeschrank. Ich nickte und ließ meinen Blick über seinen trainierten Bizeps wandern. Selbst unter der Jacke sahen seine Muskeln verlockend aus.
Robert senkte die Stimme. »Pass auf, dass dein Vater nicht mitbekommt, wie du mich ansiehst.« Er grinste unverschämt und beugte sich zu mir herunter. »Außerdem bin ich zu alt für dich, Süße.«
Ich verdrehte die Augen, lachte und drehte mich um. Ohne Robert, Pyro und Rosie, die diesem Haus etwas Humor einhauchten, wäre ich verloren. Das Flirten mit Robby brachte einen kleinen Nervenkitzel in meinen Alltag, aber es war nichts weiter als eine harmlose Spielerei.
Er sah zwar gut aus, aber der Mann war zweiunddreißig und hatte Kinder.
Ich warf Robert über die Schulter einen Blick zu und zwinkerte. »Stimmt, in deinem Alter lässt die Ausdauer nach. Sorry, damit kann ich nichts anfangen.«
»Autsch, Kleine, der war unter der Gürtellinie.«
Ich lachte, lief mit der Flasche zur Treppe, um nach oben auf mein Zimmer zu gehen.
»Wie war dein Englischtest?«
Als ich die erste Stufe der Treppe betrat, hörte ich Dads Stimme. Ich hielt inne und drehte mich zu ihm.
»Gut, schätze ich. Wie lief der Gottesdienst?«
Er zupfte sein Kollar zurecht. »Du hast gefehlt. Ich glaube, es hätte dir gutgetan, bei der Gemeinde zu sein. Wie geht es dir? Konntest du es sacken lassen?«
Nein, ganz und gar nicht, Daddy. Ich bin dabei, etwas sehr Dummes zu tun. Ich nickte und schenkte ihm ein Lächeln, von dem ich hoffte, dass es ehrlich wirkte.
Dad kam einen Schritt auf mich zu, beugte sich zu mir und küsste meine Wange. »Gut so. Und mach dir keine Sorgen, hier bist du sicher.«
»Weiß ich.« Mit dem Daumen deutete ich die Treppe hinauf. »Ich gehe dann mal lesen.«
Er löste das Kollar von seinem schwarzen Hemd und strich es glatt. »Kommst du nachher runter? Ich dachte, wir spielen noch ein bisschen Schach und reden.«
»Klar.« Ich drehte mich um und lief die Treppe nach oben. So sehr ich Dad auch liebte, er bemerkte nicht, dass er mich wie ein kleines Mädchen behandelte.
Für ihn war ich noch immer sieben, glaubte an alles, was er mir erzählte, und konnte mir nichts Besseres vorstellen, als stundenlang mit ihm Schach zu spielen. Doch diese Zeiten waren lange vorbei. Wenn man in einem Käfig aufwuchs, wurde man schneller erwachsen. Oder zumindest fühlte es sich so an. Mit jedem Tag, an dem er versuchte, meine Flügel zu stutzen, rückten die Gitterstäbe näher. Die Welt um mich herum schrumpfte, bis mir nur noch der Ausblick durch Gitterstäbe blieb. Dad ahnte nicht, dass ich kurz vor dem Ausbruch stand. Selbst wenn ich mir dabei Wunden zufügte, ich würde über der Welt schweben und sie betrachten.
Ich ging in mein Zimmer, schloss die Tür hinter mir und schaltete den Laptop ein, klickte mich durch meine Playlist und stellte Evanescence Fallen an.
Als die Melodie durchs Zimmer klang, nahm ich mir ein Buch aus dem Regal, warf mich damit aufs Bett und schlug die Seite mit der umgeknickten Ecke auf. Ich versank zwischen den Zeilen, flog mit Riesenfledermäusen durch die Unterwelt und vergaß alles um mich herum.
»Ich liebe den Ausdruck in deinen Augen, wenn du in andere Welten abdriftest.«
»Verflucht!« Ich schrak vom Bett hoch.
Nur einen Meter entfernt lehnte Dario an der Tür zu meinem Badezimmer. Seine Hände steckten in den Taschen seiner schwarzen Jeans, eine schwarze Strähne fiel in sein Gesicht und bedeckte ein Auge.
Ich rannte zur Zimmertür, drehte den Schlüssel im Schloss und stellte mich vor Dario. »Wie bist du hier hereingekommen?«
»Durchs Fenster, wie früher mal.«
Mein Herz klopfte noch immer schneller, aber der Adrenalinschub ließ nach. Es war merkwürdig, aber ein Glücksgefühl durchströmte mich. »Auf dem Grundstück sind überall Kameras verteilt, das ist unmöglich.«
»Das hält dich doch auch nicht ab.«
»Ich kenne mich hier aus.«
»Mich hat noch nie etwas vom Ziel abgehalten.« Er strich mir eine Strähne hinters Ohr. »Du wolltest reden, hier bin ich. Was hat Daddy dir erzählt?«
Ich hatte Angst vor Darios Reaktion, aber wenn ich Gewissheit haben wollte, musste ich es ansprechen.
Und wenn er sagt, er war es nicht? Wem glaubst du dann?
Darüber konnte ich mich hinterher sorgen. Ich setzte mich aufs Bett und streckte die Hand aus, damit Dario sich setzte. Als er mich nur weiter ansah, nickte ich ihm zu. »Bitte.«
Er stieß sich vom Türrahmen ab und ließ sich neben mir nieder. Sein Parfüm stieg in meine Nase und fast fühlte es sich wie früher an. Früher, als wir Kinder gewesen und nicht in die Kriege unserer Eltern gezogen worden waren.
Am liebsten wollte ich mich an ihn schmiegen und einfach nur seinen Herzschlag hören. Aber auch das schien der Vergangenheit anzugehören.
Dario stützte die Ellbogen auf die Knie und rieb sich mit dem Daumen über seine Unterlippe.
»Ich will die Wahrheit, egal, wie sie aussieht. Versprich mir, dass wir noch ehrlich zueinander sind.«
Sein Blick fand meinen, ein stummes Einverständnis lag in seinen braunen Augen.
»Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob mein Vater dir gesagt hat, dass du dich von mir fernhalten sollst, oder ob du es selbst entschieden hast.« Ich schluckte. »Aber das muss nicht so sein. Egal, was passiert ist, ich will dich, Melissa und Leo zurück in meinem Leben.«
Noch immer schwieg er.
Zwei Jahre lang hatte ich darauf gehofft, ihm alles erklären zu können. Ihm sagen zu können, wie einsam das Leben ohne ihn und seine Schwestern gewesen war und wie es sich seitdem verändert hatte.
»Er hat Angst, dass du mir etwas antust.« Ich lachte auf. »Dad denkt wirklich, dass du mir wehtun würdest. Deswegen sperrt er mich hier ein. Bodyguards, Ausgangssperre, nächtliche Kontrollbesuche, der ganze Kram. Ich ertrage das nicht mehr.«
»Warum sollte er so etwas denken?« Seine Stimme. Darios Stimme war besonders. Warm, tief, kratzig. Man konnte sie leicht von allen anderen unterscheiden. Jedes Mal, wenn er mir früher etwas vorlas, hatte sie wohlige Schauer über meinen Rücken gejagt.
Mit zwei Fingern zupfte ich an meinem grauen Kniestrumpf. Ich war nervös und hatte Angst vor Darios Reaktion, aber trotzdem sah ich ihm in die Augen. »Ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen will ich es von dir hören.«
»Was hat er gesagt?«
»Dass du einen Menschen getötet hast.«
Sein Kiefer verspannte sich und seine Nasenflügel bebten. Dario stand auf, lief zum Fenster und starrte nach draußen. Sein breiter Rücken, seine Größe sperrten das Licht aus.
Ich ging zu ihm und legte eine Hand an seinen Rücken. »Ich will die Wahrheit wissen.«
Nach einigen Sekunden drehte er sich zu mir, sein Blick war eiskalt, etwas darin hatte sich verändert. »Auch wenn sie dir nicht gefällt?«
Ich nickte.
»Aubrey?« Rosie klopfte an die Tür, ich hörte, wie sie den Knauf drehte, und schrak zusammen. »Hey, warum schließt du ab? Wir müssen noch etwas wegen morgen besprechen.«
Ich stolperte zur Tür und war froh, abgeschlossen zu haben. »Ich ziehe mich um, ich komme gleich runter.«
»Gut, aber beeil dich.« Ihre Schritte entfernten sich. Erleichtert drehte ich mich um, lehnte den Rücken gegen die Tür und erschrak erneut, als Dario direkt vor mir stand. Er legte die Hände rechts und links gegen das Holz und beugte sich zu meinem Ohr. »Wenn Daddy es sagt, wird es stimmen.« Sein Atem streifte meinen Hals. »Er hat recht. Ich tue anderen weh. Aber von jetzt an tue ich nur noch seinem Mädchen weh.«
Mein Herz hämmerte gegen den Brustkorb, ich konnte kaum atmen. Ich hob den Kopf, drehte das Gesicht zur Seite, meine Wange berührte seine Schulter. »Warum? Ich habe dir nichts getan.«
»Nimm es nicht persönlich.« Er wich ein Stück zurück. »Was ist das Wertvollste, das James Lacroux besitzt?«
Ich schluckte, wir beide kannten die Antwort.
»Und deswegen treffe ich ihn damit am meisten.«
»Willst du mich auch töten?« Meine Beine zitterten vor Anspannung, aber ich straffte die Schultern und bemühte mich, sicher zu klingen.
Bevor ich wusste, was geschah, packte er mein Handgelenk, drehte mich blitzschnell um und drängte meinen Oberkörper gegen die Tür.
»Lass mich los, verdammt.« Ich presste meinen Hintern gegen seinen Schoß, versuchte, mich zu befreien, aber ich hatte keine Chance.
Mit einer Hand schob er meine Haare auf eine Schulter und biss in meinen Nacken. Nicht fest, aber ich spürte seine Zähne in meiner Haut. »Nicht doch, Babydoll. Was ich mit dir vorhabe, wird ihm mehr wehtun als der Tod.« Dario griff mit der anderen Hand an meine Brust und knetete sie. »Ihr denkt, ihr könnt tun, was ihr wollt, und kommt davon. Aber die Zeiten sind vorbei.«
Er ließ mich los, meine Hand klatschte in sein Gesicht. »Bist du verrückt geworden?« Ich verstand nichts mehr. Warum war er so wütend auf Dad? Und was hatte er mit mir vor?
Dario drehte sich um, lief zum Fenster und öffnete es. Als er die Hände an den Rahmen legte, bereit, nach unten zu klettern, warf er mir einen Blick über die Schulter zu. »Ich war noch nie klarer bei Verstand.«
***
Sechs Jahre zuvor
»Da hinten, zwischen den Sträuchern«, flüstert Dad und deutet mit dem Zeigefinger ins Dickicht. »Da ist ein Bock.«
Er reicht Dario das Fernglas. In Dads Augen spiegelt sich Aufregung, sogar seine Wangen sind etwas gerötet.
»Ich sehe es«, antwortet Dario. »Hoffentlich kommt er raus.«
Ich will, dass der Rehbock davonrennt, und huste laut. Die beiden sehen mich an, Dario richtet den Blick wieder in die Ferne und ich unterdrücke den Impuls, dem Reh etwas zuzurufen, damit es flüchtet. Ich schieße gerne und liebe es, durch den Wald zu streifen, aber ich töte nicht. Meine Schießübungen beschränken sich auf Dosen oder Autoreifen.
»Er bewegt sich«, flüstert Dario, gibt meinem Vater das Fernrohr wieder und wendet sich an mich. »Sei gefälligst leise. Ich will heute jagen.«
In der Ferne bewegt sich etwas. Die Grashalme biegen sich, Äste knacken und ich hebe den Kopf und sehe die Spitzen eines Geweihs aus dem Gebüsch ragen.
Meine Kehle schnürt sich zusammen, ich umklammere den Kreuzanhänger meiner Kette und bete für das Leben des Rehbocks.
Dad gibt Dario ein Handzeichen, die beiden legen ihre Gewehre an und blicken zu dem Tier. Vorsichtig reckt es seine kleine Nase in die Höhe und kommt langsam näher.
Bitte verschwinde. Bitte verschwinde.
»Noch ein Stück«, flüstert mein Vater und klingt dabei wie ein Kind, das auf Santa Claus wartet.
Darios Rückenmuskeln spannen sich an. Die Luft ist von Spannung geladen.
Ich halte die Luft an. Hau endlich ab.
Das Reh senkt den Kopf und tritt aus dem Dickicht hervor und bevor ich wegsehen kann, hallen zwei Schüsse durch die Luft und das Tier kracht zu Boden.
Mein Vater klopft Dario auf die Schulter. »Ein sauberer Treffer, mein Sohn.« Er sieht mich an und lacht. »Aubrey hat ein zu weiches Herz.«
Wie zur Bestätigung laufen Tränen über meine Wangen. »Ich hasse es. Warum tut ihr so was?«