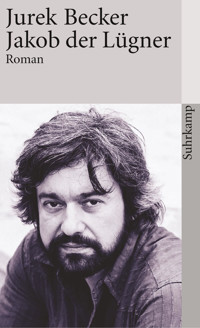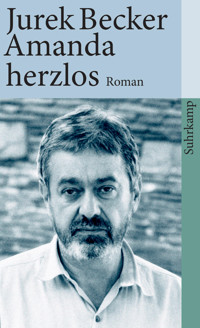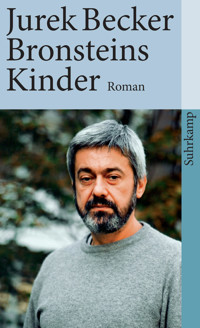
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Damals, 1973, lebte Hans zusammen mit seinem Vater. Mit Martha, der Frau, die er liebte, fuhr er häufig zu dem Häuschen des Vaters vor der Stadt. Eines Tages fand Hans das Haus besetzt. Dies war der Beginn einer Geschichte, die sein Leben veränderte: In dem Haus wurde ein Mann gefangengehalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Damals, 1973, lebte Hans zusammen mit seinem Vater. Mit Martha, der Frau, die er liebte, fuhr er häufig zu dem Häuschen des Vaters vor der Stadt. Eines Tages fand Hans das Haus besetzt. Dies war der Beginn einer Geschichte, die sein Leben veränderte: In dem Haus wurde ein Mann gefangengehalten. Der Vater und zwei seiner Freunde hatten herausgefunden, daß er Lageraufseher während des Krieges war. Nun verhörten sie ihn, schlugen ihn. Sie, die Überlebenden, glaubten eine Legitimation für ihr Handeln zu besitzen, wie sie nur Opfern zusteht. Hans ist zum Mitwisser geworden, und der Vater hielt ihn, weil er das Vorgehen mißbilligte, für einen Feind. Jetzt, ein Jahr später, lebt der Vater nicht mehr. Hans wohnt inzwischen bei Martha, aber die Liebe ist erloschen. Er will nicht bleiben und weiß nicht, wohin. Um die Geschichte vom vergangenen Jahr, von der Entführung des Aufsehers und vom Tod seines Vaters, vergessen zu können, erzählt er sie.
Jurek Becker, 1937 in Lodz geboren, starb am 14. März 1997 in Sieseby (Schleswig-Holstein). Sein Werk – darunter Romane wie der Welterfolg Jakob der Lügner (st 774) oder Der Boxer (st 526), aber auch Erzählungen und Drehbücher (u.a. zur Fernsehserie Liebling Kreuzberg) – wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Es liegt im Suhrkamp Verlag vor. Zuletzt erschienen »Ihr Unvergleichlichen«. Briefe (2004) und Mein Vater, die Deutschen und ich. Aufsätze, Vorträge, Interviews, herausgegeben von Christine Becker (2007).
Jurek Becker
Bronsteins Kinder
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 25. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 1517.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1986
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Brigitte Friedrich / ullstein bild
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73130-7
www.suhrkamp.de
für Christine
Vor einem Jahr kam mein Vater auf die denkbar schwerste Weise zu Schaden, er starb. Das Ereignis fand am vierten August 73 statt, oder sagen wir ruhig das Unglück, an einem Sonnabend. Ich habe es kommen sehen.
Ich wohne seitdem bei Hugo und Rahel Lepschitz, dazu bei ihrer Tochter Martha. Sie wissen nichts vom Hergang der Geschichte, die in meines Vaters Tod ihren Höhepunkt fand, für sie ist er einfach an Herzinfarkt gestorben. Hugo Lepschitz hat damals gesagt, der Sohn seines besten Freundes sei ihm nicht weniger lieb als ein eigener, und sie haben mich zu sich genommen. Dabei hatten die beiden sich kaum zehnmal im Leben gesehen, und wenn sie auch nur das geringste füreinander übrig hatten, dann versteckten sie es wie einen Schatz.
Man hätte alles damals mit mir machen können, mich zu sich nehmen, mich fortschicken, mich ins Bett stecken, nur fragen durfte man mich nichts. Als ich einigermaßen wieder zu mir kam, war meine und meines Vaters Wohnung aufgelöst, ich lag auf dem Sofa der Familie Lepschitz, wurde von Martha gestreichelt, und der Fernseher lief.
Seit Tagen hört das Wetter nicht auf, ein Mai ist das! Ich spüre, wie das Leben zu mir zurückkehrt; es kribbelt in meinem Kopf, die grauen Zellen räkeln sich, nicht lange, und ich werde wieder denken können. Das Trauerjahr geht zu Ende. Wenn man mich vor den goldenen Thron riefe und nach dem einen großen Wunsch fragte, brauchte ich nicht lange zu überlegen: Gebt mir das steinerne Herz. Was die anderen mit ihren Gefühlen leisten, würde ich sagen, das möchte ich mit dem Verstand erledigen. In Zukunft kann mir sterben wer will, noch so ein Jahr wird mir nicht mehr passieren.
Hinter meinem Umzug kann nur Martha gesteckt haben. Als sie mich von Vaters Beerdigung mit den paar kleinen Juden nach Hause brachte und in der leeren Stube sitzen sah, wird ihr vor Mitleid das Herz zersprungen sein. Wir liebten uns damals entsetzlich. Bestimmt hatte sie die besten Absichten, auch wenn heute alles verloren ist. Wenn sie heute ins Zimmer kommt, fange ich sofort zu überlegen an, ob es draußen nicht etwas zu tun gäbe. Seit ich hier wohne, ist unsere Herzlichkeit verfallen, und man muß sehr gute Augen haben, um noch einen Rest davon zu erkennen.
Ich habe nicht den Mut, mich nach einer neuen Freundin umzusehen. Ich stelle mir vor, was geschehen würde, wenn ich eines Tages mit einer Jutta oder Gertrud hier auftauchte. Wie Rahel Lepschitz ihr Gesicht zwischen die Hände nehmen und wie Hugo Lepschitz den Kopf über so viel Undankbarkeit schütteln und wie Martha mit starren Augen versuchen würde, so zu tun, als handelte es sich um das Alltäglichste von der Welt.
Bei Lichte besehen stehe ich also vor der Wahl, mir entweder eine bestimmte Art von Zeitvertreib aus dem Kopf zu schlagen oder hier auszuziehen. Oder die Sache mit Martha renkte sich wieder ein, aber das halte ich für ausgeschlossen. Damals hat es mir nichts ausgemacht, daß sie anderthalb Jahre älter war als ich und daß manche sich wunderten, wie eine so reife und erwachsene Person sich mit einem Kindskopf wie mir abgeben konnte. Heute kommt sie mir vor wie eine Greisin.
Vor einem Jahr hätte ich meinen Kopf verwettet, daß wir drei Kinder haben würden und daß ein riesiges Glück vor uns lag. Vor einem Jahr habe ich gezittert, wenn ich sie nur um die Ecke kommen sah.
Für jede Verrichtung, die man mir überläßt, bin ich dankbar; in der ersten Zeit durfte ich nicht einmal Kohlen aus dem Keller holen, so als wäre Nichtstun die beste Therapie für einen Patienten wie mich. Wenn ich mich in die Wanne legen wollte, mußte Hugo Lepschitz mit seinen Angestelltenärmchen die Kohlen für den Badeofen nach oben schleppen. Aus Mitleid habe ich kaum mehr gebadet. Inzwischen hat sich das Blatt zu meinen Gunsten gewendet, ich darf sogar das Abendbrot zubereiten und den Tisch decken.
Ich decke den Tisch. Sie sehen fern wie jeden Abend, sie kennen keine schönere Beschäftigung, als nach Ähnlichkeiten zwischen Gesichtern auf dem Bildschirm und solchen, die sie persönlich kennen, zu suchen. Man kann nur staunen, wie groß ihr Bekanntenkreis ist, denn an jedem Abend landen sie Treffer. Einmal soll jemand wie mein Vater ausgesehen haben, aber ich wollte das Buch, das ich gerade las, nicht unterbrechen.
Sie setzen sich so an den Tisch, daß der Fernseher in ihrem Blickfeld bleibt. Lepschitz fragt seine Frau, wo Martha steckt, sie weiß es nicht. Er beißt so heftig in ein Stück Matze, daß im Umkreis von einem halben Meter ein Krümelregen niedergeht. Irgendwo in der Stadt gibt es ein Geschäft, in dem man ungarische Matze kaufen kann; Vater ist nur ein- oder zweimal im Jahr hingegangen, doch Lepschitz will jeden Abend diese bröckligen Fladen auf dem Tisch haben. Ich fand den Laden schon immer merkwürdig: keine Apfelsinen, kein Rindfleisch, keine Tomaten, aber Matze für Hugo Lepschitz. »Was ich dich fragen wollte«, sagt Lepschitz kauend.
Noch nie war mir so unbehaglich in dieser Wohnung, dabei ist nichts geschehen. Es ist nur Zeit vergangen, viel zuviel Zeit, es knistert mir im Kopf. Ich hasse die beiden nicht etwa, Gott behüte, ich liebe sie nur nicht allzu sehr und möchte fort und weiß nicht wie.
»Du ißt ja nichts«, sagt Rahel Lepschitz.
Die Fernsehsendung handelt von Bandscheibenschäden: ein rothaariger Mann erklärt, wie durch Stärkung der Rückenmuskulatur die Schmerzen gelindert werden können. Und eine junge Frau im Gymnastikanzug führt die entsprechenden Übungen vor, für Rahel Lepschitz nichts als Schwindel. Ihr Mann fragt: »Wo siehst du Schwindel?«
»Solche Übungen«, sagt sie, »kann nur ein Mensch ausführen, der keine Rückenschmerzen hat. Genausogut können sie einem Beinamputierten empfehlen, täglich zehn Kilometer zu laufen.«
Wer so lebt, wie ich es tue, wie eine Stubenfliege, auf welche Weise will der eine neue Freundin kennenlernen? Ich unternehme nichts, mir kann nichts schiefgehen, und nichts kann eine überraschend gute Wendung nehmen, du lieber Himmel, ich bin noch keine Zwanzig. Mein Vater, der selbst nicht der Lebendigste war, hätte das niemals zugelassen; er hätte darauf bestanden, daß ich in Bewegung bleibe, daß ich zumindest einmal am Tag die Wohnung verlasse, er war ein Antreiber. Wie alt darf einer sein, um noch Vollwaise genannt zu werden? Wenn jemand sechzig ist und keine Eltern mehr hat, wird sich niemand groß wundern, aber wo ist die Grenze?
»Was ich dich fragen wollte«, sagt Lepschitz. »Seit Wochen läßt sich erkennen, daß zwischen dir und Martha etwas nicht in Ordnung ist. Kann man helfen?« »Ich bitte dich«, sagt seine Frau.
»Man kann nicht helfen«, sage ich.
Die Frage verrät, daß Martha ihnen keine Auskunft gibt, das kommt nicht unerwartet. Damals werden sie gedacht haben, sie nähmen die große Liebe ihrer Tochter bei sich auf, Marthas Ein und Alles; plötzlich hängt ihnen ein Untermieter am Hals, ein Trauerkloß von einem Untermieter, der nicht genügend Feingefühl besitzt, sich nach erloschener Liebe zu verdrücken. Die Fernsehturnerin sieht einer Frau aus dem Hinterhaus ähnlich, ich wundere mich, daß sie es nicht bemerken.
»Du mußt verstehen«, sagt Rahel Lepschitz, »daß wir uns Gedanken machen.«
»Aber ja.«
Täglich erwarte ich einen Brief von der Universität. Wahrscheinlich werde ich angenommen, ich habe wenig Zweifel: mein Abiturzeugnis ist gut, und Hinterbliebener zweier Opfer des Naziregimes bin ich auch, was soll da schiefgehen. Ich habe mich für das Fach Philosophie beworben.
Wenn es nach Vaters Willen ginge, hätte ich Medizin zu studieren, er wünschte sich immer einen Internisten zum Sohn. Aber es geht nicht nach seinem Willen, ich werde Philosophie studieren, ohne zu wissen, worum es sich dabei handelt.
»Hab bitte Vertrauen zu uns. Mit wem willst du sonst sprechen?«
Ich sage: »Das ist wahr.«
»Und weiter?«
»Wir fühlen uns nicht mehr voneinander angezogen«, sage ich.
Als ich zehn Tage hier wohnte, habe ich mich hingesetzt und ausgerechnet, wieviel mein Aufenthalt sie jeden Monat kosten würde, es war die größte geistige Anstrengung während des vergangenen Jahres. Seitdem überweise ich an jedem Monatsersten eine gewisse Summe. Zuerst wollten sie keinen Pfennig akzeptieren. Doch ich konnte keine Rücksicht darauf nehmen, nicht nur weil ich fünfmal mehr Geld auf dem Konto habe als sie; ich habe damals argumentiert, daß jedes Verhältnis, in dem die Opfer immer nur von einer Seite getragen werden, nicht von Dauer sein könne. Martha, die zufällig dabeisaß und uns zuhörte, murmelte etwas von altklug. Lepschitz handelte mich um dreißig Mark nach unten, dann waren sie einverstanden.
»Warum antwortest du uns nicht?«
Wie ein Rettungsengel schwebt Martha ins Zimmer. Sie schwebt hinter meinem Rücken vorbei, tippt mir flüchtig auf die Schulter, küßt Mutter, küßt Vater und landet sicher auf einem Stuhl. Tausend Tropfen stecken in ihrem Haar, das braun und glatt ist und über alle Maßen lang. Es ist mir klar, daß ich, sobald von ihrem Aussehen die Rede ist, noch immer wie ein Verliebter klinge. Sie entschuldigt sich für das späte Kommen und erzählt, wer sie aufgehalten hat.
Ich sage: »Wir haben eben über dich gesprochen.«
Das ist nicht nett, natürlich nicht, ich sage es mehr aus Bosheit als um einer Klärung willen.
»Es war nicht weiter wichtig«, flüstert ihre Mutter.
»Ich habe gesagt, daß wir uns nicht mehr voneinander angezogen fühlen«, sage ich leichthin.
Der Vater sendet Unmutswellen aus, aber ich bin nicht einzuschüchtern. In einem russischen Buch habe ich gelesen, daß Leute, die kaum noch etwas mit sich anzufangen wissen, zu Gehässigkeit neigen. »Das werden sie ohne deine Erklärung auch schon bemerkt haben«, sagt Martha.
»Eben nicht.«
»Aber wie konnte das geschehen?« fragt die Mutter, weil die Gelegenheit nun einmal da ist.
Martha und ich sehen uns nach dieser Frage lange an, und man kann es glauben oder nicht: wir lächeln. »Sieh dir die beiden an«, höre ich Hugo Lepschitz vorschnell sagen. Wo kommt auf einmal der Rest an Zuneigung her, dieser Bodensatz in einem Topf, den ich für leer gehalten habe? Das Lächeln zeigt mir, daß wir niemals Feinde werden können, und Martha muß haargenau dasselbe denken, den Augen nach.
»Sieh sie dir an«, sagt Lepschitz.
In meinem Zimmer ist es eng wie im Neuner-Bus. Jedes Ding steht an seinem Platz und doch im Weg, ich habe zuviel mitgebracht. Ich mußte mich von soviel trennen, daß ich nicht fähig war zu prüfen, was ich wirklich brauche. Mit Plattenschrank, Kommode, Sessel, Truhe, Schreibtisch, Bücherleiter, Schaukelstuhl habe ich mir nichts als Enge eingehandelt. Seit Monaten lache ich über die Bücherleiter, doch damals war sie nichts anderes als ein dunkelbraunes Ding, das mein Vater spottbillig in einem Antiquitätenladen gekauft hat, und zwar mit mir zusammen. Ähnliche Erklärungen gibt es für beinahe alles andere auch. Höchstens der Schreibtisch könnte mir eines Tages von Nutzen sein.
Ich lege mich aufs Bett, wie ich es zehnmal täglich tue. Ich lasse den Plattenspieler laufen, um ihre Geräusche nicht zu hören. Manchmal ahne ich, daß meine damalige Hilflosigkeit nicht allein mit Trauer zu erklären ist; die Situation überforderte mich, und die Tatsache, daß Vaters Tod mich etwa die Hälfte meines Verstandes kostete, ändert nichts daran, daß auch beide Hälften zusammen nicht ausgereicht hätten. Aber es kommt mir nicht so ungewöhnlich vor, daß einer, dessen Vater seit ein paar Tagen und dessen Mutter seit Ewigkeiten tot ist, dessen Schwester im Irrenhaus sitzt und der die Schule gerade hinter sich hat, daß dieser eine nicht immer das Richtige tut. Doch ein paar Fehler weniger hätten auch gereicht, das ist schon wahr, vor allem einer war zuviel: das Haus hätte ich nicht verkaufen dürfen. Daß ich die Wohnung aufgegeben habe – schön, sie haben es mir eingeredet; sich aber von dem Haus zu trennen war unverzeihlich.
Ich bekam tagelang zu hören: Was willst du dich mit dieser Hütte vor der Stadt belasten. Sie liegt zu einsam, um dort zu wohnen, mit deinen achtzehn Jahren. Verkauf sie, Junge, dann hast du erstens Geld und zweitens ein Problem vom Hals. Das klang doch sehr vernünftig.
Wenn ich es heute noch hätte, das Häuschen, sähe die Welt für Martha und mich anders aus. Ich will nicht behaupten, wir wären noch ein Herz und eine Seele, aber das Ende aller Bemühungen wäre noch nicht gekommen, da bin ich sicher. Es gibt keinen Ort auf Erden, der für uns wichtiger war. In dem Waldhaus haben wir uns zum erstenmal berührt, ich meine angefaßt, und nur dort haben sich Ängstlichkeit und Scham verloren. Wenn wir uns vornahmen, ins Häuschen zu fahren, dann hieß das immer: wir fahren uns umarmen. Man stellt sich mein Hochgefühl nicht vor, wenn ich unterwegs in das Haus war.
Jetzt verbringt dort ein Schriftsteller seine Wochenenden. Einige Wochen nach meinem Umzug hörte Martha mit ihrem Germanistikstudium auf und ging zur Schauspielschule, das war die nächste Katastrophe. Mit rasender Geschwindigkeit verlor sie eine schöne Eigenschaft nach der anderen. Sie benutzte fremde Wörter, sie warf mit fremden Blicken um sich, sie las andere Bücher, sie nahm Lidschatten aus dem Westen. Und von einem auf den anderen Tag trug sie keine Röcke mehr, sondern ausschließlich Hosen. Wenn das Haus noch dagewesen wäre, hätte man vielleicht etwas tun können.
Von alldem, was mit meinem Vater und, nach seinem Tod, auch mit mir geschah, habe ich nur verschwommene Vorstellungen. Ich vermute, daß man sich von Ereignissen, die aus dem Gedächtnis entfernt werden sollen, zunächst ein möglichst genaues Bild machen muß; und dies gilt wohl erst recht für Erinnerungen, die man bewahren will. Ich aber habe alles nur über mich ergehen lassen: die Erinnerungen kamen und gingen, wie sie wollten, und ich saß da.
Martha kommt in mein Zimmer und fragt, ob ich nicht ein Glas Wein mit ihnen trinken möchte. Ich sage: »Der Mensch ist doch kein Flußbett.«
»Was?«
»Der Mensch ist kein Flußbett«, wiederhole ich.
»Seit wann weißt du das?«
»Seit eben.«
Sie nickt und geht wieder hinaus, als hätte sie die gewünschte Auskunft erhalten.
Ohne Vaters Wissen fuhr ich in das kleine Haus. Ich hatte um den Schlüssel gebeten, doch er gab ihn mir nicht, er sagte, in diesen Tagen dürfe man wohl von mir verlangen, daß ich mich auf den Hintern setze und lerne. Dabei lag das Abitur so gut wie hinter mir, zwei Prüfungen standen noch aus; ich war sicher, daß er Martha nicht leiden konnte, obwohl das unbegreiflich war.
Als mir der Schlüssel zum erstenmal verweigert worden war, hatte ich ihn heimlich genommen, war damit zum Schlosser gegangen und hatte einen Nachschlüssel anfertigen lassen. Seitdem entschied allein ich, wann ich in das Haus fuhr und wann nicht, auch wenn ich jedesmal um Erlaubnis bat.
Martha und ich hatten uns zu Meistern im Spurenverwischen entwickelt: nie war Vater auch nur der geringste Verdacht gekommen. Dabei nahmen wir uns nicht in acht, während wir in dem Haus waren; bevor wir es aber verließen, kam jedes Ding an seinen Platz zurück, jedes Haar wurde aufgehoben, im Radio wurde der alte Sender wieder eingestellt. Die Mühe war übertrieben, weil Vater selten hinausfuhr und zudem gutgläubig war, doch Martha bestand darauf. Hin und wieder ließ er Bekannte für einige Tage in dem Häuschen wohnen. Einmal lagen wir im Bett, als jemand sich an der Tür zu schaffen machte. Noch nie habe ich Martha so erleichtert gesehen wie in dem Augenblick, als sich herausstellte, daß es ein Einbrecher war. Ich bin aus dem Fenster gestiegen und habe mich von hinten, mit einem Knüppel in der Hand, an ihn herangeschlichen; er floh entsetzt und hatte dreimal soviel Angst wie ich.
Hinter mir in der S-Bahn hörte jemand Nachrichten: der Zustand Walter Ulbrichts war unverändert ernst, und die verfluchten Franzosen hatten im Südpazifik wieder einmal ihre Wasserstoffbombe gezündet. Jemand sagte leise, daß die Russen es auch nicht besser machen. Es war ein Sonntag.
Ausnahmsweise fuhren wir nicht zusammen. Martha hatte einer Freundin, die vor der Stadt wohnte, versprochen, ein Buch vorbeizubringen, deshalb wollten wir uns beim Häuschen treffen. Ich war früh dran, vor Ungeduld oder in der Hoffnung, sie könnte eher da sein als erwartet. Weil uns die Liebe hungrig machte, hatte ich ein Päckchen mit belegten Broten bei mir. Man mußte mit der Bahn bis Erkner fahren, dann weiter nach Neu-Zittau mit dem Bus, und dann blieb immer noch ein Weg von zwanzig Minuten durch Wald.
Vater hatte das Haus gekauft, als ich ein Baby war und Mutter noch lebte. Er muß damals in Geld geschwommen sein. Das Haus selbst war wohl nicht so teuer, doch die Renovierung wird ein Vermögen gekostet haben: Regenrinnen aus reinem Kupfer kamen ans Dach, weil Zinkblech nicht aufzutreiben war, drei der vier Zimmer wurden mit Buchenholz ausgekleidet, und jedes bekam eine elektrische Fußbodenheizung. Als Martha zum erstenmal das Haus betrat, war sie so beeindruckt, daß sie mich vergaß.
Er hat mir nie erzählt, wie er zu seinem Reichtum kam, zum längst aufgebrauchten; doch aus Bemerkungen, aus Unvorsichtigkeiten, die ihm über Jahre hin unterliefen, konnte ich mir ein Bild machen. Bald nach dem Krieg muß er Schieber gewesen sein; nicht etwa einer von diesen Kerlen mit hochgeschlagenem Mantelkragen, die auf Schwarzmärkten und in finsteren Hausfluren ihr Zeug verkauften, o nein. Er muß an Geschäften zwischen der Ost- und der Westzone beteiligt gewesen sein. Er muß Waren, die westliche Händler nicht in den Osten liefern durften, gekauft und über die Grenze geschafft haben, zum Beispiel Stahl. Ein paarmal habe ich ihn sagen hören: Es ging nicht immer so ordentlich wie heute zu, mein Lieber. Und einmal, als ich ihn bat, in meine Schule zu kommen und im Geschichtsunterricht als lebender Zeuge über die Nachkriegszeit zu berichten, hat er den Küchenschrank angesehen und geseufzt: Jetzt hat er sein letztes bißchen Verstand verloren.
Eine Besonderheit dieses Waldes bestand darin, daß er oft nach Pilzen duftete, nach Bergen von Morcheln und Pfifferlingen, obwohl kaum einer zu finden war. Andauernd begegnete man Leuten mit leeren Körben, Küchenmessern und enttäuschten Gesichtern, vor allem an Wochenenden.
Schon aus einiger Entfernung sah ich, daß der Tag verdorben war: vor dem Eingang des Häuschens stand, widerwärtig gelb, das Auto von Gordon Kwart, einem Freund meines Vaters. Ich verstand nicht, warum Vater mir seinen Besuch verschwiegen und statt dessen meine Prüfung vorgeschoben hatte. Ich durfte mich nicht blicken lassen, denn selbstverständlich würde Kwart meinem Vater von mir berichten. Und von dort bis zur Frage, wozu ich mich ohne Schlüssel beim Haus herumtrieb, war nur ein Katzensprung. Also konnte ich getrost Martha entgegengehen, auf Vater fluchen und überlegen, was aus dem angebrochenen Sonntag werden sollte. Die Brote warf ich in den Wald. Der Rückweg war noch keine zehn Schritte lang, als ich umzukehren beschloß. Ich trat an die Hauswand heran und horchte. Erstens konnte Martha schon da sein und, ahnungslos wie sie war, im Häuschen auf mich warten. Zweitens war es möglich, daß Kwart nur kurz gekommen war und gleich wieder verschwand.
Unter meinem Lieblingsfenster, durch das die Kiefernstämme aussehen wie eine festgefügte Bretterwand, preßte ich das Ohr an die Mauer und gab mir Mühe, die Waldgeräusche auszufiltern. Sekunden später hörte ich einen kleinen Schrei, der hatte nichts Fürchterliches an sich. Ich lächelte gewiß, ich dachte: dieser Kwart. Denn der Schrei schien mir einer von der Sorte zu sein, wie sie in Liebschaften vorkommt, und Kwart war kaum jünger als mein Vater, ich schätze ihn auf Ende fünfzig.
Dann schrie es zum zweitenmal, ein wenig lauter, das hatte nichts mehr mit Zärtlichkeiten zu tun, eher mit Schmerz. Jetzt erschrak ich zu Tode über das Unbekannte, das plötzlich in unserem Häuschen vor sich ging. Eine aufgeregte Stimme, die ich nicht erkannte, rief etwas. Ich nahm den Schlüssel aus der Tasche, öffnete die Tür und stand im dunklen Flur. Die Bewegung kam aus dem großen Raum, dessen Tür aber geschlossen war. Es gab Gründe genug, sie nicht aufzureißen und zu rufen: Was ist hier los? Ich stellte mich in die Ecke hinter den Kleiderschrank, das einzige Möbel im Flur, und erschrak zum zweitenmal: es roch nach Urin.
Da war ich schon entschlossen, mit Vater über diese Ungeheuerlichkeit zu sprechen, auch wenn ich damit meinen Vertrauensbruch eingestand. Und wenn ich wirklich dazu bereit bin, dachte ich Augenblicke später, dann könnte ich Kwart auch sofort zur Rede stellen. Verschmutzte unser schönes Haus, dieser liederliche Mensch, daß man es Wochen würde lüften müssen, um ohne Ekel darin zu atmen!
Dann hörte ich Vater sagen: »Können wir endlich weitermachen?«
Das war das schlimmste: mein Vater hinter der Tür. Die Antwort war ein leises, langgezogenes Wimmern, das klang, als suchte jemand einen komplizierten Ton.
Ein Mann, dessen Stimme mir fremd war, sagte: »Laß ihm etwas Zeit.«
Mein Vater sagte laut und vorwurfsvoll: »Er hat genug Zeit gehabt.«
Sie mußten mindestens zu viert im Zimmer sein: mein Vater, der bisher stumme Kwart, die fremde Stimme und schließlich dieser Eine, mit dem sie sprachen. Es konnte doch nicht Gordon Kwart gewesen sein, der so gewimmert hatte.
Mein Vater sagte: »Zum letzten Mal: reden Sie jetzt weiter?«
»Was wollen Sie denn hören?« fragte jemand furchtsam.
Die erste unbekannte Stimme: »Wie viele gehörten dazu?«
Die Antwort: »Acht oder neun. Das habe ich doch schon gesagt.«
»Sie werden es so oft sagen, wie Sie gefragt werden.«
»Also acht?« fragte mein Vater. »Oder neun?«
»Acht«, war die Antwort nach einer Pause.
»Wer hat die Leute ausgesucht?«
»Das weiß ich nicht.«
Ich hörte ein Geräusch, das eindeutig ein Schlag war, ein dumpfer Hieb auf Rücken oder Brust, man erkannte es auch am nachfolgenden Stöhnen. Mein Gott, wer schlug da wen, noch nie im Leben hatte mein Vater mich angerührt. Und wer war das Opfer? Ein paar Greise hatten offenbar den Verstand verloren und gebärdeten sich wie die Helden eines Alptraums. Die hielten einen gewaltsam fest, verhörten ihn und waren mit den Antworten nicht zufrieden, soviel war klar.
Aus dem Badezimmer kam Gordon Kwart, nein, aus der Küche; mein Kleiderschrank verbarg mich nun zur falschen Richtung hin, Kwart sah mich auf den ersten Blick und machte empörte Augen.
Er fragte: »Was tust du hier?«
»Was ich hier tue?« sagte ich so dreist wie möglich. »Das ist auch mein Haus.«
Aber er ließ sich nicht auf Spitzfindigkeiten ein und rief: »Arno!«
Die Hoffnung, in dem Zimmer könnte ein Mann sein, dessen Stimme der meines Vaters verblüffend ähnlich klang, war nun dahin. Es wäre sinnlos gewesen, Kwart über den Haufen zu rennen und zu fliehen, ich hätte ihn schon umbringen müssen.
Mein Vater öffnete die Zimmertür. Er blickte zu Kwart, ich stand noch immer in Deckung und war für Vater kaum sichtbar. Er sah erschöpft und mürrisch aus. Das Stückchen Zimmer, das ich erspähte, war leer. Der Geruch kam von dorther.
Kwart deutete mit dem Kinn auf mich und sagte: »Wir haben Besuch.«
Vater trat schnell heran. Ich verwünschte meine Neugier, als ich sah, wie mein Anblick ihn erschreckte. Sein Hemd war stark verschwitzt, Flecken von den Achseln abwärts bis zur Hüfte. Kwart stand unschlüssig da, als wüßte er nicht, ob er Vater und Sohn nicht besser allein lassen sollte. Mein Vater griff mich beim Kragen. Er tat es so heftig, daß ein Knopf zu Boden fiel und eine Naht hörbar riß. Wir standen uns lange gegenüber, ich einen Kopf größer. Er biß die Zähne wie im Krampf aufeinander. Schließlich stieß er mich gegen die Wand und ließ los. Er vergrub die Hände tief in den Hosentaschen, wie um sich vor einer unbedachten Tat zu schützen. Endlich verschwand Gordon Kwart, vielleicht wollte er auch nur die Zimmertür vor meinen Blicken schließen.
Ich hatte keinen Zweifel, daß Vater vor allem anderen danach fragen würde, auf welche Weise ich ins Haus gekommen war; und ich beschloß, bei der Wahrheit zu bleiben, ich war viel zu verwirrt, um eine gute Geschichte zu erfinden. Auch ich steckte die Hand in die Hosentasche, ich wollte als Antwort auf seine erste Frage den Schlüssel hervorholen. Doch er fragte: »Wie lange stehst du schon hier?«
»Lange genug«, sagte ich und ließ den Schlüssel in meiner Tasche los.
»Was heißt das?«
Ich fragte: »Wer hat geschrien?«
Da geschah etwas vollkommen Verrücktes, er umarmte mich. Was hatte ich getan, das mich so liebenswert machte, ich spürte seinen aufgeregten Herzschlag. Ich hörte ihn traurig flüstern: »Ach Hans, Hans …«, das sollte heißen: Welcher Teufel hat dich bloß hergeführt. Als er mich losließ, hatte er wieder das wütende Gesicht.
Er fragte: »Warum sitzt du nicht zu Hause und lernst?«
»Weil ich alles weiß«, sagte ich.
Vater schnitt eine seltsame Grimasse, er saugte die Lippen tief in den Mund und kniff die Augen zu; er nickte lange vor sich hin und wirkte so ratlos, wie ich ihn nie gesehen hatte. Der Entschluß, mich am Arm zu nehmen und in das Zimmer zu führen, muß ihm schwergefallen sein.
Als die Tür geöffnet war, sagte er: »Das ist mein Sohn.«
Die Erklärung galt zwei fremden Männern, die mich anstarrten. Der eine stand neben Kwart am Fenster, er war mindestens siebzig Jahre alt, dick, groß und kahlköpfig, bis auf einen schmalen Kranz schneeweißer Haare. Eine Brille klemmte auf seiner Stirn. Den anderen schätzte ich um ein paar Jahre jünger. Er war es, der so schlecht roch, sein ehemals weißes Hemd starrte von Speiseresten. Er saß in unbequemer Haltung auf einem Eisenbett: sie hatten seine Füße mit einem Ledergürtel zusammengebunden, der um einen der eisernen Pfosten geschlungen war. Die Hände konnte er zwar frei bewegen, doch gewiß nur vorübergehend; am Bettgestell hingen Handschellen, in denen ein Schlüssel steckte. Das Eisenbett gehörte nicht zum Zimmer, ich hatte es nie zuvor gesehen.
Der Fremde am Fenster fragte Vater: »Wozu mußtest du ihn herholen?«
»Ich habe ihn nicht geholt«, sagte mein Vater.
»Wieso ist er dann hier?«
»Frag ihn selbst.«
Ein Nachttopf stand unter dem Bett. Und auf der Hose des Gefangenen, zwischen seinen Beinen, sah ich Nässe, ich konnte gegen den Blick nichts tun. Auf der Matratze waren dunkle Flecken, wahrscheinlich Blut. Ich dachte daran, daß ich Vater zuletzt vor ein paar Stunden gesehen hatte, zu Hause, und daß mir nichts an ihm aufgefallen war.
»Man wartet auf deine Erklärung«, sagte Vater. Der Mann auf dem Bett war sich nicht schlüssig, ob ich Freund oder Feind war; doch schien der Umstand, daß mein Erscheinen die drei beunruhigte, ihn ein wenig hoffnungsfroh zu stimmen, das war mein Eindruck. Wir konnten nicht aufhören, einander anzusehen. Auf einmal wußte ich, daß ich den Schlüssel in meiner Tasche nicht verraten durfte.
Kwart sagte zu Vater: »Mir hat er auch nicht geantwortet.«
Sie mußten den Mann so eingeschüchtert haben, daß er es nicht wagte, die Fessel von seinen Füßen zu lösen, obwohl er die Hände doch frei hatte. Er sagte zu mir: »Diese Männer haben mich entführt, und jetzt foltern sie mich.«
Kwart fragte vom Fenster her: »Wer foltert?«
Nach einem Augenblick der Stille trat mein Vater ans Bett, schlug mit dem Handrücken ein paarmal dem Gefangenen gegen die Brust und fragte streng, wie zum letzten Mal: »Ob wir dich foltern?«
»Nein.«
Vater blickte kurz zu mir, sah mein entsetztes Gesicht und wendete sich wieder dem Mann zu. »Jetzt sagst du ihm, warum du hier bist.«
Der Mann antwortete widerstrebend: »Weil ich …«
In diesem Moment wußte ich, worum es ging. Vaters Finger stieß zu jeder Silbe derb an sein Brustbein, während er ihm vorsagte: »Weil ich ein …«
»… Aufseher gewesen bin«, ergänzte der Mann.
»Und zwar wo?«
»In Neuengamme.«
»Und jetzt erklär ihm, was Neuengamme bedeutet.«
Ich sagte: »Ich weiß es.«
»Moment mal«, sagte der mir unbekannte Mann am Fenster zu Vater, »soll das heißen, daß wir jetzt zu viert sind?« »Er ist nun mal hier«, sagte mein Vater ärgerlich.
Das Ungeheuerliche hatte sich im Gesicht des Aufsehers wunderbar getarnt: hinter Stirnfalten, grauen Augen ohne Brauen, Augenringen, Bartstoppeln, die sich schon zu kräuseln begannen, und hinter einem kleinen blassen Mund, der selbst beim Sprechen kaum aufging, war es unauffindbar.
»Daß er hier ist, sehe ich auch«, sagte der am Fenster.
»Aber wie geht es weiter?«
»Hast du einen Vorschlag?« fragte ihn Vater.
Nur auf Fotos und in strengen Filmen war ich solchen Leuten bisher begegnet, nun saß er leibhaftig auf dem Bett und machte einen enttäuschend schwachen Eindruck. Er sagte: »Die Herren wollen nicht wahrhaben, daß damals ein anderes Recht gegolten hat.«
Mein Vater zeigte bedrohlich mit dem Finger auf ihn und sagte: »Nimm nie wieder in meiner Gegenwart das Wort Recht in den Mund.«
Ich war nicht sicher, ob er die Rolle des Verhandlungsführers spielte oder ob sich das jetzt, durch meine Gegenwart, so ergeben hatte.
»Wie ist er hereingekommen?« fragte der Fremde meinen Vater. »Ich denke, du hast den einzigen Schlüssel?«
»Du gehst mir auf die Nerven«, sagte Vater. »Andauernd willst du von ihm etwas wissen und fragst mich.«
Ich sagte: »Ich bin vorbeispaziert, und die Tür war angelehnt.«
»Die Tür war angelehnt?«
Beide blickten vernichtend zu Kwart, der sofort den Kopf schüttelte. »Ausgeschlossen«, sagte er, »ich habe sie zugemacht. Weiß ich nicht, wie man eine Tür zumacht?«
»Und wie ist er reingekommen? Durch den Schornstein?«
»Was weiß ich.«
In all dieser Unordnung war der Gedanke an Martha das einzig Helle und Tröstliche. Vielleicht stand sie schon in der Nähe des Hauses und wartete ungeduldig auf mein Zeichen. Ich mußte zu ihr, die Frage war nur, ob man mir Schwierigkeiten machte. Dieser Fremde und Kwart und Vater steckten in einer Unternehmung, die scharfe Vorsicht verlangte; aber sie konnten unmöglich gegen mich, den Sohn von Arno, Gewalt anwenden.
»Sag die Wahrheit, Junge«, sagte Kwart, »wie bist du ins Haus gekommen?«
»Sie haben es gehört.«
»Aber die Tür war nicht angelehnt.«
Kwart sah mich enttäuscht an. Auf einmal drehte er sich zu Vater um und sagte: »Ich möchte sehen, was in seinen Taschen ist.«
»Was soll in seinen Taschen sein?«
»Das will ich eben sehen.«
Der Gefangene saß vor Spannung aufrecht wie ein Bettpfosten. Vater schien von Kwarts Vorschlag nicht überzeugt zu sein. Er fragte mich: »Hast du etwas in deinen Taschen, was uns interessieren könnte?«
»Nein.«
»Einen Schlüssel vielleicht?«
»Nein.«
»Ich glaube ihm«, sagte Vater zu Kwart. »Wenn seine Antwort dir nicht genügt, mußt du dich selbst mit ihm einigen.«
Ich überlegte, welche von zwei Möglichkeiten die bessere war: zuerst zu sagen, daß ich nun gehen wollte, und dann zu gehen, oder einfach zu gehen. Die erste kam mir eine Spur versöhnlicher vor, also sagte ich: »Ich muß jetzt gehen.«
Ohne ihr Einverständnis abzuwarten, ging ich zur Tür, natürlich sah ich niemanden an. Vom Fenster her sprang der Fremde herbei und stellte sich mir in den Weg. Er sagte zu Vater: »Er kann nicht einfach gehen, bevor wir etwas entschieden haben.«
Aber ich ging um ihn herum, aus dem Zimmer und aus dem Haus hinaus. Hinter mir wurde gesprochen, doch war ich so beschäftigt mit dem Hinausgehen, daß ich den Sinn der Worte nicht verstand.
Die Luft draußen war das beste. Ich sah hinter einigen Büschen nach und rief ein paarmal leise Marthas Namen. Wahrscheinlich wurde ich durchs Fenster beobachtet. Als kein Zweifel mehr bestand, daß Martha noch nicht da war, machte ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle, so konnte ich sie nicht verfehlen. Ich hatte geglaubt, nach dreißig Jahren könnten sie wie normale Menschen leben, und plötzlich dieses Zimmer; als hätten sie drei Jahrzehnte lang nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Als hätten sie, wenn sie sich scheinbar normal verhielten, nur eine Maske getragen.
Ich nahm mir vor, Martha in den Wald zu locken und dort das mit ihr zu tun, was im Haus unmöglich war, denn es gab keine bessere Ablenkung. Ich war sicher, daß sie sich nicht sträuben würde, wenn ich es nur fertigbrachte, den Vorschlag zu machen. Ich prüfte den Waldboden, er war trocken wie Zunder. Die Vorstellung erregte mich, noch nie hatten wir uns unter freiem Himmel hingelegt. Wenn wir in einem Wald waren, dann immer nur in diesem, und immer stand das leere Häuschen in der Nähe. Ich erinnerte mich an eine gute Stelle, auf Wernsdorf zu, an der man vor Blicken geschützt war wie hinter sieben Mauern. Martha machte gern Witze über meine Schüchternheit, in den unpassendsten Augenblicken. Der Himmel sah aus, als ob die Sonne noch jahrelang scheinen würde. Eines aber mußte schon jetzt entschieden werden: ob ich ihr von dem Zimmer erzählte oder nicht. Zuerst sagte ich mir Unbedingt, dann Auf keinen Fall, meine Überzeugung änderte sich von Schritt zu Schritt. Das war nicht das Resultat von Nachdenken, denn ich dachte überhaupt nicht nach. Als mir klar wurde, daß wir uns unmöglich nach einer solchen Nachricht lieben konnten, entschied ich, das Geheimnis für mich zu behalten, zumindest an diesem Tag. Sie würde sonst meine Hände festhalten und es unbegreiflich finden, woran ich in einem Augenblick wie diesem dachte. Und wenn ich erst hinterher damit herausrückte, würde sie mich für einen um so größeren Rohling halten. Sie mußte mich trösten, ohne zu wissen, warum ich Trost brauchte.
An der Bushaltestelle setzte ich mich ins Gras und behielt einen Hund im Auge, der neben der Wartehalle stand und zu mir hersah. Vater war in meinen Augen immer ein besonnener Mensch gewesen, ein Logikfanatiker; die ganze Kindheit über hatte er mich mit dem Satz verfolgt, ein kühler Verstand sei nützlicher als ein heißes Herz. Wenn ich als kleiner Junge einen hysterischen Anfall bekam, was vor allem dann geschah, wenn mir etwas mehrmals hintereinander nicht gelang, sperrte er mich ins dunkle Badezimmer und sagte, ich solle rufen, wenn ich wieder zu Verstand gekommen sei.
Mit dem nächsten Bus kam Martha. Natürlich freute es sie, daß ich wartete, doch überrascht war sie nicht. Sie umfaßte meine Hüfte, schob den Daumen in eine meiner Gürtelschlaufen und ging los. Bei jedem zweiten Schritt rieb sich ihre Brust an meiner, deshalb schwieg ich eine Weile. Sie erzählte, warum sie nicht früher hatte kommen können. Ich schwieg bis zur Gabelung, an der wir den Weg zum Häuschen verlassen mußten. Dort blieb ich stehen und sagte: »Im Haus sind Leute.«
»Leute?«
»Vater und noch jemand.«
»Du warst schon dort?«
»Richtig.«
Sie sah mich abwartend an, als hätte ich noch nicht alles gesagt. Und ich spürte, daß meine Augen nicht so unbefangen blickten, wie ich es wollte. Ich nahm sie an der Hand, und wir gingen weiter, nun in die andere Richtung.
Sie fragte: »Warum hat er das nicht vorher erzählt?«
»Weil er nicht wußte, daß ich rausfahren würde«, sagte ich.
»Das ist das Risiko der Heimlichtuer.«
Es ärgerte mich, daß sie so gelassen war; sie konnte nicht ahnen, wohin ich sie führte, und war trotzdem nicht enttäuscht. Ich hätte viel darum gegeben, wenn der Vorschlag, uns eine gute Stelle im Wald zu suchen, von ihr gekommen wäre. Auch wenn es hinterher auf dasselbe hinausläuft, macht es doch einen gewaltigen Unterschied, von wem solch ein Vorschlag kommt. Nur eine Andeutung, flehte ich sie in Gedanken an, dann wollte ich mich sofort darauf stürzen und alles übrige selbst sagen.
»Hat dich dein Vater gesehen?« fragte Martha.
»Gott bewahre.«
Wir gingen an einigen kleinen Häusern vorbei, die dem unseren glichen. Ein Mädchen hatte ein Gummiseil an einem Gartenzaun festgebunden, sich mit dem zweiten Seilende auf die andere Wegseite gestellt und so ein kaum sichtbares Hindernis errichtet; mit todernstem Gesicht wartete es, daß wir über das Seil hinwegstiegen, und wir taten ihm den Gefallen. Aus dem Fenster eines anderen Hauses drang der Geruch von Suppenwürze. »Etwas nicht in Ordnung?« fragte Martha.
»Alles bestens«, sagte ich, »wovon redest du?«
»Dein Hemd ist kaputt.«
»Muß unterwegs passiert sein.«
»Ich glaube, du verschweigst mir etwas.«
»Dann weißt du mehr als ich.«
»Zum Beispiel, wohin wir gehen«, sagte Martha, doch in einem anderen Ton, so als hätte sie das Thema gewechselt.
»Spazieren natürlich«, sagte ich. »Oder glaubst du, ich habe in diesem Wald ein zweites Haus?«
Sie blieb stehen und hielt mich an beiden Armen fest. Ich mußte ihrem Blick standhalten, bis ich einen Kuß bekam. Danach fragte sie, was ich davon hielte, in die Stadt zurückzufahren und ins Kino zu gehen, wir hatten seit Wochen keinen Film gesehen. Ich war einverstanden, wahrscheinlich war es am klügsten.
Für den Morgen war die vorletzte in einer ekelhaften Reihe von Prüfungen angesetzt, die Schwimmprüfung; ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Um eine Zwei im Fach Sport zu bekommen, brauchte ich eine Eins im Unterfach Schwimmen, und dafür mußte ich die hundert Meter unter eins: vierzig schaffen. Ich versuchte mir einzureden, daß man auch mit einer Drei in Sport ein zufriedenes Leben führen könne; je länger ich wachlag, um so überzeugter war ich davon.
Als ich um zwei das Licht anmachte und auf die Uhr sah, war Vater noch nicht da. In den letzten Nächten war er immer sehr spät nach Hause gekommen, doch da hatte ich geglaubt, er käme vom Billardspielen. Vater war ein leidenschaftlicher Billardspieler.
Was hatten sie mit dem Mann vor? Wollten sie eine bestimmte Sache, von der ich nichts wußte, aufklären? Wollten sie ihn so lange verhören, bis er ein Geständnis ablegte, das dem Staatsanwalt übergeben werden konnte? Wollten sie ihm Angst einjagen, ihn quälen oder, der Himmel weiß wie lange, gefangenhalten? Oder war einem von ihnen die Idee gekommen, dachte es mir ständig dazwischen, ihn umzubringen? Gordon Kwart bestimmt nicht. Er war ein gutmütiger, langweiliger Mensch, zehnter oder zwanzigster Geiger im Rundfunk-Symphonieorchester, der sich vor allem Unvorhergesehenen fürchtete und Ruhe für Glück hielt. Über den fremden Dritten wußte ich nichts, außer daß er voller Argwohn war. Vater traute ich Gewalttätigkeit nicht zu. Aber einige Stunden zuvor hatte ich mitangesehen, wie er den Gefangenen haßerfüllt und grob behandelt hatte.
Am Nachmittag hatte ich zwar behauptet zu wissen, was Neuengamme bedeutet, doch nun, in der Nacht, merkte ich, daß es kaum mehr als ein böses Wort für mich war. Ich stand auf, holte das Lexikon und las den kurzen Artikel. Die wenigen Zahlen darin lernte ich auswendig, wie ein Material, das mir in den nächsten Tagen ständig zur Verfügung stehen sollte, vor allem die Zahl 82000. An Schlaf war immer noch nicht zu denken, so las ich noch die Artikel über ein paar andere Konzentrationslager. Damit war ich beschäftigt, bis ich Vater kommen hörte. Ich löschte das Licht, auf Zehenspitzen ging er den Flur entlang und verschwand im Badezimmer. Selbstverständlich mußten sie Aufseher hassen, selbstverständlich mußte es sie krankmachen, wenn so einer behauptete, damals habe ein anderes Recht gegolten, er habe immer nur nach dem Recht gehandelt.
Aber es gab heute ja tatsächlich andere Gesetze, andere Gerichte und eine andere Polizei. Denen konnte man vorwerfen, was man wollte, nur eines nicht: daß sie mit ehemaligen Aufsehern zu nachsichtig wären. Warum erstatteten sie nicht Anzeige und verließen sich auf das, worauf doch Verlaß war? Wozu sprachen sie überhaupt mit dem?
Allerdings hatte ich keine Ahnung, was zwischen dem Aufseher und ihnen vorgefallen war. Vielleicht hatte er sie gereizt, vielleicht hatte er sich auf eine Weise benommen, wie sie es auch nach dreißig Jahren nicht hinnehmen konnten. Vielleicht sind sie verführt worden, weil die Gelegenheit so einmalig günstig gewesen ist. Vielleicht hatte einer ihn wiedererkannt. Aber sie nahmen sich ein Recht heraus, das niemandem zusteht, selbst ihnen nicht. Und wenn er hundertmal mein Vater war: ich konnte doch nicht für richtig halten, daß ehemalige Opfer sich ihre ehemaligen Peiniger griffen. Sie hatten es sich selbst zuzuschreiben, daß ich in dem stinkenden Zimmer nur mit dem Aufseher Mitleid hatte, nicht mit ihnen.
Allerdings war es wahrscheinlich, daß die Ansichten der anderen sie nicht kümmerten; daß sie fanden, es handele sich allein um eine Sache zwischen dem Aufseher und ihnen. Und wenn man sie entdeckte, na schön, dann müßten sie die Strafe eben auf sich nehmen. Womöglich spekulierten sie darauf, daß diese Strafe im Ernstfall schon nicht sehr hoch ausfallen würde.
Aber war zwischen Tat und Gegentat nicht so viel Zeit vergangen, daß ein Affekt als mildernder Umstand nicht mehr in Frage kam? Darf einer, der mit dreißig Jahren geschlagen wird, mit sechzig zurückschlagen?
Allerdings kann sich keiner aussuchen, wann er den Verstand verliert. Weil ich Vater noch nie außer sich vor Zorn erlebt hatte, hatte ich den Schluß gezogen, er könne nicht außer sich geraten. Nun war es passiert. Vielleicht waren die drei vom Ausmaß ihrer Wut selbst überrascht worden: vielleicht hatten sie ihr Bedürfnis nach Rache längst für erloschen gehalten, bis sie diesen Mann trafen, an einem Unglückstag.
Ich hörte ihn aus dem Bad kommen und den Flur entlangschlurfen, bis vor meine Tür. Vorsichtig kam er herein, ich stellte mich schlafend. Da er die Deckenlampe nicht anmachte, hielt ich die Augen einen Schlitz weit geöffnet und sah ihn gegen das schwache Flurlicht; doch ich schloß sie, als er näher kam. Vor meinem Bett blieb er stehen, früher hatte er das an jedem Abend getan. Als wollte er prüfen, wie gut ich mich beherrschen konnte, stand er lange so da. Es fiel mir nicht schwer, das Gesicht vollkommen still zu halten; ich atmete tief wie ein Schlafender und stellte dabei fest, daß er den üblen Geruch nicht mit nach Hause gebracht hatte.
Als er wieder draußen war und in sein Zimmer ging, glaubte ich, daß er sich gerne zu mir gesetzt hätte. Solange sie mit dem Aufseher beschäftigt waren, hatte alles seine Ordnung, nahm die Sache ihren Lauf; doch danach waren sie mit sich allein und mußten wieder denken.
Die Hoffnung auf eine Zeit unter eins: vierzig gab ich aber nicht auf: es ist besser, Erfolg zu haben. Ich war nicht weit davon entfernt, die erste Schlaftablette meines Lebens zu schlucken; nur weil ich fürchtete, das schläfrigmachende Zeug noch nicht los zu sein, wenn ich in ein paar Stunden ins Schwimmbad mußte, verzichtete ich darauf. Woher hatten sie die Handschellen? Ich bin sicher, daß es im ganzen Land kein Geschäft für Handschellen gibt.
Die Dauerhaltung des Gefangenen war wohl die, daß seine Füße mit Schnur an dem einen Bettende festgebunden waren, während die Hände in Handschellen steckten, am Kopfende befestigt. Solange sie anwesend waren, banden sie ihn zur Hälfte los: wahlweise Hände oder Füße? Sie fütterten ihn und schoben ihm den Nachttopf unter, nicht oft genug. War einer von ihnen ständig im Haus? Lösten sie sich bei der Bewachung ab, oder gingen sie nur gemeinsam hin und verließen sich in der übrigen Zeit auf die Fesseln? Hatten sie sich vorgestellt, was geschehen würde, wenn sie eines Tages zum Häuschen kamen und der Gefangene verschwunden war?
Er hustete in seinem Zimmer, das hieß, er rauchte, obwohl