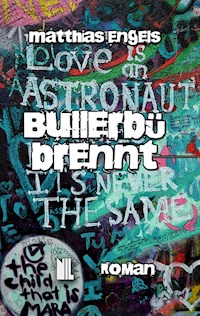
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jan ist in den Vierzigern. Jan hat eine Frau und zwei Kinder. Während sein Leben passiert, schreibt er Mails an Murphy, den es nicht gibt. Er erinnert sich an sein früheres Ich und betrachtet sein jetziges. Er blickt auf die verschiedenen Episoden seiner Beziehung zurück und auf das, was früher alles vor ihnen lag. Irgendwie hatte er feststellen müssen, dass Leben nicht ist wie in schwedischen Kinderbüchern. Jan bleibt zu Hause, während Sonja arbeitet. Er hat Zeit. Viel Zeit. Und er hat Fragen, sehr viele Fragen. Warum zum Beispiel geht alles schief, was schiefgehen kann? Aber geht denn wirklich alles schief? Ist da nicht viel Gutes in diesem "Vater, Mutter, Kinder"? Ist eventuell Astrid Lindgren an allem schuld? Sind denn zwei schon zu viel, um glücklich zu sein? Und wird am Ende wirklich alles gut, weil es sonst nicht das Ende wäre, wie ein dummer Postkartenspruch sagt? Beobachten wir Jan und Sonja, die vor Langem beschlossen haben, sich zu lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bibliographische Information der
Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
© 2021 by NIL Edition | apebook Verlag
Essen 2021
www.apebook.de
Lektorat & Buchgestaltung: SKRIPTART
www.skriptart.de
Umschlagmotiv unter Verwendung eines Fotos
von Radek Špáta
Hardcover: ISBN 978-3-96130-395-3
Softcover: ISBN 978-3-96130-396-0
eBook: ISBN 978-3-96130-397-7
1. Auflage
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlags ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, auf Datenträgern zu speichern oder anderweitig zu vertreiben.
Inhalt
Bullerbü brennt
Impressum
Zitate
1 LOVE IS A SOCIAL DISEASE
2 LOVE IS A POWER
3 LOVE IS THE NAME OF THE GAME
4 LOVE IS ON THE RUN
5 LOVE IS THE KEY
6 LOVE IS WHERE I LIVE
7 LOVE IS A ROSE
8 LOVE IS LIKE OXYGEN
9 LOVE IS A BATTLEFIELD
10 LOVE IS A LOSING GAME
11 LOVE IS BLIND
12 LOVE IS MY REBELLION
13 LOVE IS LIKE A CLOUD – HOLDS A LOT OF RAIN
14 LOVE IS A VERB – LOVE IS A DOING WORD
15 LOVE IS FOR SUCKERS
16 LOVE IS A TEMPLE
17 LOVE IS NOISE
18 LOVE IS NO BIG TRUTH
19 LOVE IS THE CURE
20 LOVE IS REAL
21 LOVE IS A BURNING THING
22 LOVE IS JUST A PARADOX
23 LOVE IS AN OPEN DOOR
24 LOVE IS STRONGER THAN PRIDE
25 LOVE IS A WORD I DON´T UNDERSTAND
26 LOVE IS THE HIGHER LAW
27 LOVE IS A SHIELD
28 LOVE IS ON THE RUN
29 LOVE IS JUST A 4 LETTER WORD
30 LOVE IS A MANY SPLENDORED THING
31 LOVE IS IN THE AIR
32 LOVE IS A STRANGER
33 LOVE IS THE MESSAGE
34 LOVE IS HERE TO STAY
35 LOVE IS A ROCK
36 LOVE IS YOUR COLOUR
37 LOVE IS STRANGE
38 LOVE WILL TEAR US APART
39 LOVE IS WHAT IT IS
40 LOVE IS JUST A BREATH AWAY
41 LOVE IS LETTING GO OF FEAR
42 LOVE IS STRONGER THAN JUSTICE
43 LOVE IS LOVE
Über den Autor
Eine kleine Bitte
Newsletter
Follow
ApeClub
Links
Zu guter Letzt
»Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.«
Edward A. Murphy
»..und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.
Astrid Lindgren
1 LOVE IS A SOCIAL DISEASE
Ich kann diese Geschichte nicht erzählen.
Mir fehlt dafür der Anfang, und auch das Ende kenne ich nicht. Aber beide werden in der Regel zu Recht erwartet. Aber wer weiß schon wirklich, wann eine Geschichte definitiv ihren Anfang nahm und ob der erste Stein für die weiteren Entwicklungen nicht schon lange vor diesem fiktiven Punkt gelegt war?
Ebenso verhält es sich mit den Enden: Der größte Irrglaube ist, anzunehmen, dass irgendeine Geschichte je mit dem letzten Punkt hinter dem letzten Wort wirklich zu Ende ist. Alles geht weiter, geht immer weiter. Wir steigen als Leser und als Beteiligte nur aus und beenden unsere Zeugenschaft an einem Punkt, der irgendwem adäquat und sinnvoll dafür erscheint. Ohne uns nimmt alles seinen weiteren Verlauf, ob wir das billigen oder nicht.
Ich kann diese Geschichte nicht erzählen. Aber ich könnte eine Geschichte erzählen. Die von Jan und Sonja in meiner, in einer Variante – der des zufälligen Zeugen einiger interessanter Geschehnisse. Aber wenn jemand an der ganzen Geschichte interessiert ist, bin ich leider sicher nicht die richtige Adresse.
Ich werde also eine Geschichte erzählen, als sei es eine komplette, schicke aber gleich voraus: vielen wird sie langweilig erscheinen, denn es ist nichts Außergewöhnliches daran. Viele werden sagen, sie sei eintönig, es finde keine Entwicklung statt. Aber seien wir einmal ehrlich: findet im wahren Leben, bei wahren Menschen tatsächlich immer eine Entwicklung statt? Eine klar verfolg- und benennbare Veränderung, nach Möglichkeit zum Guten? Wohl kaum. Das wollen wir aber, sagt der Leser, denn Langeweile und Gleichmaß – das haben wir ja in unseren eigenen Leben selbst und reichlich. Da ist was dran.
Sie wollen davon hören, was Menschen können, was ihnen möglich ist. Aber kann es nicht auch reizvoll sein zu hören, was sie nicht können, woran sie scheitern?
Immerhin wird hier geliebt und gelitten, Menschen werden geboren und Menschen sterben – reicht das nicht an großen Gefühlen und Verwirrung? Außergewöhnlich ist die Geschichte nicht, nein. Ich werde sie dennoch erzählen – oder zu erzählen versuchen.
2 LOVE IS A POWER
Am besten begänne man wohl mit einer Szene, wie sie in jedem unsäglichen Schweden-Film vorkommt: Mittsommer, rote Holzhäuser – denn in Schweden gibt es ausschließlich rote Holzhäuser – lauter Seen, lauter Veranden mit gutaussehenden Menschen von einer gewissen Kernigkeit, mit lauter Frauen in luftigen Sommerkleidern, Männern in legeren Anzügen, leichten Weißwein trinkend, mit lauter Lampions und so weiter. Keiner raucht, ist übergewichtig oder rassistisch (es sind selbstverständlich Einwandererkinder unter ihnen). Alle sind kaum – und wenn, dann höchstens auf angenehm anregende Weise – unterschiedlicher Meinung. Keinesfalls sollte man jetzt Stechmücken erwähnen, Regel- oder Prostatabeschwerden, Finanzengpässe oder Flüchtlingsfragen. Es muss eine Gemeinschaft sein: glücklich in seiner Abgeschiedenheit und wohlig ermüdet von ihren täglichen Tätigkeiten, offen und bereit für Gefühle, eine Gemeinschaft, fest überzeugt von der Möglichkeit, alles werden zu können, alles schaffen zu können, wenn man nur an sich glaubt, wenn man nur seinen Träumen folgt, wenn man sich nur…naja…liebt. So sollte man anfangen, aber das ist nicht immer so einfach.
Ach Jan, da sitzt du: mit deinem sehr kurzen Namen, der keinem Mühe macht, ihn zu behalten, und dennoch oder gerade deshalb so oft vergessen wird. Zu wenige Zeichen, zu wenige Haken und Schlaufen, um sich in fremden Gehirnen zu verankern. Dazu dein Allerweltgesicht, für das sich andere nicht schämen.
Du hast nun, ach, erfolglos einige Semester Mathematik und Philosophie studiert und beides aufgegeben (weil dem einen der Begriff ›Liebe‹ fremd war und das andere ihn nicht erklären konnte). Du hast eine Lehre gemacht, geheiratet, Kinder bekommen und kurzzeitig aufgehört zu arbeiten. Bist nach den ersten Jahren, in denen du dich um den Nachwuchs kümmertest, nie wieder richtig in einen Vollzeitjob gekommen, übst eine Aushilfstätigkeit aus, die nicht viel einbringt und für die Rente unerheblich ist, aber du hast viel Zeit für die Kinder, bist fast immer zu Hause, wenn deine Frau heimkommt, und das ist gut so.
Du weißt so einiges und hast das Gefühl, nichts zu wissen, immer weniger sogar, als nähme dein Wissen um die Zusammenhänge täglich ab, während es in einem gewissen Alter täglich zuzunehmen und klarer zu werden schien. Immer weniger, was du einmal erlerntest, gilt noch, vieles deines Grundschulwissens ist bereits widerlegt und an vielem, was du später an Information abspeichertest, gibt es inzwischen berechtigte Zweifel. Was du noch zu wissen glaubst, scheint dir aus Fetzen zu bestehen, die du hier und dort aufgelesen hast, und zu weiten Teilen, gibst du zu, könnte dein ach so fundiertes Wissen aus den kurzen Artikeln aus aller Welt auf der Rückseite der Tageszeitung stammen und tut es auch.
Ach, Jan, jetzt sitzt du manchmal morgens da, wenn die Frau zur Arbeit und die Kinder zur Schule verschwunden sind, und ab und an drängt es dich, alles darzulegen, alles, was dich bewegt, zu verschriftlichen. Kein Gedanke ist so stark, dass er per se vor dem Vergessen geschützt ist. Das weißt du. Du hast ja nie ausdauernd Tagebuch geführt, irgendwann verlorst du stets die Lust, und nach längeren Pausen sahst du den Sinn nicht mehr, damit weiterzumachen. Enge Freunde zum Briefeschreiben hast du nicht, und wer macht sich heute noch die Mühe, Briefe zu lesen und gar ausführlich zu beantworten? Du willst auch nicht das Risiko eingehen, dass irgendwer irgendwann mit diesen Briefen käme, die du aus einer wandelbaren Stimmung heraus geschrieben hättest und deren Inhalt dir höchstwahrscheinlich schon nach Tagen peinlich wäre.
Also hast du angefangen, E-Mails zu schreiben, denn diese scheinen dir von Natur aus so nah am sinnlosen Geplapper wie kein anderes Medium. Das Problem war nur: auch Mails haben einen Adressaten; aber das ließ sich lösen. Du dachtest dir einfach die Adresse einer Person aus, von der du annahmst, sie würde all deine kleinen Schadensberichte und Selbstgespräche verstehen können.
So öffnest du in letzter Zeit häufiger ein neues Fenster in deinem Mitgliederbereich und gibst den Empfänger deiner mal langen, mal kurzen Nachricht ein. Du beginnst direkt und ohne groß über Formulierungen nachzudenken. Du liest grundsätzlich nicht noch einmal durch, was du geschrieben hast, sondern klickst sofort auf den Senden-Button und kümmerst dich nicht mehr darum, was mit deinen Worten passiert. Auf Antworten wartest du nie, es werden auch keine kommen. Aber das ist Teil des Vergnügens.
Betreff: Wer Angst vor dem Ende hat, sollte keine Geschichte beginnen.
Oft genug liegt das Ende schon vor dem Anfang, wenn die Geschichte sich noch im Bereich der Möglichkeit und der Ideen bewegt, und das schon feststehende Ende erstickt sie im Keim. Manchmal kommt es abrupt und unerwartet, bevor man das Gefühl hat, alle Aggregatzustände des Stoffes seien durchlebt, und ab und an zieht es sich hin und hin und zögert und wäre besser eher gekommen. In manchen Fällen lebt man in Erwartung und einer Ahnung des Endes und merkt nicht, dass es längst präsent ist und dieser schleichende Zustand des Verfalls bereits eigentlich und de facto ENDE heißt.
Eine Geschichte braucht ein Ende, besser wäre es, man finge gar nicht erst an. Aber manchmal ist es zu verlockend, die Fäden in der Hand zu halten, die Finger in die hohlen Köpfe der Puppen zu stecken und ihnen Worte in den Mund zu legen. Dass man mit jeder Wendung, jedem Vorantreiben der Handlung bereits am Ende strickt, ist einem nicht bewusst. Erst, wenn es erforderlich wird, bekommt man Angst und fragt sich, ob es wohl ein rundes wird, das langsam heran rollt und mit dem Rest des Schwungs an genau der richtigen Stelle zum Stehen kommt, oder ob es fällt wie ein Beil und alle losen, noch durchbluteten Stränge schmerzhaft kappt. Man sucht nach guten letzten Worten. Und dann beantwortet man zwanghaft alle Fragen, aber jede Antwort zieht eine neue Frage wie eine Kugel an einer Kette um den Knöchel hinter sich her, und dann trifft man nicht die Tasten, und über jedem Punkt krümmt sich immer ein Haken. Man sucht nach Worten, und findet doch immer nur UND.
Eine Geschichte braucht ein Ende, auch tausend, auch zehntausend Seiten sind keine Lösung, wenn nicht die letzte verlässlich weiß ist. Alle müssen sterben oder sich im Zustand des unzweifelhaften Glücks auflösen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute kauft uns keiner mehr ab! Drei Pünktchen sind keine Lösung, und weiter und unermüdlich Schicht auf Schicht aufzustapeln, führt nur bis nach Babel und bis in den Himmel und zur Unendlichkeit, und das ist uns – auf höhere Weisung hin – leider verboten.
Man kann ein Ende suchen, aber keines finden. Man kann kein Ende machen, wo noch keines ist. Man. Kann. Hier. Keinen. Punkt. Setzen, weil der Satz noch nicht komplett ist.
Es will alles gesagt, es will alles getan sein, bevor man erfährt, wie es endet. So ist es abgemacht, mit dem Es war einmal, mit dem ersten Wort hast du dich darauf eingelassen, und jetzt musst du es zu Ende bringen.
Bis bald mal
Jan
3 LOVE IS THE NAME OF THE GAME
Nennen wir sie, der Einfachheit halber, Jan und Sonja. Nehmen wir an, sie seien seit einiger Zeit zusammen. Keine Tragödien, keine Katastrophen, nur das ganz normale Leben, das ja oft an sich schon Tragödien und Katastrophales bedeutet. Gemeint sei hier nur: keine Terroranschläge, keine Gewaltverbrechen. Diese Kategorie. Schauen wir uns also Jan an. Hier sitzt er, die Kinder sind zur Schule, seine Frau Sonja zur Arbeit, und macht sich so seine Gedanken.
Es ist so ein Morgen, an denen du die Augen aufschlägst und auf deinem Brustkorb sitzt das Scheusal Schicksal und will sich partout nicht überzeugen lassen, dass es gar nicht existiert. So viele Entscheidungen: man könnte jetzt die Fäuste ballen oder die Hände senken, man könnte den Kopf heben oder mit den Schultern zucken – wer soll das entscheiden – ob man morgens die Augen öffnet oder nicht, ob man was frühstückt oder es lässt. So viele Möglichkeiten, wer kann einem zweifelsfrei sagen, ob es richtig ist, jetzt rauszugehen, oder ob es besser wäre, zu bleiben, wo man ist.
Atmen: Ja! Durchaus!
Blinzeln: Ja! Unbedingt!
Ein gewisser Stolz auf den Stoffwechsel und die Verdauung, die von ganz allein funktionieren; aber schon ein Schritt ist eine Entscheidung, die schwerwiegende Folgen haben kann, im schlimmsten Fall einen zweiten und einen dritten, und wer weiß schon, was dann kommt! Sicherheitshalber erst einmal Kaffee machen. Dann: Hinsetzen und...Aushalten!
So viele Handgriffe (19 nur für eine volle Tasse!): Er ist eine Stunde wach, und wenn er das Anziehen und Bettenmachen dazu zählt, ist er sicher schon bei 250! Wenn er sich vorstellt, was noch kommt, wird er 1000 schnell erreicht haben. Und dann die Synapsen, die rotieren, und die Millionen Impulse, die verarbeitet sein wollen für den Griff nach der Zahnbürste oder den Streichhölzern!
Die Streichhölzer! – Er steckt die abgebrannten immer zurück in die Schachtel und zwar so, dass die verkohlten Köpfe in die andere Richtung zeigen als die frischen, roten. Eine dumme Angewohnheit, aber nicht ganz ohne Sinn. Wenn er am Morgen die Schachtel das erste Mal aufschiebt und er sieht die frischen Köpfe, wird es ein guter Tag, sagt er sich; sieht er die schwarzen – ein schlechter. Heute sind es die roten, fast ein Hohn, er traut dem Ganzen nicht. Man sollte keine Spiele spielen, bei denen man nicht gewinnen kann!
Sicherheitshalber erst einmal atmen. Dann: sitzen bleiben und standhalten. Den Sirenen und Senioren am Stock vor dem Fenster, den welken Blumen im brackigen Wasser (einfach nicht hinsehen), dem dumpfen Brummen des Kühlschranks (einfach nicht hinhören) und dem unheimlichen Zischen all der nicht gelesenen Bücher, die er entschieden hatte lesen zu wollen! Er hat kürzlich irgendwo aufgeschnappt, dass Entscheidungen eigentlich generell zweifelhaft seien, da man sie immer aus einer momentanen, veränderlichen Gemütslage heraus treffe, die sich schließlich unablässig wandle wie die Oberfläche des Meeres (War es Proust?). Man könnte jetzt das Fenster öffnen oder Papiere ordnen, man könnte endlich den überfälligen Brief schreiben oder sich die Haare waschen. Man könnte die weitenteils ungelesene Zeitung vom Wochenende (es ist Mittwoch) endlich wegwerfen (Schlagzeile: »Abkassieren bei Notfallopfern«).
4 LOVE IS ON THE RUN
Je komplexer eine Handlung ist und umso mehr Menschen daran beteiligt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas dabei schiefläuft – so hast du im Studium den tatsächlichen Hintergrund dessen, was man »Murphys Gesetz« nennt, kennengelernt. 1949 nahm Captain Edward A. Murphy als Ingenieur an einem Modellversuch der US Air Force teil. Für die Entwicklung eines neuartigen Raketenschlittens musste geprüft werden, wie viel Beschleunigung der Mensch auszuhalten im Stande ist. Den Probanden sollten zur Messung ihrer Reaktionen sechszehn Sensoren am Körper befestigt werden. Dies war auf genau zwei Arten möglich: in der richtigen, vorgeschriebenen Position, aber auch in einer genauen 90°-Abweichung davon. Tatsächlich ging das kostspielige Experiment schief, da einer der beteiligten Helfer sämtliche Sensoren in der falschen Position angeschlossen hatte. Murphy schlussfolgerte daraus, dass wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet, irgendeiner zwangsläufig genau diese wählen wird.
Schnell wurde die verkürzte Variante dieser Erkenntnis (»Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen«) zum geflügelten Wort und vermeintlichen Gesetz.
Natürlich ist es nur ein gefühltes Gesetz, denn bei beileibe nicht allen Vorgängen tritt immer die Katastrophe ein. Aber wir erinnern uns immer daran, wenn tatsächlich etwas schiefgeht. Während Murphy den Hauptgrund für das Scheitern seines Versuchs bei den Menschen sah, wird sein Gesetz heute auch gern für Fälle herangezogen, bei denen der Zufall oder die bekannte Tücke des Objekts für den Fehlschlag verantwortlich ist. Richtig ist aber, dass ein Scheitern immer wahrscheinlicher wird, je mehr Menschen an einer Sache beteiligt sind, denn die Möglichkeiten des Versagens, von Missverständnissen oder bewussten Sabotage-Akten werden zwangsläufig vielfältiger.
Betreff: 1 und 1 das macht 2
Murphy,
man sollte sich nicht so wichtig nehmen; nicht ständig ich sagen. Der Unterschied zwischen wichtig und nichtig ist ja marginal. Ich kann ja jeder sagen und mit ich fängt jede Geschichte erst an. Wer ich sagt, hat noch nichts gesagt. Ich und Du hat man nur erfunden, weil sich auf Mensch nichts reimt, und das ist schlecht für Liebeslieder. Auf Ich reimt sich dann Dich und das ist gut. 1 und 1 das macht 2 und 2 sind zu viel, um frei zu sein. Nimm nur den binären Code: Informationen können von nur zwei verschiedenen Symbolen dargestellt werden. 1 entspricht logisch wahr, 0 entspricht logisch falsch. Kein Platz für 2 oder 3 oder 4 in dieser Wahrheit. Und überhaupt Wahrheit! Letzten Endes gilt doch, was die Mehrheit abnickt. Was nur zwei von bald 8 Milliarden schwören, bleibt ungehört und Wahrheit letztendlich Statistik! Überhaupt Statistik: ein Pferd hat statistisch zwei vordere, zwei hintere, zwei linke und zwei rechte Beine, also hat ein Pferd acht Beine! Statistik: eine der Errungenschaften der Neuzeit! Was bleibt eigentlich von der sogenannten Zivilisation? – Aufrechtgehen, Zentralperspektive, die Umrisslinie: alles schon so lange erfunden, und viel weiter sind wir eigentlich bis jetzt nicht gekommen. Danach hat kaum noch etwas unbestreitbare Gültigkeit: alles kann man zerreden, zerpflücken, widerlegen und in Zweifel ziehen.
Es fehlen: Dinge zum Festhalten. Alles schwankt, alles schaukelt, wirft einen hin und her. Wo ist der letzte Punkt, an dem man unzweifelhaft noch auf dem richtigen Weg war? Ein Pfeiler, ein Pfosten, ein Stecken, ein Stab, der fest in der eigenen Geschichte steckt und hält, wenn man sich an ihm stützen will. Wo ist man falsch abgebogen und warum? Warum hat man kein Brot gestreut, keine Schnur abgewickelt? Ach komm, der ganze Rückweg ist anstrengend und ohnehin umsonst, denn man kann nicht zurück hinter eine Entscheidung!
So oder so
Jan
Jan hat seit einiger Zeit das Gefühl, sich gar nicht mehr richtig zu spüren. Er riecht morgens nicht mehr den frischen Kaffee, sondern stürzt ihn nur noch runter, wegen des Koffeins, auch die angenehme Kühle des Morgens nach dem Regen nimmt er kaum noch wahr. Es nimmt alles kein Ende, legt nicht einmal eine Pause ein, gefühlt immer wieder läuft er mit dem Eimer zum Brunnen, um ihn letztendlich in den Fluss zu entleeren, und während er wischt, fällt unentwegt Staub auf die Möbel und Flächen. Er liest in der lächerlichen Zeitung über einen Schauspieler:
»Dieser junge Mann hat in den letzten Jahren unheimlich an Profil gewonnen.«
Profile, Konturen, scharfe Umrisse der eigenen Person: Er selbst fühlt sich wie ausgefranst, an seinen Grenzen zerfasernd, eine sehr sorgfältig ausradierte Zeichnung einer Person, bei der nur noch eine schwache Ahnung des ursprünglichen Entwurfes erhalten geblieben ist.
5 LOVE IS THE KEY
Aber sicher ist es besser, wenn wir der Reihe nach vorgehen. Also nehmen wir an, Jan sei das erste Mal am Meer gewesen, während Sonja dort jeden Stein kannte, da sie jeden Sommer mit ihren Eltern dort gewesen war. Setzen wir mal voraus, Jan könne nicht gut schwimmen und Sonja mache sich nicht viel aus Radfahren, weshalb sie viel spazieren gingen. Hier sind sie, Hand in Hand und jung, an irgendeinem kleinen Ort an der deutschen Küste. Wenn das hier ein Film wäre, dann müsste man sich nun als perfekte Hintergrundmusik wohl irgendeinen amtlichen Pop-Song von einer gewissen sommerlichen Leichtigkeit dazu denken; nicht zu seicht und nicht zu anspruchsvoll.
Sonja hat erst seit kurzem den Führerschein und mit ihrem Kindergeld den alten R4 mit Revolverschaltung bei ihrem Vater abgestottert. Sie sind jetzt ein halbes Jahr zusammen, und die Schulzeit ist vorbei. Nach dem Abi wollte Sonja eigentlich Chemie studieren, aber der Umstand, dass sie auf einem Auge nur geringe Sehkraft hat, stand dem im Wege. Sie hat das erst seit kurzem verarbeitet und sieht nun ihrer stattdessen eilig gewählten Ausbildung neutral entgegen. Jan wird nach dem Urlaub seinen Zivildienst antreten.
Beide gelten als ruhig und vernünftig, als reif für ihr Alter. Sie sind keine Partygänger und hängen nicht rum. In der Schule sind sie nicht die Besten, aber auch nicht renitent oder faul. Sie haben Fichtes dialektischen Dreischritt gelernt. These – Antithese – Synthese, haben gelernt, dass alles relativ ist und am Standpunkt des Betrachters hängt.
»Lass uns wegfahren!«, sagt Sonja, und Jan sagt: »Okay!«
Jan ist erst ein Mal, vor Jahren, mit seinen Eltern weggefahren, an die Mosel, ansonsten hat es keinen Urlaub gegeben. Ganz wie sie es von ihrem Vater kennt, setzt sich Sonja eines Mittags mit dem Autoatlas hin und plant die Strecke. Sie bevorzugt Landstraßen, ohnehin hätte es keine sinnvolle Autobahnverbindung ans Meer gegeben. Jan beugt sich mit ihr über die Karten, ohne je gelernt zu haben, diese zu lesen. Er hat keine gute Orientierung, ist nie viel herum gekommen. Selbst in seiner Umgebung kann es vorkommen, dass er Orte nicht kennt. So wie den Ort, an dem er jetzt sein Abitur gemacht hat. Nach einer kurzen Zeit an einer Kunstschule, die er selbst beendet hatte, hatte es nur wenige Gymnasien gegeben, die ihn mitten im Jahr aufnehmen wollten. Er fand allerdings mit seinen Eltern ein Aufbaugymnasium in U., das dazu bereit gewesen war. Er war nie zuvor in U. gewesen, obwohl es nur 12 Kilometer entfernt liegt. Da keine andere Wahl blieb, war er also Schüler in U. geworden. Eigentlich fühlte er sich zu dieser Zeit das erste Mal als vollwertiger Schüler, da er jetzt mit dem Bus zur Schule fuhr, während vorher alle seine Schulen so nah an seinem Zuhause gelegen hatten, dass er laufen konnte.
Nach der Abifeier machen sie sich auf den Weg. Jan ist ein guter Beifahrer. Er steckt Sonja Bonbons in den Mund, reicht ihr zu trinken, ohne, dass sie das Steuer loslassen muss. Er macht das Fenster auf und wieder zu. Er vergleicht Sonjas markierte Route mit den Schildern am Straßenrand. Schon im Münsterland läuft der Motor heiß, und sie halten an einer Tankstelle mit kleiner KFZ-Werkstatt. Für 20 Mark müssen sie ein Kabel an der Lüftung überbrücken lassen. Danach will Sonja erst nicht weiter, aber sie beschließen, doch zu fahren, den Wagen aber an der Ferienwohnung stehen zu lassen. Sie haben ein Appartement bei Privatleuten gefunden. Sonja hasst Camping, sie hat alle Sommerwochenenden mit ihren Eltern im Wohnwagen an einem See in der Nähe ihres Heimatortes verbracht. Jan hat keine Ahnung von so etwas und eine Hemmung, wildfremde Leute anzurufen, also kümmert sich Sonja darum.
Da es noch zu früh ist, um die Wohnung zu beziehen, fahren sie erst ans Meer. Sie parkt den Wagen hinter dem Deich, auf dem Parkplatz des Schwimmbades, und öffnet die Türen. Es ist ein Schreck, fast ein Schock für Jan. Er ist Stadt, Land und Fluss gewohnt. Einige Sekunden vergehen, ehe er bemerkt, was es ist. Die Stille. Kein Straßenlärm, keine noch so entfernte Baustelle, nichts. Nur Ruhe und ganz leicht, hinter dem Deich, ein Rauschen, Raunen. Als müssten sich die Ohren daran gewöhnen wie die Augen an die Dunkelheit, konnte er plötzlich doch Stimmen hören und Wind. Sie steigen aus. Der Deich ein sattgrüner Balken, leicht schräg abfallend, der makellos blaue Himmel ein straff gespanntes Laken dahinter. Das Meer liegt ruhig da und voll. Es ist groß, weit hinten Schiffe, die sich an die Geräuschlosigkeit halten. Sie ziehen die Schuhe aus.
Andere Dimensionen. Was man als Ziel ins Auge fasst und abschätzt, liegt plötzlich weiter entfernt, als man dachte. Sie sehen die äußere Spitze der Insel, die dem Festland gegenüberliegt, und beschließen stumm, parallel zu ihr dort hin zu laufen, aber sie erreichen sie nicht. Noch erwartet Jan kleine Störfälle, wie zu Hause. Dinge, die sie daran hindern, einfach nur hier zu sein und zu gehen, wohin sie gehen wollen. Anfechtungen, Ablenkungen, Notwendigkeiten. Wie er es gewohnt ist, vermutet er ein Omen in der toten Möwe, die böse zerzaust und gefleddert im Sand liegt. Er sieht zu Sonja, vermutet Trauer oder Ekel, aber sie meint nur: »Muss doch so sein.«
Sie stehen am Meerwasser-Schwimmbad und schauen durch die Panoramascheibe den Schwimmern zu, beäugen junge Eltern mit Bollerwagen. Jan will plain air malen, er hat einen billigen Farbkasten dabei und hockt sich in den Sand. Während sie aus Muscheln Muster legt, malt er einen dicken blauen Streifen über die untere Hälfte des Blattes und einen helleren auf die Obere, fertig ist das Seestück. Er macht zehn davon in einer Stunde.
»Schau mal hier, erklär mir mal diese Pflanze!«, fordert Sonja.
Jan hat keine Ahnung, er vermutet Sanddorn, spricht von Vitamin C und Nationalgemüse der Gegend. Sonja lacht laut, rennt voraus und ruft: »Das ist wilder Rhabarber, du Blödmann!«
Jan geht das erste Mal richtig essen. Als Kind ist er ab und zu mit den Eltern beim Chinesen in der Kreisstadt gewesen. Sie gehen in die Pizzeria in der Hauptstraße. Sie trinken eigentlich keinen Alkohol, aber zum gemeinsamen Essen, allein, mit Kerzen, passt ein Wein nun einmal irgendwie besser als Cola oder Wasser. Sie trinken einen Lambrusco spumante als wäre es alter Bordeaux. Er lobt den Wein kennerhaft, immer, wenn sich eine Gesprächspause einstellt. Abends unter der Bettdecke üben sie das Schalten mit der Knüppelschaltung.
Von ihrer Ferienwohnung im Ort bis ans Meer sind es gut vier Kilometer. Sie könnten den Bus nehmen, aber es gibt einen Weg über den Deich, den Sonja kennt. Entlang an einem Schleusenwerk mit Kanal. Jan muss das alles erst lernen wie eine Fremdsprache. Priel und Siel und Marsch und Geest. Bei Wind ist das ein ganz schönes Stück Weg, aber alle paar Hundert Meter steht eine Bank. Über diesen Weg kommt man da an den Strand, wo das furchtbare Riesenhotel steht. Nie im Leben, sagen sie, würden sie dort wohnen wollen.
Sie schauen sich am Anleger für die Fährschiffe um. Es nieselt leicht. Sie haben im Supermarkt einen billigen Schirm gekauft, auf dem Moin Moin steht, mit einem Herzchen daneben. Schiffe kommen an und legen ab. Busse kommen, Menschen steigen ein und aus. Busse fahren ab. Saisonarbeiter aus der ehemaligen DDR mit mühselig gezüchteten Friesenbärten betreiben den Kutschbetrieb, das Buddelschiff-Museum hat Ruhetag. Die Fischbratbude direkt am Meer bietet Schutz vor dem Regen. Trotzig essen sie wenigstens im überdachten Außenbereich. Sonja favorisiert Räucherfisch, zu dem Jan sich noch nicht durchringen kann, sie haben zu Hause nie viel Fisch gegessen. Er hält sich an ein Brötchen mit Fischfrikadelle. Die Möwen kommen auf die leeren Tische geflogen und suchen Reste. Jan trinkt ein herbes Bier, es ist gegen Mittag. Er findet, das gehört sich so, im Urlaub. Der Bart, den er sich aus den gleichen Gründen hat wachsen lassen wollen, will nicht so richtig. Zurück an der Bushaltestelle, sehen sie einen aufgeregt wirkenden älteren Herrn, der fortlaufend auf seine Armbanduhr schaut. Sie beobachten ihn, eng aneinander geschmiegt unter ihrem Schirm. Ein Bus fährt ein, Menschen steigen aus. Eine ältere Frau ist dabei, erst Ausschau haltend, dann lächelnd. Der Mann geht zu ihr, sie kommt unter seinen Schirm, er reicht ihr den Arm, und sie gehen nicht weit an Sonja und Jan vorbei. Das ältere Pärchen spricht leise miteinander, der Herr sieht verschwörerisch zu den beiden hinüber und sagt lächelnd im Vorbeigehen: »´Ich stehe im Regen und warte auf dich´, das war mal ein alter Schlager.« Er hebt kurz den Schirm, wie zum Gruß, und beide gehen in Richtung Hafen davon. »Auf den Inseln scheint schon die Sonne!«, sagt Sonja, und tatsächlich wird der Nachmittag klar.
Sonja und Jan kommen an, nehmen die Gegend langsam in Besitz, wie alle anderen hier, aber jeder für sich. Es gibt keine Besitzansprüche, die Einheimischen halten sich zurück, sie wissen, in den langen Wintermonaten werden sie hier fast allein sein, werden aufatmen, aber sich auch wieder auf die Einnahmen des Sommers freuen. Ein fairer Handel. Diese Gegend ist stillschweigend Jans und Sonjas Gegend geworden. Eine Gegend, in der irgendwie keine Großstadt denkbar ist. Ereignislosigkeit, wohltuendes Nichts-Verpassen-Können. Keine Pflichtprogramme, dafür Berechenbarkeiten. Eine Gegend, im Sommer ganz auf Familien mit Kindern ausgerichtet, im Herbst dann auf Rentner. Diese Welt mit wildem Rhabarber und Sanddorn, aber ohne Eltern. Kalender für den Tidenhub. Fahrpläne, zwar überschaubar, aber genau. Andererseits: Wetterumschwünge, plötzlicher Regen, dann genauso plötzlich wieder Sonne. Die Überfahrtszeiten der Fähren sind nur Richtwerte. Höhere Gewalten.
Sie kaufen am Hafen Krabben vom Kutter, puhlen und essen sie auf einer Bank an der Mole. Am nächsten Morgen gibt es Krabbenrührei, am dritten Tag stinkt die ganze Bude, und sie werfen den Rest in eine Mülltonne am zentralen Parkplatz des Ortes.
Um sich die Zeit zu vertreiben, spielen sie Wolkengucken. Jan sieht zuerst ein Schaf.
»Sehr einfallsreich!«, tadelt ihn Sonja.
»Okay, ein Hund mit Pelzmantel!«, korrigiert er. Sie lacht.
Sie sieht den Kopf des jungen Mozart im Profil, einen Doppelhelix-DNA-Strang in einem sich bereits auflösenden Wolkenwirbel und ein Bierglas, bei dem der Schaum sich über den Rand ergießt. Er staunt über ihre Assoziationen und sieht, davon angespornt, zuerst ein Schiff mit geblähten Segeln, dann einen springenden Esel und zuletzt einen Mann, der eine dicke Frau auf den Knien von hinten nimmt.
»Schwein!«, sagt sie und lehnt sich zurück, die Arme unter dem Kopf verschränkt. Mit gespielt leidender Stimme seufzt sie: »Ach, dieser Stress immer zu Hause. Ständig hat man das Gefühl, dass halb schon viertel vor ist und viertel vor schon immer volle Stunde. Um zehn vor braucht man schon nix mehr anfangen, denn dann ist eh schon immer die Stunde voll!«
»Ja, recht hast du!«, gibt er zurück, in ähnlichem Tonfall. »Es ist ein hartes Brot!«
»Man hat es nicht leicht, aber was will man machen!«
»Nichts, meine Liebe! Des Tages Lasten wollen getragen werden!«
Gemeinsam seufzen sie ausgiebig, er lehnt sich ebenfalls zurück, kneift ihr in die Seite, worauf sie sich empört auf ihn wirft und beginnt, ihn auszukitzeln.
Jan lässt das erste Mal Drachen steigen. Sie haben einen billigen gekauft. Es dauert eine ganze Weile, bis Jan verstanden hat, wie es funktioniert. »Die Böen sind auch tückisch wechselhaft!«, meint er, aber Sonja lässt nicht locker. Immer wieder läuft sie an, kommandiert: »Spannung auf die Leine!« und: »Höher halten!«, bis er es letztendlich schafft und der Drache senkrecht in der Luft über ihnen steht. An der Mole umklammert Jan angestrengt die Schnur, ständig ängstlich, dass sie reißen könnte. Sonja hat Spaß daran, ihn so zu fotografieren.
Im Schwimmbad legt Sonja eine Bahn nach der anderen zurück und freut sich diebisch, dass Jan sie nicht zu fassen kriegt. Er steht im Wasser und versucht sie festzuhalten, wenn sie bei ihm ankommt, aber ihr Badeanzug ist rutschig, und er ist wasserscheu. Hinterher in der Umkleidekabine schaut Sonja an Jan herunter und sagt so laut, dass es jeder hören kann: »Mensch, wie praktisch, da kann man ja sein Handtuch dran aufhängen!«
Nach der Hälfte der Woche schlägt das Wetter kurz um. Sie sind am Wasser. Es ist Ebbe und nur wenige Menschen sind unterwegs, denn der Himmel war schon dunkelgrau, als sie losgegangen sind. Wind kommt auf. Ganz anderes Licht auf einmal. Am Horizont meint Jan die Erdkrümmung wahrnehmen zu können. Sonja steht weit im Watt, die Jacke hoch zugeknöpft und die Kapuze auf. Jan betrachtet sie. Sie sieht aus wie ein kleiner vermummter Mönch, mit ihrer roten Nase, die sie schnell bekommt, wenn es kalt ist oder windig. Caspar David Friedrich kommt ihm in den Sinn, der Mönch am Meer. Er wäre bereit, jetzt einfach mit ihr loszulaufen, seinetwegen bis Skandinavien, aber er ist nicht sehr gut in Erdkunde und sich nicht sicher, ob es von hier tatsächlich einen Weg dahin gibt.
Mittlerweile ist der Himmel wirklich schwarz. Als es anfängt zu hageln, rennen sie los, irgendwohin. Erst stellen sie sich beim Supermarkt unter, an dem eine Verkäuferin hektisch die Ständer mit Drachen, Eimerchen und Fähnchen reinholt. Als sie dann auch noch die Markise über ihnen einholt, ziehen sie weiter ins benachbarte Lokal. Eigentlich ist ihnen das zu gediegen, aber was sollen sie anderes machen. Das Lokal ist alt und urig eingerichtet, allerlei aus dem Meer an der Wand. Fischernetze, Treibgut, maritimes Sammelsurium. Sie finden einen Platz am Fenster und sehen hinaus. Regengüsse gehen nieder. Wind peitscht das Wasser in fast waagerechte Richtung, sammelt Müll und wischt ihn in Spiralen über den Platz an der Hafenmauer. Im Lokal brennt Licht, obwohl es noch früh ist. Es ist fast leer dort. Ein missmutiger Kellner im vollen, altmodischen Kellnerornat, weißes Hemd, schwarze Weste, Ledergeldbörse am Gürtel und mit perfekter, gefetteter Elvisfrisur, zu der sein Schnauzbart so gar nicht passen will, kommt an ihren Tisch. Ihm ist klar, dass sie nur wegen des Regens da sind, aber als sie doch auch heiße Suppen bestellen und nicht nur Getränke, wird er etwas freundlicher. Das Essen ist köstlich und wärmt. Jan forscht, ob das Wetter Sonjas Laune drückt. Wenn es weiter schlecht bliebe, würden sie ihre Spaziergänge einschränken müssen und mehr Zeit zusammen in der Wohnung verbringen. Ob sie Angst davor hat, dass das Streitereien verursachen könnte. Ob sie sich den Urlaub mit ihm anders vorgestellt hat? Er kann keine Anzeichen erkennen. Sonja löffelt lächelnd, hebt den Blick und streckt ihm kurz die Zunge heraus, als sie bemerkt, dass er sie ansieht. Dann schaut sie raus und sagt wieder: »Auf den Inseln scheint schon die Sonne!«, was nun erkennbar nicht stimmt, aber er beschließt, nichts zu sagen, und wendet sich ebenfalls seiner Suppe zu. Nachdem sie noch einen Tee und er einen Pharisäer getrunken haben, regnet es immer noch. Sie zahlen dennoch und beschließen, sich irgendwie durchzuschlagen. Tatsächlich schwächt der Regen etwas ab, als sie den Deich erreichen. Sie haben noch eine Tüte Himbeerbonbons in der Tasche. An jeder Bank, so machen sie ab, gibt es eins zum durchhalten. Schon kurz hinter der dritten Bank sind sie klatschnass, die Klamotten tropfen, die Tüte ist durchgeweicht und die Bonbons müssen sie erst auseinander klauben, da sie anfangen, aufzuweichen und zu kleben. Dennoch lehnen sie sich mutig gegen den Wind, ziehen sich, schieben sich und erreichen schließlich ihre Wohnung. Sie rennen die Treppe hoch, reißen sich schon im Flur die Klamotten vom Leib und duschen heiß. Am Nachmittag hat Sonja Halsweh. Jan reagiert panisch, rotiert um sie herum, ohne wirklichen Plan. Sie haben keine Medikamente dabei, und er hat sie noch nicht krank erlebt. Sie ist guter Dinge und bleibt im Bett, mit einem ellenlangen Schal um den Hals. »Was kann ich tun?«, fragt Jan.
»Du musst mir meine Leibspeise kochen!«, sagt sie mit absichtlich krächzender Stimme.
»Und was ist das?«
»Springforelle mit Mandelkernsoße, Kartöffelchen und Semmelbröseln.«
»Haben wir nicht. Sag was anderes!«
»Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln!«
»Haben wir auch nicht! Sag noch was anderes!«
»Semmelbrösel!«, sagt sie, aber die haben sie auch nicht.
»Sag mal Bouillon!«
»Genau das wollte ich eben sagen!«, gibt sie zurück, und Jan sucht die Brühwürfel.
Als es abends immer noch regnet, holt sie die Karten heraus. Jan kann nicht Karten spielen, nur Mau-Mau. Sie versucht, Jan ein paar Spiele beizubringen, aber er kann sich nichts merken, vergisst die Regeln schon beim Zuhören. Es ist hoffnungslos. Also spielen sie Mau-Mau, erst normal, dann mit Ausziehen, und schon bald sitzt Jan in seinen Boxershorts da, während Sonja nur die Strickjacke abgelegt hat.
Mit der Bahn fahren sie in die nächstgrößere Stadt. Ihnen ist nach Geschäften, nach einem kleinen Bummel. Auf der Fahrt albern sie rum. Jan sagt:
»Dein Name ist eigentlich viel zu lang. Ich sollte dir einen anderen geben!«
»Und welcher wäre das?«, fragt sie.
»Na, Eurydike zum Beispiel oder Pandora. Auch Odaliske fände ich schön!«
»Okay!«, sagt sie, »dann nenn ich dich aber Dädalus!« Und eine Stunde lang sprechen sie sich tatsächlich so an: Dädalus und Odaliske.





























