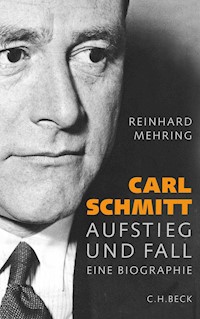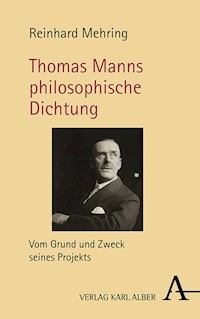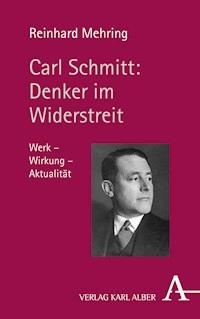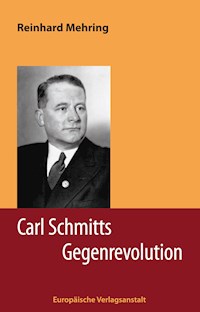
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Carl Schmitt stellte sich 1922 programmatisch in die Reihen einer "Gegenrevolution", die er durch den Bruch mit dem Monarchismus und dem Schritt "von der Legitimität zur Diktatur" gekennzeichnet sah. Von "konservativer Revolution" sprach er nicht. Die hier versammelten Studien klären diese Positionierung in der polarisierenden Auseinandersetzung mit Anarchisten und Liberalen, Vernunftrepublikanern und radikalen Demokraten, "linken" Schülern und jüdischen Intellektuellen: mit Gustav Landauer, Max Weber, Hans Kelsen, Moritz Bonn, Otto Kirchheimer und manchen anderen. Sie zeigen, wie die polemische Strategie "Legitimität gegen Legalität" im Nationalsozialismus an einen Nullpunkt von Legalität und Legitimität gelangte, den Schmitt, als Akteur mit einer offensiven antisemitischen Rechtfertigung des nationalsozialistischen Leviathan beantwortete. Auch nach 1945 noch positionierte er sich jenseits von Legalität und Legitimität, Naturrecht und Rechtspositivismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Reinhard Mehring
Carl Schmitts Gegenrevolution
E-Book (ePub)
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2021Alle Rechte vorbehalten.Covergestaltung: Christian Wöhrl, HoisdorfSignet: Dorothee Wallner nach Caspar Neher »Europa« (1945)
ePub: ISBN 978-3-86393-577-1
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2021Print: ISBN 978-3-86393-118-6
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unterwww.europaeischeverlagsanstalt.de
Vorwort
In seiner Programmschrift Politische Theologie stellte sich Schmitt in die Reihen einer „Staatsphilosophie der Gegenrevolution“, die er durch den Bruch mit der „dynastischen Legitimität“ des „Traditionalismus“ und den Schritt „von der Legitimität zur Diktatur“ (PT 72) gekennzeichnet sah.1 Von „konservativer Revolution“ sprach er nicht.2 Die folgenden – teils unveröffentlichten, teils intensiv überarbeiteten – Studien versuchen diese Selbstpositionierung zu klären.3 Schmitts Kaleidoskop von Gesprächspartnern marschiert dabei in den agonalen Konstellationen der Zwischenkriegszeit in breiter Phalanx auf: Fritz Mauthner und Gustav Landauer, Max Weber, Hans Kelsen und Heinrich Triepel, Otto Kirchheimer, Eduard Rosenbaum und Moritz Bonn, „Klassiker“ wie Rousseau, Novalis und Donoso Cortés, Julius Stahl und Bruno Bauer und auch neuere Anknüpfungen von Johannes Winckelmann, Reinhart Koselleck und Herfried Münkler. Am Ende steht eine Literarisierung.
Die vorliegenden Studien radikalisieren auf heutiger Quellenbasis Hasso Hofmanns4 Generalbefund: Legitimität gegen Legalität. Hofmanns Problemgeschichte beschrieb einen „Weg“ von der „rationalen“ und „existentialistischen“ zur „rassischen“ und „geschichtlichen“ Legitimität. Die folgenden Studien analysieren diesen Weg als Destruktionsbewegung und Legitimitätskritik; sie pointieren den Befund, dass Schmitt mit der Legalität auch die Legitimität problematisch wurde. Der „Weg“ endete mit Legitimitätszweifel und Legitimitätszerfall. Zwar war Schmitt auch ein rechtspolitischer Akteur. Seine Rolle als „Kronjurist“ im Präsidialsystem und „Führerstaat“ ist keinesfalls gering und muss für einige Aspekte noch tiefenscharf geklärt werden. Diese Akteursrolle steht in den folgenden Studien aber nicht im Zentrum. Als Soldat drückte Schmitt sich vor der Front und war bis 1933 eigentlich nirgendwo organisiert: weder in einer Studentenverbindung noch in der Kirche, einer Partei, einem Freikorps oder einer sozialen Bewegung. An der Universität strebte er nicht in Ämter, war nie Dekan oder Rektor. Er stürmte nicht an der Seite D’Annunzios Fiume, war nicht am Marsch auf Rom oder zur Feldherrenhalle beteiligt und putschte auch nicht wie später Salan oder Mishima. Den „Zugang zum Machthaber“ fand er deshalb auch nur sehr gelegentlich in untergeordneter Rolle. Er wirkte nicht auf Hitler oder Himmler, Goebbels oder Rosenberg. Die NS-Spitzenpolitiker, denen er nachweislich begegnete – u.a. Göring, Frick, Frank und Freisler –, ließen sich von ihm auch nicht ernstlich beeinflussen. Sieht man vom Umgang mit Johannes Popitz ab, so hatte Schmitt wohl nur auf Hans Frank bis 1936 einen beachtlichen Einfluss, der im Detail aber schwer zu klären ist. Es ist sehr zweifelhaft, ob er als „Staatsrat“ auf Göring wirkte. Unter den NS-Akteuren gehörte er allenfalls in die zweite Reihe. Er war aber vor allem ein „Totengräber“ Weimars und „Quartiermacher“ des Nationalsozialismus, wie es einstige Weggefährten schon früh sahen.
Die meisten nationalsozialistischen Spitzenpolitiker hatten keine näheren Beziehungen zu ihren Vordenkern; sie waren intellektuell nicht ambitioniert. Während die ältere Forschung heterogene Autorengruppen unter Labels vom „antidemokratischen“ Denken und nationalsozialistischer Ideologie oder „Weltanschauung“ homogenisierend versammelte, trennte die neuere Forschung deshalb stärker zwischen den Vordenkern und den Akteuren. Wo der Nationalsozialismus zunächst „intentionalistisch“ personalisierend von „Hitlers Weltanschauung“5 her als „Hitlerismus“6 betrachtet wurde,7 wird die nationalsozialistische „Polykratie“ inzwischen komplexer analysiert.8
Schmitt markierte mit seiner Schrift Politische Romantik bereits seinen Bruch mit restaurativen Bemühungen und Idyllen abgelebter Zeiten. Zwar lässt sich sagen, dass er die „Legitimität der Neuzeit“ problematisierte und jenseits von Demokratie und kommissarischer Diktatur die souveräne Diktatur eines plebiszitären Führerstaats erstrebte; in der kritischen Analyse und Dekonstruktion war er aber stärker als in den systematischen Alternativen. Als Jurist und Staatslehrer mied er bis 1933 deshalb auch die eindeutige Positionierung im parteipolitischen Kampf. Er polemisierte zwar gegen den Versailler Vertrag und Genfer Völkerbund; eine solche nationalistische Positionsnahme war im Weimarer Spektrum aber weit verbreitet; solange Schmitt sie nicht eindeutig mit einer Absage an die Weimarer Republik und Verfassung verband, war sie parteipolitisch deshalb wenig spektakulär und skandalös. Zwar forderte er immer wieder „konkrete“ Identifikationen und Positionierungen ein; seine eigene Stellung ließ er aber jenseits plakativer Etiketten oft vage und unklar.
Schmitt operierte mit einer doppelten Adressierung und Semantik, versteckte politische Signale im geistesgeschichtlichen Spiegel hinter historischen Parallelen und Autorenmasken. Immer wieder bezeichnete er den Feind dabei als „eigne Frage als Gestalt“; in seiner antisemitischen Rede Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist sprach er zwar von „Wendepunkten“ und „Maskenwechseln“ jüdischen Verhaltens.9 Wenige Autoren betrieben Geistesgeschichte aber so konsequent wie er selbst als ein präsentistisches, in die Gegenwart zielendes Maskenspiel.10 Zentrale Beziehungen und Mentoren seines Werkes verschwieg er – nach 1933 und 1945 – auch. Er demaskierte Feinde und verschleierte sein eigenes Spiel. Die Autorenmasken, die er seinem Werk über die Jahre aufsetzte, um bestimmte Konstellationen perspektivisch zu treffen, sind kaum zu zählen: Donoso Cortés oder Hobbes, Benito Cereno, Savigny, Hamlet oder Eusebius sind nur einige davon. In seiner späten Schrift Theorie des Partisanen identifizierte Schmitt sich mit dem französischen General Raoul Salan, der im Algerienkrieg „der unerbittlichen Logik des Partisanenkriegs erlag“ (TP 66) und gegen den französischen Präsidenten de Gaulle putschte: „Er berief sich gegen den Staat auf die Nation, gegen die Legalität auf eine höhere Art Legitimität“ (TP 86). Diese Legitimität wurde Schmitt so fragwürdig und fraglich wie die Legalität selbst, weshalb seine Profilierung von Legalität und Legitimität in juristischer Reserve auch auf starke normative Geltungsansprüche verzichtete und „Naturrecht“ wie „Rechtspositivismus“ gleichermaßen zurückwies. Schmitt erscheint in den folgenden Studien als dekonstruktiver Diagnostiker und Mineur noch der eigenen Positionen. Schrieb er zuletzt an einer „Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie“, so zielt die vorliegende Sammlung auf eine kritische Analyse seiner Legitimitätslegende, um die Kategorien der Legalität und Legitimität von polemischen Hypotheken zu lösen.
Inhalt
Vorwort
Zur Einführung in die Thematik
Teil A: Gegenrevolutionäre Profilierung im geistesgeschichtlichen Spiegel
I.Der „schmale Weg des Transzendentalismus“. Schmitts Weg zur gegenrevolutionären Souveränitätslehre
II.Offene Anfänge? Carl Schmitts frühe Option für die Gegenrevolution
III.Die Spanische Grippe und die Lehre von der „kommissarischen Diktatur“
IV.Gegen romantischen Utopismus: Schmitts Novalis-Bild
V.Gegen den Anarchismus: Fritz Mauthner und Gustav Landauer im Visier
VI.Cortés-Maske im Spanienmythos
Teil B: Von der Liberalismuskritik zur „demokratischen Legitimität“?
I.Max Weber und Carl Schmitt
II.Cato oder Plato? Max Webers letzte Worte
III.Biographie eines Antipoden: Hans Kelsen (1881–1973)
IV.Demokratiediskurs als philosophische Bewegung. Zum Methoden- und Richtungsstreit in der Weimarer Staatsrechtslehre
V.Liberale Demokratie als Paradoxon? Carl Schmitts Beisetzung des klassischen Liberalismus
VI.Soziale Realität versus „Begriffsrealismus“: Otto Kirchheimer und der Links-Schmittismus
VII.Abrechnungen enger Weggefährten: Eduard Rosenbaum und Moritz J. Bonn
Teil C: Antwortsuche und mythische Verstrickung
Überleitung
I.Vordenker der souveränen Diktatur? Das antiliberale Rousseau-Bild und Carl Schmitt
II.Goethe oder Shakespeare? Rollenspiele im Nationalsozialismus
III.Konstitutionalismus und Antisemitismus: Carl Schmitts Rechtswissenschaftsgeschichte
IV.„Autor vor allem der ‚Judenfrage‘ von 1843“: Carl Schmitts Bruno Bauer
V.„Ich müßte mich mit Triepel auseinandersetzen“. Triepel, Schmitt und Die Hegemonie
VI.Savigny oder Hegel? Die Schrift Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft
Teil D: Legitimitätssuche im Spätwerk
I.Legitimität gegen Legalität? Schmitts Absetzung von Johannes Winckelmann
II.Sinnkritik nach Carl Schmitt. Reinhart Kosellecks Rezeption im Briefwechsel
III.Akkreditierung im Schmittianismus? Herfried Münklers Korrespondenz mit Carl Schmitt
IV.Im „Labyrinth der Legitimitäten“ und Ethos-Analyse: Schmitt und Münkler über neue Kriege und Krieger
V.„Neue Normalität“ und Postheroismus in Merkels anfänglicher Corona-Politik
VI.Statt eines Schlusses: Gespräch mit Damen über den abwesenden Herrn Schmitt
Nachwort
Siglen der wichtigsten Werke Carl Schmitts
Nachweise
Anmerkungen
Zur Einführung in die Thematik
Am 7. Januar 2015, dem Tag des Pariser Terroranschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, Auftakt weiterer Terrorserien, erschien Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung (Soumission).11 Heute wirkt er durch die neuere politische Entwicklung in Frankreich, den Umsturz des Parteiensystems und den Wahlsieg Emmanuel Macrons (2017) sowie der neuen Lage seit der Corona-Pandemie etwas überholt. Houellebecq publizierte den Roman in die Endphase der sozialdemokratischen Regierung François Hollande hinein und imaginierte hier, in den Kategorien Carl Schmitts gesprochen, eine „legale Revolution“ durch eine Partei des politischen Islamismus, die, analog Hitler, einen Legalitätskurs zur Machtergreifung verfolgte, weil sie auf die strategische Schwäche der parlamentarischen Systemparteien setzte, um über eine Regierungsbeteiligung zur diktatorischen Macht zu gelangen. Houellebecq entwarf den Musterfall einer legalen Revolution nach dem Drehbuch Schmitts. Sein Ich-Erzähler, Literaturwissenschaftler und Huysmanns-Spezialist ähnelt mit seiner zynischen und sexistischen Lebensführung sowie seiner Ausflucht in den katholischen Rechtsintellektualismus auch Schmitt selbst; auch der wurde immer wieder als nihilistischer Ästhetizist gedeutet, der den Sprung in den autoritären Katholizismus suchte, ohne ihn ernstlich zu leben. Auch die Korrelation von Sexismus und Politik, der Dreiklang autoritärer Liquidierung und Unterwerfung der Frau, des sacrificium intellectus und der politischen Autonomie und Freiheit ähnelt Schmitts gegenrevolutionärer Botschaft. Wie Schmitt 1933 unterwirft sich Houellebecqs Ich-Erzähler am Ende der Diktatur, nachdem ihm persönliche Privilegien und akademische Reputation garantiert wurden.
Aktuell ist die Lage der liberalen und parlamentarischen Demokratie heute, nicht erst seit Corona, alles andere als rosig. Schwenkten die Historiker von den Konfrontationsgeschichten des Kalten Krieges nach 1989 auf triumphale Glücksgeschichten und Erfolgsnarrative um, so wird die Zukunft der Demokratie seit dem 11. September 2001 negativer erzählt. Unter den terroristischen und fundamentalistischen Bedrohungen wurden liberale Freiheiten der Sicherheit geopfert. Erlebte das 20. Jahrhundert die Weltherrschaft der USA, so scheint China heute im hegemonialen Ausscheidungskampf zu triumphieren.12 Es zeigt dabei wenig Neigungen, sich zu demokratisieren, und nutzt die digitale Revolution vielmehr für die Optimierung eines repressiven Überwachungsregimes. Wir diskutieren die aktuelle Krise der Demokratie heute in Europa vereinfacht mit Chiffren und Stichworten wie: Putin, Erdogan, Bolsonaro, Trump. Seit der Milleniumswende erlebten wir ein katastrophales Scheitern vorgeblicher Demokratisierungsmissionen im Mittleren und Nahen Osten, Afghanistan- und Irak-Krieg, den Untergang des „Arabischen Frühlings“ in Diktatur und Bürgerkrieg, ein Scheitern des europäischen Verfassungsprozesses an Volksabstimmungen und nationalen Parlamenten, das vielfach bedenkliche exekutive Krisenregime der globalen Finanzkrise, Ukraine-Krieg, IS-Terror und Syrienkrieg, Migrationskrise, autoritäre Tendenzen u.a. in den Višegrád-Staaten Nordosteuropas (Viktor Orbán, Andrej Babiš u.a.), separatistische Neigungen nicht nur in Katalonien, „Brexit“, einen dramatischen Umbruch der Parteiensysteme u.a. in Italien und Frankreich, rechtspopulistische Herausforderungen in vielen europäischen Staaten. Die großen europäischen Kernstaaten regierten schon vor den Corona-Zeiten mehr oder weniger im Krisenmodus. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie folgte 2020 ein globaler Ausnahmezustand, der zu starken Einschränkungen von Grundrechten und Prinzipien der liberalen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit führte. Eine unproblematisch stabile liberale und parlamentarische Demokratie findet sich heute fast nirgendwo. Fast überall zeigt sich eine „Wendung“ zum autoritären, exekutiven oder totalen Staat, wie sie Schmitt im Untergang der Weimarer Republik für die frühen 1930er Jahre schon als Folge einer Zwischenkriegs- und Krisenzeit diagostiziert hatte.
In der Bundesrepublik erinnerte die Regierungsbildungskrise 2017/18 am Beginn der vierten Amtszeit Angela Merkels erneut an Weimarer Verhältnisse: 1930 war die Sozialdemokratie in Weimar aus einer Koalitionsregierung ausgestiegen und es gab bis zum Januar 1933 nur noch sog. Präsidialkabinette, vom Reichspräsidenten gestützte Minderheitsregierungen, um Neuwahlen zu vermeiden, die extremistische Parteien (NSDAP, KPD) gestärkt hätten. Bundespräsident Steinmeier erinnerte an diese historische Parallele, als er seine SPD 2018 zur Regierungsverantwortung und neuerlichen Merkel-GroKo ermahnte. Die Furcht vor Neuwahlen blieb die Amtszeit Merkel IV hindurch aktuell, ein plötzlicher Bruch der arg gebeutelten und geschrumpften GroKo wurde nur pragmatisch vermieden. Einige Jahre lang erlebten wir das katastrophale Scheitern der Conservative Party und des politischen Systems des United Kingdom an der Brexit-Entscheidung von 2016. Das Mutterland der parlamentarischen Demokratie und des Liberalismus zerlegte sich selbst. Es zerstörte dabei nicht nur seine parlamentarische Kultur, sondern diskreditierte auch das Instrument der Volksabstimmungen, das vor wenigen Jahren noch vielfach als Hoffnungsanker galt. Trump verleugnete Ende 2020 seine Wahlniederlage und rief fast unverblümt zum Sturm auf das Capitol auf, sodass ein zweites Impeachment-Verfahren eingeleitet wurde. Die Mehrheit der Republikaner hielt aber weiter zu Trump und lehnte eine Amtsenthebung ab. In der Bundesrepublik wäre sie deshalb vielleicht ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Natürlich ermöglichen solche Krisen auch heilsame Reformen und Regenerationsprozesse. Es wäre aber naiv anzunehmen, dass die Verheißungen liberaler Demokratie aus diesen Krisen unbeschadet wiederauferstehen. Verkündigte mancher nach 1989 noch sehr vollmundig den definitiven Triumph der demokratischen Mission der Westlichen Welt, ist heute der kritische Befund der Zwischenkriegszeit nach 1918 erneut aktuell, dass der „bürgerliche“ Liberalismus in seinen elementaren Bestandsvoraussetzungen eklatant gefährdet und geschwächt ist.
Wer einem solchen Krisenbefund zustimmt, wird sich über das weltweite aktuelle Interesse an Carl Schmitt (1888–1985) nicht wundern.13 Schmitt war ein scharfer Kritiker des Liberalismus, Vordenker des „autoritären“ und „totalen“ Staates, Apologet des Weimarer Präsidialsystems und „Kronjurist“ des Nationalsozialismus. Als junger, hochbegabter Jurist beobachtete er schon vor 1918 den Wandel zur Militärdiktatur unter den Bedingungen des Krieges und folgte diesem Zug zur Diktatur dann als Lebensthema. Als Staatsrechtslehrer konzentrierte er sich dabei auf die deutschen Verhältnisse. 1921 publizierte er eine erste große Monographie Die Diktatur, die ihm sogleich Berufungen nach Greifswald (1921) und Bonn (1922) eintrug. 1928 wechselte er nach Berlin und kehrte 1933 nach kurzem Kölner Intermezzo wieder dahin zurück. 1945 verlor er infolge seiner starken nationalsozialistischen Belastung seine Berliner Professur.
Seit den 1920er Jahren publizierte er in rascher Folge grundlegende und schlagkräftige Schriften, die heute in vielen Sprachen intensiv diskutiert werden. Genannt seien nur: Politische Theologie (1922), Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1923), Der Begriff des Politischen (1927), Verfassungslehre (1928), Der Hüter der Verfassung (1931), Legalität und Legitimität (1932). Schmitt trennte strikt zwischen Liberalismus und Demokratie. Den Parlamentarismus betrachtete er dabei als eine liberale Form politischer Willensbildung und Entscheidung. Schmitt betonte aber eine Spannung von Idee und Realität; er meinte, dass die parlamentarische Debatte sich in der modernen Demokratie nicht mehr „rationalistisch“ an politischer Argumentation und Überzeugung ausrichtet, sondern dass der einzelne Abgeordnete zum abhängigen Agenten im „Parteienstaat“ der Parteilinie mutiert. In seiner Verfassungslehre kennzeichnete er das liberale Verfassungsdenken vor allem durch die strikte Gesetzesbindung, Gewaltenteilung und starke Grundrechtsbestimmungen. Er meinte, dass die Verbindung von Demokratie mit Liberalismus, die uns heute um der Liberalität willen selbstverständlich erscheint, eigentlich historisch ist und demokratische Gleichheit sich auch antiliberal und außerparlamentarisch in anderen Formen politischer Willensbildung äußern und organisieren kann. Die Weimarer Republik eröffnete der „unmittelbaren Demokratie“ hier u.a. den außerparlamentarischen Weg des Volksbegehrens und Volksentscheids. Der politische Extremismus nutzte diese Instrumente zur Schwächung des parlamentarischen Systems.
Anders als die parlamentarische Demokratie der Bundesrepublik bot die Weimarer Verfassung mehr Möglichkeiten für eine antiparlamentarische Regierungsbildung.14 Der Reichspräsident wurde in Weimar direkt vom Volk für sieben Jahre gewählt. Nach dem Tod Friedrich Eberts übernahm Paul von Hindenburg, der einstige Generalfeldmarschall, Kriegsheld und Träger der Militärdiktatur, das Amt; 1932 wurde er gegen Hitler wiedergewählt. Weil der Reichstag seit 1930 keine parlamentarisch getragene Regierung mehr wählte, stützte Hindenburg Minderheitsregierungen. Im Januar 1933 ernannte er Hitler, den erklärten Totengräber der Republik, zum Kanzler und ermöglichte so den Untergang Weimars. Schmitt rechtfertigte die „kommissarische Diktatur“ des Präsidialregimes exponiert und trat spätestens seit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 zum Nationalsozialismus über. Er suchte nun die Nähe zu nationalsozialistischen Spitzenpolitikern wie Hermann Göring und Hans Frank und wirkte bis 1936 in wichtigen Funktionen an der nationalsozialistischen Gleichschaltung des Rechtssystems und der Rechtswissenschaft mit. Bis 1942 rechtfertigte er den nationalsozialistischen Imperialismus als herrschaftliche „Großraumordnung“.
Schmitt beobachtete nicht nur einen Zug zur Diktatur, sondern rechtfertigte diese Entwicklungen auch sehr grundsätzlich. Er war tatsächlich davon überzeugt, dass eine politische Ordnung Deutschlands jenseits der liberalen und parlamentarischen Demokratie legal und legitim möglich sei. Dabei verstand er sich als Jurist, der auf dem Boden des geltenden Rechts argumentiert. Begrifflich trennte er zwischen Legalität und Legitimität. Die Rede von „Legitimität“ meidet das stärkere Wort vom „Naturrecht“ und betont den historischen Wandel der Rechtsauffassungen. Als antiliberaler Denker und lebensphilosophischer „Existentialist“ lehnte Schmitt ein katholisch-christliches „ewiges“ Naturrecht ebenso ab wie das universale Vernunftrecht der Aufklärung und des deutschen Idealismus nach Kant. Schmitt dachte radikal politisch und nationalistisch. Die „dynastische Legitimität“ der Kaiser und Könige hatte seiner Auffassung nach im Weltkrieg kläglich versagt und abgedankt. Zur Rechtfertigung des Rechts blieb deshalb nur die „demokratische Legitimität“. Schmitt erklärte mit seiner Verfassungslehre den politischen „Willen“ der Nation zum Geltungsgrund des Rechts, zur Legitimität der Legalität. Diesen „Willen“ bezeichnete er auch als „Macht oder Autorität“ und sprach im Vokabular des Existentialismus von einem „Recht auf Selbsterhaltung“. Als Jurist bemühte er sich weniger um die rechtsphilosophische Klärung seiner Legitimitätsauffassung als um die nationalistische Mobilisierung des politischen „Willens“, der die Verfassung tragen sollte. Er setzte keinen starken Rechtsbegriff gegen die herrschende Legalität und Legitimität, sondern analysierte zunächst nur die Rechtsgrundlagen der geltenden Verfassung.
Die Weimarer Republik entstand nach dem Ersten Weltkrieg unter äußerst schwierigen Rahmenbedingungen; Schmitt betrachtete sie zwar als ein „Diktat“ der Sieger des Ersten Weltkriegs, akzeptierte sie aber auch als „Verfassungsentscheidung“ nach dem klassischen Drehbuch des Nationalstaats: durch die Wahl einer Nationalversammlung, Verfassungsentwürfe und die positive Entscheidung der Nationalversammlung. Schon die Verfassungslehre meldet aber Vorbehalte an: Der tragende politische Wille kann schwächeln, schwinden oder auch revolutionäre Alternativen suchen. Die Autorität der Verfassung steht zur Disposition der revolutionären verfassunggebenden Gewalt.
Artikel 1 der Weimarer Verfassung verfügte: „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Das Grundgesetz stellt heute den Menschenwürdegrundsatz und die Menschen- und Grundrechte voran. Erst in Artikel 20 GG heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte erfolgte 1948 als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg. Schmitt dachte als Staatsrechtler noch nicht unter diesem Primat der Menschenrechte. Man muss wohl auch sagen: Er glaubte nicht an universale Menschenrechte, sondern betonte den politischen Ursprung und die Machtgrundlagen des Rechts. Normen galten seiner Auffassung nach nur, wenn und weil sie von einem existierenden Willen, einer faktischen Macht oder Autorität gesetzt und erhalten werden.
In seinen grundlegenden Schriften Politische Theologie und Der Begriff des Politischen führte Schmitt sehr drastisch aus, was er über diesen politischen „Willen“ dachte. Entscheidungen formieren sich in Unterscheidungen:
„Die spezifische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.“ „Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch häßlich zu sein; er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er ist eben der andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, daß er in einem besonders intensiven Sinne existentiell etwas anderes und Fremdes ist […] Den existentiellen Konfliktfall können nur die Beteiligten selbst unter sich ausmachen; namentlich kann jeder von ihnen nur selbst entscheiden, ob das Anderssein des Fremden im vorliegenden Konfliktsfalle die Negation der eigenen Art Existenz bedeutet und deshalb abgewehrt oder bekämpft wir, um die eigene, seinsmäßige Art von Leben zu bewahren.“ (BP 26f)
Schmitt entwickelte aus diesem Ansatz eine Programmschrift zur Mobilisierung des nationalistischen Kampfes gegen die Versailler Friedensordnung, den Genfer Völkerbund und den Weimarer Liberalismus und Parlamentarismus. Seine Schrift Der Begriff des Politischen, 1927, 1932, 1933 und 1963 in verschiedenen Fassungen erschienen, wirkt bis heute als Kampfschrift der „Neuen Rechten“. Die Rede vom „existentiellen“ Willen, von Seins- und Lebensformen, demokratischer „Homogenität“ und Gleichheit im Kampf gegen Feinde, der Ton nationalistischer Xenophobie und ethnischen Homogenitätswahns spricht heute noch manchen an. Schmitt malte und buchstabierte ihn im Nationalsozialismus auch aggressiv antisemitisch, rassistisch, revanchistisch und imperialistisch aus. Alle illiberalen und diskriminierenden Töne, aber auch manche Gegenstimmen finden sich in seinem polysemen und kakophonen Werk. Im Februar 1956 notierte Schmitt dazu in sein Tagebuch:
„Modernes Gespräch: Wieviele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Zwei tote Sprachen, Griechisch und Latein kann ich gut lesen; ich spreche leidlich 5 nationale, d.h. halbtote Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch; und beherrsche mindestens sieben lebendige, d.h. ideologische, wirksame, d.h. internationale Sprachen, nämlich humanistisch, liberaldemokratisch, faschistisch, marxistisch, römisch=katholisch christlich=evangelisch, ferner: positivistisch und hegelianisch. Macht also zusammen 14 Sprachen, deren Vokabulaire, Grammatik und Syntax mein Gehirn präsent haben muss. Sonst wäre ich nämlich schon längst ein- und untergebuttert. So aber lebe ich noch und genieße der Freiheit meines Geistes.“ (GL 341)
Schon früh verknüpfte Schmitt Macht und Recht systematisch miteinander. Seine Politische Theologie bindet das Recht der Macht an eine politische Ordnungsleistung. Nicht jede Macht ist im Recht, sondern nur diejenige, die eine effektive Ordnung stiftet. Der bekannte Schlüsselsatz der Schrift lautet hier: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ Es heißt dort auch:
„Die Ordnung muß hergestellt sein, damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muß eine normale Situation geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber entscheidet, ob dieser normale Zustand wirklich herrscht. Alles Recht ist ‚Situations-recht‘. Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in ihrer Totalität. Er hat das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt das Wesen der staatlichen Souveränität, das also richtigerweise nicht als Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol juristisch zu definieren ist“. (PT 20)
Unter Berufung auf Thomas Hobbes spricht Schmitt von einem notwendigen Zusammenhang oder Konnex des juristischen Entscheidungsdenkens: des sog. „Dezisionismus“, mit einem „Personalismus“, und er betont, dass die personalistischen Voraussetzungen des Entscheidungsdenkens eigentlich nur in einem „theistischen“ Weltbild gesichert sei. Nur hier werde der Mensch als metaphysisches Wesen souverän über die Natur erhoben. Schmitt schmückte seinen Sprung in die Metaphysik normativ „aus dem Nichts“ geborener Entscheidung mit Berufungen auf Kierkegaard, Sorel und eine „Philosophie konkreten Lebens“. So schreibt er: „In der Ausnahme durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik.“ (PT 22) „Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht des Volkes“ (PB 200), schreibt er 1934. Schon 1923 beruft er sich auch auf Mussolini und die „schöpferische“ Aktion und Gewalt.
Schon damals gerät sein Werk auf die abschüssige Bahn der „Gegenrevolution“: Schmitt konstruiert einen Kampf zwischen „Autorität“ und „Anarchie“, „theistischem“ und „materialistischem“ Weltbild, und er setzt die personale Herrschaft und Entscheidung gegen ein Zerrbild vom liberalen und positivistischen Gesetzesdenken, das die Herrschaft des Rechts als Zwang einer juristischen Subsumptionslogik auslegt. Schmitt tritt mit seiner Souveränitätslehre 1922 schon in eine erbitterte Gegnerschaft zur „Reinen Rechtslehre“ Hans Kelsens und entblödet, schämt oder scheut sich nach 1933 nicht, Kelsens Gesetzesdenken als „jüdischen Geist“ zu denunzieren. Immer wieder betonte er nach 1933, dass sein „Dezisionismus“ eigentlich ein „konkretes Ordnungsdenken“ sei; seine starke These, dass souveräne Entscheidungen „personalistische“ und „theistische“ Voraussetzungen haben, dass die Freiheit des Menschen religiös und metaphysisch begründet sein muss, warf Schmitt aber in den Auslegungspfad der Führerideologie und des Mythos. Seine „Philosophie konkreten Lebens“ oszilliert zwischen einem theistischen und einem existentialistischen Credo. Eine konsistente philosophische Systematik findet sich im Werk nicht. Nach seiner Kritik am „bürokratischen Funktionsmodus“ des Gesetzesdenkens wurde Schmitt auch zum Apologeten der „unmittelbaren Gerechtigkeit“ des nationalsozialistischen „Führerstaates“, für den er dekretierte: „Gesetz ist Wille und Plan des Führers.“ Erst spät realisierte er, dass Hitler einen terroristischen Leviathan schuf. Verklärte er Hitler 1934 noch zum souveränen Diktator und Richterkönig im Ausnahmezustand, so notierte er 1948 in sein Tagebuch:
„Was ist seit 1918 in Deutschland geschehen? Aus dem Dunkel des sozialen, moralischen und intellektuellen Nichts, aus dem reinen Lumpenproletariat, aus dem Asyl der obdachlosen Nichtbildung stieg ein bisher völlig leeres unbekanntes Individuum auf und sog sich voll mit den Worten und Affekten des damaligen gebildeten Deutschland.“ (GL 112) „Nun hatte man den Ernstnehmer, den Ernstmacher, einen nichts als Realisator, einen nichts als Durchführer und Vollstrecker, den reinen Vollstrecker der bisher so reinen Ideen, den reinen Schergen.“ (GL 113) „Die Idee bemächtigt sich eines Individuums und tritt dadurch immer als fremder Gast in die Erscheinung. Der fremde Gast war Adolf. Er war fremd bis zur Karikatur. Fremd gerade durch die aseptischleere Reinheit seiner Ideen von Führer, Charisma, Genie und Rasse. Er war ein voraussetzungsloser Vollstrecker.“ (GL 114)
Schmitt möchte hier verstehen, weshalb Deutschland auf Hitler hereinfiel. Der souveräne und „charismatische“ Führer erscheint ihm plötzlich nur noch als Projektionsfläche und Phantom diverser Zuschreibungen. So merkwürdig und fragwürdig solche Überlegungen auch sind, formulieren sie doch auch eine Kapitulationserklärung der eigenen personalistischen Führersehnsucht: Die Flucht aus der Norm in die Entscheidung, der Abbau liberaler Verfahren und Machtkontrollen übereignete das Recht der Willkür und Tyrannei. Viele einstige Weggefährten brachen mit Schmitt und beschrieben seine „zynische“ und „dämonische“ Gestalt teils atemberaubend negativ. Moritz Bonn, ein einstiger Förderer, meinte: „Wie alle schwachen Geister lechzte er nach der befreienden Tat; ob Tat oder Untat, war ihm schließlich einerlei“.15 Karl Löwith kritisierte Schmitts „Dezisionismus“ 1935 als politischen Opportunismus16 und zielte damit auch gegen den philosophischen Existentialismus seines akademischen Lehrers Heidegger. Für das nihilistische Pathos bloßer „dezisionistischer“ Entschlossenheit erinnerte er an einen Freiburger Witz: „Ich bin entschlossen, nur weiß ich nicht wozu.“17 Schmitts politischer Theorie und Verfassungslehre wurde immer wieder vorgeworfen, dass sie die Staatszwecke nicht positiv formulierte. Max Weber hatte einst gehofft, dass der moderne Parlamentarismus den Typus des „Verantwortungspolitikers“ ausprägen würde. Diese Hoffnung auf eine qualifizierte demokratische Führerauslese war spätestens mit der Selbstpreisgabe der Weimarer Republik an den Nationalsozialismus erledigt: Das Volk wählte sich falsche Führer. Wenn Schmitt nach 1945 endlich zugab, dass der „charismatische Führer“ ein destruktiver Hasadeur war, verwarf er auch seine frühere „personalistische“ Antwort.
Schmitt flüchtete aus den Krisen der Weimarer Demokratie in die totalitäre Diktatur. Sein Werk war in den kritischen Analysen stärker als in den radikalen Antworten. Manche frühere Positionen revidierte er nach 1945. „Eine geschichtliche Wahrheit ist nur einmal wahr“ (VRA 415), schrieb er seinen Lesern nun ins Stammbuch, äußerte sich nicht mehr offen nationalistisch und verzichtete auf öffentliche Kommentare zur Bundesrepublik, der er privatim aber die Souveränität und Legitimität bestritt. Die Neue Rechte beruft sich heute gerne auf Schmitt als „Klassiker“ des Rechtsintellektualismus, da direkte NS-Anschlüsse unmöglich sind, rezipiert ihn aber meist nur mimetisch und epigonal auf niedrigem Niveau. Sie übernimmt Schlag- und Stichworte ohne originäre Analysen. Von Mohler über Maschke zu Kubitschek zeigt sich hier auch ein intellektueller Absturz. Es gibt heute erneut eine Sehnsucht nach einfachen Antworten und starken „Führern“. Die „charismatischen“ Führer und Autokraten aber entpuppen sich vielfach erneut als populistische Idioten, Dummköpfe, Hochstapler und Hasadeure. Ist Schmitts Befund einer Entliberalisierung der Demokratie heute wieder sachlich aktuell, so zeigen die populistischen Demagogen, dass der Ruf nach dem souveränen Führer und radikalen Systemalternativen keine tragende Antwort bietet. Liberalismus ohne Demokratie verkennt den Gleichheitsanspruch des Individualismus, Demokratie ohne Liberalismus und Liberalität aber wird totalitär. Nur die strikte Befristung und Beschränkung der Macht schützt vor falschen Führern.
Teil A:Gegenrevolutionäre Profilierung im geistesgeschichtlichen Spiegel
I.Der „schmale Weg des Transzendentalismus“. Schmitts Weg zur gegenrevolutionären Souveränitätslehre
1. Fehlende Antwort auf den Rechtshegelianismus?
Carl Schmitt begann seine akademische Karriere als Strafrechtler. Das Strafrecht gehört zum öffentlichen Recht.1 Ähnlich wie sein Straßburger akademischer Lehrer Fritz van Calker (1864–1957) verband Schmitt es mit dem Staatsrecht, wenn er seine Habilitationsschrift der Staatsphilosophie widmete und seine Studie explizit als „philosophische Untersuchung“ (WdS 9) und „Argumentation“ bezeichnete. Er kombinierte Strafrecht und Staatsrecht also früh und grundlegend mit philosophischen Fragen. Die Kombination Strafrecht und Rechtsphilosophie war seit Kant und Feuerbach akademisch gängig, weil das Recht des Staates, seine Bürger zu bestrafen, nach liberaler Auffassung besonders begründungsbedürftig ist. Gustav Radbruch (1878–1949) vertrat diese Kombination lange in Heidelberg; Schmitt kam in Straßburg mit Max Ernst Mayer (1875–1923) in engeren Kontakt, der ebenfalls für die Verbindung von Strafrecht und Rechtsphilosophie stand.
Die deutsche Universitätsphilosophie tendierte nach 1900, nach gängiger philosophiegeschichtlicher Einschätzung,2 zum Übergang vom Neukantianismus zum Neo-Hegelianismus, zu Lebensphilosophie und Phänomenologie. Wilhelm Windelband (1848–1915), ein Schulpapst der – von der sog. „Marburger Schule“ (Cohen, Cassirer, Natorp) sich abgrenzenden – sog. „südwestdeutschen Schule“ des Neukantianismus, hatte lange (1882–1903) in Straßburg gewirkt und 1910 bereits eine „Erneuerung des Hegelianismus“ proklamiert. Diese Schule war kultur- und wertphilosophisch akzentuiert. Schmitt grenzte sich mit seiner Habilitationsschrift auch von der „Marburger“ Ethik Cohens ab und neigte mehr der „südwestdeutschen“ Betrachtungsweise zu, wie sie in Straßburg vorherrschte.
Der damalige Neo-Hegelianismus spaltete sich in Links- und Rechtshegelianismus. Schmitt beobachtete die Entwicklung des marxistischen Links-Hegelianismus schon vor 1933 insbesondere bei Georg Lukács (1885–1971) und fragte lebenslang, wo Hegels Philosophie aktuell dominierte und residierte: ob etwa in Berlin, Moskau oder Rom, verkürzt formuliert. Schmitt unterschied „Hegel-Linien“ und trat gerade im Spätwerk explizit in einen Kampf um Hegels Erbe ein. Diesen Kampf führte er eigenwillig jenseits buchstäblicher Hegel-Studien wie der Sekundärliteratur. Seine Hegel-Rezeption lässt sich in ihrer Intensität allenfalls mit seiner Hobbes-Rezeption vergleichen; selbständige Hegel-Studien hat Schmitt aber nicht publiziert. Der junge Hegel und die Phänomenologie des Geistes beschäftigten ihn mehr als der spätere Systemphilosoph, der in Berlin „Naturrecht und Staatswissenschaft“ systematisch miteinander verknüpfte. Zu den bekannten Autoren des zeitgenössischen Rechtshegelianismus hielt Schmitt lebenslang auf Abstand: insbesondere zur Schule Julius Binders, die den Rechtshegelianismus in die nationalsozialistische Rechtswissenschaft trug und mit Karl Larenz einen gewichtigen Autor fand, der auch in der Bundesrepublik noch durch grundlegende Lehrbücher großen Einfluss auf die deutsche Rechtswissenschaft nahm.
Diese buchstäbliche Distanz zum zeitgenössischen Rechtshegelianismus ist höchst verwunderlich; niemand wäre damals erstaunt gewesen, wenn Schmitt den Schulterschluss gesucht und sich zum Rechtshegelianismus bekannt hätte, wie es sein bedeutender Schüler Ernst Rudolf Huber (1903–1990) nach 1933 auch tat. Schmitts ambivalentes Verhältnis zur Philosophie lässt sich schon im Verhältnis zum zeitgenössischen Neuhegelianismus sehen. Seine Hegel-Rezeption ist hier nicht nachzuzeichnen. Nur eine Bemerkung sei erinnert: In den Verfassungsrechtlichen Aufsätzen heißt es 1958 in einer Glosse:
„Schon meiner Dissertation ‚Über Schuld und Schuldarten‘ von 1910 hatte Karl Binding mit vollem Recht entgegengehalten, dass ihr die Auseinandersetzung mit dem Hegelianischen Strafrecht fehlt. In den folgenden Jahrzehnten bin ich den bedeutenden hegelianischen Rechtsphilosophen meiner Zeit, Julius Binder und Karl Larenz, eine Erwiderung auf ihre Argumente schuldig geblieben. An dieser Stelle kann ich das große Versäumnis nicht nachholen.“ (VRA 428)
Die erwähnte Bemerkung von Karl Binding (1841–1920) ist nicht bekannt. Im Frühwerk hat Schmitt Binding rezipiert. Wahrscheinlich wardiese Rezeption für die Klärung seines Ansatzes auch wichtig; Schmitts Verhältnis zu Binding ist aus den Quellen aber kaum zu klären. Karl Larenz (1903–1993) hat Schmitt sicher gekannt; er gehörte wie Huber zu der jüngeren Generation, die im Nationalsozialismus die Lehrstühle (oft exkludierter Gelehrter) besetzte und die Rechtswissenschaft massiv nazifizierte. Binder und Larenz sahen die Nähen ihres neuhegelianischen Ansatzes zu Schmitts „konkretem Ordnungsdenken“3 und äußerten sich wiederholt zu dessen Schriften, während Schmitt schwieg. Was eine forcierte Hegelianisierung des Nationalsozialismus über Schmitt hinaus bedeutet, lässt sich damals an Hubers Schriften beobachten.
Auch im Nationalsozialismus mied Schmitt weiter eine philosophisch-systematische Fundamentierung. 1958 sprach er in seiner Glosse nicht nur vom Hegelianischen Strafrecht,4 sondern von Hegel allgemein. Wenn er Binder und Larenz namentlich erwähnte, meinte er vermutlich weniger die Schriften als die schulbildende Wirkung Binders in Göttingen insbesondere auf Larenz.5 Ansonsten ist kaum verständlich, dass Schmitt schreibt, er sei Binder eine „Erwiderung“ schuldig geblieben. Zwar hat er dessen Göttinger Spätwerk seit 1919 kaum beachtet, insbesondere dessen 1925 erschienene Philosophie des Rechts nicht; Binders propädeutisches Werk Rechtsbegriff und Rechtsidee von 1915 aber hat er eingehend rezensiert. Diese 1916 erschienene Rezension ist ein Abschluss der „rechtsphilosophischen“ Grundlegungsarbeit des Frühwerks. Sie markiert eine Positionierung im Übergang vom Neukantianismus zum Neo-Hegelianismus und klärt Schmitts Distanz zum Neuhegelianismus in der Rechtswissenschaft. Als Abschied von expliziter rechtsphilosophischer Fundamentierung ist sie ein Epochenabschluss im Werk.
2. Erste Antwort auf Neukantianer
Schmitts Schrift Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, spätestens Januar 1914 bei Mohr erschienen,6 1916 als Habilitationsschrift in Straßburg eingereicht und 1917 erneut publiziert, stellt sich einleitend die Aufgabe, „den Staat in seiner Vernünftigkeit“ (WdS 15) zu erkennen. Mit dem liberalen Strafrechtsphilosophen P. J. A. Feuerbach geht Schmitt hier davon aus, dass Kant an der Trennung von Recht und Ethik gescheitert sei, weil „Recht nicht aus der Ethik abgeleitet“ (WdS 18) werden könne. Während Cohen das Problem aus philosophischer Sicht ethisch verkannt habe, stelle sich spätestens seit Rudolf Stammler diese Trennungsfrage für die Rechtswissenschaft. Im ersten Kapitel der Schrift, „Recht und Macht“ überschrieben, fragt Schmitt nach den Möglichkeitsbedingungen von Rechtswissenschaft transzendentalphilosophisch und wissenschaftstheoretisch, wie es dem zeitgenössischen Neukantianismus entsprach; er führt aus, dass Rechtswissenschaft nur möglich ist, wenn die Rechtstheorie die „Machttheorie“ des Rechts zurückweist und auf der Differenz von Macht und Recht besteht. Nur dann sei die Antithese von Sein und Sollen und das Recht als „Norm“ und „Gebot“ bewahrt. „Wenn es ein Recht geben soll, dann darf es nicht aus der Macht abgeleitet werden, denn die Verschiedenheit von Recht und Macht ist nicht zu überbrücken.“ (WdS 35) Schmitt grenzt sich von der Machttheorie des Rechts und vom Rechtspositivismus ab und besteht auf einer Grundnorm oder Rechtsidee, die „Normen in lückenloser Geschlossenheit unabhängig von jeder Empirie“ (WdS 37) statuiert oder hypostasiert. Beiläufig erwähnt er hier bereits Hans Kelsen, bezieht sich aber für den rechtsphilosophischen Diskussionsstand mehr auf Stammler und Natorp.
Schmitt deutet eine eigene Antwort an, die auf seine spätere Politische Theologie vorauszudeuten scheint: Die Unterscheidung von Macht und Recht, Sein und Sollen, Setzung des Rechtssystems als Normensystem bezeichnet Schmitt nämlich als religiöse „Bewertung“, als einen Vertrauensakt oder Vertrauensvorschuss, für den er aus Luthers Schrift De potestate Papae (WdS 29) zitiert. Schmitt zitiert auf Latein: „Primum, quod me movet, rhomanum pontificem esse aliis omnibus superiorem, est ipsa voluntas dei, quam in ipso facto videmus. Neque enim sine voluntate dei in hanc monarchiam unquam venire potuisset rhomanus pontifex.“ In deutscher Übersetzung heißt es: „Das Erste, das mich zu der Annahme bewegt, dass der römische Bischof allen anderen, wenigstens allen, von denen wir wissen, dass sie sich als Bischöfe aufspielen, überlegen ist, das ist der Wille Gottes selbst, den wir in eben dieser Tatsache am Werke sehen. Denn ohne den Willen Gottes hätte der Papst zu Rom niemals in diese monarchische Stellung geraten können.“7 Der Verweis auf die Autorität Luthers signalisiert, dass selbst Luther die religiöse „Anerkennung“ der Macht als Recht ausgerechnet in einer Kampfschrift gegen den Papst zugeben musste.
Die „Zurückführung einer tatsächlichen Macht auf den Willen Gottes“, dieses „Bekenntnis höchsten Vertrauens“, Macht als Recht anzuerkennen, formuliert Schmitt folgendermaßen:
„Es ist nämlich, aus der Definition des Rechts als Macht eine Bewertung herauszuhören, die an dem Begriffe der Macht zu hängen scheint, indem jede, wenigstens jede relativ dauernde und beständige Macht als berechtigt und begründet – nicht bloß erklärlich – aufgefasst wird.“ (WdS 29)
Man ist geneigt, solche Formulierungen bereits mit der späteren Souveränitätslehre kurzzuschließen. Schmitt erklärt die Unterscheidung von Macht und Recht nicht nur zu einer notwendigen Voraussetzung der Rechtswissenschaft, sondern auch zu einer alltäglichen Erfahrung und gelebten Praxis und deutet diesen soziologischen Befund religiös oder religionsphänomenologisch. Für diese Anerkennung von Macht als Recht, mit Georg Jellinek gesprochen: als „normative Kraft des Faktischen“, zitiert er nach Luther dann Julius Stahl, was im Horizont späterer antisemitischer Stigmatisierung Stahls intrikat ist. Für eine solche „religiöse“ Sanktionierung der Wahrnehmung von Macht als Recht ließen sich vergleichbare Stellen bei Kant oder Hegel finden. So schreibt Kant in der Metaphysik der Sitten:
„Der Ursprung der obersten Gewalt ist für das Volk, das unter derselben steht, in praktischer Hinsicht unerforschlich. […] Ein Gesetz, das so heilig (unverletzlich) ist, dass es, praktisch, auch nur in Zweifel zu ziehen, mithin seinen Effekt einen Augenblick zu suspendieren, schon ein Verbrechen ist, wird so vorgestellt, als ob es nicht von Menschen, aber doch vor irgend einem höchsten tadelfreien Gesetzgeber herkommen müsste, und das ist die Bedeutung des Satzes: ‚alle Obrigkeit ist von Gott‘“.8
Hegel schreibt:
„Überhaupt aber ist schlechthin wesentlich, dass die Verfassung, obgleich in der Zeit hervorgegangen, nicht als ein Gemachtes angesehen werde; denn sie ist vielmehr das schlechthin an und für sich Seiende, das darum als das Göttliche und Beharrende und als über der Sphäre dessen, was gemacht wird, zu betrachten ist.“9
Schmitt betrachtet den „Dualismus“ von Macht und Recht im historischen Rahmen der „Zwei Schwerter“-Lehre und betont, dass das katholische und das protestantische Kirchenrecht zwei konträre Antworten und Lösungen gaben. Er zitiert diverse kirchenrechtliche Literatur und deutet bereits an, dass Rudolph Sohm (1841–1917) und Ulrich Stutz (1868–1938) die protestantische Alternative zum Katholizismus besonders deutlich entwickelten. Sohms Wirkung auf Max Weber betonte Schmitt später immer wieder. Es ist naheliegend, seine Habilitationsschrift als „katholisches“ Credo zu deuten, was hier aber nicht weiter interessiert. Hier soll auch weniger beschäftigen, ob Schmitt 1914 bereits eine eigene Antwort gibt, die auf seine spätere „Politische Theologie“ und Souveränitätslehre vorausweist. Mit Blick auf die Binder-Rezension interessiert vor allem die Positionierung zum Neukantianismus.
Wie in seiner Dissertation ignoriert Schmitt auch in der Habilitationsschrift den eigenen Ansatz einer philosophischen Ethik und betont die Eigenständigkeit des Rechts. In der letzten Fußnote Über Schuld und Schuldarten hieß es 1910 bereits dezidiert: „Die Frage nach der Schuld ist in jeder Hinsicht eine metajuristische.“ (SS 137). Schmitt klammerte sie vollständig aus und sprach stattdessen nur von der juristischen Konstruktion der „Schuldarten“. Im zweiten Kapitel vom Wert des Staates definiert er den Staat, kursiv hervorgehoben, nun folgendermaßen: „Der Staat ist demnach das Rechtsgebilde, dessen Sinn ausschließlich in der Aufgabe besteht, Recht zu verwirklichen“ (WdS 56). Schmitt schließt eine äußert knappe „Auseinandersetzung mit der Rechtslehre Kants und seiner Nachfolger“ (WdS 60) an, nennt Stammler, Natorp und Cohen, geht auf Cohen aber nicht erneut ein, weil er dessen Ethik des reinen Willens bereits einleitend als ethische Verkennung der Rechtswissenschaft abgelehnt hatte. Schmitt meint, dass Kant Recht und Moral nicht konsequent genug getrennt habe, weil er den „Rechtszwang“ ethisch begründen wollte. Auch Kants Nachfolger hätten „Autonomie und Heteronomie“ miteinander vermengt. Stammlers Theorie der Rechtswissenschaft habe immerhin das Problem gesehen, dass Kant Recht und Sittlichkeit nicht überzeugend voneinander trennte und verband; Natorp habe das Problem dann zu lösen versucht, das Cohen ignorierte.
Schmitts knappe Skizze ist argumentativ schwer zu beurteilen, zumal die genannten Autoren – Kant, Stammler, Natorp, Cohen – ihrerseits höchst komplex und anspruchsvoll argumentieren. Die Ausführungen lassen aber erkennen, dass Schmitt eine Grundfrage der neukantianischen Rechtsphilosophie problemgeschichtlich skizziert und seine eigene Antwort nicht innerhalb des Neukantianismus sucht, sondern eher auf kirchenrechtliche Lösungen zu verweisen scheint. Dieser Rückgang hinter die rechtsphilosophische Diskussion auf das Kirchenrecht muss nicht als konfessionelles Credo betrachtet werden. Man könnte ihn im Rahmen des südwestdeutschen Neukantianismus auch als kulturphilosophischen Rückgang auf faktische (kirchenrechtliche) Formationen betrachten und mit einigen Überschwang etwa auf Max Webers „verstehende“ Religionssoziologie verweisen: Wo Webers berühmte „Zwischenbetrachtung“10 die Religionssoziologie in eine „Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung“ kondensierte, erörtert Schmitt fast gleichzeitig eine positive konfessionelle „Bewertung“ des Machts als Recht und die damit – vorbehaltlich – gegebene Anerkennung des Staates. Hier muss genügen, dass er die zeitgenössische rechtsphilosophische Ausgangsstellung und Aufgabe insbesondere mit Stammler verband, mit dem er sich früher schon in nachgelassenen Aufzeichnungen (TB 1912/15, 73ff) auseinandergesetzt hatte.
3. Schmitts Binder-Kritik
Kommen wir damit zur Binder-Rezension von 1916. Es lag damals akademisch nahe, dass der junge Autor des Werts des Staates sich für eine grundlegende Monographie über die „Rechtsidee“ interessierte und sich zu Stammler und Binder positionieren wollte. Der allgemeine philosophiegeschichtliche Rahmen ist der angedeutete Übergang vom „Neukantianismus“ zum „Neuhegelianismus“. Larenz, als Binder-Schüler einer der Erben dieser Debatte, skizzierte ihn rückblickend in seiner Methodenlehre der Rechtswissenschaft folgendermaßen:
„Die Erneuerung der deutschen Rechtsphilosophie zu Beginn unseres Jahrhunderts ist in erster Linie das Werk Rudolf Stammlers. Durch ihn wurde eine rechtsphilosophische Bewegung eingeleitet, die, so vielfältig und verschlungen ihre Wege im einzelnen auch sind, im ganzen durch die Abkehr vom Positivismus gekennzeichnet ist. Die Abkehr vom Positivismus verband sie durchweg mit der Bejahung der Geschichtlichkeit des Rechts; so strebte sie einer Synthese der beiden großen Geistesströmungen: des ‚Naturrechts‘ und des ‚Historismus‘, zu. Etwa zu Beginn der zwanziger Jahre hatte die vom Neukantianismus ausgehende Bewegung – mit ersten Werken, mit Lask, Radbruch, Max Ernst Mayer, mit Emge, Laun u.a. – ihren Höhepunkt erreicht; Sie setzte sich teilweise im Neuhegelianismus (Binder, Schönfeld, Dulckeit) fort.“11
Stammler wie Binder sind heute als Autoren kaum noch bekannt. Während Stammlers Name wissenschaftsgeschichtlich fast nur noch in der Weber-Forschung fortlebt, durch den Vernichtungsschlag, den Weber12 gegen Stammlers „‚Überwindung‘ der materialistische[n] Geschichtsauffassung“ führte, diskredierte sich der juristische Rechtshegelianismus der Binder-Schule durch seine Apologie des Nationalsozialismus selbst. Wie Larenz andeutet, ist die rechtsphilosophische Diskussionslage vor und nach 1918 durch die Namen Stammler und Binder und die Aufgabe einer „Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie“ zwar nicht hinreichend bezeichnet. So wäre bspw. auch auf die sog. „Lebensphilosophie“ nach Dilthey und Nietzsche sowie die stärker „katholisch“ geprägte Rechtsphänomenologie zu verweisen. Wichtig ist aber, dass Schmitt sich mit seinem Frühwerk und seinen akademischen Qualifikationsschriften in dieser Diskussionslage verortete.
Seine Binder-Besprechung steht in einer Reihe kleinerer Rezensionen und Miszellen, in denen Schmitt sich mit zeitgenössischen Autoren auseinandersetzte. Die Erträge gehen in die frühen Monographien ein. Neben Miszellen zu Schopenhauer und Wagner sind hier vor allem Rezensionen zu Fritz Mauthner (1849–1923) und Walther Rathenau (1867–1922), Hans Vaihinger (1852–1933) und eben Binder (1870–1939) zu nennen. Vaihinger, der Begründer der Kant-Studien, Autor einer frühen Nietzsche-Studie, lehrte lange in Halle, wo auch Stammler in der Rechtswissenschaft wirkte. Seine Philosophie des Als-Ob modernisierte Kant mit Nietzsche.13 Schmitts frühe Vaihinger-Rezeption ist bleibend wichtig, was von der Forschung vielfach bemerkt wurde, wogegen die Mauthner-Rezeption und die Binder-Kritik bislang fast keinerlei Beachtung fanden. Die Mauthner-Rezension14 zeigt Schmitts frühes Interesse an Sprachkritik und Begriffsgeschichte, das in der Dissertation bereits im Untertitel als „terminologische Untersuchung“ anklingt. Die längere Binder-Rezension argumentiert stärker philosophisch und steht im engen Zusammenhang mit der Habilitationsschrift. Fragte Der Wert des Staates nach der neukantianischen Antwort über Stammler hinaus, so fragt die Binder-Rezension, ob es Binder gelungen sei, den neukantischen „Rechtsbegriff“ durch eine andere transzendentale Auslegung der „Rechtsidee“ zu überbieten.
Binder, deutlich jünger als Stammler (1856–1938), lehrte damals in Würzburg und wechselte 1919 nach Göttingen, wo er schulbildend wirkte. Sein offenes Bekenntnis zum Neuhegelianismus wird meist erst mit der Göttinger Zeit und der Philosophie des Rechts verbunden. Im Vorwort von Rechtsbegriff und Rechtsidee deutet Binder politische Motive an, wenn er von der „Erhebung des deutschen Volkes“ spricht: „Ist es nicht Hegels metaphysischer Geschichtsidealismus, nach dem unser die großen Ereignisse des Jahres 1914 erlebendes Gemüt verlangt, um den Sinn dieses Erlebens zu verstehen“?15 Schon 1915 klingt ein scharfer Nationalismus an, der Binder nach 1918 zur Ablehnung von Versailles16 wie der Weimarer Republik, später zur emphatischen Bejahung des Nationalsozialismus17 führen wird. Für die philosophische Grundlegung beruft sich Binder 1915 dennoch auf Kant. Wie Stammler ist er allerdings der Auffassung, dass Kant Sein und Sollen nicht strikt genug getrennt habe und „bei aller grundsätzlichen Gegnerschaft gegen das Naturrecht im Grunde doch in denselben Fehler wie dieses verfallen ist, nämlich das Seiende mit dem Seinsollenden zu identifizieren.“18
Schmitt liest Rechtsbegriff und Rechtsidee nun nicht als Übergang zum Neuhegelianismus, sondern als Rückfall in den Positivismus. Binders umfangreiches Werk heißt im Untertitel: Bemerkungen zur Rechtsphilosophie Rudolf Stammlers. Binders Analyse geht Stammlers Werk spröde, kleinteilig und ermüdend durch und entwickelt noch keine alternative Rechtsphilosophie. Es ist hier nicht zu erörtern, ob Schmitt Binders Werk angemessen dargestellt und kritisiert hat. Seine Rezension liest sich wie eine Replik auf Binders Stammler-Kritik. Schmitt verteidigt Stammler aber nicht eingehend gegen Binder, sondern interessiert sich schon früh, Jahre vor Binders Systematisierung seiner Rechtsphilosophie, mehr für dessen Anspruch auf idealistische Revision und Überbietung des neukantianischen Rahmens durch eine neue „Rechtsidee“; Schmitt fragt danach, ob Binder über Stammler hinausgelangt oder nicht vielmehr hinter dessen Transzendentalismus zurückgefallen sei. Es ließe sich dafür Webers höhnische Wendung von „Stammlers ‚Überwindung‘ der materialistischen Geschichtsauffassung“ adaptieren: Schmitt polemisiert gegen Binders idealistische „Überwindung“ von Stammlers Rechtsbegriff.
Binder bekennt sich 1915 noch zur Transzendentalphilosophie und nicht zur „Hegelschen Rechtsmetaphysik“ (SS 174). Schmitt führt aus, dass Binder zutreffend kritisiert, dass Stammlers Rechtsbegriff nur ein „System abstrakter Rechtsbegriffe“ und keine „reinen“ bzw. „transzendentalen“ Kategorien erfasst habe; er selbst hatte die rechtsphilosophische Aufgabe im Wert des Staatesähnlich beschrieben und zwischen „transzendentaler“ Rechtsphilosophie und „allgemeiner“ Rechtslehre (analytischer Rechtstheorie) strikt unterschieden. Als Zwischenergebnis formuliert Schmitt:
„Nach dem Ergebnis von Binders Kritik ist demnach selbst dem heißen Bemühen eines Gelehrten wie Stammler das mit den tauglichsten Mitteln begonnene Unternehmen einer reinen Rechtslehre misslungen. So wächst die Erwartung, auf welche Weise wohl Binder selbst den schmalen Weg des Transzendentalismus einschlagen wird, ohne von ihm nach der Seite einer transzendenten Metaphysik oder nach der eines empirischen Positivismus abzuweichen.“ (SS 176)
Der Leser ahnt bereits, dass Schmitt zu einem negativen Befund gelangen wird. Er führt ätzend aus, dass Binder hinter Stammlers Autonomisierung des Rechtssystems zurückgefallen sei, weil seine Überhöhung des Rechtsbegriffs durch eine apriorische „Rechtsidee“ – man ist versucht, von „Grundnorm“ zu sprechen – gänzlich bedeutungslos bleibe und den Normativismus faktisch in das Stadium des Positivismus zurückwerfe, der die Differenz von Macht und Recht kassiert. Schmitt schreibt: „Binder zieht die Positivität im faktischen Sinne in den Begriff des Rechts.“ Seine „Rechtsidee“ füge Stammlers „Rechtsbegriff“ nichts hinzu, bleibe ein „leeres Wort“ ohne „praktische Bedeutung“ (SS 179); Binder erkläre die apriorische Norm zur „Funktion des Bewusstseins, durch die wir gewisse Bewusstseinsinhalte als rechtliche erkennen“ (SS 177), und liefere keine Kriterien für die normative Bewertung, sodass im Ergebnis nichts anderes als die faktische Anerkennung des gegebenen Rechts bleibe. Das zeigt Schmitt im zweiten Schritt für Binders Verhältnisbestimmung von „Recht und Ethik“, die die sittliche Persönlichkeit mit ihrer positivrechtlichen Umschreibung gleichsetze. Im Ergebnis spricht Schmitt von einer unkritischen „Abkehr von dem Kantischen Prinzip“ und vom „Vorbau einer positivistischen Rechtslehre“.
Schmitt verwirft also Binders „Rechtsidee“ insgesamt und betrachtet das ganze Werk als Rückfall in den Positivismus. Er erörtert das insbesondere an zwei Aspekten: am psychologistisch-intuitionistischen Fehlschluss, die Anerkennung von Rechtsnormen für „apriorisch“ zu halten, sowie an der Absorption jedes ethischen Verständnisses von Personalität durch das positive Recht. Beide Aspekte waren schon für die Habilitationsschrift zentral. Dort attestierte Schmitt der neukantianischen Debatte eine mangelnde Klärung des Verhältnisses von Recht und Ethik, und er deutete die positive „Bewertung“ des Rechtssystems und damit gegebene Unterscheidung von Macht und Recht als ein soziologisches und religionsphänomenologisches Faktum.
Während Schmitt eine eigene philosophische Grundlegung der Ethik jenseits des Rechtsdenkens niemals unternahm, ist seine Ablehnung von Binders Kurzschluss von Rechtsbejahung auf Apriorismus vielleicht schon deshalb so vehement, weil seiner eigenen Antwort, mit dem Verweis auf die Antworten des Kirchenrechts, ihrerseits ein Odium des Soziologismus und Psychologismus anhaftete. Das zeigt sich im Wert des Staates schon in der hegelianisierende Rede vom Umschlag von „Quantität in die Qualität“, von der Quantität als „Symbol oder Indiz einer Qualität“ (WdS 35): gemeint ist das soziologische Faktum einer Anerkennung des Rechtssystems durch die Unterworfenen. Dass Schmitt diese Anerkennung voraussetzt und religionsphänomenologisch verklärt, ließe sich als Kniefall vor der Macht und Sakralisierung von „Autorität“ deuten: als Forderung eines „autoritären Charakters“ und Konstruktion des Bürgers als „Untertan“. Diese Legitimation von Herrschaft drapiert sich mit einem überkonfessionellen Begriff von Religiosität, wie er damals etwa von Rudolf Otto (1869–1937) mit der Rede vom „Numinosen“ entwickelt wurde.19 Schmitt ärgert es, dass Binder das „Apriorische“ naiv reklamiert und Rechtspositivismus mit Rechtsphilosophie verwechselt; er sieht Stammler wie Binder „auf dem schmalen Weg des Transzendentalismus“ scheitern, macht mit seinen eigenen Überlegungen aber selbst nicht ganz klar, wie er die Unterscheidung von Macht und Recht sichern und den Transzendentalismus gegen die Gebildeten unter seinen Beschwörern retten möchte. Sein phänomenologischer Hinweis auf die faktische Anerkennung verbleibt eigentlich seinerseits im Horizont der „Machttheorie“.
4. Positionierung zu KaufmannsKritik der neukantischen Rechtsphilosophie
An einer Stelle seiner Binder-Rezension deutet Schmitt an, dass Kelsen der naiven Verwechselung von Macht und Recht, Sein und Sollen entgangen sei. Schmitt lobt die „Konsequenz, mit der z.B. Kelsen die Jurisprudenz als normative Wissenschaft den soziologisch explikativen Wissenschaften gegenüberstellt“ (SS 178). Stammler wie Binder verwechselten ihren Rechtspositivismus dagegen mit transzendentaler Rechtsphilosophie. Schon früh sieht Schmitt also Kelsens Schritt vom Positivismus zum Normativismus als solchen, während er Jellinek als Ausgangspunkt nicht weiter erwähnt. Er nimmt die Theoriedynamik mit eigenem Impetus innovativ wahr und betrachtet Kelsen als Erben Jellineks. Kelsen legte das selbst nahe, obgleich er keinen persönlichen Zugang zu Jellinek fand.20 Für Schmitt lag eine Weiterführung seiner Kritik der neukantianischen Rechtslehre durch Auseinandersetzung mit Kelsen also akademisch schon früh nahe; 1922 knüpfte er in seiner Politischen Theologie auch explizit an Kelsen an. Dazwischen liegt aber das Erscheinen von Erich Kaufmanns (1880–1972) Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie von 1921, das für Schmitt schon deshalb wichtig war, weil er damals als Nachfolger Smends in Bonn Kaufmanns direkter Kollege wurde. Smend war mit Kaufmann seit Studientagen spannungsvoll befreundet; er betrieb Schmitts Berufung, die ohne Kaufmanns unterstützendes Plazet gewiss nicht erfolgt wäre. Kaufmann zitierte in seiner Kritik der neukantianischen Rechtslehre Schmitts Binder-Kritik zustimmend, nahm dessen verwandte Kritik zur Kenntnis. Für Schmitt lag es 1922 also akademisch nahe, seine Auseinandersetzung mit der neukantianischen Rechtslehre mit Kelsen weiterzuführen und sich hier zu Kaufmanns exponierter Kritik zu positionieren.
Die Schrift Politische Theologie wird heute selten in der Erstausgabe von 1922, mehr in der Ausgabe von 1934 gelesen, der alle neueren Ausgaben folgten. Es ist deshalb kaum bekannt, dass Schmitt 1933 seitenlange Ausführungen21 zu Kaufmann strich, mit dem er sich Mitte der 1920er Jahre verfeindet hatte. Schmitt tilgte alle früheren positiven Referenzen, aus persönlicher Feindschaft, Opportunismus und Kampf gegen „jüdischen“ Geist. Das ohnehin schwierige wissenschaftsgeschichtliche zweite Kapitel seiner Programmschrift wurde dadurch im Gedankengang fast unverständlich; es gewann seine Gliederung aber gerade durch seinen aktuellen Bezug auf Kaufmanns Kritik der neukantianischen Rechtslehre. Schmitt positionierte sich, gerade in Bonn angekommen, eingehend zu seinem Bonner Kollegen. Das Kapitel beginnt 1922, laut Inhaltsübersicht, mit neueren Schriften zur Staatslehre: „Kelsen, Krabbe, Wolzendorff, Erich Kaufmann“. Die Ausführungen zu Kaufmann, über drei Seiten lang, sind später dann vollständig gestrichen.
Kaufmanns 1921 erschienene Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie22 geht von einer Stammler- und Kelsen-Kritik aus und schlägt vehement auf den „Formalismus“ und „Positivismus“ von Stammler, Binder und anderen ein. Sie zitiert Schmitts Binder-Kritik zustimmend,23 klagt aber, anders als Schmitt, „Metaphysik“ ein und ruft gegen den Neukantianismus zum „wahren“ Kant zurück. Kaufmann grenzt sich scharf von Stammler, Kelsen und dessen Wirkungen ab, konzediert aber ähnlich wie Schmitt:
„Konnte nach alledem der südwestdeutsche Neukantianismus eine eigentliche Rechtsphilosophie nicht begründen, so konnte er auf der anderen Seite durch sein Einmünden in den Rechtspositivismus und seine Tendenz, philosophische Fragen in methodologische Fragen aufzulösen, die Methodenlehre der positiven Rechtswissenschaft fördern und anregen.“24
„Der metaphysikfreie Neukantianismus ist substanzloser Rationalismus“,25 meint Kaufmann; Kelsen habe als „Meister des Rechtsformalismus“ immerhin einige „Reinigungsarbeiten“ erledigt. Kaufmann macht den Neukantianismus für eine gegenwärtige „Krisis“ des „deutschen Geistes“ verantwortlich und meint am Ende:
„Aushöhlung und Entleerung alles Lebendigen ist das letzte Wort. Erkenntnistheorie ohne Wahrheitsbegriff, Psychologie ohne Seele, Rechtswissenschaft ohne Rechtsidee, formale Gesinnungsethik ohne Sittlichkeitsbegriff, Geisteswissenschaft ohne Gefühl für konkrete Geistigkeiten sind die Kinder der Zeit. Nirgends ein leerer Halt in den uferlosen Meeren der leeren Formen und der vom Denken nun einmal nicht auflösbaren empirischen Tatsächlichkeit. So wurde der Neukantianismus, ohne es selbst zu ahnen, das Gegenteil dessen, was er wollte: der unmittelbare Wegbereiter jener an sich selbst verzweifelnden Spengler-Stimmung, der jüngsten Erkrankung unserer, einer Metaphysik des Geistes beraubten Volksseele.“26
Es ist hilfreich, Kaufmanns Ton von 1921 zu hören, um Schmitts Krisis-Ton besser einzuordnen. Schmitts Schrift Politische Theologie beginnt im ersten Kapitel mit einer „Definition der Souveränität“ und schließt mit dem zweiten Kapitel eine akademische Auseinandersetzung mit neueren Staatslehren an, die die frühere Neukantianismus-Kritik weiterführt und eine idealtypische Kontrastierung von Normativismus und Dezisionismus skizziert. Im titelgebenden Kapitel „Politische Theologie“ ordnet Schmitt diese Alternativen dann in eine metaphysikgeschichtliche Skizze ein. Was zunächst als einfache Alternative erscheint, wird damit im „Übergang von Transzendenzvorstellungen zur Immanenz“ als geschichtliche Entwicklung fatal und prekär. Am Ende des zweiten Kapitels scheint Schmitt für seine „dezisionistische“ Souveränitätslehre eine starke Gegenposition zum Neukantianismus aufzubieten. Wo Kaufmann zu Kant zurückrief, geht Schmitt mit Hobbes aber auf ein älteres „Weltbild“ zurück, das eigentlich kaum zu vertreten sei. Im vierten und letzten Kapitel stellt er sich deshalb auch in die Reihen der „Gegenrevolution“. Dieser Rückgang hinter Kant auf Hobbes ist signifikant: Schmitt strebt bereits aus dem Mainstream heraus zu einem unzeitgemäßen Autor, mit dem er sich identifiziert.
Die Auseinandersetzung mit Kelsen und Kaufmann ist für die akademische Profilierung dieser überraschenden Volte, des Rückgangs hinter Kant auf Hobbes, wichtig. Während die – hier nicht näher zu analysierende – erste eingehende Auseinandersetzung mit Kelsen eine Fortsetzung der früheren Auseinandersetzung mit dem neukantianischen Transzendentalismus war, geht Schmitt mit Krabbe und Wolzendorff dabei auch auf die Genossenschaftstheorie zu, die er stets als „organischen“ Gegenspieler der mechanistisch-positivistischen Linie Labands betrachtete, die mit Kelsen endete. Schmitt stellt Krabbe und Wolzendorff in die Linie der Genossenschaftstheorie, die Gierke begründete und mit Preuß und Smend in Weimar triumphierte, weil sie die staatsbürgerliche Politisierung und Demokratisierung besser zu erfassen vermochte. Schmitts Ausführungen sind nicht leicht nachvollziehbar. Es sei nur erwähnt, dass Schmitt mit dem gerade verstorbenen Wolzendorff in engerer Korrespondenz stand27 und seine Ausführungen deshalb auch einen nekrologischen Nebenaspekt haben. Die Fassung von 1934 springt sehr plötzlich von Wolzendorff zu Max Weber, weil sie Kaufmann herausgekürzt und exorziert hatte. Nur von den Kaufmann-Ausführungen von 1922 her wird aber verständlich, dass Schmitt über Kaufmanns Kritik hinausgeht, indem er hinter Kant auf Hobbes zurückgeht. Dabei stellt er Kaufmanns Schlussfolgerungen korrekt dar; er fragt aber gegen Kaufmanns Konfrontation von „Form“ und „Leben“ leicht skeptisch und spöttisch:
„Ist das die goldene Mitte zwischen den beiden Extremen Formalismus und Nihilismus und nur eine Wiederholung jener alten Antithesen von lebendig und tot, organisch und mechanisch usw.? Kaufmann hat bisher eine Darstellung einer Lebens- oder Irrationalitätsphilosophie nicht gegeben.“28
Diese Formulierungen zeigen schon, dass Schmitt seine Wendung zur „Irrationalitätsphilosophie“, wie sie die Parlamentarismus-Broschüre ausführt, als weiterführende Antwort auf den Bonner Kollegen exponiert. Zuvor bemerkt er im ersten Kapitel seiner Programmschrift, dass auch Kaufmann, ähnlich wie Anschütz, „die extremen Fälle vom Recht ausschließen“29 wolle. Schmitts so akademisches, den Forschungsstand rekapitulierendes zweites Kapitel, „das Problem der Souveränität als Problem der Rechtsform und der Entscheidung“ übertitelt, hat seine Pointe aber in der Überbietung von Kaufmanns Kritik durch den Rückgang auf Hobbes. Wo Kaufmann einen Rückgang hinter den zeitgenössischen Neukantianismus auf Kant proklamierte, ruft Schmitt zu Hobbes zurück und stellt die „Gegenrevolution“ in dieses Erbe.
5. Transzendentale Souveränität?
Schmitt schließt 1922 also mit seiner Positionierung zu Kaufmann seine eigene Kritik der neukantianischen Rechts- und Staatslehre ab, die er in seiner Habilitationsschrift begonnen hatte und in der Binder-Besprechung weiterführte. Wo er vor 1918 diagnostizierte, dass der Neukantianismus auf dem „schmalen Weg des Transzendentalismus“ gestrandet sei und den Transzendentalismus an Positivismus und Methodologie verraten habe, scheint er der „Machttheorie“ nun selbst zu verfallen. Das zeigt sich insbesondere im phänomenologischen und anerkennungstheoretischen Hinweis auf die „religiöse“ „Bewertung“ faktischer Macht als Recht. Vielleicht suchte Schmitt mit seiner Souveränitätslehre eine eigene Variante des „Transzendentalismus“. Wiederholt habe ich seine Habilitationsschrift als „transzendentalpragmatische“ Grundlegung bezeichnet.30 Schmitt nannte eine „relativ dauernde und beständige Macht“, wie zitiert, ein „Symbol oder Indiz einer Qualität“ (WdS 35): nämlich des Rechts, und er berief sich dafür auf kirchenrechtliche Literatur. Beide Aspekte kehren in der Politischen Theologie wieder: Schmitt anerkennt 1922 nicht jede Macht als Recht, er erkennt nur derjenigen Macht eine Rechtsqualität zu, die den „Ausnahmezustand“ entscheidet, einen Normalzustand schafft und also Ordnung stiftet.
Wo Schmitt im Wert des Staates auf kirchenrechtliche Literatur verweist, skizziert er 1922 seine „begriffssoziologische“ These und Skizze vom Wandel des Weltbildes und „Übergang von Transzendenzvorstellungen zur Immanenz“. Vergleicht man diese Säkularisierungsthese – Schmitt spricht im Vorwort zur zweiten, revidierten Auflage, auf Webers „Zwischenbetrachtung“ anspielend, von Stufen eines „Säkularisierungsprozesses“ – etwa mit Wilhelm Diltheys „Weltanschauungslehre“ und „Philosophie der Philosophie“, so konstatiert Schmitt keine Pluralität konsequent möglicher Idealtypen, die zur alternativen Option stünden, sondern eine historische Abfolge. Was er im „Ausnahmezustand“ praktisch für nötig erachtet: die souveräne Entscheidung, historisiert er in den „metaphysischen“ Voraussetzungen. Damit formuliert er einen zwiespältigen Befund: Systematisch betont er, dass dezisionäre Entscheidungen einen starken Personalismus fordern, der auf „Transzendenzvorstellungen“ beruht und eigentlich nur in einem „theistischen“ Weltbild begründet und gehalten sei; säkularisierungsgeschichtlich konstatiert er aber, dass dieses Weltbild seit der Französischen Revolution mit dem Übergang zur Volkssouveränität und demokratischen „Immanenzvorstellungen“ hoffnungslos in die Defensive geraten sei und die „Gegenrevolution“ deshalb schon 1848 ihre „Legitimität“ verlor. Auch Schmitt konstatiert also, ähnlich wie Kaufmann, eine metaphysische „Krisis“. 1922 weist er Kaufmanns Ruf nach dem „Lebensgefühl“ und einer „Metaphysik des Geistes“ dennoch zurück. Die „Darstellung einer Lebens- oder Irrationalitätsphilosophie“, die er 1922 bei Kaufmann vermisst, wird er 1923 im Schlusskapitel seiner Broschüre Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus dann in Georges Sorels „Lehre vom Mythos“ finden, die Mussolini mit dem Marsch auf Rom gerade einem nationalistischen Praxisbeweis unterzog.
6. Rekapitulation
Schmitts Binder-Rezension von 1916 wurde hier als ein missing link in der Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie betrachtet, die 1914 mit dem Wert des Staates begann und mit der Politischen Theologie zu einem Abschluss gelangte. Der Neukantianismus beschränkte den erkenntnistheoretischen Grundansatz Kants stark auf Wissenschaftstheorie und Methodologie. Wie gelangte man philosophisch über ihn hinaus? Der philosophische Gegenwartsdiskurs antwortete mit einer Wendung zu Hegel31 oder (etwas später) einer erneuten Rückkehr zu Kant und zu strikter Kant-Philologie (Julius Ebbinghaus u.a.). Die juristische Rezeption folgte mit Binder und Larenz der Wendung zu Hegel und entwickelte einen stark politisierten Rechtshegelianismus, der sich dem Nationalsozialismus empfahl. Schmitt dagegen prüfte seine schwache transzendentalpragmatische Auslegung der Rechtsidee (aus dem Wert des Staates) vergleichend und lehnte Binders Auslegung ab. Mit der Politischen Theologie nahm er 1922 dann seinen Abschied vom Neukantianismus, indem er seine schwach-transzendentale Auslegung der „Rechtsidee“ als Souveränitätslehre explizierte und sich vom Bonner Kollegen Erich Kaufmann absetzte, indem er seinen Referenzkanon umstellte: Wo Kaufmann einen Rückgang auf Kant, „Leben“ und „Metaphysik“ gegen den Neukantianismus (und namentlich auch Kelsen) setzte, proklamierte Schmitt einen souveränitätstheoretischen und „gegenrevolutionären“ Rückgang auf Thomas Hobbes und Donoso Cortés. Seine schwache Lesart der Rechtsidee hatte 1914 vor allem besagt: Der Staat muss sich als „Diener des Rechts“ darstellen und die Differenz von Macht und Recht konstitutionalisieren, indem er sie für sich reklamiert und behauptet. Mit seiner Souveränitätslehre betont Schmitt 1922 nun die konstitutive Ordnungsleistung des Souveräns als Koinzidenzfall von Macht und Recht: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet; das heißt auch: Wenn die Machtbehauptung Gehorsam findet, ist sie im Recht; sie setzt dann die Differenz von Macht und Recht als Ordnungsund Friedensfunktion.
Mit dieser Auslegung der „Rechtsidee“ als Souveränitätslehre war Schmitts Bedarf an rechtsphilosophischer Fundamentierung gleichsam erschöpft. Er sprach nicht weiter im Namen der Rechtsphilosophie, entsagte jeder naturrechtlichen Philosophie, kritisierte philosophische Grundlegungen als Rechtfertigungsideologien und Bürgerkriegsparolen und sprach stattdessen nur noch von Legalität und „Legitimität“. Seine Lage als Jurist situierte er stets „zwischen Theologie und Technik“. Der Theologie billigte er dabei immerhin zu, im Namen der „Offenbarung“ die diskursive Zugänglichkeit letzter Fragen zu tabuisieren und die philosophische Kritik zu suspendieren. Zwar rekurrierte Schmitt auf den „Dezisionismus“ von Thomas Hobbes, wo Kaufmann Kant gegen den zeitgenössischen Neukantianismus ausgespielt hatte. Den philosophisch-naturrechtlichen Ansatz von Hobbes ignorierte er aber stets. Sein Leviathan-Buch interessierte sich 1938 nur noch für den Mythenpolitiker. Philosophisch neigte Schmitt zwar in mancher Hinsicht Hegel zu; niemals äußerte er sich darüber aber eingehender. Seine Reserve gegenüber dem zeitgenössischen Neuhegelianismus war nicht zuletzt politisch motiviert: nicht nur gegenüber dem Links-Hegelianismus (Lukács), sondern auch gegenüber einem politisierenden Rechts-Hegelianismus, der dem Nationalsozialismus nach 1933 eine Philosophie schenken wollte und so, in anderer Weise als Heidegger, den Traum vom Philosophenkönigtum träumte, den „Führer“ zu führen. Schmitts Entscheidung gegen starke philosophisch-naturrechtliche Legitimierungen der herrschenden Legalität stand eigentlich schon 1922 fest; die Entwicklung des Links- wie Rechtshegelianismus vor und nach 1933 bestätigte ihn dann in seiner Reserve gegenüber starken rechtsphilosophischen Fundamentierungsansprüchen.
Mit der Binder-Rezension markiert Schmitt 1916 bereits seinen Auszug aus der Rechts- und Staatsphilosophie. Seine Transformation der “Rechtsidee“ in die Souveränitätslehre ist im scharfen Rückgang hinter Kant auf Hobbes nur dann deutlich zu sehen, wenn die Erstausgabe der Politische Theologie von der späteren Fassung von 1934 unterschieden wird, die alle Verweise auf Kaufmann gestrichen hat. Schmitt positionierte sich 1922, gerade in Bonn angekommen, zu Kaufmanns Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie, indem er dessen Rückruf zu Kant mit einem Rückruf zu Hobbes konterte. Eine starke Rechtsphilosophie hat er nie zu schreiben beabsichtigt. Er verblieb aber auf dem Boden der zeitgenössischen Lebensphilosophie und Weltanschauungslehre, indem er metaphysikgeschichtliche Voraussetzungen seines starken Dezisionismus und Personalismus problematisierte und historisierte. Schmitt bezog einen verlorenen Posten und sah sich nach seiner Politischen Theologie fortan als unzeitgemäßer Autor und Außenseiter an. Es ließe sich also von einer doppelten Transformation des Transzendentalismus sprechen: Einerseits schrieb Schmitt den Transzendentalismus in das historische Apriori einer Weltanschauungslehre um und andererseits hoffte er doch auf die Selbstbehauptung des Staates in der Setzung der Differenz von Macht und Recht, im außerordentlichen Notrecht des „Ausnahmezustandes“.
II.Offene Anfänge? Carl Schmitts frühe Option für die Gegenrevolution
1. Zwischenkriegszeit
Die Weimarer Republik war der Bundesrepublik niemals nur Geschichte, sondern stets auch eine Mahnung, Lehrstück und Modell. In der Vergangenheitspolitik der alten Bundesrepublik diente „Weimar“ dabei meist als negatives Vorbild. Bonn war nicht Weimar, die Bundesrepublik sollte „Weimarer Verhältnisse“ tunlichst meiden. Die alte Bonner Republik fürchtete die historische Parallele und grenzte sich vielfältig ab. In der Auseinandersetzung mit der Weimarer Verfassung suchte sie in „Widerspruch und Umkehrung“ ein „Gespenst“ zu bannen.32
Die junge Disziplin der „Zeitgeschichte“ begann in den 1950er Jahren mit dem „Untergang“ der Weimarer Republik und der – heute gerne auch als „Machtübergabe“ erörterten – „Machtergreifung“ des Nationalsozialismus. Der Blick auf den Untergang Weimars konzentrierte sich dabei auf das politische System und „Strukturprobleme“ der Verfassung. Karl Dietrich Bracher33 steht – nach althistorischen Anfängen – mit seinen Maßstäbe setzenden Monographien für diese Agenda zeitgeschichtlicher Forschung. Bracher schritt vom Untergang Weimars und den „Stufen der Machtergreifung“ zur Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Diktatur, totalitären Erfahrung und Zeit der Ideologien. Kurt Sontheimer34