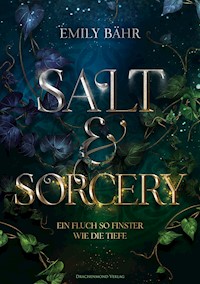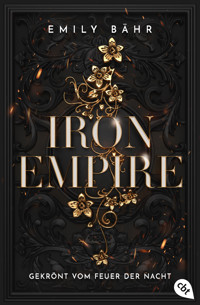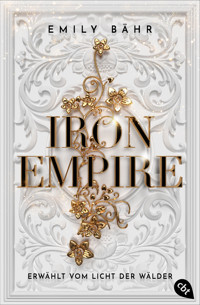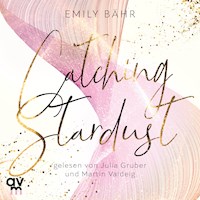
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Queen's University
- Sprache: Deutsch
Man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. »Steckst du Menschen gerne in Schubladen?« »Keine Schubladen. Eher so … bunte Aufkleber, die ich den Leuten aufdrücke. Auf die Art weiß ich wenigstens, worauf ich mich einlasse.« »Sicher, dass du dich hierauf einlassen willst?« Schmerz. Verlust. Depression. Als Ruth an die Uni in Belfast zurückkehrt, will sie genau das hinter sich lassen – ein Neuanfang, nachdem sie vor einem Jahr ihren besten Freund bei einem Unfall verloren hat. Womit sie nicht rechnet, ist Dominic, der nerdige, sarkastisch veranlagte Einzelgänger, der plötzlich immer wieder in ihrem Leben auftaucht und es so tatsächlich schafft, sie allmählich aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. Schnell wird klar, dass die Anziehung zwischen den beiden größer ist, als sie zugeben wollen. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht einfach verdrängen und Ruth merkt bald, dass sie nicht die einzige ist, die mit ihren Dämonen zu kämpfen hat… Catching Stardust ist Band 1 der Queen's-University Reihe. Band 2 Counting Rainbows erscheint im Oktober 2022.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Catching Stardust
Die Autorin
Zwischen Narnia und Westeros lebt EMILY BÄHR im magischen Nordirland, wo sie als Grafikdesignerin den Lebensunterhalt für sich und ihre Katzen verdient. Als bekennender Nerd liebt sie Science-Fiction, Rollenspiele, Kinobesuche und ihren Debattierclub und würde bei der ersten Gelegenheit auf den Mars auswandern. Da dies allerdings unwahrscheinlich ist, flüchtet sie sich in die magievollen, futuristischen oder romantischen Weltenin ihrem Kopf, während sie im Schutz der Nacht Wikipedia nach unnützem Wissen durchforstet.
Das Buch
Man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat.
Schmerz, Verlust. Depression. Als Ruth an die Uni in Belfast zurückkehrt, will sie genau das hinter sich lassen – ein Neuanfang, nachdem sie vor einem Jahr ihren besten Freund bei einem Unfall verloren hat. Womit sie nicht rechnet, ist Dominic, der nerdige, sarkastisch veranlagte Einzelgänger, der plötzlich immer wieder in ihrem Leben auftaucht und es so tatsächlich schafft, sie allmählich aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. Schnell wird klar, dass die Anziehung zwischen den beiden größer ist, als sie zugeben wollen. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht einfach verdrängen und Ruth merkt bald, dass sie nicht die einzige ist, die mit ihren Dämonen zu kämpfen hat…
Emily Bähr
Catching Stardust
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 1. Auflage März 2022 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com ISBN 978-3-95818-628-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Black
Steel Blue
Mint
Deep Navy
Vermilion
Olive
Crimson
Celadon
Amaranth
Slate
Unicorn Skin
Juniper
Aegean
Mulberry
Magenta
Galaxy
Marigold
Mauve
Graphite
Cerulean
Pearl
Caramel
Ash
Coral
Pine
Smoke
Sea Foam
Spruce
Indigo
Holographic
Flint
Ember
Fire
Epilog – CMYK
Content Note (Achtung Spoiler!)
Nachwort
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Black
Für Jordan.
Content Note
Liebe Lesende,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deswegen findet ihr auf Seite 363 eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte.
Wir möchten, dass ihr das bestmögliche Leseerlebnis habt.
Eure Emily Bähr und das Forever-Team
Black
Ruth
Wir sind nichts als Sternenstaub, der versucht, seinen Weg zurück ins All zu finden.
Mein Kopf ist ein wildes Tier, das sich verzweifelt im Kreis zu winden scheint, während der Satz immer wieder durch die Leere darin hallt. Ein Endlosecho im tiefen Schwarz meiner Gedanken.
Hilflos, verloren und kaputt sehe ich dabei zu, wie der Sarg geräuschlos in die Tiefe gleitet, während im Hintergrund eine generische Klaviermelodie vor sich hin dudelt, weil niemand von uns darauf vorbereitet gewesen ist, ein passendes Stück für die Beerdigung zu suchen. Niemand ist je darauf vorbereitet, jemanden in Olivers Alter zu Grabe zu tragen.
Nach außen hin wirke ich vermutlich gefasst, doch der Sturm in meinem Kopf weitet sich mit jeder Sekunde mehr zu einem tödlichen Hurrikan aus, der meine ganze Existenz zu verschlucken droht. Jeder Funken Freude, jeder Tropfen Hoffnung, dass es eines Tages besser werden könnte, gehört nun der Vergangenheit an.
Und ich sitze hier und lasse zu, dass meine Mutter mich auf die Beine zieht, als der letzte Akkord verklingt. Wie aus weiter Ferne dringt ihre Stimme zu mir durch, doch ich kann nichts mehr hören. Ich klammere mich an den Stoff meines Kleids, ohne dass eine einzelne Träne aus meinen Augen entwischt. Noch immer haftet mein Blick auf dem Loch im Boden, in das der Sarg verschwunden ist. Als könnte der Aufzug jeden Moment wieder nach oben fahren und mir meinen besten Freund zurückgeben.
Aber das wird nicht passieren. Schon bald wird von ihm nichts weiter übrig sein als Asche und Staub. Wieder hinauf zu den Sternen, während ich allein auf der Erde zurückbleibe.
Allein mit nichts als mir selbst und der Erinnerung.
Steel Blue
Dominic, ein Jahr später
Existenz bedeutet Schmerz.
Vor allem, wenn das eigene Handy einen nach einer viel zu kurzen Nacht um vier Uhr morgens aus dem Bett klingelt. Ein Blick nach draußen, und ich wünsche mir, ich hätte nur dieses eine Mal in meinem Leben auf die Stimme der Vernunft gehört, zu einer menschlichen Uhrzeit schlafen zu gehen.
Mehr schlurfend als aufrecht quäle ich mich aus dem Bett, suche mir Boxershorts, Hose und Shirt zusammen und taste mich anschließend im Halbdunkel durchs Zimmer Richtung Tür. Ein schwacher oranger Schein fällt von der Straße herein. Selbst durchs geschlossene Fenster kann ich das ausgelassene Geschrei der Feierwütigen hören, die es aus unerfindlichen Gründen gar nicht erwarten können, dass nächste Woche das neue Semester beginnt. Innerlich wappne ich mich schon einmal dafür, gleich da rauszumüssen, bevor ich in den Flur schleiche.
Das Badezimmer finde ich beim ersten Versuch, den Lichtschalter beim dritten. Ich spritze mir eine Ladung kaltes Wasser ins Gesicht und trockne mich mit einem Handtuch ab, das künstlich nach Erdbeere riecht. Anschließend begebe ich mich zurück ins Zimmer. In einer Ecke finde ich meinen Mantel, in einer anderen meine Schuhe und mein Handy auf einem Amazon-Paket, das als provisorischer Nachttisch dient.
Studentenbude eben.
Ich beweise so viel Anstand, der schlafenden Schönheit im Bett zumindest einen letzten Blick zuzuwerfen, bevor ich schon wieder aus ihrem Leben verschwinde. Sunny ist neunzehn und fängt dieses Jahr in Belfast mit dem Studium an. Schauspiel. Sie ist vor ein paar Tagen von Manchester hierhergezogen und vertreibt sich die Einsamkeit in der neuen Stadt mit Tinder.
Das ist auch schon alles, was ich über sie weiß – mehr, als ich überhaupt wissen muss.
Löschen, befehle ich meinem Kopf, als wäre ich ein Computer, und schließe danach leise die Zimmertür hinter mir. Meine müden Knochen verfluchen mich für meinen nächtlichen Ausflug in die Welt der Matches – mein Selbstwertgefühl freut sich dagegen über den anerkennenden Schulterklopfer nach dem erfolgreichen Date.
Kurz darauf trete ich auch schon in die morgendliche Dunkelheit. Noch immer höre ich irgendwo in der Ferne ein paar Nachtschwärmer brüllen, aber hier in den Holylands ist das um diese Zeit keine Überraschung. Es ist die Woche vor der Freshers’ Week, viele kommen gerade aus den Semesterferien zurück. Und während sie die lang ersehnte Wiedervereinigung mit ihren Besties feiern, mache ich mich völlig übermüdet auf den Weg zur Frühschicht im Supermarkt.
Glücklicherweise sind es nicht mehr als fünf Gehminuten von Sunnys WG. Ich laufe zum Ende der Straße, biege einmal um die Ecke, und schon bin ich auf der Botanic Avenue. Selbst mitten in der Nacht schreien die auf Hochglanz polierten Schilder der Coffeeshops, Buchläden und Restaurants förmlich »Hipster«. Hier gibt es alles von Falafel über Tacos bis hin zu einem ausgefallenen Laden namens Build A Burger – selbstverständlich zu gewaschenen Preisen, die sich kein Student ohne Sugardaddy leisten kann. Da ich so jemanden allerdings nicht habe – sehr wohl aber verdient hätte, rein aus Prinzip –, schaue ich gar nicht so genau hin, um ja nicht daran zu denken, was ich mir denn mal gönnen sollte, wenn ich könnte.
Ein Seufzen entgleitet mir, unter das sich ein lang gezogenes Gähnen mischt, als ich endlich vor den Türen des Spar-Marktes ankomme, der – den Studenten sei Dank – jetzt auch vierundzwanzig Stunden geöffnet hat. Denn natürlich können diese armen Geschöpfe keine einzige Stunde ohne die Möglichkeit leben, ihren Vorrat an Energydrinks aufzustocken.
Ich nehme mich da nicht aus.
In der Glastür betrachte ich das Spiegelbild meines völlig übermüdeten Selbst, bevor ich mich in die ganzjährig klimatisierte Hölle, die sich Supermarkt nennt, hineinwage. Sofort schlägt mir ein eisiger Wind entgegen, und hinter der Kasse zu meiner Linken grinst mir die Gottesanbeterin bereits motiviert und hilfsbereit entgegen. Eigentlich heißt er Sebastian … oder Stanley … aber seine speichelleckerische Art, sein schlaksiger Körperbau sowie seine viel zu aufrechte Haltung haben ihm diesen Spitznamen eingebracht. Er nickt mir zu und zeigt mir ein Lächeln, das seine klaviertastenartigen Zähne entblößt. Ein Schauer läuft mir über den Rücken.
Bei seinem Anblick weiß ich sofort, dass etwas im Busch ist.
»Morgen«, knurre ich ihm knapp entgegen und folge seinem Wink, zu ihm zu kommen, statt mich in die Umkleidekabine zu verkriechen.
»Guten Morgen, Dominic.« Falls es mit der Karriere als Supermarktmanager nicht klappt, würde er einen guten Willy Wonka abgeben. »Alles klar?«
Ich nicke, und erst dann bin ich nah genug an die Kasse herangetreten, um zu sehen, dass er heute nicht allein ist. Er hat eine neue Mitarbeiterin neben sich, die anscheinend genauso glücklich über ihre Anwesenheit hier ist wie ich.Als sich unsere Blicke begegnen, schaut sie mich an, als wollte sie mich entweder für meine bloße Existenz erwürgen oder am liebsten aus dem Raum stürmen. Schwer einzuschätzen, und alles, was mir dazu einfällt, ist: Na toll.
Skeptisch mustere ich das Mädchen, das im Vergleich zu mir so klein ist, dass ich sie genauso gut als Rucksack nehmen könnte.
»Das ist Ruth«, erklärt die Gottesanbeterin. »Sie fängt heute bei uns an. Ruth, das ist Dominic. Er studiert auch an der Queen’s.«
Auch. Wie sie also. Diese Info, ihre Körpergröße, aber vor allem der grässliche Haarschnitt, der einen Vibe von Topf und Bastelschere verströmt und dabei die Farbe von Zuckerwatte hat, wollen nicht so recht zusammenpassen. Sie sieht aus wie sechzehn! Aus großen grauen Augen betrachtet mich diese Ruth für einige Sekunden. Dann nickt sie mir zu.
Aha, eine Begrüßung.
»Na, wie geht’s?«, frage ich sie und erhalte nur ein weiteres Nicken.
Neben mir räuspert sich die Gottesanbeterin, ein Lächeln auf den Lippen, das die Unbehaglichkeit der Situation genau widerspiegelt, bevor er sich an meine neue Kollegin wendet.
»Dominic hilft dir heute, dich zurechtzufinden, und erklärt dir den Job.«
Erneut hebt sie den Kopf und senkt ihn wieder.
Und die Leute halten mich für schweigsam.
»Na, dann ist ja alles paletti, was?« Das Schulterklopfen der Gottesanbeterin trifft mich so unvorbereitet, dass meine Nackenhaare sich aufstellen. »Geh dich umziehen, und dann fangt ihr mit den Regalen an.«
»Okay.«
Ich werfe einen letzten Blick auf meine neue Kollegin und bleibe ein wenig zu lange an ihrem puppenartigen Gesicht hängen, aus dem sie mich immer noch passiv anstarrt. In ihren Augen kann ich nicht viel lesen, aber wenn ich ehrlich bin, war ich noch nie ein Empathiesternchen, sondern eher eine taktlose Dampfwalze.
Meine Schicht beginnt offiziell um fünf, also hätte ich noch ein paar Minuten, um vor meinem Spind zu sitzen und mal wieder meinen Lebensweg infrage zu stellen, bevor ich den Tag beginne, aber ich fühle mich mies bei dem Gedanken. Daher werfe ich lediglich einen kurzen Blick aufs Handy, nur um festzustellen, dass um diese Zeit (und generell) kein Schwein etwas von mir will, bevor ich mich auf den Weg zurück in den Verkaufsraum mache. Scheinheilig motiviertes Lächeln inklusive.
Weit komme ich nicht, denn mein neuer Lehrling erwartet mich direkt vor der Tür der Umkleide. In der Enge des Ganges stehe ich zum ersten Mal direkt vor ihr, und mir wird umso bewusster, wie klein sie tatsächlich ist. In dem Poloshirt, das zur Uniform gehört, versinkt sie förmlich.
»Rosie …«, beginne ich vorsichtig, während ich noch versuche, mich zu entscheiden, ob ihr Gesicht mir gefällt oder doch eher Angst einjagt.
»Ruth.«
Sag ich ja.
»Du sprichst also?«
Ich kann mir den Kommentar nicht verkneifen, woraufhin ich prompt einen strengen Blick von ihr ernte. Doch zu meiner Überraschung währt er nicht lange. Routiniert pustet sie sich den Pony aus ihren Augen, ehe sie schließlich nickt. Auf ihren Lippen liegt ein feines Zittern, das selbst mir nicht entgeht, und als sie wieder etwas sagt, klingt ihre Stimme so, als hätte sie sie seit Ewigkeiten nicht benutzt. Rau und leise, fast ein wenig zu tief.
»Manchmal.«
Soll das ein Scherz sein? Ich sehe ihr in die Augen, aber auch dort steht die Antwort auf meine unausgesprochene Frage nicht geschrieben.
»Ah«, sage ich vorsichtig und ziehe meine Mundwinkel nach oben, sodass ich meine Gesichtsmuskulatur beinahe quietschen hören kann. »Dann komm mal mit.«
Während ich sie kurz durch den hinteren Bereich führe, ihr das Lager zeige und den Wareneingang erkläre, merke ich schon bald, dass das »Manchmal« sehr wohl genauso gemeint war. Kaum ein Mucks kommt über ihre Lippen, obwohl ich den großen Entertainer spiele und zumindest für den Moment versuche, nicht den misanthropischen Soziopathen raushängen zu lassen. Erfolglos.
»Also … Ruth.« Als wir den ersten Wagen mit Ware für die Regale hinausschieben, gönne ich mir eine kurze anerkennende Kunstpause für mein sonst so schlechtes Namensgedächtnis. »Was verschlägt dich nach Belfast?«
»Uni.«
Natürlich. Ich bin nie gut in diesem Small-Talk-Ding gewesen, doch jetzt komme ich mir furchtbar unbeholfen vor. Aber noch viel unerträglicher als mein sinnfreies Gequatsche finde ich die drückende Stille, die entsteht, wenn ich es nicht tue.
»Und was studierst du?«
»Physik.«
Dieses Gespräch am Leben zu halten ist in etwa so frustrierend wie diese Mandalas zum Ausmalen, die es bei der WelcomeOrganisationgibt. Langwierige, minutiöse Fusselarbeit, die einen zu mehr Achtsamkeit bewegen soll. Am Ende hat man einen bunten Kreis mit Mustern drin, der einen weder geistig noch emotional erfüllt.
Ihre Antworten bleiben entweder einsilbig oder ganz aus, weshalb ich mich irgendwann darauf beschränke, ihr nur zu erklären, was sie zu tun hat, während wir die Regale eins nach dem anderen befüllen.
Eine monotone Arbeit, aber wenigstens stimmt die Bezahlung. Noch dazu kann ich meine Schichten so legen, dass sie nicht mit den Vorlesungen kollidieren.
Was Ruth hier macht, verstehe ich nicht ganz. Mit den Markensneakern und der Designerhandtasche, die ich im Pausenraum erspäht habe, wirkt sie nicht gerade wie jemand, der es nötig hat, sich morgens um sechs für knapp neun Pfund die Stunde die Hände schmutzig zu machen. Aber ich spare mir den sinnlosen Versuch, sie danach zu fragen.
Nach der Hälfte der Schicht bin ich so weit, ihr das gleiche Etikett zu geben wie Stonehenge oder Area 51: Ein Mysterium, aber ich kann glücklich damit leben, nie herauszufinden, was wirklich dahintersteckt.
Das ist übrigens auch der Moment, in dem sich die Gottesanbeterin wieder blicken lässt. Mit einem für diese Uhrzeit viel zu heiteren Lächeln klatscht er zweimal laut, um sich anzukündigen.
»Na, wie läuft’s?«
Ruth und ich werfen uns einen kurzen Blick zu, bevor wir überraschend synchron mit den Schultern zucken. Schließlich übernehme ich die Antwort für uns beide: »Ganz okay. Ruth lernt schnell.«
Die Gottesanbeterin nickt zufrieden und reibt sich geschäftig die Hände. »Großartig. Ist es okay, wenn ich sie für den Rest des Tages mitnehme?«
Nein, geht gar nicht, will ich schon antworten, bevor ich mich in letzter Sekunde daran erinnere, dass mein Manager keine Ironie versteht.
»Klar.«
»Dann komm mal mit, Ruth. Dominic, übernimmst du die Kasse?«
Mit einem letzten Blick zu mir und einem Nicken, das ich als Dank interpretiere, folgt sie ihm in Richtung Büro. Als ich ihr hinterhersehe, fällt mir vor allem ihr Gang auf, die Art, wie sie ihre Schritte so sehr mit Bedacht zu setzen scheint, dass nicht einmal ihr kurzes rosafarbenes Haar in Bewegung gerät.
»Seltsame Frau.« Eine Sekunde zu spät merke ich, dass ich das tatsächlich laut ausgesprochen habe, doch bis auf die Stimme des Ansagers von Cool FM bin ich sowieso völlig allein im Supermarkt. Ich schüttele den Kopf und verwerfe die Gedanken an Ruth genauso schnell, wie sie gekommen sind. Eine seltsame Frau, ja, doch wer einmal einen Fuß auf einen Universitätscampus gesetzt hat, weiß, dass es dort noch ganz andere Gestalten gibt.
Als ich am frühen Nachmittag in die Medway Street einbiege, fühle ich mich wie gerädert. Die Schicht im Spar hat meineEnergiereserven bis auf ein Minimum aufgebraucht, und der Weg nach Hause gibt mir jetzt den Rest. Noch dazu regnet es – Überraschung! Am Horizont setzen sich die quietschgelben Kräne der Werft von den grauen Wolken ab, während der Lärm der anliegenden A2 das Einzige ist, was mich davon abhält, noch im Gehen einzuschlafen.
Ich mache einen großen Schritt über eine Pfütze und komme vor einem barackenartigen Backsteinkomplex an, dessen einst rote Mauern inzwischen mehr ins Graubraun übergehen. Mein Zuhause – oder zumindest ein Ort, an dem ich umsonst wohnen kann, bis ich das Studium hinter mich gebracht habe.
Drei Jahre noch, rufe ich mir in den Kopf und sauge den Duft von Regen und Industrie ein, der hier in East Belfast Dauergast ist. Darunter mischt sich Essensgeruch, der umso intensiver wird, als ich das Haus betrete. Vom gefliesten Flur zweigen zwei Wohnungen ab, eine Treppe führt ins Obergeschoss. Hinter einer Tür kann ich deutlich das Rauschen der Dunstabzugshaube hören. Ich atme noch einmal ein – Bratkartoffeln.
Für eine Sekunde zögere ich, in mein eigenes Apartment zu gehen, und spiele mit dem Gedanken, Gill einen Besuch abzustatten, um etwas Essbares abzustauben. Gill ist die Dame, die mir ihre zweite Wohnung zur Verfügung stellt, ohne etwas dafür zu verlangen. Sie arbeitet mit der Welcome Organisation zusammen und hat mich von dort gewissermaßen adoptiert, nachdem … na ja.
Mir ist klar, dass sie sich über meine Gesellschaft freuen würde, aber ich bin nicht in Stimmung für Small Talk von wegen »Und, freust du dich schon auf die Uni?«, weshalb ich diese Idee gleich wieder verwerfe. Was ich jetzt brauche, sind Ruhe, eine Fertiglasagne und meine Konsole.
Auch wenn ich mich insgeheim nach etwas Selbstgekochtem sehne, trifft mich doch eine Welle der Erleichterung, als ich mich endlich in meinen eigenen vier Wänden wiederfinde. Die Wohnung ist nicht groß, bietet gerade genug Platz für Bad, Küche und zwei winzige Zimmer, aber sie reicht für mich. Und die Tatsache, dass ich mir meine Dusche nicht mit Mitbewohnern teilen muss, ist für mich das größte Gefühl von Luxus.
In der Küche schnappe ich mir eine Gabel und die Fertiglasagne aus dem Kühlschrank. Um sie aufzuwärmen, fehlt mir die Motivation, weshalb ich mich gleich zurück in mein Wohnzimmer verziehe. Dieses bietet außer einem Sofa und einem Fernseher, der gefühlt noch von vor der Jahrtausendwende stammt, nicht viel. Das wenige Geld, das ich verdiene, nutze ich, um zumindest die Nebenkosten zu zahlen, mich am Leben zu halten und mir hin und wieder ein paar Klamotten zu kaufen. Dementsprechend sind die Wände um mich herum kahl und leer, aber das stört mich wenig.
Erschöpft lasse ich mich auf die alte braune Ledercouch fallen, wobei ich darauf achte, nicht auf einer der schmerzhaften Federn zu landen. Auf Knopfdruck springt der Fernseher an, dann mache ich mich daran, den Plastikfilm von der kalten Lasagne zu pulen. Anschließend schaufle ich lustlos das nach Pappe und Tomate schmeckende Zeug in mich hinein, bevor ich mein Bein ausstrecke und mit dem großen Zeh das alte Nintendo 64 auf dem Boden zum Leben erwecke.
Vor ein paar Tagen habe ich Pokémon Snap wieder für mich entdeckt, weshalb ich seither meine Freizeit damit verbringe, der weltbeste Paparazzo in der Welt virtueller Monster zu werden. Zumindest bis es mich so sehr langweilt, dass ich ernsthaft überlege, ob es nicht doch intelligenter ist, Zeit mit echten Menschen zu verbringen. Dann wiederum ist meine Auswahl zwischen meiner Dungeons-and-Dragons-Gruppe und Gill nicht sonderlich groß, zumal mir die Muße fehlt, um mehr soziale Kontakte zu pflegen. Und wenn ich ehrlich bin – ganz allein fühle ich mich auch gar nicht. Ich habe schließlich noch den digitalen Professor Eich, der mich in meinem Bestreben, Fotograf zu werden, ermutigt. Und welchen Zweck erfüllen Freunde sonst, außer einen zu motivieren, seine Träume zu verwirklichen?
Die Müdigkeit macht mich anscheinend sentimental, wenn ich über solche Dinge überhaupt grübele. Ich verwerfe die Gedanken an mein verkümmertes Sozialleben, komme aber nur dazu, auf der Konsole ein hübsches Bild von einem Karpador zu schießen, bevor das Smartphone in meiner Tasche nach Aufmerksamkeit verlangt.
Sieben neue Matches, lässt mich die Pushmeldung auf dem Sperrbildschirm meines Handys wissen. Ich verdrehe die Augen – ach, da war ja was. Wann habe ich so viel Zeit auf Tinder verbracht, dass ich gleich derart viele Fische gleichzeitig an Land ziehe? Nachdenklich klicke ich mich durch die potenziellen Traumfrauen und kann mich an keine Einzige erinnern, weshalb ich nur müde die Augenbrauen hebe.
Mir ist klar, dass ich meinen Herzdamen (oder zumindest einer davon) jetzt schreiben sollte, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich ehrlich bin, hat mir die letzte Nacht schon vollkommen gereicht: Ein paar angenehme Stunden mit Netflix, Sunny und ihrem süßen Mund, mit dem sie auch ganz andere Dinge getan hatte, als bloß unentwegt nervige Fragen über das Geschehen im Fernseher zu stellen.
Nein. Für heute und den Rest der Woche habe ich eindeutig genug von anderen Menschen.
Mint
Ruth
Missmutig betrachte ich mich im Spiegel und versuche, darin irgendwie die Motivation wiederzufinden, die mich vor ein paar Wochen noch so beflügelt hat.
Meine Therapiestunden sind vorbei, ich bin gut auf meine Medikamente eingestellt, und ich fühle mich endlich wieder so sehr im Reinen mit mir, dass ich sogar geglaubt habe, ich könnte das alles schaffen. Zurück an die Uni, einen Nebenjob, neue Freunde finden – ein normales Leben, in dem ich mich nicht den ganzen Tag im Bett herumwälze und mir wünsche, ich wäre jemand anders.
Den ersten Schritt habe ich am Donnerstag gewagt, und was soll ich sagen? Der Schuss ging komplett nach hinten los. Schon morgens habe ich mich kaum aus dem Bett schieben können. Nachdem ich es dann doch geschafft habe, ist mein erster Tag auf der Arbeit so ernüchternd gewesen, wie er nur hätte sein können.
Ich war nie schüchtern, aber reden – vor allem mit Fremden – fällt mir inzwischen so schwer, dass ich kaum ein Wort herausgebracht habe. Dabei will ich das gar nicht, ich will antworten, die Menschen sogar anschreien, um zu spüren, dass ich nach all der Zeit noch am Leben bin.
Aber es klappt nicht. Sosehr ich es mir auch wünsche, da ist noch immer dieser Griff, der mich eisern umschließt. Und je mehr ich versuche, daraus auszubrechen, desto fester packt er mich.
Noch am selben Tag habe ich meine Kündigung eingereicht – per E-Mail, feige, wie ich bin. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, die Stelle sei nichts für mich, dabei ist es wohl eher umgekehrt. Danach folgten drei Tage im Bett, während deren ich sämtliche Anrufe meiner Mutter ignoriert und die Energie für Versuch Nummer zwei heute zusammengekratzt habe.
Wenn es mit dem Job schon nicht funktioniert hat, dann bestimmt mit der Uni, nicht wahr? Hahaha.
Wem mache ich eigentlich was vor?
Der Frau im Spiegel, die mich seit geschlagenen zehn Minuten anstarrt, sicher nicht. So lange sitze ich schon hier – angezogen, geschminkt – und versuche mich davon zu überzeugen, dass ich wirklich das Haus verlassen sollte.
»Ich kann das«, sage ich mir und klinge dabei noch weniger zuversichtlich, als ich mich fühle. Mit den Fingern fahre ich mir durch die kurzen, dünnen Haare – ein Resultat der Aktion New Me. Hinten kurz, sodass ich sie kaum in ein mickriges Zöpfchen zwingen kann. Vorne mit Pony. In Roséblond. Es fühlt sich noch immer völlig fremd an. So leicht.
Nach einer weiteren Minute richte ich mich auf und greife nach meinem Regenmantel. Ich halte inne, kurz bevor meine Finger den gelben, plastikartigen Stoff berühren. Einatmen. Ausatmen.
»Ich kann das.«
Endlich überwinde ich mich, schnappe mir das Kleidungsstück, schlüpfe in die Ärmel und ziehe den Reißverschluss zu, bevor ich mir meinen viel zu langen Schal um den Hals wickle. Erneuter Blick in den Spiegel. Mein Gesicht blickt mir aus einem Nest aus petrolgrüner Wolle entgegen.
Ich kann das, wiederhole ich still, dann mache ich mich endlich auf den Weg.
Von meinem Apartment in der Botanic Avenue ist es nur ein Katzensprung zum Campus. Meine Mum hat ihre Beziehungen als ehemalige Dozentin und ihren Geldbeutel spielen lassen, um mich mitten ins Geschehen zu verpflanzen. Ich bin ihr dafür dankbar, aber wegen der Wellen an Feierwütigen, die jede Nacht durch die Straße branden, nicht wirklich glücklich mit der Lage. Als Belohnung dafür, dass ich es immerhin schon vor die Tür geschafft habe, gönne ich mir einen Kaffee von Starbucks, bevor ich mich dem steten Strom an Studenten anschließe, der sich auf die Uni zubewegt.
Darunter sind auch ein paar Fresher, deren aufgeregtes Gezwitscher ansteckend sein könnte, wenn es mich nicht daran erinnern würde, wie ich vor zwei Jahren zusammen mit Oliver …
Ich schüttele den Gedanken ab wie ein lästiges Insekt, auch wenn ich sicher sein kann, dass er mich immer wieder anfallen wird. Vor allem hier an diesem Ort, an dem so viele glückliche Erinnerungen hängen.
Es wäre ein Leichtes gewesen, einen Neuanfang an einer anderen Universität zu wagen – Edinburgh, London, Newcastle –, aber Queen’s kennt meinen Fall und hat zugestimmt, dass ich die Kurse des ersten Jahres nicht wiederholen muss, obwohl ich an keiner Prüfung teilgenommen habe. Auf diese Art spare ich mir Zeit – und die Kosten –, solange ich am Ende dieses zweiten Jahres nur alle Klausuren mitschreibe und die verpassten nachhole. Im Umkehrschluss bedeutet das zwar mehr Druck für mich, aber weniger auf den Geldbeutel meiner Mutter. Nach allem, was sie wegen mir durchgemacht hat, ist es das Mindeste, was ich tun kann.
Auf dem Gelände angekommen, biegt der Großteil der Herde, in deren Mitte ich mich bisher versteckt habe, nach rechts in Richtung Lanyon Building ab. Das große, prunkvolle Backsteingebäude mit den spitzen Dächern und dem idyllischen Innenhof ist nicht nur das Postkartenmotiv der Universität, sondern auch der Ort, an dem die Einführungsveranstaltungen stattfinden. Mein Weg jedoch führt geradeaus, vorbei an der McClay Library zur Fakultät für Physik und Mathematik.
Ein bisschen bin ich froh darüber, mir die ganzen Fresher-Veranstaltungen und Kennenlernrunden zu ersparen. Denn so kann ich mich einfach in die letzte Reihe der Vorlesung setzen, um mich in Ruhe vom Dozenten berieseln zu lassen, während ich versuche, meine Nervosität im Zaum zu halten. Hinter jeder Ecke scheint eine potenzielle Erinnerung zu lauern, und das, obwohl Oliver und ich damals verschiedene Kurse besucht haben.
Überraschend gefasst schaffe ich es in den Seminarraum, wo ich niemanden wiedererkenne. Natürlich – alle, die mit mir begonnen haben, sind jetzt schon im dritten Jahr. Ich könnte mich zu einer Gruppe oder einer einzelnen Person setzen. Vielleicht zu den Jungs in der zweiten Reihe, die über die Semesterferien quatschen, oder neben die Schwarzhaarige hinten rechts, die die Nase in ein Buch gesteckt hat? Am Ende zwingt mich mein rasendes Herz dazu, den Fensterplatz in der sechsten Reihe einzunehmen, wo mir auch bis zum Ende der Stunde niemand droht zu nahe zu kommen.
Ich werte das als einen 50:50-Erfolg. Zwar fehlt mir noch immer der Mut, mich mit Leuten zu unterhalten, aber immerhin liege ich nicht mehr allein zu Hause im Bett und starre an die Decke.
Mit diesem kleinen Triumph im Hinterkopf setze ich zumindest ein leichtes Lächeln auf, das jedoch im Laufe der Stunde mehr und mehr aus meinem Gesicht verschwindet. Der Dozent für Quantenphysik verschwendet nicht viel Zeit darauf, uns einen Überblick über das bevorstehende Jahr zu geben, sondern taucht direkt in die Untiefen von Schrödingers Katze und Hilberträumen ein.
Obwohl ich im ersten Semester recht gut zurechtgekommen bin, habe ich jetzt Schwierigkeiten, dem Stoff zu folgen. Im Laufe der Zeit haben sich zu viele Lücken aufgetan. Einiges habe ich vergessen, anderes hatte ich am Ende des Jahres nicht mehr mitbekommen, sodass ich, als der Dozent endlich die Vorlesung beendet, am liebsten weinen will.
Während die anderen bereits hinausstürmen oder sich nach vorne zum Pult bewegen, lasse ich meine Stirn entkräftet auf meine Mitschrift sinken. Meine sonst so ordentlichen Notizen sind ein einziges Chaos voller Fragezeichen und markierter Stichworte, die ich unbedingt nachlesen muss. Im Grunde ist jedes einzelne Blatt in gelben Textmarker getüncht.
Ich habe etwas später am Tag noch eine Vorlesung. Die Versuchung, in der Zwischenzeit einfach nach Hause zu gehen, ist groß. Doch mir ist klar, dass ich – einmal wieder in der Sicherheit meiner Wohnung – dort nicht mehr so schnell wieder herauskomme. Stattdessen versuche ich, das letzte bisschen Elan, das ich habe, zusammenzukratzen und mache mich auf den Weg zur Bibliothek. Wenn ich schon zwei Unijahre in einem schaffen muss, sollte ich besser gleich damit anfangen, mein Gedächtnis aufzufrischen.
Das C.S.-Lewis-Zimmer ist ein offenes Geheimnis der Universität. Versteckt hinter einem Schrank im dritten Stock der Bibliothek, dient es als kleiner Lern- und Konferenzraum, der aus unerfindlichen Gründen von den wenigsten genutzt wird. Es erinnert an eine Art Turm, rund, mit einer geschwungenen, gepolsterten Bank, die sich an die Hälfte der Wand schmiegt. Links befinden sich weitere Sitzgelegenheiten unter den Fenstern, doch das zentrale Stück bildet ein runder Tisch genau in der Mitte, in dessen Platte eine Karte von Narnia eingelassen ist.
Gerade zu Beginn des Semesters ist das gesamte Gebäude normalerweise so gut wie leer, weshalb ich, nachdem ich mich zwischen alten Mänteln durchgekämpft habe, umso überraschter bin, den Raum dahinter belegt vorzufinden.
Als jemand mir zum ersten Mal von diesem Geheimnis erzählt hat, wurde mir erklärt, es ist eine ungeschriebene Regel, dass man den Raum nicht betritt, solange jemand darin ist. Und genau das ist jetzt der Fall – ein Kommilitone hat es sich auf der Bank bequem gemacht und scheint dort zu schlafen.
Obwohl er mit dem Rücken zu mir liegt, erkenne ich ihn an der langen Silhouette sofort als den Kerl wieder, der mich letzte Woche noch im Supermarkt eingearbeitet hat: Dominic.
Mein erster Impuls ist es, auf der Stelle kehrtzumachen und zu verschwinden, bevor er am Ende noch aufwacht und mich fragt, wieso ich gleich nach dem ersten Tag gekündigt habe. Alles in mir schreit danach abzuhauen, damit ich mich nicht rechtfertigen muss. Aber ich bin wie festgenagelt. Der Wunsch, hier oben ein paar Bücher zu wälzen und die nervigen Geräusche der restlichen Bibliothek zu vergessen, ist ebenso groß wie die irrationale Panik vor einem möglichen Gespräch. Gleichzeitig warnt mich meine innere Stimme, dass ich nicht ewig vor jedem einzelnen Menschen davonrennen kann. Ein Seufzer entwischt mir – leider etwas zu laut.
»Komm ruhig rein.« Dominics Stimme ist klar wie ein Glockenschlag und klingt dabei furchtbar müde. »Ich lieg hier nur rum.«
Stirnrunzelnd betrachte ich seinen Rücken. Es ist unmöglich, dass er mich erkannt hat, ohne sich umzudrehen, also scheint es ihm wirklich egal zu sein, ob er Gesellschaft hat oder nicht. Noch immer stehe ich unschlüssig im Türrahmen. Nach seiner Einladung einfach rauszustürmen käme mir umso seltsamer vor. Also trete ich vorsichtig ein und beginne damit, meine Sachen auf dem Tisch auszubreiten und das Textbuch aus dem ersten Semester aufzuschlagen.
All das scheint diesen Dominic nicht im Geringsten zu stören. Regungslos bleibt er auf der Bank liegen und nimmt dabei fast die Hälfte ihrer Länge ein. Verglichen mit mir ist er ein Riese. Das ist zugegebenermaßen nicht besonders schwer, doch selbst alle anderen wirken im Vergleich zu ihm klein.
In den ersten Minuten fällt es mir schwer, mich auf das Buch vor mir zu konzentrieren. Ständig huscht mein Blick zu ihm rüber, bis mir allmählich klar wird, dass meine Anwesenheit ihn wirklich nicht interessiert. Gut so. Etwas entschlossener puste ich mir die Fransen meines Ponys aus der Stirn und mache mich an die Arbeit.
Es braucht nicht mehr als ein paar Seiten, bis sich meine Gehirnzellen langsam reaktivieren. Das wenigste aus dem ersten Jahr habe ich vergessen, sondern schlichtweg verdrängt, nachdem ich das Wissen so lange nicht anwenden musste. Ich lese ein Einführungskapitel, dann das Skript aus der ersten Vorlesung zur Quantentheorie von vor zwei Jahren und mache mich schließlich an die Aufgaben des dazugehörenden Tutoriums.
Bereits die erste lässt mir die Haare zu Berge stehen und zwingt mich dazu, erneut durch den Stoff zu blättern. Aber mit einem Mal packt mich die Motivation. Eine Entschlossenheit durchströmt mich, die ich lange nicht mehr gespürt habe. Schon immer hat die Aussicht auf eine schwierige oder gar unlösbare Aufgabe mich beflügelt, und es ist wundervoll zu spüren, dass auch Olivers Tod daran nichts geändert hat. Konzentriert arbeite ich mich durch das Arbeitsblatt und bin ganz vertieft – zumindest so lange, bis ich gewaltsam wieder in die Realität gerissen werde.
»Du bist so still, ich hab gedacht, wer auch immer hier reingekommen ist, ist sofort wieder abgehauen.«
Mitten in der Berechnung erstarre ich zu einer Statue. Mein Stift hinterlässt einen Farbfleck auf dem Papier, ehe ich ihn vorsichtig beiseitelege. Langsam hebe ich den Blick und begegne Dominics Augen. Ohne dass ich es gemerkt habe, hat er sich aufgerichtet, die Lippen zu einem amüsierten Grinsen verzogen, während er sich die zerzauste Frisur richtet.
»Alles klar?«, setzt er noch hinterher, weil ich ihn offenbar anschaue wie ein Schaf.
Mir schnürt sich die Kehle zu, weshalb ich nur nicke und fieberhaft überlege, was ich jetzt sagen soll.
»Bei … dir?« Meine Stimme klingt, als hätte ich zum Frühstück eine Packung Kreide gefuttert. Aber hey: Ein ganzer Satz! So gut wie zumindest.
»Müde«, antwortet Dominic und lehnt sich dabei zurück. Seine Antwort ist ihm deutlich anzusehen – ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen mit so ausgeprägten Augenringen gesehen. »Bisschen früh, um mit dem Lernen anzufangen, meinst du nicht?«
Ich zucke mit den Schultern und sehe wieder hinab auf das Blatt Papier. Es passiert schon wieder. Bereits im Supermarkt hat er ständig Fragen gestellt, um irgendwas aus mir herauszubekommen, während ich nur vor mich hin gestarrt habe wie ein Fisch. Dabei glaube ich kaum, dass er ernsthaft an mir und meinem Leben interessiert ist, sondern bloß zu der Sorte Mensch gehört, die Stille nicht ertragen kann. Seine übereinandergeschlagenen Beine zucken, während er mit den Fingern fast lautlos auf das Polster der Bank trommelt.
Er macht mich nervös.
»Ich …« Komm schon, Stimme! »Ich habe vieles aus dem ersten Semester vergessen und will den Anschluss nicht verlieren.«
»Du bist gar kein Ersti?!«
Stirnrunzelnd blicke ich zu ihm auf. »Nein. Wie kommst du drauf?«
»Na …« Er wedelt mit den Händen. Eine seltsame Geste, deren Bedeutung ich trotzdem verstehe: meine Größe. Wahrscheinlich hat er mich bis jetzt für eine Grundschülerin gehalten. Gelangweilt verdrehe ich die Augen und will mich wieder meinem Beweis widmen.
»Ich hab gar nichts gesagt«, lässt er mich eine Spur zu selbstgefällig wissen.
»Aber gedacht.«
»Wenn du jede Frage ignorierst oder so einsilbig beantwortest, muss ich eben spekulieren.«
Mist, verrechnet. Ich streiche die Zeile, die ich eben hingeschrieben habe, durch und schaue nicht mal auf, als ich antworte.
»Und was spekulierst du so?«
Eine so winzige, unschuldige Frage … Trotzdem kann ich nicht leugnen, dass die Antwort mich interessiert. Was sehen die Leute in mir, wenn sie mich heute treffen? Was können sie aus mir herauslesen?
»Ist das eine ernst gemeinte Frage?«
»Klar.«
Dieses Mal schreibe ich den richtigen Erwartungswert hin, während ich plötzlich meinen Herzschlag deutlich spüren kann. Dieses Gespräch und Dominics Anwesenheit versetzen mich in leichte Panik. Vor allem, weil mir jetzt umso klarer wird, dass ich seit der Beerdigung mit niemandem außer meinem Therapeuten, meinem Neurologen, dem Typen vom Spar und meiner Mutter mehr als ein paar Worte gewechselt habe.
Zu meiner Überraschung kommt Dominic meiner Aufforderung nach.
»Du bist klein«, stellt er fest, als wäre das der relevanteste Fakt. »Und dem Haarschnitt nach zu urteilen, entweder zu viel auf Pinterest unterwegs oder anders als alle anderen.«
Beinahe grunze ich auf. Ist das sein Ernst?
»Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, du studierst entweder Literatur oder was mit Kunst.« Immerhin das weiß er inzwischen besser. »In deiner Freizeit schreibst du gern eigene Geschichten oder Gedichte. Generell bist du eher ein Bücherwurm oder so was.«
Aufmerksam höre ich ihm zu und gleiche seine wilden Spekulationen mit dem ab, was ich bin oder behaupte zu sein. Ich kann ihm schriftlich geben, was ich studiere, und dass ich bestenfalls ein- bis zweimal im Jahr ein Buch anfasse, aber seine Worte bringen mich dennoch zum Nachdenken.
»Weiter?«
»Sagst du mir wenigstens, ob ich richtigliege?«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich lese selten. Ich habe andere Hobbys.«
Hatte.
»Du schaust Animes und schreibst dazu Fan-Fiction, hörst gern K-Pop und spielst ein Instrument oder so.«
Seine Stimme klingt nicht wie ein Vorwurf, sondern wie eine ernsthafte Einschätzung, basierend auf dem, was er sieht. Erneut hebe ich den Blick und mustere ihn.
»Steckst du Menschen gern in Schubladen?«, frage ich geradeheraus, ohne meine Stimme dabei angreifend klingen zu lassen.
»Keine Schubladen«, erwidert er. »Eher so … bunte Aufkleber, die ich den Menschen verpasse – auf die Art weiß ich wenigstens, worauf ich mich einlasse.«
Sicher, dass du dich hierauf einlassen willst? Fast hätte ich den Satz ausgesprochen, aber ich zügele mich im letzten Moment, obwohl ich es nicht schaffe, meine Überraschung zu verbergen. Zum ersten Mal sehe ich ihn richtig an.
Sein dunkles, zur Seite gescheiteltes Haar erweckt den Eindruck, als könnte er mal wieder einen Friseurbesuch vertragen. Die Ringe unter seinen großen, schiefergrauen Augen zeugen von viel zu wenig Schlaf, während sie einen starken Kontrast zu seiner sonst blassen Haut bilden. Dazu hohe Wangenknochen und ein sorgsam rasiertes Kinn.
Dominics Klamotten sind nicht brandneu, keine Markensachen, und an seinem Rucksack, den er vorhin noch als Kissen benutzt hat, hängt einer der Träger buchstäblich am seidenen Faden.
Ich habe Menschen nie nach ihrem Äußeren beurteilt, und das werde ich auch jetzt nicht tun. Aber dieser eine Satz mit den Stickern verrät mehr über ihn, als er ahnt.
Auf die Art weiß ich wenigstens, worauf ich mich einlasse.
Ich lasse seine Aussage unkommentiert und starre stattdessen wieder auf mein Blatt. Doch meine Gedanken sind so unruhig, dass die Zahlen vor meinen Augen zu Hieroglyphen werden. Wie zarte Nadelstiche kann ich Dominics Blick weiterhin auf mir spüren, wie er jede meiner Regungen genau studiert, während er in seinem Kopf nach dem richtigen Sticker sucht. Bekomme ich den für Weebs oder den für rebellische Kids aus gutem Hause? Und wenn – was passiert als Nächstes?
»Welchen Sticker bekomme ich?«, rutscht es mir heraus, woraufhin Dominic überraschend Luft ausstößt. Ist das ein Lachen? Ich wage nicht aufzusehen, meine aber zu hören, wie er seine Sachen schnappt, aufsteht und auf mich zukommt.
»Am Anfang fand ich einen in Rosa sehr passend«, erklärt er und steht auf einmal neben mir. Wenn ich im Sitzen zu ihm aufsehe, wird der Größenunterschied nur noch deutlicher. Jetzt bemerke ich auch, dass seine Augen nicht grau, sondern grün sind – und etwas Düsteres liegt darin, das ich nicht genau zuordnen kann. Seine Hand ruht auf meiner Stuhllehne.
»Und jetzt?«
Dominics Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, das mich erschaudern lässt. Keine Ahnung, wieso. Statt einer Antwort nickt er mir zu und wendet sich zum Gehen, während ich ihm irritiert hinterherstarre. Erst als er bereits so gut wie im Kleiderschrank verschwunden ist, richtet er noch einmal das Wort an mich.
»Ich komm drauf zurück, Samwise.«
Die Schwere eines Versprechens schwingt in seinem Satz mit, das nicht so recht zu unserer eigentümlichen Konversation passen will. Was mich aber noch viel mehr irritiert, ist der Spitzname.
Hat er mich eben ernsthaft Samwise genannt?
Deep Navy
Dominic
Während ich noch auf die Bahn nach Hause warte, lasse ich den heutigen Tag im Geiste Revue passieren, um mich vom Sekundenschlaf abzuhalten. Angefangen hat es mit einer Vorlesung in Datenbanken, gefolgt von einem Nickerchen im C.S.-Lewis-Zimmer, das meiner Meinung nach nur für zwei Zwecke genutzt wird: schlafen oder Nervenzusammenbrüche. Dort dann meine unheimliche Begegnung der dritten Art mit Ruth.
Noch immer bin ich unschlüssig, welchen Sticker ich ihr am Ende wohl verpassen werde. Aber ich bin der festen Überzeugung, mir wird schon der richtige einfallen, sobald ich sie genauer unter die Lupe nehmen kann. Was aber anscheinend so schnell nicht möglich sein wird, denn vorhin erst hat die Gottesanbeterin mich wissen lassen, dass Ruth überhaupt nicht wiederkommt.
Tja. Sei’s drum.
Erschöpft lehne ich mich an einen Leuchtkasten mit einem Plakat von Translink, das vor dem Fahren ohne gültiges Ticket warnt, als ein Vibrieren in meiner Hosentasche mich zurück in die Realität holt. Sunny, von der ich eigentlich gehofft habe, dass der eine Abend alles zwischen uns war, erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Die meisten Frauen verstehen die Kombination aus Tinder und meinem heimlichen Abgang als klare Aussage, doch sie …
Noch schaffe ich es nicht, ihr eine deutliche Abfuhr zu erteilen. Vor allem, weil sie gerade so freundlich ist, mich an ihrer Outfitwahl für die Kneipentour heute Nacht teilhaben zu lassen.
Ein Lächeln huscht mir über die Lippen, als ich durch die Kollektion an Selfies in spärlicher Bekleidung scrolle, und ich lasse mich sogar dazu herab, ihr meine Anerkennung mitzuteilen:»Nice.«
Bin ich ein Arsch? – Yep.
Skeptisch betrachte ich meine einsilbige Nachricht und beschließe, noch ein Emoji hinterherzusetzen, um nicht ganz wie ein emotionaler Eisblock rüberzukommen, bevor ich das Handy wieder in der Hosentasche verschwinden lasse.
Nachdenklich kaue ich auf der Unterlippe herum. Obwohl vor meinem geistigen Auge noch immer das Bild von Sunnys üppiger Oberweite dominiert, schleicht sich ein anderer Gedanke immer wieder in mein Bewusstsein.
Welchen Sticker bekomme ich?
Den für Quälgeister schon einmal garantiert, denn egal, wie sehr ich mich auch zwinge – meine Kommilitonin mit den fusseligen Zuckerwattehaaren will einfach nicht aus meinem Kopf. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, etwas stimmt nicht mit ihr. Zu gern würde ich mir einreden, ich wüsste genau, wer sie ist – ein Buchnerd, Weeb, Rebellin, Was-auch-immer – doch irgendwie passt nichts zu ihr. Sie wirkt streberhaft, wenn sie sich am ersten Tag schon zum Lernen in die Bibliothek setzt, aber wie passt das dazu, dass sie schon nach einer Schicht im Supermarkt kündigt? Wieso hat sie überhaupt erst dort angefangen?
Stopp.
Ich muss dringend aufhören, an sie zu denken, und mich ganz schnell auf meine eigenen Probleme konzentrieren. Das Letzte, was ich brauche, ist Ablenkung oder dass irgendeine Frau sich wie ein Parasit in meinem Kopf einnistet.
Falls ich sie wiedersehen sollte, frage ich sie nach dem Job. Danach entscheide ich über den passenden Sticker, stelle Ruth in denselben Schrank wie all die anderen Menschen, die in meinem Leben kommen und gehen, und mache genauso weiter wie bisher.
Ganz einfach. Genau so.
Thema beendet.
Zu Hause führt mein erster Gang zum Briefkasten. Neben der Broschüre eines neuen Restaurants namens Fryer Tuck, dessen Dumpingpreise augenblicklich Vertrauen erwecken, finde ich darin auch einen Umschlag ohne Absender. Die Ecken sind zerknittert, das Papier sieht aus, als wäre es schon zehnmal recycelt worden. Auch ohne die feine Handschrift, in der mein Name und meine Adresse darauf notiert sind, hätte ich erkannt, von wem er stammt. Der Brief verströmt den feinen Duft eines süßen Parfüms – wie ein Liebesbrief. Nur weiß ich zu genau, dass es keiner ist.
Seufzend lasse ich den Umschlag in meine Manteltasche gleiten, gehe ins Haus, nur um ihn dort zu den anderen zu werfen, die in einer Schublade in der Küche ihr Dasein fristen. Ungeöffnet. Wie viele es inzwischen wohl sind? Ich würde gern behaupten, dass es mir so egal ist, dass ich mir nie die Mühe gemacht habe zu zählen, aber ich weiß ganz genau, dass es mit dem neuen zusammen achtundzwanzig sind.
Auch diesen lasse ich ungeöffnet in den Untiefen meiner Küchenzeile verschwinden. Mit einem Seufzen knalle ich die Schublade zu. Halte kurz inne und schüttele dann den Kopf.
Nein. Vergessen. Weitermachen.
Ich verbringe den Rest des Tages, wie ich es am liebsten habe, obwohl die meisten es als verwerflich bezeichnen würden: mit Energydrinks, ein bisschen Tinder, Fertigkartoffelpüree (selbstverständlich kalt) und dazu mein Nintendo 64. Fast fühle ich mich ein bisschen wehmütig, als mein guter Freund Professor Eich mich zu meiner letzten Mission schickt, doch sobald die Credits über den Bildschirm laufen, hole ich schon das nächste Spiel hervor. Zumindest bis mein Handy mich wieder ablenkt.
Diesen Abend habe ich nur drei Matches. Mein Selbstwertgefühl ist ein wenig angekratzt davon, doch wenn man bedenkt, dass ich nach wie vor keine Lust habe, mich näher mit den Ladys auseinanderzusetzen, ist es wohl besser so.
Viel zu spät gehe ich ins Bett und schlafe noch später ein, weshalb ich am nächsten Morgen eine Schmerztablette einwerfen muss, weil mir der Schädel brummt. Als ich sie in der Küche mit einem Glas Wasser hinunterstürze, bleibt mein Blick erneut an der Schublade hängen.
Achtundzwanzig Briefe. Hartnäckig ist sie, das muss ich ihr lassen, aber an mir wird sie sich die Zähne ausbeißen … Ich denke schon wieder zu viel darüber nach.
Schnaubend fahre ich mir durch die Haare, bevor ich mein Handy checke. Keine neuen Matches über Nacht, dafür geschätzte zweihundert Nachrichten von Sunny. Außerdem erinnert mich die Uhrzeit daran, dass ich mich auf den Weg machen sollte.
Die Vorlesung über Berechnungstheorieverbringe ich mehr tot als lebendig auf meinem Platz ganz hinten links – etwas, das ich vermutlich nächste Woche, wenn ich nicht mehr verstehe, was überhaupt das Thema ist, schon bereuen werde –, bevor ich mich für vier Freistunden auf den Weg zurück zum Hauptcampus mache.
Den Umständen meiner Jugend habe ich es zu verdanken, dass ich mit fünfundzwanzig gerade erst im zweiten Jahr des Bachelors für Computer Science sitze, was mich grundsätzlich nicht stört. Nur in puncto Stundenplan habe ich dieses Mal die Arschkarte gezogen. Dienstage beginnen für mich um neun Uhr morgens. Eine Stunde Vorlesung, nur um danach bis zum Nachmittag rumzuhocken. Entsprechend war die Versuchung heute groß, einfach mal zu »verschlafen«, aber das würde ich nicht wagen.
Dass ich die Queen’s University besuchen kann, ist in meinem Fall absolut keine Selbstverständlichkeit. Und dass ich dort studieren kann, ohne am Ende mit 20 000 Pfund Schulden ins Berufsleben zu starten, erst recht nicht. Die Welcome Organisation hat mich vor fünf Jahren nicht nur buchstäblich von der Straße aufgelesen, sondern mir darüber hinaus die Chance gegeben, meine A-Levels nachzuholen, und mir später das Stipendium zugespielt, das mich jetzt sorgenfrei durchs Studium bringt. Ich denke, in Anbetracht dessen hat guter Wille einen höheren Stellenwert als mein vollkommen zerstörter Biorhythmus.
An einem sonnigen Tag wie diesem erstrahlt der perfekt getrimmte Rasen vorm Lanyon in einem derart künstlichen Grün, dass Queen’s etwas von einem amerikanischen Spielfilm hat. Die Sorte, in dem die Protagonisten an der Universität die große Liebe finden. Der Footballstar und das Mauerblümchen. Oder das scheinbar naive Blondchen, das in Harvard Jura studiert. Doch die Realität ist anders: keine glücklich aussehenden Grüppchen von Studenten, die im Gras zusammen lernen, keine sportlichen Typen, die Flyer für Verbindungen verteilen. Nur ich, wie ich auf dem Parkplatz an der rechten Seite des Gebäudes herumschleiche, bis eine seltsame Erscheinung beinahe dafür sorgt, dass mein Dozent für Softwareentwicklung mich mit seinem BMW überrollt.
Das aggressive Hupen reißt mich aus meiner Trance, doch ich bringe nur ein entschuldigendes Winken zustande, bevor mein Blick wieder auf den Grund für meine Ablenkung fällt. Zuckerwatte. Auf zwölf Uhr.
Sie verlässt gerade die Fakultät für Physik und scheint nicht zu bemerken, dass ich fast überfahren wurde. Zielstrebig begibt sie sich auf den Weg in Richtung McClay Library, während ich mir nur einen Sekundenbruchteil Zeit lasse, darüber nachzudenken, ob es wirklich schlau ist, Ruth zu folgen.
Meine Füße handeln schneller als mein Gehirn und nehmen bereits die Verfolgung auf, ohne dass ich überhaupt einen Plan habe, was ich zu ihr sagen oder wie ich meine plötzlichen Stalker-triebe rechtfertigen soll. Dabei macht sie es mir gar nicht so leicht. Obwohl sie buchstäblich ein Hobbit ist, legt sie ein Tempo an den Tag, mit dem ich nicht gerechnet habe. Als wäre der Teufel persönlich hinter ihr her.
Noch ehe ich sie einholen kann, verschwindet sie blitzschnell in der Bibliothek und lässt mich stutzend vor dem Gebäude zurück.
Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten.
Erstens: Ich lasse Zuckerwatte Zuckerwatte sein und freunde mich mit dem Entschluss an, dass sie keinen bunten Sticker braucht. Dass ich sehr wohl mein Leben weiter in glückseliger Ignoranz verbringen kann, ohne zu wissen, wer diese Frau ist oder warum sie gleich am ersten Tag im Supermarkt gekündigt hat. Ich mache auf dem Absatz kehrt und suche mir einen anderen Schlafplatz drüben im Computer Science Building.
Zweitens: Ich folge ihr, finde heraus, was sich hinter den rosa Haaren verbirgt und … ach, keine Ahnung. Ich mach’s einfach.
Ich spare mir die peinliche Nummer, bei der ich einen Kommilitonen frage, ob er eine Frau gesehen hat, die aussieht wie die Grunge-Version von Stephanie aus Lazy-Town, und mache mich auf gut Glück auf den Weg ins C.S.-Lewis-Zimmer. Der Kleiderschrank, der dorthin führt, empfängt mich mit dem vertrauten Geruch von altem Leder, und als ich Ruths rosa Haarschopf dahinter entdecke, huscht ein Lächeln über mein Gesicht.
Dieses verschwindet jedoch augenblicklich, als ich ihr Schluchzen höre. Sofort erstarre ich zur Salzsäule, bevor ich einen Schritt zurückweiche. Einen einzigen, obwohl alles in mir schreit: Das geht dich nichts an!
Doch aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht, meinen Rest Anstand zusammenzukratzen und umzudrehen, als ich ihre zierliche Gestalt am Tisch entdecke. Ruth ist in sich zusammengesunken, wodurch sie noch kleiner wirkt als ohnehin schon. Das Beben ihrer Schultern ist die einzige Regung, die von ihr ausgeht. So leise, wie ihr Schluchzen ist, gleicht es einem Wunder, dass ich es auf Anhieb gehört habe.
Frustriert beiße ich die Zähne zusammen. Ein Teil von mir will jetzt erst recht zu ihr und ihr zumindest meine Hilfe anbieten, so nutzlos diese auch sein mag. Ein anderer Teil hat noch immer Option Nummer eins von vorhin im Kopf. Statt allerdings eine Entscheidung zu treffen, bleibe ich an Ort und Stelle stehen, mein Atem flach, mein Puls rasend. Still sehe ich dabei zu, wie sie mehr und mehr in sich zusammensackt, und etwas in mir rührt sich. Ihr Anblick erinnert mich an meine Mutter.
Nicht die wütende Mutter. Nicht die verwirrte Mutter. Oder die verzweifelte. Sondern die traurige. Die, die für mich da war, als mein Dad nicht mehr nach Hause kam. Die, die jeden Abend allein in der Küche saß und dachte, ich sei bereits im Bett. Dabei habe ich zugesehen, wie sie sich Nacht um Nacht vor Trauer am Tisch gekrümmt hat, während ich selbst nur hilflos und unentdeckt im Türrahmen gestanden habe. So wie jetzt.
Der Stich, der sich bei der Erinnerung wie ein Eiszapfen in meine Brust bohrt, zwingt mich schließlich zur Kehrtwende. Ruths Anblick, sosehr ein Teil von mir ihr auch helfen will, löst etwas in mir aus, das ich aus guten Gründen lange vergraben habe und das jetzt droht herauszubrechen.
Das kann ich nicht zulassen. Wie das Kind, das ich damals war, gehe ich lautlos rückwärts, ohne den Blick von der weinenden Gestalt abzuwenden, und erst als ich die Tür wieder schließe, wage ich Luft zu holen.
»Sorry … ist das das C.S.-Lewis-Zimmer?«