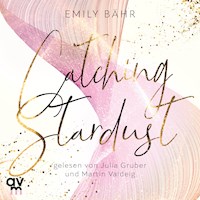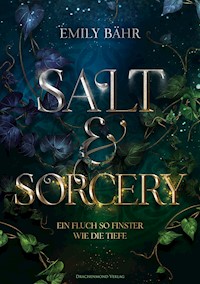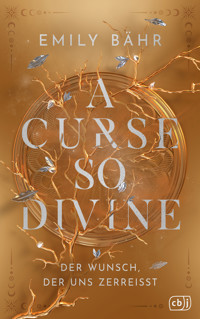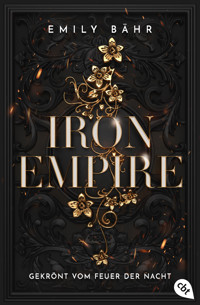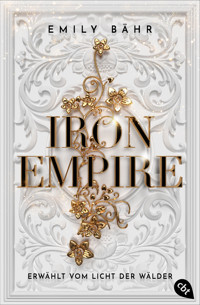
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die "Iron Empire"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Seherin, die die Zukunft fürchtet, ein Prinz, der keiner sein will und eine Welt, in der jeder Atemzug der letzte sein könnte
Als ein Flugzeug in ihrer Heimat abstürzt, ändert sich Kaeliahs Leben schlagartig. Denn der Passagier ist niemand geringeres als Hunter, der Prinz des Eisernen Imperiums, welches seit Jahrhunderten die Wispernden Wälder zerstört und damit auch die Lebensgrundlage ihrer Bewohner. Kae, die erst kürzlich zur Seherin ernannt wurde und vergeblich um die Akzeptanz ihres Volkes kämpft, sieht ihre Chance, sich zu beweisen. In der Hoffnung ihre Heimat zu retten, begleitet sie den Prinzen zurück in sein Reich und merkt dabei schnell, dass ihre Verbindung weit über Diplomatie hinausgeht.
Doch als Kae am kaiserlichen Hof ankommt, findet sie dort nichts als Intrigen und ein Land an der Schwelle zum Krieg, während der Menschheit buchstäblich die Luft zum Atmen ausgeht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Emily Bähr
Iron Empire
Erwählt vom Licht der Wälder
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Dezember 2023
© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Emily Bähr
Covermotive: Shutterstock / kaisorn; Turbosquid by Shutterstock (deckorator4, Morecano, 4045)
FK · Herstellung: AJ
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30044-9V003
www.cbj-verlag.de
Für Kathrin,
die Träume wahr werden lässt.
Liebe*r Leser*in,
bitte beachte, dass dieses Buch bestimmte Themen behandelt, die ungewollte Reaktionen auslösen können. Deshalb findest du auf hier eine Content Note, in der diese Aspekte aufgelistet werden.
Hinweis: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte, daher entscheide für dich selbst, ob du sie lesen möchtest.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!
Emily und das cbt-Team
I
Kae
Die Bäume schrien, als das Feuer an ihren Blättern leckte und sie ihrer Farbe beraubte. Grün wurde zu Rot, dann zu Schwarz. Ascheflocken fielen wie Schnee vom Himmel, bestäubten das dichte Unterholz, die aus dem Boden ragenden Wurzeln, meine Haut, während ich die schwelenden Überreste dessen anstarrte, was einst unser Dorf gewesen war.
Mein Fluchtinstinkt trieb mich zur Eile an, aber meine Füße waren wie im Boden verwurzelt, als wäre ich selbst einer der uralten Bäume, die mich umgaben. Ich bewegte mich nicht von der Stelle, obwohl die Hitze längst auf meinem Gesicht brannte. Obwohl Qatou rastlos auf meiner Schulter umhersprang und seine weichen Fühler nach meiner Wange ausstreckte.
Das Bild der Zerstörung ließ mich nicht los. Es hielt mich gefangen und brach mein Herz entzwei. Was passierte gerade? Wieso war ich hier? Und wo waren die anderen?
Ein lautes Fiepen an meinem Ohr brachte mich schließlich zur Vernunft. Mühevoll gelang es mir, den Blick von meiner verlorenen Heimat loszureißen, doch wohin schaute man, wenn um einen herum nichts als Zerstörung wartete?
Ich nahm Qatou in die Hand, strich ihm einmal kurz mit dem Daumen über das weiche weiße Fell, bevor ich ihn in meine gewobene Tasche krabbeln ließ.
Und jetzt?, fragte ich mich, während die seltsame Taubheit von mir abließ und den Platz für ein anderes Gefühl freigab: Panik. Nackte Panik.
Binnen eines Wimpernschlags nahm ich alles in mich auf. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, hielt jetzt, nachdem es mein Zuhause dem Erdboden gleichgemacht hatte, direkt auf mich zu.
Ohne weiter nachzudenken, rannte ich los. Weg vom Dorf. Weg von den Flammen. Dabei hätte ich genauso gut mit der Zeit selbst um die Wette laufen können. Das Inferno war inzwischen so gewaltig geworden, dass es mir mit jedem Moment schwerer fiel, eine Schneise zu finden, die sich das Feuer nicht schon längst geholt hatte.
Nach wie vor regnete es Asche, doch darunter mischte sich nun auch etwas anderes. Federn, Fell, die winzigen Körper der Tiere, die in den Baumkronen ihre Nester bauten. Ich spürte, wie Qatou in meiner Tasche zitterte, und musste selbst die Tränen wegblinzeln, weil der Anblick mich noch viel stärker traf als der des zerstörten Dorfes.
Der Wald starb. Mit ihm Tausende unschuldige Seelen. Und ich war mittendrin und konnte doch nur hilflos dabei zusehen, wie die Flammen alles verzehrten, bis auch mein letzter Ausweg vernichtet war.
Hitze fraß sich durch meine Kleidung. Schweiß mischte sich unter die Tränen, die mir inzwischen ungehemmt übers Gesicht liefen. Qatou fiepte leise. Und irgendwo in meinem Hinterkopf fragte eine verzweifelte Stimme, wie das alles hatte passieren können.
Als ich die Augen aufschlug, meinte ich noch immer verbrannte Erde auf meiner Zunge zu schmecken. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass alles nur ein Albtraum gewesen war. Orientierungslos blinzelte ich in das schummrig–blaue Licht meiner Höhle. Ich konnte nicht einschätzen, wie spät es war – das hatte ich im Gegensatz zu den anderen nie gekonnt –, aber so müde wie ich mich fühlte, kam es mir vor, als wäre kaum ein Augenblick vergangen, seit ich mich hingelegt hatte. Und doch ließen sich die Bilder in meinem Kopf nicht abschütteln. Alles war so real gewesen vom Knacken brechender Äste bis zum schneidenden Geruch des Feuers. Ich erschauderte.
»Qatou?« Nicht einmal meine Stimme klang nach mir, als ich besorgt nach ihm rief.
Über meinem Kopf regte sich etwas. Ich hörte das aufgeregte Flattern winziger Flügel, bevor er auf meiner Brust landete. Weiche Pfötchen berührten mein Kinn, Fühler kitzelten meine Lippen und entlockten mir ein erleichtertes Lächeln. Qatou war hier. Wohlbehalten. Und ich zu Hause in meiner engen Baumhöhle – das Feuer nichts als eine finstere Traumerscheinung.
Nach unserer kurzen Begrüßung begann Qatou zu schnurren, während ich die Erinnerungen an die Nacht beiseitezuschieben versuchte. Nur ließ mich das mulmige Gefühl nicht los. Ob ich mit dem Seher darüber sprechen sollte? Normalerweise ermahnte er uns, nicht zu viel in Träume hineinzuinterpretieren. Aber das eben hatte sich so … echt angefühlt. Als wäre ich selbst dort gewesen. Möglicherweise hatte es doch etwas zu bedeuten. Eine Warnung, die der Wald mir geschickt hatte.
Entschlossen stand ich auf, wodurch Qatou fast von meiner Hängematte fiel. Ich ignorierte sein empörtes Fiepen, streckte mich einmal ausgiebig und band meine langen schwarzen Haare neu zusammen, denen man ansah, wie unruhig ich geschlafen hatte. Von draußen drangen die Geräusche des Dorfes zu mir herein, raschelnde Blätter, Kinderstimmen, das Hämmern der Nerborin, deren Werkstatt nur einen Baum entfernt lag.
Ich trat nach draußen und atmete erleichtert die frische, kühle Luft ein. Der schmale Holzsteg unter meinen Füßen, der sich spiralförmig um den Baum wand, fühlte sich angenehm vertraut an. Überrascht stellte ich fest, dass es schon helllichter Tag war. Der durch das dichte Blätterdach fallende Sonnenschein tauchte das Dorf in sanftes grünes Licht. Alles war so, wie es sein sollte. Die schier endlos hohen Bäume mit den zahlreichen Höhlen darin unangetastet. Ebenso die Brücken, Rampen und Rutschen, die sie mit ihren Ästen scheinbar willkürlich formten. Selbst der Tau, der in winzigen Wasserfällen von den riesigen Blättern in die Tiefe stürzte. Lichtstrahlen verfingen sich darin, ließen das Wasser funkeln wie Millionen Diamanten. Ich legte den Kopf zurück, um ein paar Tropfen, die direkt neben mir niedergingen, mit meinem Mund aufzufangen, und wusch mir den Schweiß aus dem Gesicht.
Auf einen leisen Pfiff flatterte Qatou auf meine ausgestreckte Hand und tat es mir gleich. Eine Angewohnheit, die er sich zugelegt hatte, seit er beschlossen hatte, mir nicht mehr von der Seite zu weichen.
Liebevoll beobachtete ich ihn dabei, wie er zwei seiner sechs Pfötchen mit Wasser benetzte, um sich damit erst seine langen Ohren, dann das dichte weiße Fell und zum Schluss die schmetterlingsartigen Flügel auf dem Rücken zu waschen.
Als er sich hübsch genug fühlte, um den Tag zu beginnen, schüttelte er sich und flatterte davon. Doch wenn ich eines über Qatou wusste, dann, dass er sich nie allzu weit von mir entfernte. Ich sah ihm nach, wie er in den Baumkronen verschwand, um nach Beeren oder Pilzen zu suchen, bevor ich mich selbst auf den Weg machte.
Während ich durchs Dorf spazierte, wurde mir klar, dass ich nicht so lange geschlafen hatte, wie zunächst vermutet. Die Sonne stand zwar bereits hoch am Himmel, doch das Getümmel war übersichtlich. Einige Kinder waren schon auf den Beinen, spielten allerdings nur. Ihr Unterricht bei den Houran hatte noch nicht begonnen.
Eine Gruppe Komen versammelte sich vor der Gemeinschaftshöhle, um gleich im umliegenden Wald Früchte für unser Essen zu sammeln. Obwohl sie ein Stück von mir entfernt standen, musste ich mich nicht einmal anstrengen, um ihre mürrischen Mienen zu bemerken. Jeden Tag schliefen sie weniger, um das Dorf noch ein bisschen früher zu verlassen, um sich noch weiter in den Wald hinauszuwagen. Denn ihre Erträge fielen immer geringer aus. Vorsichtig reckte ich den Hals, bis ich Dhan unter ihnen entdeckte. Ich lächelte leicht, wollte ihm zuwinken, doch er wirkte angespannt und war ganz vertieft in die Ansprache seines Ausbilders.
Obwohl die frische Luft mir guttat, überprüfte ich jeden Winkel des Waldes zweimal. War das ein Funke oder doch nur ein Glühwürmchen? Roch es nach Rauch oder bildete ich es mir ein? Die Bilder aus meinem Traum saßen mir immer noch tief in den Knochen, doch mit jedem Stück, das ich zurücklegte, wurde mein Verstand klarer.
Ich wählte einen Weg zum Heiligen Baum, auf dem mir nur wenige andere Menschen begegnen würden. Mir stand nicht der Sinn nach einem Gespräch – vor allem nicht heute. So folgte ich dem spiralförmigen Weg, der sich um den Baum wand, aufwärts, bis ich einen langen Ast erreichte, der wie eine Brücke zum nächsten ragte.
Das Labyrinth aus verschlungenen Baumpfaden im Dorf konnte selbst für Menschen, die ihr ganzes Leben hier verbracht hatten, eine Herausforderung darstellen, denn die Dagun veränderten den Aufbau regelmäßig, um ihn den Bedürfnissen der Bewohner anzupassen. Mehrmals musste ich umkehren, weil ein Ast ins Nichts ragte, dabei hätte ich schwören können, dass er vor einigen Tagen noch in eine andere Richtung gezeigt hatte. Aber letzten Endes erreichte ich mein Ziel.
Am südlichen Zipfel des Dorfes lag ein See, in dessen Oberfläche sich die Baumkronen so klar spiegelten, dass es mir manchmal so erschien, als würde ich mich an der Grenze zwischen zwei Welten bewegen. Einzelne aus dem Wasser ragende Steine bildeten einen Pfad, dem ich nun zur Insel in der Mitte des Sees folgte.
Der Heilige Baum war eine Versammlungs- und Gebetsstätte für alle Bewohner des Dorfes, doch jedes Mal, wenn ich auf dem Weg dorthin von Stein zu Stein hüpfte und die leuchtenden Fische unter der Wasseroberfläche mich neugierig betrachteten, kam ich mir wie ein Eindringling vor. Als würde ich etwas Verbotenes tun.
Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen, als ich die Insel betrat, auf der ein einziger, gigantischer Baum wuchs, dessen Äste die gesamte Umgebung überspannten. Die Höhlen in seinem Inneren waren nicht von uns erschaffen worden, denn es war untersagt, den Heiligen Baum, Ulun Purlutai, mithilfe von Magie zu verformen. Stattdessen fanden hier die Geschöpfe des Waldes ein Zuhause. Mogus, wie Qatou einer war, aber auch Vögel, Nagetiere und die Telai, schneckenartige Kreaturen, die nachts aus ihren Schlupfwinkeln in der Baumrinde krochen und in bunten Farben leuchteten. Das Einzige, was überhaupt auf die Anwesenheit von Menschen hindeutete, war eine aus dem Boden ragende Wurzel, in deren Schutz sich ein einzelner Stein befand. Auf ihm saß der Mann, den ich suchte. Seher Khar – der Qo’aivyn.
Beklommen blieb ich in einigem Abstand vor ihm stehen und fragte mich, ob es wirklich so eine kluge Idee gewesen war, hierherzukommen. Plötzlich erschien es mir albern, den Qo’aivyn mit meinem Anliegen zu belästigen, und ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das seine Eltern nachts wegen eines schlechten Traums aus dem Bett holte. Doch ehe ich es mir anders überlegen konnte, hatte Seher Khar mich entdeckt.
»Tritt heran.«
Ich schluckte schwer und verschränkte die Hände vor meinem Körper, um das Zittern darin zu verbergen. Mit vorsichtigen Schritten ging ich auf den Stein zu. Er war nicht sonderlich hoch, leicht zu erklimmen, doch es reichte, um den Größenunterschied zwischen dem Qo’aivyn und mir zu betonen und mich zusätzlich einzuschüchtern. Der Schatten der Baumwurzel hüllte den Boden um mich herum in Dunkelheit, während ein einzelner Lichtstrahl genau so durch eine Lücke brach, dass er den Seher in strahlendes, warmes Licht tauchte.
Wie immer, wenn ich ihn sah, überraschte mich sein Alter. In meiner Vorstellung war der Seher so alt wie der Wald selbst, doch der Mann, der vor mir saß, hatte kaum dreißig Sommer erlebt. Seine Haut war blass wie meine eigene und auf seiner Stirn entdeckte ich feine Fältchen, die sich vertieften, als ich mich vorsichtig räusperte. Er verlagerte sein Gewicht nach vorn, wobei der Stoff seiner weißen Robe leise raschelte, und musterte mich.
»Kaeliah.«
Es verblüffte mich, dass Seher Khar meinen Namen kannte. Schließlich lebten allein im Dorf fast zweitausend Menschen – unzählige weitere Mitglieder unseres Volkes waren in anderen Gebieten der Wispernden Wälder verstreut.
»Qo’aivyn«, erwiderte ich und verbeugte mich leicht. »Ist es gerade ungünstig?«
Ich zwang mich, die Nervosität abzuschütteln, um nicht wie ein kleines Kind zu wirken. Selbstbewusst reckte ich das Kinn. Wenn der Seher meinen Albtraum nicht weiter besorgniserregend fand, würde er mir das schon sagen.
Er schüttelte den Kopf und lehnte sich wieder zurück, die Hände locker auf seinen überkreuzten Beinen. »Wie kann ich dir helfen?«
»Ich brauche deinen Rat«, begann ich, wobei ich unschlüssig von einem Bein aufs andere trat. Bisher hatte ich noch nie die Hilfe des Sehers gesucht und wusste nicht so recht, was von mir erwartet wurde. Sollte ich mich hinsetzen, knien oder weiter hier herumstehen? »Ich hatte einen … Traum.«
»Einen Traum?« Allein die Art, wie er missbilligend die Brauen zusammenzog, ließ mich mein Handeln sofort bereuen. Aber nun gab es kein Zurück.
»Qo’aivyn. Ich weiß, du hast vor Kurzem erst darüber gesprochen, dass Träume normalerweise nichts zu bedeuten haben.«
»Das habe ich«, fiel er mir ins Wort.
»Dieser Traum hat sich nur so … anders angefühlt. Der Wald hat gebrannt und ich war mittendrin, alles war so echt. Es kam mir mehr wie eine Vision oder etwas in der Art vor.«
»Kaeliah.« Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und tauchte sein Gesicht in die Sonnenstrahlen, als würden sie ihm Worte zuflüstern. »Was weißt du über den Wald?«
Ich seufzte. »Gourbolun ist ein lebendiges Wesen«, wiederholte ich das Wissen, das mir von Kindesbeinen an beigebracht worden war. »Er besitzt ein eigenes Bewusstsein, kann fühlen wie wir Menschen auch.«
»Und er kommuniziert einzig und allein mit dem Qo’aivyn.« Der Seher strich mit den Fingern über die Oberschenkel, bevor er von dem Stein glitt. Beinahe lautlos kam er neben mir auf dem Boden auf und war mit einem Mal sogar kleiner als ich. Väterlich legte er die Hand auf meine Schulter. »Kaeliah. So etwas wie Visionen gibt es nicht. In unseren Träumen verarbeiten wir oft unsere eigenen Gedanken und Gefühle, was in der Vergangenheit hin und wieder zu der Auslegung geführt hat, es gäbe Menschen, die in die Zukunft sehen können.«
»Ich weiß.«
»Bist du vielleicht unruhig oder verängstigt? Bereitet dir etwas Sorgen? Die Zeremonie heute Nacht?«
Unwillkürlich fiel mein Blick auf die Halskette, die der Seher trug. An einem opulenten Band aus Gold baumelte ein schlanker weißer Edelstein, der die Länge meines Zeigefingers besaß und von innen heraus zu glühen schien. Ein Qo’ai, ein Kristall aus dem Harz des Heiligen Baumes, der jedem Menschen meines Volkes nach seinem achtzehnten Sommer übergeben wurde, um aus ihm ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu machen.
Energisch schüttelte ich den Kopf. »Ich bin aufgeregt, ja, aber ich vertraue darauf, dass Gourboluns Entscheidung mich in eine gute Zukunft führen wird«, antwortete ich und meinte meine Worte auch genau so. Ich war nicht nervös oder gar ängstlich wegen der Zeremonie, sondern vielmehr erwartungsvoll.
»Sehr gut.« Der Seher nahm die Hand von meiner Schulter. »Dann sehe ich dich heute Abend.«
Er ließ mir keine Zeit, Widerworte einzulegen, geschweige denn mich angemessen zu verabschieden. Meine überrumpelte Verbeugung sah er schon gar nicht mehr, da er sich längst abgewandt hatte und in Richtung des Pfads schlenderte, der am Ufer der kleinen Insel entlangführte. Als hätte unser Gespräch gar nicht stattgefunden. Als hätte mein Albtraum keinerlei Bedeutung – was vermutlich der Wahrheit entsprach, obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes weismachen wollte.
Überfordert blieb ich unter der Wurzel stehen, ohne eine Ahnung, was ich mit dem Rest des Tages anfangen sollte. Andere Jugendliche in meinem Alter verbrachten ihren letzten Tag als »Kinder« mit ihren Eltern, legten Schmuck und schöne Kleider an oder bereiteten sich mental auf die Zeremonie vor, die buchstäblich ihr Leben veränderte. Aber ich? Ich hatte niemanden, der mir Gesellschaft leisten würde. Nur Qatou, der mit einer Beere zwischen den Pfoten auf meiner Schulter landete und seine Zähne in das pinkfarbene Fruchtfleisch schlug.
II
Kae
In den Wispernden Wäldern waren die Nächte mit der Magie getränkt. Daher war es kein Wunder, dass die meisten Dorfbewohner es vorzogen, bis lange nach der Dämmerung wach zu bleiben. Statt durch Blätter gefiltertes Sonnenlicht war es dann der Wald selbst, der die Welt erhellte. Die Telai, die aus ihren Verstecken krochen und in allen Farben des Regenbogens schimmerten, Spinnennetze, die aussahen, als wären sie aus glühender Seide gesponnen, und die vielen, vielen anderen Kreaturen, deren Fell, Schuppen oder Federn leuchteten wie die Sterne. Man erzählte sich, dass die Tiere des Waldes aus Licht geschaffen waren, und in Nächten wie heute glaubte ich sogar daran.
Obwohl ich den ganzen Tag wenig zu tun gehabt, mich nur am Fluss gewaschen und frische Kleidung angelegt hatte, zögerte ich meinen Aufbruch zum Heiligen Baum bis zum letzten Moment hinaus. Immer wieder zupfte ich den weichen schwarzen Stoff des geliehenen Gewandes zurecht, das sich wie ein Fremdkörper auf meiner Haut anfühlte. Zusammen mit den Bändern in meinen Haaren und den vielen Ketten und Gürteln, die mein Körpergewicht vermutlich verdoppelten, erweckte ich zwar den Anschein, als wäre ich Teil der Zeremonie, aber es fühlte sich nicht so an. Ich vermisste meine kurze Kleidung, in der ich mich frei bewegen und den Wind auf meinen Gliedern spüren konnte. Stattdessen steckte ich in diesem Kokon aus Stoff fest. Einen Vorteil hatte der jedoch …
Ich unterdrückte ein Kichern, als Qatou es sich auf Höhe meiner Brust bequem machte. Durch die Gürtel um meine Taille bildete die Seide eine Art Tasche, in der der Mogu selbst während der Zeremonie nicht von meiner Seite weichen musste.
»Kae?«
Ich runzelte die Stirn, als jemand meinen Namen rief, und bevor ich die Stimme zuordnen konnte, stand Dhan auch schon in meinem Zimmer. Das schiefe Lächeln auf seinem Gesicht wirkte vorsichtig, fast so als fürchtete er, ich könnte ihm den Kopf abbeißen.
»Solltest du nicht mit den anderen bei Ulun Purlutai sein?«, fragte ich.
»Sollte ich.« Seine Mundwinkel hoben sich noch ein Stück mehr und ein schelmisches Funkeln erhellte seine braunen Augen. »Aber ich wollte sichergehen, dass du keine kalten Füße bekommst.«
»Meinst du das ernst?« Ich überbrückte die winzige Distanz zwischen uns und blickte ihn herausfordernd an. »Wieso denken alle, dass ich Angst vor der Zeremonie habe?«
»Weil es ein großes Ereignis ist, das über deine ganze Zukunft bestimmt? Du behauptest doch nicht etwa, dass du nicht zumindest ein kleines bisschen nervös bist?«
Ich musterte Dhan. Angefangen bei seinen zerzausten braunen Haaren, über sein feines Gesicht, die vollen Lippen und seine Wangen, auf denen der Hauch eines Bartschattens lag, bis hinab zu seiner Kette. Seinen grünen Qo’ai hatte er vor drei Monden erhalten. Jetzt war er einer der Komen, die die Plantagen am Rand des Dorfes betrieben und den Wald auf der Suche nach Nahrungsmitteln durchstreiften. Seit der Zeremonie hatte ich ihn nur von Weitem zu Gesicht bekommen. Er kam mir älter vor. Erwachsener. Ernster.
»Wieso bist du hier?«, überging ich seine Frage und erntete ein Schulterzucken.
»Ich dachte …« Er starrte an die niedrige Decke. »Ich dachte nur, dass du dich vielleicht wohler fühlst, wenn du nicht allein bei der Zeremonie erscheinen musst.«
Ich schluckte, um das Unwohlsein loszuwerden, das sich augenblicklich in meiner Brust zusammenbraute. Es war üblich, dass Kinder von ihrer ganzen Familie zur Feier gebracht wurden – eine Art Übergabe, die die Brücke ins Erwachsenenalter symbolisierte. Aber ohne Mutter, Vater, Großeltern oder sonstige Verwandtschaft gab es niemanden, der mich zum Heiligen Baum hätte begleiten können.
»Ist das denn erlaubt?«, fragte ich mit belegter Stimme und Dhan lächelte. Zärtlich strich er mir eine lose Haarsträhne hinters Ohr.
»Denkst du, das interessiert mich?«
Seine Worte brachten mein Herz kurz zum Stolpern, woraufhin ich ihn leicht überfordert in eine Umarmung zog. Dhan und ich waren von Kindesbeinen an befreundet, doch anders als alle anderen war er nie von meiner Seite gewichen. Und das bis heute.
»Du zitterst«, stellte er fest.
»Das bin nicht ich.« Schnell rückte ich wieder von ihm ab, während Qatou knurrend aus meinem Kleid kletterte.
»Hast du etwa vor, den kleinen Waldgeist mitzunehmen?«
»Nicht, dass er mir eine andere Wahl lässt.« Zärtlich streichelte ich ihm über den Rücken, worauf er sich beruhigte und sich wieder in seine Stoffhöhle verkroch. Wie gesagt – ich hatte keine Wahl. Wie auch bei der Zeremonie. Oder der Tatsache, dass ich es vorgezogen hätte, mich allein auf den Weg zu machen. Denn obwohl ich Dhans Geste schätzte, wäre es mir lieber gewesen, den Abend einfach hinter mich zu bringen, ohne dass die Leute darüber tuschelten, wieso ich nicht allein auftauchte.
»Hast du deinen Kranz?«, fragte Dhan.
»Ja.« Ich ging zu der Stelle, wo die Wand meiner Höhle eine Knolle formte, die ich als Tisch nutzte. Dort hatte ich die letzten Wochen damit zugebracht, meinen Juge-Kranz zu formen und zu perfektionieren. Unmittelbar nach unserer Geburt wurde am Rande des Dorfes ein Juge-Strauch gepflanzt, der mit uns wuchs, bis wir alt genug für die Zeremonie waren. Wie auch alle anderen, die gleich mit mir ihren Qo’ai erhalten würden, hatte ich die Zweige vor Kurzem beschnitten und daraus einen Kranz geformt. Die grünen herzförmigen Blätter raschelten, als ich ihn hochnahm.
»Dann sollten wir los.«
Wieder kam mir der Gedanke, dass ich eigentlich lieber allein losgegangen wäre, doch statt etwas zu sagen, versuchte ich ein Lächeln aufzusetzen. Es war schon spät, und wenn eines in diesem Dorf noch skandalöser war, als allein mit einer Person aus einer anderen Familie bei einem Fest aufzutauchen, dann die Unverschämtheit, unpünktlich zum wichtigsten Tag seines Lebens zu erscheinen.
»Hast du eigentlich einen Wunsch, in welche Zunft dich Ulun Purlutai schicken soll?«
»Nein.« Dhans ausgestreckte Hand ignorierend hüpfte ich von einer Wurzel und ging zielstrebig weiter in Richtung Dorfrand. Inzwischen war ich doch nervös, aber nicht wegen der Zeremonie, sondern weil mir klar wurde, dass ich viel zu lange getrödelt hatte. »Hattest du einen?«
»Ich wollte zu den Dagun – aber ich kann mich nicht über die Komen beschweren.«
Die Farbe Gelb stand für die Dagun, eine kleine, dennoch hoch angesehene Zunft, die mithilfe von Lichtmagie das Wachstum der Bäume beeinflussen konnte.
Ich fragte mich, ob mein Schicksal wohl bei ihnen auf mich wartete oder ob der Heilige Baum eine andere der insgesamt sieben Zünfte für mich vorsah. Mit den Händen war ich nicht sonderlich geschickt, wie ich beim Stecken meines Kranzes gemerkt hatte, also machte er hoffentlich keine Quturtan aus mir, die Stoffe und Kleidung für das Dorf herstellte. Vielleicht eine Takoutan? Menschen, die dem Seher bei seinen Aufgaben halfen und sich um die hilfsbedürftigen Mitglieder der Gesellschaft kümmerten? Allerdings konnte ich nach der Begegnung am Morgen gut darauf verzichten, näher mit dem Qo’aivyn zu tun zu haben.
Die Fische im See erstrahlten in der Nacht besonders stark und erhellten mit ihrem warmen Schein die Bäume in der Umgebung, während das Wasser wirkte, als bestünde es aus flüssigem Feuer. Von der Insel drang bereits Stimmengewirr zu uns herüber und ich beeilte mich, den Steinpfad zu überqueren.
Auf der anderen Seite erwarteten mich Seher Khar und die anderen Jugendlichen samt ihren Familien, die mich missbilligend musterten. Ich starrte ausdruckslos zurück und zuckte kurz zusammen, als Dhan mir die Hand auf die Schulter legte. Er meinte es gut, doch seine Anwesenheit machte die angespannte Stimmung nicht erträglicher.
Keiner sprach ein Wort, als der Seher uns bedeutete, ihm zu folgen. Er führte uns zu der riesigen Wurzel, unter der er am Morgen meditiert hatte und nun das gesamte Dorf versammelt war. Tuschelnd knieten sie auf dem Boden, alle bei ihren Zünften, in neugieriger Erwartung auf den Beginn der Zeremonie.
Seher Khar führte uns direkt an die Stelle, wo die gigantische Wurzel im Boden versank, und bedeutete uns, dort zu warten. Er selbst schloss die Hand um den weißen Bernstein an seinem Hals und summte eine mir fremde Melodie.
Wie auf ein unsichtbares Zeichen erklang der Schlag einer Trommel. Der wortlose Gesang des Qo’aivyn wurde lauter und nun setzte auch der Rest des Volkes mit ein. Stimmen mischten sich unter den Rhythmus, wurden zu einer eigentümlichen Melodie, die mich an das Brummen eines riesigen Insektenschwarms erinnerte. Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen und Dhan verstärkte den Griff um meine Schulter. Doch seine Anspannung war nichts im Vergleich zu der nackten Angst, die ich auf den Gesichtern der anderen Jugendlichen erkannte.
Statt sie anzusehen, wandte ich meinen Blick zu den Bewohnern des Dorfs, die sich im Takt der Melodie hin- und herwiegten. Sie alle trugen ihre Kristalle deutlich zur Schau, sodass sie zu einem riesigen Regenbogen verschwammen, der in dieser Neumondnacht heller erstrahlte als all die anderen Lichter zusammen.
Hinter ihnen am Stamm hatten die Gurangin bereits das Festmahl zubereitet, das nach der Zeremonie verspeist werden würde. Ein fruchtiger Duft wehte zu mir herüber, doch ich kam nicht umhin festzustellen, dass die Auswahl kleiner war als sonst bei feierlichen Anlässen. Die vielen Körbe und Töpfe waren teilweise nicht einmal bis zur Hälfte gefüllt. Ein Anblick, der mir einen Schauer den Rücken hinablaufen ließ.
Was auch immer der Heilige Baum für mich vorgesehen hatte, ich hoffte, dass ich in meiner neuen Rolle dabei helfen konnte, die Krise zu überwinden.
»Sureene.«
Das Mädchen, das mir am nächsten stand, zuckte erschrocken zurück, als der Seher ihren Namen aufrief. Ihre Eltern mussten sie förmlich in seine Richtung schieben, doch die letzten drei Schritte hatte Sureene allein zu gehen. Ihre Familie nickte ihr wohlwollend zu, bevor sie sich abwandte und zu den anderen Menschen ihrer Zunft setzte, um in den Gesang miteinzustimmen.
Sureene war beim Seher angelangt, der ein paar Worte mit ihr wechselte, die ich aus der Distanz nicht verstand. Sie nickte und ging in die Knie, um ihren Kranz an die Wurzel des heiligen Baumes zu legen, ein Gebet auf den Lippen. Einige Momente verstrichen, ehe sie sich wieder aufrichtete, wobei ihre Augen im bunten Licht glasig wirkten. Nun reichte Seher Khar ihr ein Messer, wieder ein Nicken. Dann holte sie aus und stach die Klinge in die Wurzel des Heiligen Baumes.
Unter der Rinde strahlte ein grellweißes Licht, das sich in winzigen Tropfen in die Hand des Mädchens ergoss. Kurz kam mir der wirre Gedanke, dass sie sich daran verbrennen müsste, doch entgegen ihrer bisherigen Furcht zuckte sie jetzt nicht einmal mit den Wimpern.
Sobald der letzte Tropfen des Baumharzes in ihrer Hand gelandet war, schloss Sureene ihre Finger um das Material und wartete. Ein paar Takte der Musik verstrichen, bis Seher Khar ihr bedeutete, dass es an der Zeit war. Sie öffnete ihre Finger, und der Bernstein, der sich darin gebildet hatte, leuchtete in strahlendem Orange.
»Gurangin!«, verkündete der Qo’aivyn.
Ich meinte Freudentränen auf Sureenes Gesicht zu erkennen, als sie sich in den Reihen ihrer neuen Zunft niederließ, direkt an der Seite ihrer Eltern, wo sie fortan dafür sorgen würde, dass unser Volk stets warme Speisen hatte.
Anschließend rief der Seher den Nächsten zu sich. Soqe, der ebenfalls zu den Gurangin gehören sollte. Dann Jeruli, die der Heilige Baum zu den Takoutan schickte, und Areen, der sich mit einem blauen Stein in der Hand zu den Houran, den Lehrern und Geschichtsschreibern, setzte.
Natürlich kam ausgerechnet ich als Letzte an die Reihe, aber das hatte ich wohl verdient, nachdem ich die anderen hatte warten lassen. Auf halber Strecke zum Seher ließ Dhan von mir ab. Beinahe kraftlos glitt seine Hand von meinem Rücken und ich sah aus dem Augenwinkel, wie er sich bei den anderen Komen niederließ. Ab hier war ich auf mich allein gestellt. Ich reckte das Kinn noch ein Stück, um kein ebenso verängstigtes Bild wie die anderen abzugeben. Qatou an meiner Brust zitterte jedoch mit jedem Schritt mehr, als wüsste er, dass gleich etwas Wichtiges geschehen würde.
Als ich den Qo’aivyn erreichte, starrte dieser mich nur wortlos an. Anscheinend hatte er entschieden, dass ich genug gesehen hatte, um zu wissen, was ich zu tun hatte. Ich atmete tief ein und kniete mich auf den Boden, um meinen Kranz zu den anderen zu legen, wobei mir auffiel, wie viel kleiner er im Vergleich war. Mein Herz zog sich unangenehm zusammen. Eigentlich wurde der Juge-Strauch bei der Geburt gepflanzt, doch anders als die anderen war ich nicht im Dorf geboren worden. Die Komen hatten mich im Wald gefunden, als ich bereits ein paar Sommer alt gewesen war. An das, was davor war, erinnerte ich mich nicht. Und die meiste Zeit fragte ich mich auch nicht, wer meine Eltern waren, oder was passiert war. Außer jetzt, wo ich meinen kleinen Kranz neben den anderen sah.
Ich schloss die Augen und murmelte mein Gebet, um den Schmerz in meiner Brust zu verdrängen. Danach richtete ich mich auf, nahm dem Qo’aivyn das Messer ab und wandte mich der mächtigen Wurzel zu, in deren Schatten ich mir wie ein winziges Insekt vorkam. Ich entdeckte zahlreiche Kratzer in der Rinde von den Tausenden vor mir, die diese Zeremonie bestritten hatten. Und wie auch sie würde ich meinen Platz in der Gesellschaft finden. Meine Herkunft spielte keine Rolle.
Entschlossen stach ich das Messer in die Rinde des Baumes. Wie bei den anderen öffnete sich eine kleine Mulde, aus der nach kurzer Zeit weiß schillerndes Harz tropfte. Unbeholfen formte ich mit der Hand eine Schale, um das kostbare Material aufzufangen, und legte meine Finger darum, sobald der Strom versiegte.
Dann wartete ich.
Ich hatte keine Ahnung, ob ich etwas Besonderes sehen oder spüren sollte, während sich der Bernstein formte. Ein Kribbeln in meiner Brust? Eine Vision meiner Zukunft? Obwohl – diese gab es laut dem Qo’aivyn ja nicht. Aber vielleicht etwas anderes, das diesen Moment außergewöhnlich machte.
Aber da war nichts. Ich war einfach nur ich. Und ich blieb auch ich, als der Seher mir endlich das Zeichen gab, mich dem Volk zuzuwenden und meine Hand zu öffnen. Tief durchatmend kam ich seiner Aufforderung nach und hätte meinen Qo’ai vor Überraschung beinahe fallen gelassen.
Er war nicht grün wie der meines Freundes Dhan. Oder orange, blau oder violett wie bei den Jugendlichen zuvor. Auch nicht gelb. Oder rot. Oder magentafarben. Sondern weiß. Weiß wie die Farbe des Harzes, bevor es sich verfestigte. Weiß wie der Qo’ai, den Seher Khar besaß.
Der Gesang und die Trommeln verebbten, noch ehe der Qo’aivyn meine Bestimmung verkündete. Ein Wimpernschlag, in dem der gesamte Wald den Atem anzuhalten schien. Ich spürte Überraschung, Verwirrung, aber vor allem Panik, als ich den Blick hob und dem Seher in die Augen schaute. Der kalte Zorn darin traf mich wie ein Blitzschlag, riss mir den Boden unter den Füßen weg und ließ mich gleichzeitig wünschen, ich hätte das Weite gesucht, statt zur Zeremonie zu erscheinen.
Der Erste, der die Stimme erhob, war auch nicht der Seher. Oder ich. Sondern ein alter Mann, der in der vordersten Reihe saß.
»Qo’aivon!«, verkündete er ehrfürchtig, bevor er die Hände erst in die Höhe streckte und sich anschließend verbeugte. Als hätte es nur einen Auslöser gebraucht, taten die anderen es ihm gleich. Eine Kettenreaktion, die wie eine Welle durch mein Volk ging. Einige riefen meinen Namen. Andere »Qo’aivon«. Sehersanwärterin. Und meinten damit mich. Ausgerechnet. Das Waisenmädchen, das niemals irgendwo dazuzugehören schien.
Unbändiger Stolz ließ meine Brust anschwellen, ein Lächeln meine Mundwinkel nach oben wandern. Heute Morgen war ich als niemand aufgewacht, aber jetzt war ich Kaeliah, Qo’aivon der Eijn. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, wirklich ein Teil meines Volkes zu sein.
III
Hunter
Vier Wochen später
Als Prinz eines mächtigen Imperiums wurde man auf viele Dinge vorbereitet. Auf Ansprachen und Bälle. Banketts und diplomatische Besuche. Darauf, in der Öffentlichkeit jederzeit sein Gesicht zu wahren. Aber niemals auf die zerstörerische Gewalt des Verlusts eines geliebten Menschen.
Als Dr. Hemsworth endlich aus dem Krankenzimmer trat, hatte sich die Kälte längst in meine Glieder gefressen. Seit Stunden saß ich hier auf dem Korridor, wie es sich für einen Prinzen eigentlich nicht gehörte. Aber was hätte ich sonst tun sollen?
Der hagere Arzt, der meiner Familie schon seit Ewigkeiten diente, entdeckte mich und schüttelte nur still den Kopf, bevor er sich empfahl. Ich sah ihm nicht hinterher. Stattdessen erhob ich mich von meinem Platz auf dem Boden und näherte mich dem Raum. Dabei hätte ich so viel lieber das Weite gesucht.
Auf das, was ich dort drinnen vorfinden würde, hatte mich niemand vorbereitet, aber ich schluckte meine Angst herunter, weil ich meine Pflicht kannte. Und weil ich meine Mutter jetzt unmöglich allein lassen konnte.
Vorsichtig schob ich die Tür des Zimmers auf, das im Vergleich zum Rest des Palastes ungewohnt zweckmäßig eingerichtet war. Laken, Wände, Vorhänge – alles in Weiß. Selbst der Fußboden kam mir blasser vor.
Meine Mutter saß am Fußende des langen Bettes, das einen Großteil des hohen Raumes einnahm. Sie hatte das Gesicht in den Händen vergraben und ihr sonst so fein frisiertes braunes Haar hatte sich aus dem Dutt gelöst, während Schluchzer ihren zierlichen Körper erzittern ließen.
Mit aller Kraft zwang ich mich dazu, meinen Blick nicht auf ihr verharren zu lassen. Mir stattdessen die reglose Gestalt im Bett anzusehen. Meinen Bruder, dessen sonnengeküsste Haut auf einmal ganz fahl war, passend zum Rest des Raumes. Seine Miene wirkte friedlich. Der Arzt hatte vermutlich ein spezielles Mittel verwendet, um die bläulichen Lider zu schließen und seine blutunterlaufenen Augen darunter zu verstecken. Nur an Alexanders Lippen haftete noch ein verräterischer Hauch Rot.
Ich hatte im Leben schon viele Menschen gesehen, die den Sporen erlegen waren, doch nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen hatte ich daran gedacht, dass dieses Schicksal meinen Bruder ereilen könnte.
Ich drehte den Kopf zur Seite, weil ich seinen Anblick nicht länger ertrug, und bemühte mich, meine brodelnden Gefühle im Zaum zu halten. Angespannt biss ich die Zähne zusammen, während ich mich auf den freien Stuhl neben meiner Mutter setzte. Sie weinen zu sehen, hinterließ eine seltsame Beklommenheit in meiner Brust. Die mächtigste Frau der Welt schien auf einmal winzig klein.
Hilflos legte ich ihr eine Hand auf den Rücken, was sie erschrocken zusammenfahren ließ. Wie ertappt richtete sie sich auf und wischte die Tränen ab, doch ihr Gesicht war völlig verquollen.
»Wann bist du reingekommen?«
»Gerade eben.«
Sie nickte. »Dein Bruder …« Ihre sonst so feste Stimme klang fragil, zart wie frisch gefallene Schneekristalle.
»Ich weiß.«
Ich widerstand dem Impuls, erneut hinzusehen. Es war schon zu viel gewesen, ihn halb erstickt in der Orangerie zu finden, wo er immer hingegangen war, um den Kopf freizubekommen und frische Luft zu schnappen. Frisch – oder wie man es sonst nennen wollte in einem Land, in dem ein bloßer Spaziergang im Garten tödlich enden konnte.
Seit ich Alexander dort entdeckt hatte, war ein ganzer Tag vergangen. Zuerst hatte der Arzt ihm gute Überlebenschancen eingeräumt, doch über Nacht hatte sich sein Zustand drastisch verschlechtert. Und jetzt, kurz nach Sonnenaufgang, hatten die toxischen Sporen, die er eingeatmet hatte, seine Lunge vollständig zersetzt. Alexander Louis Athgolan, Kronprinz und zukünftiger Kaiser des Eisernen Imperiums, dahingerafft von demselben Gift, das sein Volk schon seit Jahrzehnten wie die Fliegen sterben ließ.
Neben mir räusperte sich meine Mutter und nahm eine aufrechte Haltung an. Ich sah förmlich, wie sie die liebende Mutter in sich hastig begrub, um stattdessen die Herrscherin heraufzubeschwören.
»Hunter.« Jetzt verwendete sie die ruhige Stimme, die sie für unliebsame Besprechungen reserviert hatte. »Wir müssen über deine Zukunft sprechen.«
Ich blinzelte verwirrt, konnte nur mit Mühe verhindern, dass mir der Mund offen stand. »Meine Zukunft?«
»Deine Zukunft.«
»Ist das dein verdammter Ernst?« Da waren sie, die Emotionen, die ich bis eben noch sorgsam unter Verschluss gehalten hatte. »Du willst jetzt über meine Zukunft sprechen?«
»Es ist nicht nur deine, sondern die des ganzen Landes.«
Ich schoss in die Höhe. »Und das Scheiß-Land kann nicht mal fünf Minuten warten, bis sein Kronprinz kalt ist?«
»Hunter!«
»Was? Was erwartest du von mir? Dass ich mich mit dir hinsetze und so tue, als wäre ich er, damit das Volk bloß nicht merkt, dass die kaiserliche Dynastie so etwas wie Gefühle besitzt?«
Meine Mutter starrte mich ungerührt an, ein Ausdruck in ihrem Blick, der mich trotz des sommerlichen Wetters Kälte spüren ließ. »Ich möchte, dass du dich mit dem Gedanken vertraut machst, deinen rechtmäßigen Platz einzunehmen.«
»Du willst mich auf dem Thron sehen?« Ein bitteres Lachen kam mir über die Lippen. »Hörst du dir eigentlich selbst zu?«
»Ich will mit dir über die Möglichkeit sprechen.«
»Hier und jetzt?«
»Denkst du, unsere Feinde warten, bis wir uns von diesem Verlust erholt haben?«
Nein, wollte ich antworten, weil meine Mutter das erwartete. Aber stattdessen zischte ich nur: »Keine Ahnung. Vielleicht wüsste ich mehr über diese ominösen ›Feinde‹, wenn du mich nicht mein ganzes Leben lang aus sämtlichen Staatsangelegenheiten rausgehalten hättest.«
Meine Mutter sackte zusammen. Der Vorwurf hatte gesessen. Sie wusste genauso gut wie ich, dass dieses Dilemma hätte vermieden werden können, sodass sie nicht am Totenbett meines Bruders das Schicksal eines ganzen Reiches auf meine Schultern legen musste.
Ich schnaubte verächtlich. Ich und Kaiser. Als ob. Jeder andere Mensch wäre weitaus besser für den Thron geeignet als ich. Aber meine Mutter wollte mich. Dass ich nicht lache.
»Scheiße«, knurrte ich. »War es das dann? Oder willst du mich auch gleich noch vereidigen?«
Ihre Lippen bildeten einen schmalen Strich, ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Diskussion lange nicht beendet war. Für sie zumindest. Für mich dagegen …
Ich wartete ihre Antwort gar nicht mehr ab, sondern stürmte aus dem Zimmer. Ich musste von hier verschwinden. Bloß weg von diesem Raum, weg von dem Schrecken der letzten Stunden und weg von dieser Zukunft, die nicht meine eigene war.
Eine ganze Weile rannte ich ziellos im Palast umher. Die Anlage war so weitläufig, dass die scheinbar endlos langen Korridore an den meisten Tagen reichten, um meine schwelenden Gefühle in einem Dauerlauf zu ersticken. Heute nicht. Mir kamen ganze Heerscharen an Angestellten, Soldaten und Boten entgegen – allen genügte mein bloßer Anblick, um zu wissen, was passiert war. Betreten wichen sie vor mir zurück und sahen zu Boden. Hin und wieder hörte ich Beileidsbekundungen, die das Feuer in meinem Inneren nur von Neuem entfachten.
Irgendwann erreichte ich das äußerste Ende des Ostflügels. Von hier aus führte ein gläserner Tunnel durch die Gärten, die seit Jahren keine mehr waren. Dort wurde mir klar, was ich tun musste. Entschlossen öffnete ich die unscheinbare Pforte, die in die Passage führte, und sofort blendete mich strahlendes Licht.
Offenbar hatte das Wetter nicht verstanden, was passiert war, denn die Sonne verhieß einen idyllischen Sommertag. Einer, der zum Entspannen, Spazierengehen und Reiten einlud – Dinge, die im Eisernen Imperium niemand mehr tat.
Einen Augenblick hielt ich inne und schaute hinaus. Der Himmel war klar und blau. So unscheinbar. Nur wenn man genau hinsah, erkannte man in der Luft und auf dem Boden winzige weiße Partikel, feiner als jede Schneeflocke, die in der sanften Brise tanzten und nachts leuchteten wie Glühwürmchen. Dabei waren sie weder das eine noch das andere. Sondern weitaus komplexer. Tödlicher.
Sporen.
Eine weitere Welle der Wut bäumte sich in meinem Inneren auf. Dieses Mal nicht auf meine Mutter, sondern auf diese kaputte Welt, die wir bewohnten. Eine Welt, die Menschen wie meinen Bruder viel zu früh aus dem Leben riss.
Ich schluckte, schüttelte den Kopf und rannte weiter. Schneller dieses Mal, obwohl meine Beine nach dem Lauf durch den Palast protestierten. Was einst der Garten gewesen war, zog an mir vorbei. Statuen, Säulen, Springbrunnen, überwucherte Pfade, die die Natur längst zurückerobert hatte. Von meiner Mutter wusste ich, dass mein Ururgroßvater nach dem Ausbruch der Sporen alles darangesetzt hatte, die Anlage zu erhalten, doch mittlerweile war uns bewusst, dass wir den Kampf gegen den Wald nicht gewinnen konnten. Selbst Gasmasken schützten nur eine kurze Zeit vor den Sporen, bevor diese sich wie Säure durch die Filter fraßen. Wie ein eigenständiger Organismus, der es auf alle Lebewesen abgesehen hatte.
Am Ende des gläsernen Tunnels erreichte ich mein eigentliches Ziel: Den Flugplatz, auf dem bei feierlichen Anlässen die Gäste des kaiserlichen Hofes landeten. In einem abgetrennten Bereich des Hangars lag meine Pilotenausrüstung. Dort erwartete mich bereits Nyota.
Sie quittierte mein Erscheinen mit einem Schnauben und stellte sich mir in den Weg. In dem opulenten schwarzen Kleid, das mit ihrer Haut zu verschmelzen schien, wirkte sie einschüchternd, vor allem wenn sie wie jetzt die Arme vor der Brust verschränkte und mich von Kopf bis Fuß musterte.
»Was wird das hier, Hunter?«
Ich wich ihrem Blick aus und betrachtete stattdessen den goldenen Anhänger an ihrem Halsband. Ein Sperling, das Wappentier des Fürstentums Zazwa. Ihrer Heimat.
»Lass mich durch.«
»Ich glaube nicht, dass du in deinem Zustand in ein Cockpit steigen solltest.«
Nun sah ich ihr doch in die Augen. An anderen Tagen hätte mich das bedrohliche Funkeln darin erschrocken zurückweichen lassen – aber nicht heute.
»Nyota«, zischte ich.
»Ja?«
»Wieso bist du hier?«
»Wegen dir. Weil ich dich kenne und geahnt habe, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis du irgendwas Leichtsinniges unternimmst.«
Beinahe hätte ich gelacht. Sie kannte mich echt zu gut. Auch wenn es mich überraschte, wie schnell die Nachricht sich herumgesprochen hatte. »Alexander hat es nicht geschafft«, sprach ich aus, was wir beide bereits wussten. Ich hatte keine Ahnung, was ich sonst sagen sollte.
»Ich weiß. Es tut mir leid.« Nyotas Lippen bildeten einen schmalen Strich, als wäre sie genauso verblüfft, die Nachricht aus meinem Mund zu hören, wie ich. Davon abgesehen, verriet ihre Miene jedoch nichts. Obwohl sie hier im Palast meine engste Vertraute war, wusste ich nicht, wie nahe sie Alexander stand. Gestanden hatte.
»Also, Hunter«, begann sie nach einer kurzen Pause scharf, »zurück in den Palast mit dir.«
»Du bist nicht meine Mutter.« Und auch nur knapp ein Jahr älter als ich, sodass sie mir schon zweimal nicht zu sagen hatte, was ich tun oder lassen sollte.
Ich schob mich an ihr vorbei und begann damit, meinen Spind nach meiner Ausrüstung zu durchwühlen. Normalerweise trug ich zum Fliegen einfachere Kleidung, die nicht »Seine Kaiserliche Hoheit« schrie, aber für heute würde die Uniform, die ich bereits anhatte, genügen. Ich schnappte mir Fliegerbrille, Lederhandschuhe und meine Maske, bevor ich mich zur Tür wandte, die in den Hauptbereich des Hangars führte.
Nyota stand noch immer wie festgewachsen an Ort und Stelle und beobachtete jeden meiner Schritte genau. Ihr war vermutlich klar, dass sie mich nicht aufhalten konnte, egal wie viele vernünftigen Gründe sie auch aufführte.
»Ich komme klar«, versicherte ich ihr.
»Etwas Glaubwürdiges fällt dir nicht ein?«
Ich zuckte mit den Schultern, legte meine Handschuhe an und anschließend die Maske. Mir fehlte die Kraft, mit Nyota zu streiten. »Ich bin bis zum Abendessen zurück.«
Erst, als die Schwerkraft mich aus ihren Klauen entließ und ich das bekannte Prickeln in meinen Fußsohlen spürte, konnte ich wieder klar denken. In rasender Geschwindigkeit ließ ich die Erde hinter mir, den Flughafen, den kaiserlichen Palast und schon bald auch die Hauptstadt Eleyburgh.
Der Motor meiner kleinen Maschine dröhnte laut, und das Vibrieren des Steuers unter meinen Händen fühlte sich so vertraut an, dass ich allmählich zur Ruhe kam. Immer wieder huschte mein Blick auf die Höhenanzeige meiner Instrumente, während ich im Kopf die Meter zählte, wie ein Sterbender die Sekunden, die ihm verbleiben.
Als ich die letzten Ausläufer der Stadt hinter mich gebracht hatte, erreichte die Nadel die magische Grenze von 1500. Zur Sicherheit ließ ich sie noch ein Stück weiter klettern, dann endlich nahm ich die Maske ab und atmete zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder frische Luft. Das schneidende Gefühl in meiner Nase trieb mir Tränen in die Augen, doch statt sofort wieder zu verschwinden, blieben sie dort. Und das für eine ganze Weile.
Mein Bruder war tot. Worte, die erst jetzt in der Klarheit des Himmels ihre volle Wirkung entfalteten. Und wenn es nach meiner Mutter ging, sollte ich an seiner Stelle den Thron besteigen.
Sogar jetzt, wo ich dieser Bürde fürs Erste entkommen war, verkrampfte sich mein Körper allein bei dem Gedanken daran. Auf einmal hatte selbst das Fliegen nicht dieselbe betäubende Wirkung wie sonst, und die Versuchung, einfach nicht zurückzukehren, wuchs mit jedem Meter, der mich mehr vom Palast trennte.
Schon bald hatte ich den Fluss überquert, der ein Stück südwestlich der Stadt eine Kurve schlug. Hinter ihm lagen nur ein paar vereinzelte Dörfer, kaum mehr als eine Ansammlung Häuser, die von hier oben wie Spielzeuge wirkten. Gleichzeitig wurde das Terrain hügeliger. Die Straßen schmaler. Die Felder kleiner. Bis ich schließlich die Ausläufer der Wispernden Wälder erreichte.
Im Flug überquerte ich mehrere Forstanlagen, riesige Camps, die Holz und Bernstein aus den Wäldern förderten. Routiniert wich ich einer Rauchsäule aus und dachte nach. Normalerweise kehrte ich an dieser Stelle um oder schlug eine andere Richtung ein, die entlang der Waldgrenze führte, aber beides würde mich eher früher als später zurück zum Palast führen. Und den wollte ich für ein paar Stunden nicht zu Gesicht bekommen – ebenso wie den Rest des Landes.
Entschlossen lockerte ich meinen Griff ums Steuer und ließ der Maschine freien Lauf, überquerte die verbotene Grenze. Nach und nach passte ich meine Höhe an, denn je dichter der Wald wurde, desto gigantischer wuchsen die Bäume darin und behielten selbst aus der Vogelperspektive ihre einschüchternde Wirkung. Tatsächlich nahm diese sogar zu, je weiter sich das Meer aus Grün unter mir erstreckte. Aber gerade war das alles, was ich sehen wollte. Grün, so weit das Auge reichte.
Unter mir zogen die Kilometer vorbei. Berge erhoben sich. Riesige Felssäulen ragten aus dem Wald empor und kamen mir so nahe, dass ich ihre Gipfel beinahe berühren konnte. Sie alle ließ ich hinter mir, bis ich sämtliches Zeitgefühl verlor. Dann ging wie aus dem Nichts ein Ruck durch mein Flugzeug.
Das Rattern der Überziehwarnanlage warf mich aus meiner Trance, machte meine Wahrnehmung binnen eines Wimpernschlags messerscharf. Vor mir tanzten die Nadeln der Instrumente auf und ab, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, zehn Stockwerke tief zu fallen. Ich verstärkte meinen Griff ums Steuer und erhöhte hastig den Schub, um den drohenden Strömungsabriss zu verhindern.
Was passierte hier?
Auf einmal riss eine Turbulenz an meinem Flugzeug und warf es zur Seite, sodass ich kurzzeitig vergaß, wo oben oder unten war. Mit aller Kraft versuchte ich die Kontrolle zurückzuerlangen und umzukehren, aber das heftige Schütteln wollte nicht aufhören. Meine Maschine, eine halbe Tonne Stahl, war nichts als eine Feder im Wind. Und während ich noch verzweifelt daran arbeitete, uns auf Kurs zu bringen, fiel mein Blick auf die Instrumententafel. Die Höhenanzeige, die mit jedem weiteren Rucken nach unten sackte. Panisch versuchte ich, mir die Maske wieder aufzusetzen – auf Kosten meiner Manövrierfähigkeit. Eine unsichtbare Kraft zerrte an den Flügeln und ein lautes Krachen ertönte, dessen Ursprung ich nicht zuordnen konnte.
»Mayday, Mayday.« Ich hämmerte mit der flachen Hand auf den Funksender, aus dem nicht einmal ein Störgeräusch drang. »Mayday, Mayday. Hier spricht Hotel Alpha 21, Position …«
Ein erneuter Ruck ging durch mein Flugzeug, der mir die Luft aus der Lunge presste und jedes weitere Wort ersterben ließ. Vor mir kippte der Horizont und mein Sinkflug wurde immer schneller. Ich rüttelte am Steuer, aber nichts passierte. Nicht einmal das hydraulische Heckruder reagierte mehr auf mich. Die Turbulenzen hatten aus meiner Lenkung Geschichte gemacht, und ich konnte nur hilflos dabei zusehen, wie die Bäume immer näher kamen.
Mir blieben nur zwei Möglichkeiten:
Entweder ich akzeptierte mein Schicksal, schloss die Augen und nutzte die letzten Sekunden, um mich von meinem Leben zu verabschieden, bis die Wucht des Aufpralls diesem ein Ende setzte.
Oder ich betätigte den roten Knopf an der Seite des Armaturenbretts, der einen Mechanismus auslöste und mich mitsamt Sitz und Fallschirm aus dem Cockpit schleuderte. Für den Bruchteil einer Chance, den Absturz selbst unbeschadet zu überstehen – nur um dann den Toxinen der Wispernden Wälder zu erliegen.
Na, welchen Tod wählst du?, hörte ich ausgerechnet jetzt Alexanders neckische Stimme in meinem Kopf.
Dann lehnte ich mich vor und schlug mit der Faust auf den Knopf.
IV
Kae
Schon zum dritten Mal an diesem Tag hatte Seher Khar mich ins Dorf geschickt, um Besorgungen zu erledigen, während er bei Ulun Purlutai zurückgeblieben war, um auf dem Stein darunter zu meditieren. Eine Weile lang hatte ich ihm geglaubt, dass er diese Dinge, vor allem Wurzeln, Beeren und Kräuter, wirklich brauchte und die Botengänge mich Demut lehren sollten. Doch fast einen Mondzyklus nach meiner Ernennung zur Qo’aivon war sogar mir klar geworden, dass die Realität anders aussah. Und aus dem Stolz über meine Berufung war schnell Enttäuschung geworden.
Wo ich auch hinging, begannen die Menschen hinter meinem Rücken zu tuscheln. Sie waren davon überzeugt, dass die frühzeitige Wahl eines neuen Sehers ein Vorbote für einen großen Umbruch war, doch bisher schien diese Veränderung nur mich zu betreffen. Statt für die anderen unsichtbar zu sein, spürte ich ihre Blicke zu jeder Zeit auf mir. Manchmal wachte ich sogar in der Furcht auf, jemand könnte meine Höhle betreten haben. Aber während ihre Absichten wenigstens freundlich oder zumindest respektvoll waren, machte Seher Khar keinen Hehl daraus, dass er meine Berufung nicht billigte. Was vermutlich der Grund war, wieso er versuchte, mich so lange wie möglich von der Insel im See fernzuhalten.
Und ich? Mir blieb nichts anderes übrig, als mich in meine neue Rolle zu fügen. Und die sah nun einmal vor, dass mein Vorgänger mir in den ersten Monden alles über das Amt beibrachte. Auch wenn sich dieser Unterricht hauptsächlich darauf konzentrierte, wie ich einen Krug voll Quqe vom Dorf zum Heiligen Baum transportierte, ohne einen Tropfen des stinkenden Gesöffs zu verschütten.
Mit einem unterdrückten Seufzen stellte ich das Gefäß vor dem Stein unter der riesigen Wurzel ab, unter der unsere Kränze mittlerweile fast völlig verwelkt waren, und trat einen Schritt zurück, damit mir der Geruch von verfaulten Früchten und Alkohol nicht länger in die Nase stieg. Ich hatte nie verstanden, wieso die Älteren so einen großen Wert auf das Gebräu legten, aber gerade lernte ich, das Zeug richtig zu hassen.
»Ich habe dir den Quqe gebracht«, machte ich mich bemerkbar, nachdem Seher Khar scheinbar keine Notiz von mir genommen hatte.
Gemächlich hob er die Lider, hielt den Kopf aber weiterhin in den Nacken gelegt, ohne mich eines Blickes zu würdigen. »Sehr gut.«
»Ich könnte mich zu dir setzen und mit dir meditieren.« Noch immer hatte ich die Hoffnung nicht aufgegeben, doch er schüttelte den Kopf, bevor ich den Satz überhaupt beendet hatte.
»Du bist noch nicht so weit.«
Eine ganze Weile hatte ich auf seine Einschätzung vertraut. Hatte akzeptiert, dass alles, was er mich tun ließ, einem höheren Ziel folgte, aber seit ich vor wenigen Tagen ein Gespräch zweier Takoutan mitangehört hatte, glaubte ich ihm kein Wort mehr.
Was tut sie da? Sollten nicht wir die rechte Hand des Qo’aivyn sein?
Vielleicht eine Strafe. Er wird sie sicher nicht ohne Grund ständig ins Dorf schicken. Ich habe gehört, dass sie … Mehr hatte ich nicht ertragen können.
Unschlüssig malte ich mit den Sandalen Kreise in die Erde. Es war früher Nachmittag und außer uns beiden war niemand auf dieser Seite des Heiligen Baums unterwegs. Hoffnungsvoll fragte ich: »Gibt es sonst etwas, das ich tun kann?«
»Bring den Krug hinab in die Halle. Dann kannst du dir etwas zum Mittagessen holen.«
Wütend ballte ich die Hände zu Fäusten und musste gegen die Widerworte ankämpfen, die einfach aus meinem Mund sprudeln wollten. Am liebsten hätte ich geschrien, doch stattdessen tat ich, was der Seher von mir verlangte, und brachte den Quqe in den Gebetsraum unter dem Heiligen Baum. Der Auftrag war schnell erledigt, und als ich wieder nach draußen trat, fühlte ich mich niedergeschlagener denn je.
Wie selbstverständlich landete Qatou auf meiner Schulter, doch sogar sein weiches Fell, das er an meinen Hals schmiegte, schaffte es nicht, meine Laune zu heben. Frustriert biss ich die Zähne zusammen. Mir stand nicht der Sinn nach der Enge meiner Höhle – oder schlimmer: den Blicken der anderen, die sich im Gemeinschaftshaus ihr Mittagessen holten. Nein. Vielleicht würde mir ein Spaziergang guttun, mich möglicherweise sogar auf neue Gedanken bringen. Am Ende könnte er sogar zu der Erkenntnis führen, dass meine missliche Lage eben doch ihren Grund hatte.
Normalerweise ging ich nicht weiter als bis zu den Plantagen am Rand des Dorfes, wo die Komen einige Pilze und Gewächse angepflanzt hatten, die selbst im Schatten der riesigen Bäume gediehen. Heute endete mein Weg hier allerdings nicht, sondern führte mich tiefer in den ungezähmten Teil des Waldes hinein. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen, denn jenseits der Grenze lauerten Tiere, die weitaus bedrohlicher waren als die Mogus oder Telai. Aber der Wald machte mir keine Angst. Ich war unter dem dichten Blätterdach aufgewachsen, wusste, wie ich mich zurechtfand und lautlos über Stock und Stein bewegte, um nicht die Aufmerksamkeit eines Raubtiers auf mich zu ziehen, das gerade auf Beutezug war.
Mit jedem Schritt, den ich mich vom Dorf entfernte, wurde das Terrain unwegsamer und die Geräusche des Waldes lauter. Zwitschernde Vögel, rauschende Bäche, knackende Äste – ich genoss es, so tief in die Natur einzutauchen, vor allem weil keine Menschenseele außer mir unterwegs war. Keine Blicke, seien sie nun verängstigt, neugierig oder gar verurteilend, lagen auf mir. Ich spürte, wie die Anspannung von mir abfiel, wie sich meine Wirbelsäule streckte, weil ich viel zu lange versucht hatte, mich so klein wie möglich zu machen.
Qatou erhob sich von meiner Schulter und flatterte aufgeregt umher. Er schien ebenso dankbar für diesen Ausflug wie ich. Wie ein Irrlicht schwebte er von einer Wurzel zur nächsten, sprang auf dem Schirm eines Baumpilzes herum und jagte einer Motte hinterher. Ich beneidete ihn um diese Unbekümmertheit und wünschte mir in diesem Moment, ich wäre ebenfalls ein Geschöpf des Waldes.
Ohne auf den Weg zu achten, tauchte ich tiefer ins Dickicht ein. Dabei sollte ich besser nicht zu lange fortbleiben, schließlich bestand stets die Möglichkeit, dass Seher Khar mich brauchte … Beinahe hätte ich über meinen eigenen Gedanken gelacht, da erregte plötzlich ein Geräusch meine Aufmerksamkeit.
Es war eine Art Brummen, das aus weiter Ferne zu mir durchdrang. Ein völlig neuer Klang, den ich nie zuvor gehört hatte und der nun immer lauter wurde. Er kam von irgendwo über mir.
Jeder andere hätte vermutlich kehrtgemacht oder sich versteckt, aber ich war zu neugierig, um auf die Stimme der Vernunft zu hören. Ich stieß einen leisen Pfiff aus, um Qatou auf mich aufmerksam zu machen, doch der war nach wie vor damit beschäftigt, seinem neuen Mottenfreund hinterherzujagen. Also begann ich den beschwerlichen Aufstieg in das Dach des Waldes allein.
Anders als die Bäume im Dorf waren diese hier nicht von der Magie der Dagun beeinflusst worden. Es gab keinen Steg, der nach oben führte, weshalb ich mich ganz auf meine Kletterfähigkeiten verlassen musste. Glücklicherweise bot die tief zerfurchte Rinde des Baumes genügend Halt, sodass ich schnell vorankam. Währenddessen schwoll der Lärm weiter an. Irgendwann erreichte ich die Krone und folgte einem Ast, der kaum breiter als meine Füße war, das letzte Stück hinauf. Dann, als ich an einem der riesigen Blätter ankam und der freie blaue Himmel schon zum Greifen nah war, rauschte etwas über meinen Kopf hinweg. Erschrocken fuhr ich zusammen, kletterte weiter, bis ich den höchsten Punkt des Baumes erreicht hatte. Hier war das Brummen mit Abstand am lautesten.
Ich kniff die Augen zusammen, um besser erkennen zu können, woher das Geräusch kam. Der Himmel war klar, doch im Süden, nicht allzu weit von mir entfernt, entdeckte ich ein Tier. Eine Art Vogel, der mir völlig unbekannt war, und dessen silbernes Gefieder in der hochstehenden Sonne funkelte. Ich blinzelte überrascht. Nein, kein Gefieder. Metall.
Verwirrt beobachtete ich das Ding, studierte, wie es in der Luft schwebte, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Dabei schien es Mühe zu haben, sich in der Luft zu halten, als würde eine heftige Böe an ihm rütteln. Nur wehte hier oben kein Wind.
Auf einmal ertönte ein Krachen, das mir durch Mark und Bein ging, und der Nicht–Vogel begann, in einer scharfen Drehung abwärtszutrudeln. Ich strengte meine Augen noch mehr an und meinte zu erkennen, wie sich eine weitere kleinere Gestalt daraus löste, die Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Doch schienen dieser plötzlich Fäden aus dem Rücken zu wachsen, aus denen sich perlweiße Schwingen entfalteten.
Alles passierte so schnell, dass ich kaum verarbeiten konnte, was ich sah. Da verschwanden beide schon in den Blättern. Ein Knall ertönte. Dann erstarb das Brummen und die Welt hüllte sich in Schweigen, als hätten sogar die Vögel den Atem angehalten. Ein paar Wimpernschläge lang verharrte ich in meiner Position, bevor ich mich hastig an den Abstieg machte.
Die Absturzstelle zu finden, war nicht schwer, auch wenn ich mich dabei weiter vom Dorf entfernte. Mir war bewusst, dass ich den anderen, vor allem aber dem Qo’aivyn Bescheid geben sollte, statt mich auf eigene Faust auf den Weg dorthin zu begeben. Dann wiederum war ich die Nachfolgerin des Sehers und durchaus in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, weshalb ich mich sputete, um als Erste dort zu sein. Sicherlich hatten auch andere den Lärm gehört.
Sowie ich die Stelle erreichte, kamen mir die Tränen. Das seltsame Ding, das vom Himmel gefallen war, hatte nicht nur einen der Bäume schwer beschädigt, es hatte sich auch eine Lache aus Flüssigkeit auf dem Boden darunter gebildet, die lichterloh brannte. Sofort setzte mein Herz ein paar Schläge aus, und ich fühlte mich einen Atemzug lang in meinen Albtraum zurückversetzt. Was, wenn es doch eine Vision gewesen war, die mich vor diesem Moment warnen wollte?
Qatou landete schnuppernd auf meiner Schulter. Seine Gelassenheit ließ mich schnell realisieren, dass die Szene wenig mit meinem Traum gemein hatte. Das Feuer erstreckte sich nur über eine kleine Fläche und verlor auf dem feuchten Boden rasch an Energie. Es hätte schon eine weitaus größere Kraft gebraucht, um die uralten Bäume in Brand zu stecken.
Ich seufzte erleichtert, obwohl das Ausmaß der Zerstörung kaum Raum für Beruhigung ließ. Das metallische Ding war direkt in die Baumkronen gestürzt, hatte Äste, Blätter und Zweige mit sich in die Tiefe gerissen. Überall verteilt lag gesplittertes Holz, aber auch andere Teile, die ich genauer untersuchte. Ich trat näher an ein größeres, flaches Stück heran und klopfte mit dem Fingerknöchel dagegen. Metall, kein Zweifel.
Aber was sollte das sein? Die symmetrische Form und die saubere Verarbeitung deuteten darauf hin, dass es von Menschen geschaffen worden war. Doch keiner aus meinem Volk besaß die Fähigkeit, etwas Derartiges zu fertigen. Auf einem der Teile war eine Zeichnung. Ein Rechteck bestehend aus drei Streifen in Schwarz, Weiß und Violett. In der Mitte prangte eine goldene Blume, eine Archima. Plötzlich erinnerte ich mich wieder an die Gestalt, die aus dem Wrack gefallen war, und begann damit, die unmittelbare Umgebung abzusuchen.
Es war Qatou, der meine Aufmerksamkeit auf ein gigantisches Tuch lenkte, das sich in einer der Baumkronen in der Nähe der Absturzstelle verheddert hatte. Aus ihm ragten dicke Seile, an deren Ende eine Art Stuhl baumelte. Verwirrt musterte ich die Konstruktion, bis ein Stöhnen mich von dem Mann, der darunter lag, Notiz nehmen ließ.
Ohne auch nur an Vorsicht zu denken, eilte ich zu ihm und hockte mich neben ihn auf den Boden. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Es war wirklich ein Mensch gewesen, der in dem metallischen Ding gesessen hatte und durch den Himmel geflogen war. Jetzt lag er vor mir und schien kaum bei Bewusstsein zu sein.
Instinktiv hielt ich Ausschau nach Verletzungen, doch wie durch ein Wunder schien er bis auf einige Schürfwunden und Kratzer unversehrt. Vorsichtig nahm ich seinen Kopf und bettete ihn auf meinen Schoß, während ich mit der Hand seinen Schopf abtastete. Kein Blut. Aber möglicherweise hatte er sich bei seinem Fall trotzdem gestoßen und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Immerhin atmete er, was eine Erleichterung war. Mir lagen Tausende Fragen auf der Zunge, die ich ihm am liebsten sofort gestellt hätte, doch zuerst musste ich dafür sorgen, dass er sie auch beantworten konnte.