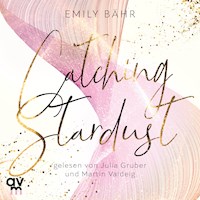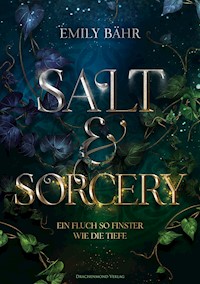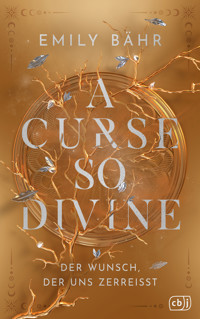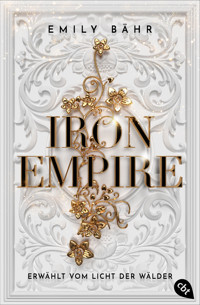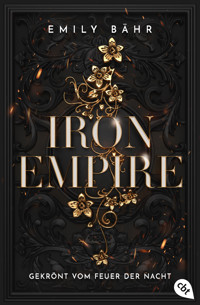
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die "Iron Empire"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Seherin ohne Magie, ein Kaiser ohne Krone,
und eine Liebe, die Rettung oder Untergang bedeuten könnte.
Seit ihrer Flucht aus dem Palast ist das ganze Kaiserreich hinter Kae und Hunter her. Während Hunter entscheiden muss, ob er sich weiter zurückzieht oder für sein Geburtsrecht kämpft und den sinnlosen Krieg beendet, stellt Kae fest, dass sie ihre Lichtmagie verloren hat.
Als das Eiserne Imperium beschließt, die Wispernden Wälder dem Erdboden gleichzumachen, reisen die beiden in Kaes Heimat, um die Eijn zu warnen. Allerdings hat sie als Lichtlose ihren Platz im Volk verwirkt und ihre Worte bleiben ungehört.
Den bevorstehenden Kampf kann sie nur verhindern, indem sie ihre Magie wiedererlangt und sich ihren Platz als Seherin zurückverdient. Doch dafür muss sie tiefer in die Wälder reisen, um einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Unterdessen kehrt Hunter ins Imperium zurück, obwohl dieser Schritt die beiden unwiderruflich zu Feinden machen könnte …
Der Abschluss der packenden Romantasy-Dilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Emily Bähr
Iron Empire
Gekrönt vom Feuer der Nacht
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Mai 2024
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Umschlaggestaltung: Emily Bähr
Umschlagmotive: Shutterstock / d1sk; Turbosquid by Shutterstock (deckorator4, Morecano)
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30983-1V001
www.cbj-verlag.de
Für Patty
Wie das Burger-Patty
Liebe*r Leser*in,
bitte beachte, dass dieses Buch bestimmte Themen behandelt, die ungewollte Reaktionen auslösen können. Deshalb findest du hier eine Content Note, in der diese Aspekte aufgelistet werden.
Hinweis: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte, daher entscheide für dich selbst, ob du sie lesen möchtest.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!
Emily und das cbt-Team
I
Hunter
Die aufgehende Sonne färbte den Himmel und die vereinzelten Wolken rot, sodass es sich anfühlte, als flögen wir durch ein Meer aus Blut. Unter uns zog das ruhige Wasser der Weißen Bucht dahin, während hinter uns die Berge der Wispernden Wälder im Horizont versanken. Nicht mehr lange und sie wären ganz verschwunden. Wie auch die Hauptstadt, mein Zuhause und mein altes Leben.
Mittlerweile hatte sich Nyota zu uns ins Cockpit gesellt, ohne etwas zu sagen. Still saß sie da wie Kae und ich. Denn es gab keine Worte, um das, was wir in der letzten Nacht erlebt hatten, zu beschreiben.
Ich versuchte, all meine Gedanken auf den Flug zu konzentrieren, auf die Instrumente und das Kribbeln in meinen Beinen, um zumindest einen Hauch der Sorglosigkeit zu spüren, die mich sonst beim Fliegen überkam. Aber nichts half. Wenn ich auch nur blinzelte, kehrten die Bilder sofort in meinen Kopf zurück. Der Verlust meiner Mutter ließ sich noch viel schwerer verdrängen als der meines Bruders. Es war zu viel geschehen. Und ich hatte keine Ahnung, wie es jetzt weiterging.
Nach dem Start hatte ich die Maschine in Richtung Osten gelenkt, weg vom Palast, ohne ein festes Ziel vor Augen. Ein Kurs, den ich am liebsten beibehalten hätte, bis ich nicht nur die Hauptstadt, sondern auch das ganze Eiserne Imperium hinter mir gelassen hätte. Weiter über den Ozean, bis hin zu den sagenumwobenen Fernländern, die noch kein Mensch entdeckt hatte. Wenn ich den Instrumenten allerdings trauen durfte, würden wir es am Ende kaum über die Weiße Bucht schaffen, die meine Heimat Chreste vom Fürstentum Ero trennte. Wir würden landen müssen und uns dann überlegen, wie wir weitermachen sollten.
Besorgt warf ich einen weiteren Blick auf die Tankanzeige. Die Nadel schwebte gefährlich nah über dem roten Bereich. Zwar war ich nicht mit dem Flugzeug vertraut, aber ich vermutete, dass wir keine hundert Kilometer mehr schafften, bevor wir zum Landen gezwungen waren. Und auch wenn ich das Schweigen gern noch eine Weile in die Länge gezogen hätte, wusste ich, dass es Zeit war, die anderen über unseren Status zu informieren.
»Wir müssen bald landen«, verkündete ich, wobei meine Stimme so rau und schwach klang, dass sie beinahe mit dem Brummen der Triebwerke verschmolz.
Hinter mir löste sich Nyota aus ihrer Starre und straffte die Schultern. Ich konnte förmlich sehen, wie die Militärausbildung einsetzte und sie sich dazu zwang, weiterzumachen, während dieser Effekt bei mir auf sich warten ließ. »Wie bald?«
»Fünfzehn, vielleicht dreißig Minuten.«
»Hast du nicht getankt?«
»Nicht genug.« Wir hatten zu schnell Gesellschaft bekommen. Und auch nachdem Kae sich um sie gekümmert hatte, war das Risiko zu hoch gewesen, weiter am Boden zu bleiben.
»Okay. Schaffen wir es an Land oder soll ich die Schwimmwesten rausholen?«
Ich blinzelte durchs Cockpitfenster in die aufgehende Sonne. Wegen der Helligkeit konnte ich nur schwer ausmachen, was vor uns lag, aber wenn ich unseren Kurs richtig einschätzte, dürften wir kurz vor der Küste Eros sein.
»Wir schaffen es an Land. Der nächste Flughafen ist in Tarhos, dort könnten wir landen.«
»Spricht etwas dagegen?«
Ich presste die Lippen zusammen. Nyota kannte mich gut genug, um selbst den kleinsten Hauch Unsicherheit in meiner Stimme zu hören.
»Ich weiß es nicht.« Nach gestern Nacht wusste ich gar nichts mehr.
»Hunter«, sagte sie streng. »Rede mit mir. Was geht dir durch den Kopf?«
»Ich kann es nicht genau beschreiben. Objektiv ist es die beste Möglichkeit, die wir haben, aber ich hab ein ungutes Gefühl bei der Sache. Keine Ahnung, wem wir noch trauen dürfen. Und wie es überhaupt weitergehen soll.«
Nyota nickte. »Können wir nicht abseits der Stadt landen?«
»Zu gefährlich.«
»Dann der Flughafen in Tarhos«, beschloss sie. »Wir landen. Tanken. Und dann fliegen wir weiter nach Zazwa.«
»Zazwa?«
»Bei meiner Familie sind wir in Sicherheit und können in Ruhe unser weiteres Vorgehen besprechen.«
Ich starrte eisern geradeaus. Vermutlich war das die vernünftigste Option, aber das mulmige Gefühl in meinem Magen ließ sich nicht ablegen. Schwer zu sagen, ob es Paranoia war oder die Angst davor, mich mit der Realität auseinanderzusetzen, aber allein der Gedanke über das Geschehene zu sprechen, war zu viel.
»Es sei denn, du willst lieber umkehren und deinen Onkel zur Rede stellen.«
»Nein.«
Alles, bloß das nicht.
Während ich unsere Höhe langsam verringerte, fiel mein Blick immer wieder zu Kae, die bislang keinen einzigen Ton von sich gegeben hatte. Sie hatte die Hand um ihren Qo’ai geschlossen und ich meinte zu erkennen, dass sie leicht zitterte.
»Alles in Ordnung?«, frage ich leise, nachdem Nyota in die Kabine verschwunden war, um eine Bestandsaufnahme zu machen.
Kae schüttelte den Kopf und hielt den Blick starr geradeaus gerichtet. Sofort machte sich das schlechte Gewissen in mir breit. Der Gedanke, dass ich sie in all das hineingezogen hatte, sie nicht nur aus ihrer Heimat, sondern auch mitten in diese Krise gezerrt hatte, war unerträglich. Sie hatte das nicht verdient.
Fieberhaft überlegte ich, was ich sagen oder tun konnte, aber mir wollten die richtigen Worte nicht einfallen. Es tut mir leid käme mir lächerlich vor in Anbetracht dessen, was gerade in ihr vorgehen musste. Ich wagte es nicht einmal, meine Hand auf ihre zu legen, obwohl sich alles in mir nach ihrer tröstlichen Nähe sehnte. Aus Angst, ich könnte etwas kaputtmachen. Aus Angst, sie könnte mich dafür hassen, dass ich sie in diese Welt gebracht hatte.
Ich seufzte. Ihr Volk. Ihr Wald. Ihre Heimat. Alles nur weitere Punkte auf meiner Liste an Problemen.
Ich suchte Kaes Blick, doch sie sah mich nicht an, blieb weiter starr sitzen. Lediglich Qatou lugte kurz aus ihrer Jackentasche hervor und wirkte mit den angelegten Ohren ebenso ängstlich, wie ich mich fühlte. Am liebsten hätte ich mich wie er irgendwo verkrochen, aber zuerst musste ich dieses Flugzeug landen und uns in Sicherheit bringen. Wenigstens das war ich Kae schuldig. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, welcher Ort überhaupt noch sicher war.
Unter uns kam die Küste in Sichtweite. Die hohen Kreidefelsen, von deren Farbe die Weiße Bucht ihren Namen hatte. Von hier oben wirkten sie nur wie weiße Streifen, doch ich erinnerte mich lebhaft an meinen ersten Besuch in Tarhos, das eingebettet zwischen den Klippen an den Ufern des Ibevy lag, und wie winzig klein ich mich gefühlt hatte. Ich verringerte unsere Höhe weiter und lenkte das Flugzeug nach rechts. Feiner Nebel umwaberte die Gipfel der Klippen, der sich in der Morgensonne allmählich auflöste und die Sicht freigab.
Ich orientierte mich an der Form der Küste und dem dichter werdenden Schienennetzwerk, bis der Flughafen in Sicht kam. Ein einziges riesiges Gebäude aus Stahl, das auf den ersten Blick verloren wirkte. Erst auf den zweiten erkannte man die breite Schlucht daneben, in der Tarhos erbaut worden war.
Gerade rechtzeitig kehrte Nyota ins Cockpit zurück und ließ sich seufzend in ihren Sitz fallen. »Ich hoffe, deine kaiserlichen Privilegien reichen als Währung für Treibstoff – es gibt nämlich absolut nichts an Bord.«
Unsicher verzog ich die Lippen. Allein der Gedanke, das Wort kaiserlich mit mir in Verbindung zu bringen, war mir zuwider. Aber wenn es hart auf hart kam, hatten wir vermutlich keine Wahl.
»Wir sind im Landeanflug«, informierte ich die anderen und hatte Mühe, meine zunehmende Unruhe zu verbergen. »Ihr solltet euch anschnallen.«
»Du bist doch nicht etwa nervös?«, stichelte Nyota und ich bewunderte sie dafür, dass sie die Kraft fand, mich aufzuziehen.
»Ich doch nicht.«
Ein Rucken ging durch die Maschine, als ich die Klappen ausfuhr, um uns weiter auf Sinkflug zu bringen und unser Tempo zu reduzieren. Erneut wanderte mein Blick zur Tankanzeige, deren Zeiger inzwischen auf Rot stand. Das würde eine absolute Punktlandung werden.
Mittlerweile waren wir tief genug, dass ich die Landschaft genauer betrachten konnte. Weite Wiesen, die vor langer Zeit einmal Acker und Weiden gewesen waren und jetzt vollkommen unberührt dalagen. Eine Straße, auf der ein einziges Automobil entlangfuhr. Und eine ganze Reihe Schienen. Mit seiner zentralen Lage und dem Zugang zum Meer war Tarhos einmal eine blühende Handelsstadt gewesen. Doch das war Vergangenheit. Die Sporen hatten nicht nur den Tourismus, sondern auch den Großteil der Landwirtschaft zum Erliegen gebracht und das einst pulsierende Herz an der Grenze zwischen Ero und Helvend war mittlerweile nur noch ein dunkler Fleck auf der Karte. Einer, den die Menschen aufgrund der hohen Kriminalitätsrate um jeden Preis mieden.
Meine Hände waren schwitzig, als ich den Hebel fürs Fahrwerk betätigte und die Landebahn ins Visier nahm. Die gleiche Angst, die mich bereits beim Start erfüllt hatte, war zurück, doch dieses Mal war kein Adrenalin in meinem Blut, um mich von der Nervosität abzulenken. Was, wenn ich versagte? Eine einzige Fehleinschätzung könnte uns das Leben kosten. Ich zitterte am ganzen Körper. Entsprechend war unsere Landung so hart, dass ich kurz das Gefühl hatte, mich übergeben zu müssen. Das Fahrwerk ächzte unter dem Aufprall, kurz hoben wir wieder ab, um Sekunden später erneut auf dem Boden aufzukommen. Als ich die Luftbremsen ausfuhr, rutschte ich auf dem Sitz nach vorne, bis der Gurt schmerzhaft gegen meinen Brustkorb drückte. Zwar wurden wir laut der Anzeige langsamer, doch das Ende der Landebahn kam viel zu schnell näher. Ich sah uns schon darüber hinausrollen und die Klippe hinabstürzen, als der Druck auf meinen Rumpf allmählich nachließ und ich endlich wieder atmen konnte.
Ich hielt das Steuer so fest umklammert, dass meine Knöchel weiß hervortraten, während ich uns aufs Rollfeld lenkte, und lockerte meinen Griff erst, als ich auf das offene Hangartor zusteuerte. Ein ohrenbetäubendes Piepen ertönte, um mich über den leeren Treibstofftank zu informieren. Doch unser Schwung reichte zusammen mit den letzten Tropfen Sprit, um auch noch die letzten Meter zu überwinden.
Im Hangar erwartete uns ein Empfangskomitee. Ich war so auf unsere Landung fokussiert gewesen, dass ich überhaupt nicht daran gedacht hatte, welchen Eindruck es wohl machte, wenn wir unangekündigt ohne Rufzeichen in einem Transportflugzeug der kaiserlichen Familie in Tarhos auftauchten. Möglicherweise hielten sie uns für Kriminelle – ein Missverständnis, das wir hoffentlich klären konnten, wenn sie mein Gesicht sahen.
Dennoch wurde die Nervosität schlimmer. Ich zählte vier Personen mit Gewehren. Durch die Gasmasken und schwarzen Trenchcoats fiel es mir schwer, einzuschätzen, ob sie zum nationalen Militär oder der örtlichen Polizei gehörten. Vielleicht waren sie auch nur Arbeiter, die für die Sicherheit am Flughafen sorgten, aber in jedem Fall machten sie einen wenig einladenden Eindruck.
Zögernd brachte ich unsere Maschine neben ihnen zum Stehen und schaltete die Triebwerke aus. Mein Herz raste in meiner Brust, doch das tat es schon, seit … Nein. Nicht jetzt.
Ich nahm einen tiefen Atemzug und zwang mich dazu, das Steuer loszulassen und mich abzuschnallen. Jede einzelne Bewegung kostete mich Überwindung. Aufstehen. Maske aufsetzen. Nyota und Kae zunicken. Die Schultern straffen. So tun, als würde ich mich nicht am liebsten auf den Boden legen und aufgeben. Check.
Sobald wir aus der Luftschleuse des Flugzeugs getreten waren, wurden wir umzingelt. Zu den vier Wachen von vorhin hatten sich zwei weitere dazugesellt. Die eine davon, eine junge Frau, hielt mir eine Armbrust aus Metall direkt unter die Nase. Eine seltsam archaische Waffe, deren eingelegter Pfeil dadurch jedoch nicht weniger bedrohlich wirkte.
Neben ihr trat auch der zweite Neuankömmling an mich heran, ein Mann, dessen Gesicht fast komplett unter einer Gasmaske verborgen war. Nur vage konnte ich grüne Augen und kupferfarbene Haut hinter seiner getönten Schutzbrille erahnen. Er trug dieselbe Uniform wie die anderen und an seiner Brust prangte ein Abzeichen der Rendorseg, der Polizei von Tarhos. Ein silberner Schild mit einer eingravierten Windrose.
»Gibt es ein Problem, Officer?«, fragte ich und versuchte gelassen zu klingen.
»Kommt ganz darauf an. Name?«
»Hunter Athgolan. Und das sind Nyota Omari und Kaeliah … Stone.« Ich improvisierte hastig einen Nachnamen, um Kae nicht sofort ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu befördern.
»Hunter Athgolan?«, erwiderte der Kerl mit gespielter Überraschung, obwohl er mich zweifelsohne längst erkannt hatte. »Und was verschafft uns die Ehre eines so hohen Besuches?«
»Wir sind auf der Durchreise nach Zazwa und brauchen Treibstoff.«
»Zazwa? Und was wollt Ihr dort?«
»Zu meiner Familie«, sprang mir Nyota zur Seite. »Sicher habt ihr von dem Angriff auf Eleyburgh gehört.«
»Das haben wir in der Tat. Tatsächlich ist es keine halbe Stunde her, seit der Kaiser seine Ansprache gehalten hat. Wer hätte gedacht, dass Ihr uns so bald beehrt?«
»Der Kaiser?«, entfuhr es mir überrascht.
»Kaiser Rowan I.«
Ich tauschte einen alarmierten Blick mit Nyota. Rowan hatte sich selbst zum Kaiser ernannt? Wut kochte in mir hoch, doch ich wehrte mich mit aller Macht dagegen, dass sie die Kontrolle an sich riss. Jetzt musste ich mehr denn je vorsichtig sein, was ich sagte.
»Dann ist es umso wichtiger, dass wir so schnell wie möglich weiterreisen. Wir brauchen Treibstoff. Bitte.«
»Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen«, entgegnete der Officer. »Ihr steht unter Verdacht, die Kaiserin ermordet zu haben. Ihr seid hiermit verhaftet.«
Auf sein Stichwort traten drei der Polizisten mit Handschellen an uns heran. Mühsam unterdrückte ich den Impuls, mich zur Wehr zu setzen. »Das ist eine Lüge. Rowan steckt hinter der Ermordung. Er will die Krone und hat es jetzt auf mich abgesehen.«
»Habt Ihr dafür Beweise?«
»Hat Rowan Beweise?«
Der Officer zuckte mit den Schultern. Fast so, als interessierte es ihn herzlich wenig, was die Wahrheit war. »Euer Erscheinen spricht nicht gerade für Eure Unschuld.«
»Wir sind auf der Flucht«, zischte ich. »Im Palast hätten wir keinen Tag überlebt.«
Ein Klicken ertönte, als die Männer Kae und Nyota Handschellen anlegten. Die Polizistin mit der Armbrust drückte mir diese ins Gesicht, sodass sich der Pfeil schmerzhaft in meine Schläfe bohrte. Hinter der Schutzbrille warf sie einen fragenden Blick zu ihrem Vorgesetzten.
»Ihr macht einen Fehler«, versuchte ich es weiter, verzweifelter. »Bitte lasst uns erklären.«
»Oh, keine Sorge, Ihr werdet Gelegenheit haben, Euch zu erklären, sobald wir Euch der Nationalgarde übergeben haben. Und jetzt mitkommen.«
Einer der Soldaten packte meine Hand. Doch obwohl ich es besser wusste, wand ich mich aus seinem Griff und rammte ihm mit voller Kraft den Ellenbogen in den Bauch. Hastig duckte ich mich aus der Schusslinie der Armbrust, wich einem weiteren Mann aus, während Nyota sich ebenfalls zur Wehr setzte. Doch unser Aufstand war nur von kurzer Dauer. Sobald die Polizisten die erste Überraschung überwunden hatten, gewannen sie schnell die Oberhand, hielten meine beste Freundin fest, während nun auch ich akzeptieren musste, dass mir Handschellen angelegt wurden.
Trotz seiner Maske meinte ich, ein Grinsen auf dem Gesicht des Officers zu erahnen. Er hatte dem Geschehen mit vor der Brust verschränkten Armen zugeschaut und nickte nur zufrieden, als wir uns endlich ergaben. »Da wir das geklärt hätten: Mitkommen!«
Fieberhaft überlegte ich mir, wie wir uns noch retten konnten, aber mir wollte nichts einfallen. Wir waren unbewaffnet, noch dazu in der Unterzahl und unsere Gegner zweifelsohne gut ausgebildet. Das Einzige, das uns jetzt helfen würde, wäre ein Wunder. Oder Magie.
Während die Polizisten uns zum Tor des Hangars trieben, sah ich vorsichtig in Kaes Richtung. Sie hielt den Kopf gesenkt, offenbar ihrem neuen Schicksal ergeben, wobei ihre Haut noch blasser wirkte als sonst. Ich versuchte, näher an sie heranzukommen, doch jedes Mal, wenn ich auch nur einen Millimeter vom Kurs abwich, zog mich die Polizistin, die mich eskortierte, sofort wieder zurück.
Dann, als hätte sie meinen Gedanken erahnt, hob Kae den Kopf und für einen Sekundenbruchteil traf ihr Blick auf meinen. Panik stand in ihren braunen Augen geschrieben, Verzweiflung, aber auch Resignation. Kapitulation. Eine Botschaft, die ich ohne Worte verstand: Sie konnte uns nicht retten, wie sie es vorhin getan hatte. Wie auch immer sie es geschafft hatte, ihre Magie zu nutzen, um uns die Palastwachen vom Leib zu halten – es würde ihr nicht wieder gelingen.
Und so verließ auch mich der letzte Funke Hoffnung und ich ergab mich meinem Schicksal. Ich versuchte mich innerlich für das, was uns bevorstand, zu wappnen, doch selbst dazu fehlte mir die Kraft. Ich war müde. Viel zu müde. Und am Ende.
Vor dem Hangar wurden wir auf die Ladefläche eines verbeulten Transporters geladen, dessen Aufhängung laut knarzte, als wir der Reihe nach aufstiegen und uns auf den Boden setzten. Dabei stellten die Polizisten sicher, genug Abstand zwischen Nyota, Kae und mich zu bringen, damit wir uns auf keinen Fall unterhalten konnten. Oder irgendetwas gegen unsere Inhaftierung unternehmen.
Nein. Egal, was wir versuchen würden, um uns aus dieser Lage zu befreien: Ohne Kaes Magie hatten wir keine Chance. Wir hatten verloren.
II
Kae
Wie eine Schlange aus Stein führte eine gewundene Straße hinab in die Schlucht, die ein Fluss in den Stein gefressen hatte. Hohe Wände verschlangen das Licht der Morgensonne, sodass es merklich kälter wurde, als wir die ersten Häuser passierten. Weiße, in den Fels gemeißelte Bauten mit Dächern in hellem Türkis, deren Verzierungen davon zeugten, dass Tarhos einst eine stolze Stadt gewesen war. Nun war davon nichts mehr übrig. Die Fassaden waren bei genauerer Betrachtung schmutzig, das Pflaster zwischen den Häusern aufgesprungen und außer uns keine Menschenseele in der Dämmerung unterwegs.
Am Grund der Schlucht waren die Sporen so dicht, dass sie uns wie feiner, glühender Dunst umgaben. Sie legten sich auf meine Kleidung, meine Haare, mein Gesicht. Unwillkürlich presste ich die Maske fester gegen meinen Mund. Das raue Leder kratzte auf meiner Haut, und obwohl sie mir die Sporen vom Leib hielt, galt das nicht für den beißenden Gestank, der in diesen Straßen herrschte.
Mehr denn je sehnte ich mich nach meinem Zuhause. Der Geborgenheit des Waldes, der frischen Luft, und wenn ich Qatous nervöses Zucken unter meiner Kleidung richtig deutete, dann ging es ihm genauso. Allerdings war zu Hause weiter entfernt als je zuvor. Ein paar Handschellen, eine riesige Bucht und ein halbes Reich lagen zwischen mir und dem Ort, an dem ich geboren und aufgewachsen war. Und gerade bezweifelte ich, dass ich ihn je wiedersehen würde.
Die Wachmänner brachten uns tief ins Herz der Stadt, wo es noch dunkler war, weil die Gebäude dichter beieinanderstanden. Wir überquerten unzählige Brücken, die über schmale Kanäle führten und kaum genug Platz für das Fahrzeug boten, durchquerten Unterführungen, in denen der Lärm des Motors tausendfach von den Wänden zurückgeworfen wurde und meine Ohren zum Klingeln brachte. Am Ende erreichten wir einen Ort, wo der Nebel noch dichter und der Gestank noch unerträglicher war. Ich konnte kaum sehen, was sich jenseits der Ladefläche des Wagens befand. Die Gebäude waren nur noch Schemen, als wir schließlich vor einem von ihnen anhielten.
Mein Körper bewegte sich von allein, sobald die Wachen uns aufforderten aufzustehen. Mein Kopf war leer. Die Resignation hatte mich fest in ihren eisigen Klauen, und was auch immer jetzt passieren würde, mir war klar, dass ich nichts dagegen ausrichten konnte. Selbst wenn unser Leben davon abhing, nie wieder würde ich mich zur Wehr setzen, wie ich es vorhin im Hangar getan hatte. Dazu hatten sich die Bilder zu sehr in mein Gedächtnis gebrannt.
Nur am Rand nahm ich wahr, dass wir in ein großes, quaderförmiges Gebäude geführt wurden, denn vor meinem geistigen Auge sah ich nur sie. Die Männer und Frauen der Kaisergarde. Auf dem Boden liegend mit angesengter Kleidung, aufgeplatzten Gesichtern, geschmolzenen Masken. Sogar jetzt steckte mir der Geruch nach verbranntem Stoff und Leder in der Nase, überlagerte selbst den Gestank dieses Ortes.
Plötzlich umgab uns schummriges Halbdunkel. Ein langer Gang mit Fenstern auf der rechten Seite, hinter denen sich absolute Finsternis befand. Nach einer Weile erreichten wir einen Raum, in den die Wachen Hunter und mich stießen. Worte wurden gewechselt, aber gerade schaffte ich es nicht, mich genug zu konzentrieren, um die Sprache der Aldan zu verstehen.
Ein Klicken ertönte und der Druck an meinen Handgelenken ließ nach.
Schritte entfernten sich.
Ein lauter, metallischer Knall erschütterte die Wände.
Dann wurde es still.
»Kae? Kae? Ist alles in Ordnung?« Hunters Stimme klang, als käme sie aus einer anderen Welt. Und nur mühsam schaffte ich es, mich an sie zu klammern, ihr in die Gegenwart zu folgen, heraus aus den Erinnerungen an meine Taten. »Kae?«
Ich hob meinen Kopf und sah ihn an. Sein Gesicht schwebte unmittelbar vor meinem, ein angenehm vertrauter Anblick, obwohl die Müdigkeit und Trauer darin mein Herz nur schwerer machten. Was war nur mit uns geschehen? Schwach nickte ich, um ihm zu zeigen, dass ich ihn hörte. Mehr bekam ich nicht zustande, weil meine Kehle so trocken war, als hätte ich einen Teil des Feuers verschluckt, das ich vorhin … Nein.
»Du brauchst keine Angst haben«, flüsterte er und legte die Hand auf meinen Oberarm. Ein leichtes Prickeln rauschte durch meinen Körper, doch es hatte kaum eine Chance gegen die Taubheit, die mich befallen hatte. »Wir finden schon einen Ausweg.«
Ich wollte gleichermaßen weinen und ihn schütteln. Dieser verdammte Lügner. Sein unverbesserlicher Optimismus hatte uns schon in manch aussichtsloser Lage begleitet, aber jetzt konnte ich die Unsicherheit nur zu deutlich aus seinen Worten heraushören. Er glaubte nicht an eine Rettung. Genauso wenig wie ich.
Dennoch ließ ich den Gedanken für einen Augenblick zu. Die Vorstellung, dass das hier nur ein weiterer Stein war, den uns das Schicksal in den Weg gelegt hatte. Eine Herausforderung, die es zu überwinden galt, obwohl mir klar war, dass das nicht stimmte. Dass mein Vergleich nicht passte.
Das hier war kein Hindernis. Nein, wir waren auf einem völlig neuen, unbekannten Weg gelandet.
»Kae?«
Ich löste mich aus meiner Starre und ließ zu, dass Hunter mich in eine Umarmung zog. Ließ zu, dass er mich hielt, obwohl ich längst den Boden unter den Füßen verloren hatte. Ließ zu, dass mir seine Nähe vorgaukelte, es hätte den Angriff auf Eleyburgh nie gegeben. Dass wir uns immer noch in meinem Zimmer befanden. Dass er mich immer noch küsste, als gäbe es auf der Welt nur ihn und mich. Dass wir beide alles waren, was zählte.
Dann löste ich mich aus der Umarmung und trat einen Schritt zurück. Zwang meinen Verstand, seine Arbeit wieder aufzunehmen. »Wo sind wir?«
Hunter zuckte mit den Schultern und verzog das Gesicht. »Im Gefängnis, schätze ich. Oder was die Leute in Tarhos darunter verstehen.«
Ich sah mich um. Der Raum, in dem wir uns befanden, war nicht sonderlich groß, kaum drei Schritte lang mit einer Decke, die so niedrig war, dass ich nur die Hand heben musste, um sie zu berühren. Eine einzelne Glühbirne hinter einem Gitter spendete Licht. In einer Ecke standen Kartons. Ansonsten gab es nichts. Kein Fenster. Nicht einmal eine Pritsche.
»Wo ist Nyota?«, fragte ich.
»Keine Ahnung.« Hunter seufzte, die Arme vor der Brust verschränkt. »Der Officer wollte ihre Aussage. Wenn wir Glück haben, hört er ihr zu und wir kommen hier raus.«
»Und wenn nicht?«
»Dann bringen sie uns zurück in die Hauptstadt.«
Und was das bedeutete, brauchte ich gar nicht zu erfragen. So viel hatte ich mitbekommen. Hunters Onkel war jetzt der Herrscher, machte uns für den Tod an der Kaiserin verantwortlich und das ganze Land schien ihm zu glauben.
»Können wir sie überzeugen?«, fragte ich vorsichtig. »Dass du … ich meine, dass wir unschuldig sind und Rowan hinter allem steckt?«
»Keine Ahnung. Aber was auch immer gerade passiert, Rowan hat es von langer Hand geplant. Ich bezweifele, dass er es überhaupt so weit kommen lässt, dass jemand die … Umstände der letzten Nacht untersucht. Oder überhaupt unsere Aussage anhört. Die Garde steht auf seiner Seite.«
»Aber nicht alle, oder?«
»Ich weiß es nicht.«
»Und du bist der rechtmäßige Kai…«
»Nein.« Hunters Stimme hatte einen warnenden Ton angenommen.
»…ser.« Ich biss mir auf die Unterlippe, als Hunter scharf Luft einsog. Augenblicklich bereute ich, das Wort überhaupt in den Mund genommen zu haben, denn auch wenn es stimmte, wollte er das gerade vermutlich nicht hören. Der Schmerz in Hunters Blick sprach Bände. Und wer war ich, ihn an seine Verpflichtungen zu erinnern, wenn ich meine eigenen mehr als einmal selbst hatte von mir stoßen wollen? »Tut mir leid. Das ist sicher das Letzte, das du hören willst.«
Er nickte schwach. »Schon gut. Was passiert ist, ist passiert. Kein Grund, dem nachzuhängen, wenn wir Wichtigeres zu tun haben.«
Ich sah ihm in die Augen und musste mich nicht einmal anstrengen, um die Lüge darin zu sehen. Zögernd nahm ich seine Hand. »Wir können darüber sprechen. Über letzte Nacht.« Er holte Luft, um mir zu widersprechen, doch ich kam ihm zuvor. »Nicht jetzt. Und auch nicht morgen, wenn du das nicht möchtest. Aber ich bin für dich da und höre dir zu. Egal, was kommt.«
Er lehnte seine Stirn an meine, und obwohl ich ahnte, dass er für meine Worte dankbar war, klang seine Stimme seltsam resigniert. »Ich komme darauf zurück, sobald wir hier raus sind.« Er trat einen Schritt zurück und rüttelte probeweise an der Türklinke.
»Wir müssen den Leuten die Wahrheit erzählen. Du musst ihnen sagen, was Rowan getan hat. Du bist immer noch du. Dein Name, dein Titel haben Einfluss.«
»Wer wird mir glauben?«
»Ich? Nyota? Was ist mit Dr. Hemsworth? Die Kaiserin hat selbst gesagt, dass …«
»Selbst wenn«, unterbrach mich Hunter. »Selbst wenn das stimmt. Selbst wenn sich wie durch ein Wunder alles in Wohlgefallen auflöst, wir dieses Missverständnis aufklären können und Rowan seine gerechte Strafe bekommt, bin ich der letzte Mensch, der diese verdammte Krone verdient hätte.«
»Wieso?«
»Sieh dich doch mal um!« Er machte eine allumfassende Geste. »Wer hat uns denn überhaupt erst in diese Situation gebracht? Wer hat dich in diese Situation gebracht? Wer hat mit jedem einzelnen ach so brillanten Einfall dafür gesorgt, dass alles genau so passiert ist, wie Rowan es wollte? Das war ich. Ich habe dich aus deiner Heimat gezerrt. Ich habe nicht früher realisiert, dass am Hof etwas absolut nicht stimmt. Ich habe nicht erkannt, dass sich der Schuldige direkt vor meiner Nase befindet. Ich …« Er zögerte kurz, ballte die Hände zu Fäusten. »Wegen meiner Inkompetenz ist meine Mutter tot. Das spricht nicht gerade für meine Qualifikation, über ein Land zu herrschen, das sowieso vor die Hunde geht, meinst du nicht?«
Ich biss mir auf die Unterlippe. Wie gern hätte ich ihm gesagt, dass er so viel mehr war. Dass er mehr war als das, was er sah. Mehr als seine Fehler. Aber mir war klar, dass das gerade keinen Zweck hätte. Dass er mir nicht glauben würde. Außerdem verstand ich, wieso Hunter sich so fühlte. Mir ging es ja genauso. Ich war ebenso wenig dafür geeignet, mein Amt zu bekleiden, wie er.
Ich hatte einen Auftrag gehabt. Einen einzigen. Ins Eiserne Imperium zu reisen und mich für den Wald einzusetzen. Doch ich hatte unser Schicksal nur ein wenig hinauszögern können, die Aldan gerade so davon überzeugt, sich überhaupt mit den Wispernden Wäldern zu befassen. Und selbst das war nun nicht mehr von Bedeutung. Rowan würde sich wohl kaum an den Beschluss des Rates halten.
Ich hatte versagt. Und noch dazu hatte ich meine Heimat, meinen Glauben und mein Volk verraten, indem ich unser oberstes Gesetz gebrochen hatte. Ich hatte anderen Lebewesen Leid zugefügt. Schlimmer noch: Ich hatte getötet.
Hitze kroch durch meinen Körper, als die Erinnerung zurückkehrte. Übelkeit stieg in mir auf. Mein Herz raste. Meine Haut brannte. Was hatte ich nur getan?
Ich legte die Hand auf meine Brust. Auf die Stelle, wo sich unter der Kleidung mein Qo’ai befand, dessen Wärme mir sonst immer Trost spendete. Doch ausgerechnet diese blieb heute aus. Hastig holte ich den Kristall hervor und erschrak, als meine Finger die bitterkalte, glatte Oberfläche berührten.
Da war keine Wärme mehr, kein Trost und auch kein Licht. Die zuckenden Blitze unter der Oberfläche waren verschwunden und alles, was blieb, war ein vollkommen transparentes Stück Kristall. Wie Glas.
Ich hatte das Gefühl, mein Herz würde zersplittern. Qatou, der meinen Schock spürte, kletterte endlich aus seinem Versteck und schnupperte argwöhnisch an meinem Qo’ai. Mehrmals berührte er ihn mit der Nase, den Fühlern und den Pfoten, doch nicht einmal er schaffte es, dem Stein einen Funken Licht zu entlocken.
»Was ist passiert?« Ich war so auf meinen Kristall fokussiert gewesen, dass ich Hunters Nähe erst bemerkte, als sein Atem meine Wange streifte. Er hatte sich vorgebeugt und die Augenbrauen verwirrt zusammengezogen. »War das schon immer so?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Was bedeutet das?«
»Ich weiß es nicht.« Ich kannte nur Gerüchte. Alte Erzählungen der Eijn, die ich immer für einen Mythos gehalten hatte. Geschichten von Menschen, die unsere Gesetze gebrochen und die Macht, die der Heilige Baum ihnen geschenkt hatte, missbraucht hatten, um Böses zu tun, bis der Wald sie bestraft hatte. Er hatte ihnen ihre Magie entzogen, sie zu Lichtlosen gemacht und ihnen damit auch einen Platz in der Gesellschaft der Eijn verwehrt.
Tränen brannten in meinen Augen. Es waren nur Geschichten, doch es passte. Auch ich hatte die Gesetze unseres Volkes gebrochen. Auch ich hatte Böses getan. Aber … doch nur, um mich zu wehren, um Hunter und Nyota zu beschützen.
Wütend schloss ich die Hand um den Qo’ai, drückte zu, bis sich seine scharfen Kanten in meine Haut bohrten, und wehrte mich mit aller Macht gegen die Tränen. Nicht hier. Nicht jetzt. Es gab so viel anderes, das meine Aufmerksamkeit verlangte. Aber egal, wie sehr ich es versuchte, die Verzweiflung überwältigte mich.
Ich sank auf die Knie, spürte erneut Hunters Körper ganz nah an meinem. Aber dieses Mal schaffte nicht einmal er es, mir den Trost zu spenden, den ich brauchte.
Ich hatte versagt.
Es dauerte lange, bis ich mich beruhigte und den Qo’ai niedergeschlagen unter meiner Kleidung verschwinden ließ. Und noch länger, bis etwas passierte.
Hunter und ich hatten uns an die Wand gesetzt. Sein Kopf ruhte auf meiner Schulter und ich bewunderte ihn dafür, wie er es in dieser Situation schaffte, Schlaf zu finden. Vermutlich war das eine gute Idee. Wer wusste schon, was jetzt geschehen würde und wann wir unsere Kräfte brauchten? Aber ich brachte es nicht über mich, meine Augen länger als einen Moment zu schließen, weil mich jedes Mal dieselben Bilder heimsuchten.
Irgendwann näherten sich Schritte, begleitet vom Klimpern eines Schlüssels. Ich stupste Hunter vorsichtig in die Seite, um ihn zu wecken, da war er auch schon auf den Beinen. Aus dem Nichts hellwach, die Schultern angespannt, bereit, dem, was gleich durch die Tür kommen würde, mutig entgegenzutreten.
Doch zu unserer beider Überraschung war es …
»Nyota?«, stieß Hunter aus.
Ich blinzelte, verblüfft darüber, ihr vertrautes Gesicht zu sehen. Ein schmales Lächeln lag auf ihren vollen Lippen, ein bisschen erleichtert, ein bisschen selbstzufrieden, aber keine Antwort darauf, wieso sie allein und ohne Handschellen auftauchte.
»Lange nicht gesehen«, begrüßte sie uns matt, als ich mich aufrichtete. »Habt ihr mich vermisst?«
»Was ist passiert? Hast du mit ihnen geredet? Glauben sie uns?« Hunter trat auf sie zu und legte die Hände auf ihre Schultern, fast so, als wollte er sichergehen, dass er die echte Nyota vor sich hatte und kein Trugbild.
»Was glaubst du? Wie oft hab ich dir gesagt, dass du die Klappe halten und mir das Reden überlassen sollst?«
»Also lassen sie uns gehen?«
Nyotas Lächeln erstarb. »Es ist … kompliziert.«
»Was heißt das?«
»Am besten, ihr macht euch selbst ein Bild davon. Kommt mit.«
Ohne weitere Erklärung bedeutete Nyota uns, ihr zu folgen. Wir liefen durch den Gang, dann durch eine Tür in den Raum hinein, den ich vorhin schon durch die Fenster gesehen hatte. Dieses Mal jedoch war er hell erleuchtet, sodass mir seine Dimensionen erst jetzt wirklich bewusst wurden. Er war riesig wie der Ballsaal im königlichen Palast. Doch statt glänzendem Parkett und Kronleuchtern gab es nur grauen Betonboden und Dutzende Regale, die bis unter die Decke reichten, sowie Lampen, deren grellweißes Licht harsche Schatten auf die Wände zeichnete.
»Wo sind wir?«, fragte Hunter.
»Im Hafen von Tarhos.«
»Nicht auf der Polizeiwache, nehme ich an.«
»Nein. Aber das Wichtigste: in Sicherheit. Fürs Erste.«
»Fürs Erste?« Hunters Stimme bekam einen spöttischen Unterton. »Willst du uns nicht langsam erklären, was das Ganze soll?«
Nyota schüttelte den Kopf. »Glaub mir, es ist leichter, wenn sie es dir erklären.«
»Sie?«
Ohne darauf einzugehen, beschleunigte Nyota ihre Schritte. Wir durchquerten die Hälfte der Halle, bis wir eine Stelle im Boden erreichten, in der ein quadratisches Loch klaffte. Dort führte eine Treppe unter die Erde. An ihrem Ende erwartete uns ein weiterer Korridor, der mich unwillkürlich an den Bunker unter dem Palast erinnerte. Die gleichen vergitterten Lampen und einheitlich grauen Wände. Der gleiche modrig staubige Geruch. Und die gleichen metallischen Türen, die in regelmäßigen Abständen rechts und links auftauchten.
Dann endlich öffnete sich der Korridor in einen Raum, der mich mit seinen Geräten und Schränken an die Palastküche erinnerte. Nur wesentlich kaputter und dunkler. In der Mitte stand ein Holztisch, in den Wörter, Zahlen und sogar ganze Karikaturen gekritzelt waren. An seinem Ende saß ein Mann mit abwartend verschränkten Armen, bei dem es sich der Schnitzerei im Tisch zufolge um den »Chef« handelte.
»Da seid ihr ja endlich.«
Hunter hielt abrupt an, sodass ich beinahe in ihn hineinlief. Vor Unglaube stand ihm der Mund leicht offen. »Farkas?«
»Wer denn sonst?« Der Mann mit den schwarzen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Locken grinste breit, sodass seine weißen Zähne einen sanften Kontrast zu seiner rötlich braunen Haut bildeten. Demonstrativ nahm er den silbernen Anstecker ab, der an der Brust seiner schwarzen Lederjacke prangte, und legte ihn auf den Tisch. »Auch nach all den Jahren immer noch ein Brett vorm Kopf, Hoheit.«
»Sieh es als Kompliment für deine Verkleidungskünste.« Überraschend entspannt näherte sich Hunter dem Tisch und betastete das Abzeichen. »Kunststoff? Dein Ernst?«
Farkas lachte laut auf. Es war ein zufriedenes, bellendes Lachen, das von den leeren Wänden zurückhallte, sodass es sich anhörte, als wären noch hundert weitere Personen im Raum. »Aus dem Spielwarenladen in der Kros. Du wärst überrascht, wie viele darauf reinfallen. Cienne hat echt ganze Arbeit geleistet.«
Er deutete mit dem Daumen hinter sich, wo halb im Schatten eines Türrahmens die Frau stand, die Hunter die Armbrust an die Kehle gehalten hatte. Inzwischen war sie unbewaffnet, wirkte aber mit der engen Kleidung aus schwarzem Leder nicht weniger einschüchternd. Lediglich ihr helles, beinahe weißes Haar, das fast mit ihrer cremefarbenen Haut verschmolz, passte nicht ganz zu ihrer Erscheinung.
»Ihr hattet übrigens großes Glück. Wir haben am Flughafen eigentlich auf eine Lieferung Foliatum gewartet, da seid ihr plötzlich aufgetaucht. Aber wo sind meine Manieren?«, fiel Farkas ein. »Setzt euch, setzt euch. Wir haben viel zu besprechen.«
Erst als Nyota mir rückversichernd die Hand zwischen die Schulterblätter legte, kam ich der Aufforderung nach. Offensichtlich kannten sie und Hunter diesen Farkas, dennoch war mir die Situation nicht geheuer. Eben waren wir noch Gefangene gewesen, die dem Kaiser ausgeliefert werden sollten, und jetzt sollte das alles vorbei sein? Das fiel mir schwer zu glauben, auch wenn ich dankbar war, zumindest unserer Zelle und damit meinen erstickenden Gedanken entkommen zu sein.
Wir ließen uns auf knarzenden Holzstühlen neben Farkas nieder. Aus der Nähe entdeckte ich, dass auch die anderen Sitzplätze mit Spitznamen versehen worden waren. Demzufolge wäre Hunter die Prinzessin, Nyota ein Gehirn und ich ein Zauberer. Beinahe passend.
»Und wer ist eure bezaubernde Begleitung?«, fragte Farkas und deutete auf mich.
»Kae«, stellte ich mich knapp vor, wobei ich unwillkürlich die Hand auf die Jackentasche legte, in der Qatou sich versteckte.
Als ich es bei meinem Spitznamen beließ, sprang Nyota für mich ein: »Sie ist eine Freundin und mit uns aus dem Palast geflohen. Kae, das ist Farkas. Hunter und ich haben die Militärausbildung zusammen mit ihm absolviert.«
»Nicht nur das. Aber gut. Lasst uns gleich zum Geschäftlichen kommen.« Er verschränkte die Hände ineinander. In seinen braunen Augen lag ein schelmisches Funkeln.
»Zum Geschäftlichen?«, stieß Hunter aus. »Würdest du uns vielleicht vorher noch erklären, warum du uns in eine Zelle geworfen hast, nachdem du uns am Flughafen abgepasst hast?«
»Ich wollte zuerst wissen, mit wem ich es zu tun habe.«
»Du kennst mich, verdammt. Wir waren Freunde.«
»Nyota und ich waren Freunde«, verbesserte Farkas kühl. »Du und ich wir waren bloß Bekannte, daher verstehst du sicher, dass ich mir zuerst anhören wollte, was sie zu sagen hat, bevor ich euch einfach so in meinem Zuhause rumlaufen lasse.«
Hunter schnaubte verächtlich.
»Da wir das geklärt haben, will ich jetzt auch von euch wissen: Warum sollte ich mir einen dicken Batzen Geld entgehen lassen und euch nicht dem Kaiser ausliefern?«
Hunters Blick wurde ernst, keine Spur mehr von der Entspannung, die ich eben darin gesehen hatte. »Du würdest einen ehemaligen Kameraden einfach so ausliefern?«
»Oh, ja. Wenn die Kohle stimmt, ohne Zögern und ohne jede Spur eines schlechten Gewissens.«
»Du hast dich verändert.«
»Nein. Die Welt hat mich verändert. Großer Unterschied. Nicht alle von uns werden mit einem goldenen Löffel im Mund und allem Luxus, von dem sie nur träumen können, geboren. Andere müssen dafür kämpfen.«
Hunter schnaubte. »Du hättest das Zeug für eine Karriere beim Militär gehabt. Du hättest es bis nach ganz oben schaffen können. General Fú hat es selbst gesagt.«
»Um für den Rest meines Lebens irgendwelchen Befehlen zu folgen oder jetzt – noch schlimmer – in einen Krieg geschickt zu werden? Vergiss es.«
»Krieg?!«, entfuhr es Hunter schockiert.
Ohne etwas zu sagen, tastete Farkas auf der Ablage hinter sich nach einem Stapel Papier, den er vor uns auf den Tisch knallte. Es war eine Zeitung. Hunter und ich rückten näher zusammen, um die Schlagzeile lesen zu können.
FÜRDIERETTUNGDESEISERNENIMPERIUMS
ALARMRUFSEINERKAISERLICHENHOHEITROWAN I.
NURDERSTÄRKSTEEINSATZKANNDASSCHLIMMSTEVERHINDERN
Unter dem Tisch griff Hunter nach meiner Hand, sodass ich spürte, wie seine Finger zitterten, als er den Artikel überflog. Ich hatte mit dem Lesen immer noch Schwierigkeiten, aber allein die Überschrift und einzelne Stichwörter aus dem Text reichten, um mir die Bedeutung der Worte zusammenzureimen. Vor allem die Fotografie von Hunter am Ende der Seite, zusammen mit der Unterschrift.
FAHNDUNGNACHDEMVERRÄTER. JEDERSACHDIENLICHEHINWEISMÖGEUMGEHENDDERPOLIZEIGEMELDETWERDEN.
Ich schluckte.
»Wie lange ist es her, seit wir aus dem Palast aufgebrochen sind?«, fragte Hunter an Nyota gewandt.
»Drei, vielleicht vier Stunden? Die Redakteure der Tageszeitungen müssen schon früh auf den Beinen gewesen sein.«
»Oder wurden sofort informiert.«
»Es gab eine landesweite Ansprache«, mischte sich Farkas mit ein und strich sich eine verirrte Locke hinters Ohr. »Direkt heute früh. Hätte Cienne mich nicht aus dem Bett geworfen, hätte ich sie vermutlich verschlafen.«
»Welche Ansprache? Worum ging es?«
»Die von deinem Onkel. Und ziemlich genau um das, was in dem Artikel steht. Colastine ist böse. Prinz Hunter ist böse. Krieg ist die einzige Lösung, unsere Zivilisation zu retten, weshalb sich alle fähigen Frauen und Männer bitte schnellstmöglich in den Kasernen melden sollen.«
»Und die Leute glauben das?«, wollte Hunter angespannt wissen.
»Wenn man dem Flüstern in den Straßen trauen darf, ja. Nicht alle, aber die meisten. Und zumindest hier in Ero ist Colastine nicht gerade beliebt.«
»Und was glaubst du?«
»Ich glaube gar nichts«, erwiderte Farkas. »All die Jahre im Untergrund haben mich gelehrt, dass Menschen wie ich der Politik egal sind. Warum sollte ich mich also für sie interessieren?«
»Wenn es wirklich zum Krieg kommt, wird dich die Politik genauso betreffen wie alle anderen.«
»Pff. Das soll sie mal versuchen.« Farkas machte eine abfällige Armbewegung, um zu unterstreichen, wie wenig ihn die drohende Gefahr interessierte. »Hast du überhaupt eine Ahnung, wer ich bin?«
»Du bist Farkas Zoltan Inevak, Sohn von Ildikó Inevak, der Frau, die vor zwanzig Jahren eigenhändig Helvend und Ero vor dem Bürgerkrieg bewahrt und den Frieden gesichert hat«, erklärte Hunter. Es war seltsam, dass er auf einmal derjenige war, der andere an ihr Erbe erinnerte statt umgekehrt.
»Und was hat ihr das gebracht? Ermordet von ihren eigenen Landsleuten … Nein, ich halte mich von der Politik fern. Ich bin Farkas Inevak, Anführer der Gilde der Ratten und der beste Schmuggler, den du in diesem Land finden kannst.« Er schnaubte verächtlich. »Aber was ist mit dir, Hunter Athgolan, Kronprinz des Eisernen Imperiums? Warum sehe ich nicht dich auf dem Thron, sondern deinen größenwahnsinnigen Onkel, der an seinem ersten Tag im Amt sofort den Krieg ausgerufen hat?«
Hunter verschränkte die Arme vor der Brust und seufzte. »Touché.«
»Da wir das also geklärt haben, wieso sollte ich euch nicht einfach an seine Kaiserliche Majestät verkaufen und mir von dem Geld eine schöne Insel jenseits der Fernländer kaufen?«
Hunter schwieg. Die Stille zog sich unangenehm in die Länge und noch immer zitterte seine Hand. Ich spürte seine Hoffnungslosigkeit. Doch sosehr ich es auch gewollt hätte, ich konnte ihm nicht helfen, weil es mir genauso ging. Weil mir genauso die Worte fehlten. Weil mir kein Grund einfiel, warum er es nicht tun sollte. Sollte er uns doch verkaufen. Als ob es jetzt noch einen Unterschied machte.
Am Ende ergriff Nyota das Wort. »Weil wir das Schlimmste verhindern können.«
»Ach ja?«, bohrte Farkas wenig beeindruckt nach.
»Du hast es selbst gesagt: Nicht alle stehen hinter dem Krieg oder hinter Rowan. Und wenn wir beweisen können, dass Hunter unschuldig ist, dann hat sein Onkel kein Anrecht auf den Thron. Und wir können diesen Krieg beenden.«
»Ambitioniert wie immer, was, Nyota?«
Ihre Augen wurden schmal und ihr Mund öffnete sich leicht. Vermutlich lag ihr eine schlagfertige Erwiderung auf der Zunge, die sie sich mit aller Kraft verkniff. Die Luft zwischen ihr und Farkas schien wie aufgeladen. Eine Spannung, die verriet, dass mehr hinter seiner Aussage steckte, als ich ahnte.
»Selbst wenn du das irgendwie beweisen könntest«, fuhr er unbeirrt fort, »bräuchtest du immer noch jemanden, der an seiner Stelle den Thron besteigt.«
»Hunter ist be…«
»Ich glaube nicht, dass Hunter das genauso sieht. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?«
Nyota sah Hunter ungläubig an. Doch statt zu sagen, dass er sehr wohl dazu bereit war, alles für sein Land zu tun, nickte er nur ergeben.
»Das kann nicht dein Ernst sein«, entwich es Nyota. »Du bist der Thronerbe. Du musst …«
»Nein«, unterbrach er sie. »Wer ich bin oder nicht, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass ich wirklich der Allerletzte bin, der auf diesem Thron sitzen soll. Ernsthaft. Du wärst besser dafür geeignet. Sogar Farkas hier.«
»Ihr schmeichelt mir, Hoheit.«
»Bullshit«, zischte Nyota. »Du bist der Kronprinz. Der Thron gehört rechtmäßig dir und du bist mehr als ausreichend dafür qualifiziert. Deine Mutter …«
»Meine Mutter ist tot. Was nebenbei bemerkt auch meine Schuld ist. Wäre ich nicht zu inkompetent gewesen, Rowans Spielchen früher zu durchschauen …«
»Dann werde ich eben Kaiserin«, beschloss Nyota. »Ich herrsche über das Eiserne Imperium, wenn es sein muss. Ich oder einer der Fürsten oder von mir aus auch irgendjemand aus dem Volk. Es spielt keine Rolle, weil es jetzt das Allerwichtigste ist, diesen Krieg zu verhindern und Rowan zur Verantwortung zu ziehen. Wir müssen etwas tun!«
»Und was?«, fragte Hunter. »Sollen wir einfach zurück in den Palast marschieren und Rowan freundlich bitten, sich ein bisschen zu entspannen? Wir haben keine Optionen.«
»Wir haben Verbündete. Menschen, die diesen Krieg nicht wollen. Menschen, die Rowan nicht ausstehen können. Menschen, die die Wahrheit verdienen.«
»Wenn sie die Wahrheit glauben.« Hunter vergrub das Gesicht in der Hand. »Wenn sie uns überhaupt zuhören. Es steht Rowans Wort gegen meins und nach allem, was wir wissen, hat er jede noch so kleine Eventualität bedacht. Die ganze verdammte Garde steht auf seiner Seite.«
»Wir finden einen Weg, Hunter. Wir haben immer einen Weg gefunden und das weißt du.«
»Nicht hieraus. Nein.«
Nyota spannte den Kiefer an, ballte die Hände zu Fäusten. Ich wusste, nur ein einziges weiteres Wort von Hunter und sie würde explodieren. Doch der schwieg nun endgültig. Sank weiter in sich zusammen, als hätte ihn auch der letzte Funke Widerstand verlassen.
Nyota seufzte und ihre Miene wurde ein kleines bisschen weicher, als sie sich wieder an Farkas wandte. »Na los. Mach schon. Leg uns Handschellen an und liefere uns aus, damit du deinen Lohn abholen kannst.«
»Hm?« Farkas rutschte überrascht auf dem Stuhl zurück.
»Das Kopfgeld. Darum geht es dir doch, oder? Nutz deine Chance hier und jetzt, werde uns los und kauf dir die Insel in den Fernländern.«
»Ist das dein Ernst?«
»Ja, natürlich. Du hast Hunter gehört. Wir haben sowieso keine Optionen.«
Farkas schwieg, fuhr sich nachdenklich mit der Hand über die Bartstoppeln.
»Es sei denn, du hast deine Meinung geändert?«, bohrte Nyota nach. »Vielleicht wolltest du uns von Anfang an nicht verraten. Weil dir klar ist, was dann passiert. Weil dir klar ist, dass der Krieg auch vor dir keinen Halt machen wird, egal wie tief im Untergrund du dich versteckst. Deine Ratten können dich nicht schützen.«
»Als ob.«
»Ach nein? Ich kenne dich, Farkas. Egal wie sehr du auch versuchst, das kriminelle Genie zu spielen, kannst du nicht leugnen, wer du bist. Und dass du sehr wohl ein Gewissen besitzt. Denkst du, ich wusste nicht, wo du dich die ganzen letzten Jahre herumgetrieben hast? Oder wer hinter der Gilde der Ratten steckt? Denkst du, im Palast hat niemand mitbekommen, dass die Straßen in Tarhos sicherer geworden sind und dass die Lords der Stadt auf wundersame Weise ärmer werden, während die Bevölkerung weniger hungert?«
»Das macht mich immer noch zu einem Verbrecher.«
»Was ist mit Lucienne? Ihr seid zusammen, oder? Du schuldest mir keine Antwort, eure Blicke verraten alles.« Wie zur Bestätigung sah Farkas zu Lucienne hinüber, die der Szene noch immer abwartend beiwohnte. Doch das Zucken ihrer Lippe verriet, dass auch sie sich ertappt fühlte.
»Lucienne ist ein schöner Name. Aus Colastine?«
»Vérole«, erwiderte diese, das erste Mal, dass sie überhaupt etwas sagte. Ihre rauchige Stimme klang angespannt. »Und ich bevorzuge Cienne. Worauf willst du damit hinaus?«
»Es ist ein offenes Geheimnis, dass Amaury Daunier und Alastair Bancroft beste Freunde sind. Sicherlich wird auch ein Krieg nichts daran ändern. Und wenn es so weit ist, dann werden die beiden bestimmt auf einer Seite stehen. Dann ist es ohne Zweifel nicht un…«
»Schon gut«, ging Farkas dazwischen. »Schon gut. Punkt verstanden. Du hast ja recht. Ich hätte Hunter und dich in der Wandelwüste verdursten lassen sollen.«
»Hast du aber nicht. Und aus demselben Grund wirst du uns auch jetzt nicht ausliefern. Also lass die Spielchen endlich und hilf uns.«
III
Hunter
Nyota, Farkas und ich kannten uns schon eine Weile. Er lebte ursprünglich in Tarhos, bevor seine Mutter ermordet wurde und er aus der Stadt fliehen musste. Was danach geschehen ist, konnte ich nicht sagen. Ich wusste nur, dass er eines Tages in die Militärakademie aufgenommen und unserer Einheit zugeteilt wurde. Während der Ausbildung wurden wir Freunde und in unserem ersten Jahr waren die beiden zusammen, bis Nyota festgestellt hatte, dass sie keine romantische Anziehung empfand und deshalb nicht an Beziehungen interessiert war. Freunde blieben sie trotzdem und offenbar verstand sie noch immer, wie er tickte, denn er hielt sein Wort. Obwohl er jede Chance hatte, uns auszuliefern, half er uns, unterzutauchen. Und wenn es im Eisernen Imperium einen Ort gab, an den Leute gingen, um nicht gefunden zu werden, dann war es Tarhos.
Durch seine Lage in der Schlucht herrschte ein fast immerwährender Schleier aus Sporen, der Besucher das ganze Jahr über fernhielt. Tagsüber wurde es zwischen den eng stehenden, in den weißen Fels gemeißelten Häusern nie richtig hell und nachts blieb die Dunkelheit aus. Es war ein Paradies für zwielichtige Gestalten, zu denen Kae, Nyota und ich jetzt wohl oder übel gehörten.
Von unserer Unterkunft aus, einer kleinen Wohnung über einem Tabakladen, in dem auch das in Tarhos besonders beliebte Rauschmittel Foliatum über die Theke ging, konnte ich die betriebsame Tímárgasse beobachten. Einer der Orte in der Stadt, in denen dank der vielen Schenken und Bordelle Leben herrschte.
Es war später Abend und der dritte Tag nach unserer Flucht aus dem Palast. Die Sonne hatte den Nebel orange gefärbt, der wie zähflüssige Suppe über das Kopfsteinpflaster schwappte. Während die Sporen sich in Eleyburgh nach einer Weile niederließen, sorgte der konstante Wind vom Meer in Tarhos dafür, dass sie nicht zur Ruhe kamen und sich zwischen den Straßen in der Luft sammelten, bis der seltene Regen sie davonspülte.
Das Quietschen einer Tür ließ mich zusammenfahren. Zuerst dachte ich, dass jemand uns gefunden hatte, doch es war nur Kae, die unser enges Wohnzimmer betrat. Die Dielen knarzten leise unter ihren Schritten, und als ich ihr Gesicht sah, wurde mein Herz schwer. Wir waren erst ein paar Tage in Tarhos und dennoch wirkte sie weniger wie sie selbst als je zuvor. Die schlichte Kleidung, die Cienne ihr gegeben hatte, passte nicht. Die Hosen aus grobem Baumwollstoff reichten ihr nur bis knapp über die Knöchel und in den grauen Wollpullover hätte Kae vier Mal gepasst. Ihre Haare waren strähnig und die Ringe unter ihren Augen dunkel von all den Nächten, die sie wach gelegen hatte, in dem Versuch, ihrem Bernstein wieder Leben einzuhauchen.
So wie auch jetzt. Wortlos setzte sie sich zu mir auf die breite Fensterbank und nestelte mit den Händen an ihrem Qo’ai herum, der bei unserer Flucht seine Energie verloren zu haben schien. Dabei starrte sie abwesend nach draußen. Ich wünschte, ich hätte eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen, doch davon, dass die Kristalle einfach aufhörten zu leuchten, hatte ich noch nie etwas gehört. Wenn wir sie zur Energiegewinnung benutzten, lösten sie sich einfach auf. Wurden erst zu Feuer und schließlich zu Asche und Rauch. Aber das hier? Das musste etwas sein, wovon wir Aldan nichts verstanden. Wie von so vielem.
»Was machst du gerade?«, fragte Kae leise.
»Aus dem Fenster schauen.« Das Einzige, was ich im Moment überhaupt machen konnte.
»Hast du irgendwas Interessantes mitbekommen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Das Spannendste war ein streitendes Paar, das vor ein paar Minuten im Pub gegenüber verschwunden ist. Aber wenn ich mich nicht mit irgendetwas beschäftige, fällt mir die Decke auf dem Kopf. Dir nicht?«
»Doch.« Kae seufzte. »Es ist eine Sache, nichts tun zu können, aber dabei noch an einen Ort gebunden zu sein … Erinnert mich an die Tage im Gefängnis.«
»Das tut mir immer noch leid.«
»Muss es nicht. Ich schäme mich nur, dass ich nicht früher erkannt habe, was Rowan plant. Jetzt im Nachhinein ergibt es Sinn, warum er mich unbedingt aus dem Weg räumen wollte.«
»Ja, dein Auftauchen muss seine Pläne ziemlich ins Wanken gebracht haben.«
»Aber es hat nicht gereicht.«
Ich seufzte. »Nein. Wie war es denn so im Gefängnis? Sicher hattest du dort wesentlich bessere Gesellschaft, als ich es im Moment bin.«
Ein seltenes, mildes Lächeln streifte Kaes Lippen. Qatou flatterte durch den Raum und landete zwischen uns auf dem Fensterbrett. Neugierig legte er die Pfoten an die Scheibe und schnupperte daran, sodass sich ein kleiner Fleck Kondensation bildete.
»Es war seltsam«, antwortete Kae schließlich. »Auf der einen Seite waren die Menschen dort ungewohnt nett zu mir, aber gleichzeitig hatte ich auch solche Angst.«
»Das kann ich mir vorstellen, kaum warst du im Eisernen Imperium, haben wir dich wie eine Verbrecherin behandelt und eingesperrt.«
»Nicht deshalb.«
»Sondern?«
»Ich hatte Angst um dich. Das Letzte, was ich gesehen habe, war, wie du halb erstickt am Boden lagst, bevor sie mich weggeschleppt haben. Bei jeder Gelegenheit habe ich dem Empfänger gelauscht, aus Angst, sie würden deinen Tod verkünden. Dann standest du plötzlich in der Tür.«
Mein Herz zog sich zusammen bei der Erinnerung an den Tag. An Alexanders Beisetzung, das Wiedersehen mit Kae und den Regen. Vorsichtig streckte ich die Hand aus und legte sie auf Kaes.
»Ich war schon immer für meine dramatischen Auftritte bekannt.«
Kae begann mit ihrem Finger Kreise auf meine Haut zu malen. Die zarte Berührung ließ feine Schauer durch meinen Körper ziehen.
»Was machen wir hier, Hunter?«, wisperte sie.
Ich sah auf, direkt in ihre braunen Augen. Ihr Blick war undurchdringlich, ernst mit so vielen unausgesprochenen Worten darin.
Ratlos zuckte ich mit den Schultern. »Darauf warten, dass das Paar aus dem Pub kommt, und schauen, ob sie sich wieder versöhnt haben?«
»Das meine ich nicht.«
Ich seufzte. Natürlich meinte sie nicht das. Aber eine Antwort hatte ich auch nicht. »Ich weiß es nicht. Warten, schätze ich.«
»Worauf?«
»Eine Idee? Darauf, dass Rowan aufgibt?« Ich verzog die Lippen. »Darauf, dass sie uns finden? Wenn es nach Nyota ginge, vermutlich darauf, dass ich endlich zur Vernunft komme und meinen Anspruch auf den Thron geltend mache. Aber …«
»Du bist nicht der Richtige.« Kae betrachtete mich verständnisvoll. »Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Rolle auferlegt zu bekommen, für die man einfach nicht geeignet ist.«
Sie umklammerte ihren Qo’ai fester.
»Vielleicht muss er nur wieder aufgeladen werden?«
»Nein. So funktioniert ein Qo’ai nicht.«
»Verstehe.«
Wir sprachen nur wenig darüber. Kae war das Thema sichtlich unangenehm und ich würde mich hüten, nachzubohren, wenn es ihr so schwerfiel, es überhaupt zu erwähnen. Ich wusste nur, dass ihr Qo’ai seine Magie verloren hatte und dass sie glaubte, es läge daran, dass sie die Palastgarde angegriffen hatte. Für mich klang das unsinnig, schließlich hatte sie nur aus Notwehr gehandelt, aber ich war der Letzte, der verstand, wie ihre Magie oder der Wald funktionierten.
»Hunter … ich weiß, dass wir es nicht sollten … aber können wir zumindest kurz nach draußen gehen?«
Ich presste die Lippen zusammen. »Du weißt, dass das nicht geht.« Mit dem Finger deutete ich auf eine Hauswand gegenüber. Dort war neben einem Werbeplakat für eines der Etablissements in der Stadt ein Fahndungsbild angebracht, das meine kaiserliche Visage zeigte. Es war eine Sache, wenn Nyota so wie jetzt nach draußen ging, um Besorgungen zu erledigen und uns mit Nachrichten zu versorgen, aber ein viel zu großes Risiko, wenn ich mich in der Öffentlichkeit zeigte.
»Ich weiß … Es ist nur … je länger ich in dieser Wohnung sitze, desto mehr habe ich das Gefühl zu ersticken.«
»Geht mir genauso«, seufzte ich und war für einen Moment über mich selbst überrascht. Wann war ich die Stimme der Vernunft geworden? Derjenige, der ein Risiko scheute oder sich damit zufriedengab, einfach an Ort und Stelle zu verharren, bis irgendetwas passierte?
Wieder wanderte mein Blick nach draußen. Auf der Straße war einiges los, ein regelrechtes Gedränge. Dutzende Menschen zogen durch die Tímár und verschmolzen mit ihren Mänteln und Masken zu einer homogenen Masse.
Ich sah erneut Kae an. Dann Qatou, der noch immer die Pfoten gegen die Scheibe drückte und nun mit seiner winzigen rosafarbenen Zunge über das Glas leckte. Dann zur Tür, neben der an einem Kleiderhaken Kaes und meine Masken hingen.
Langsam richtete ich mich auf. Mein Rücken ächzte unter der plötzlichen Belastung, nachdem ich den ganzen Nachmittag auf der Fensterbank verbracht hatte. Draußen war es inzwischen etwas dunkler geworden. Der Nebel mehr violett als orange, vereinzelt erhellt vom blassen Licht der Straßenlaternen.
»Hunter?«
»Lass uns gehen.«
Kae stieß überrascht Luft aus. »Meinst du das ernst?«
»Ja. Es wird dunkel … und wenn wir vorsichtig sind, können wir uns sicher ein bisschen umsehen.«
Schnell richtete Kae sich auf und mit einem Mal war zumindest ein Bruchteil ihres Selbst zurück. Nur ein Funken, aber es reichte, um mein Herz zum Flattern zu bringen und mich die mögliche Gefahr unseres Ausflugs vergessen zu lassen. Kae lächeln zu sehen, war jede Gefahr wert.
Und bevor ich es mir anders überlegen konnte, bevor die Zweifel mich wieder einholten, bevor ich mich daran erinnerte, in was für einer Situation wir steckten, legte ich den Arm um ihre Taille, zog sie an mich heran und küsste sie.
Hier unten war der Schleier noch viel dichter. Richtiger Nebel hatte sich zwischen die Sporen gemischt und sorgte dafür, dass ich kaum ein paar Häuser weit sehen konnte. Dieser Umstand kam uns entgegen, denn offensichtlich hatte es sich der Kaiser nicht nehmen lassen, jede einzelne Hauswand mit meinem Gesicht zu verzieren. Die Plakate waren einfach gehalten mit einer Fotografie von mir, einer Liste meiner Verbrechen und einem ziemlich beachtlichen Preis für meine Verhaftung. Einer, der mir trotz aller Umstände ein wenig Genugtuung verschaffte, weil er zeigte, wie dringend mein Onkel mich aus dem Weg schaffen wollte. Selbst wenn er dafür die kaiserliche Schatzkammer plündern musste.
Kae und ich wanderten Hand in Hand ziellos durch die Straßen. Wir hatten uns nie Gedanken darüber gemacht, wo wir hinwollten, aber ehrlich gesagt, war ich einfach nur dankbar dafür, überhaupt aus dem Haus zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass die stinkende schwülwarme Luft Tarhos’ mir derart guttun würde und die Schwere meiner Gedanken zumindest für den Moment vertrieb.
Wir folgten der Tímárgasse, blieben hin und wieder stehen, um sicherzugehen, dass uns niemand folgte, und um die Umgebung ganz in uns aufzunehmen. Bars mit ausgefallenen Namen, Alkoholläden, Apotheken, Bordelle, in deren Schaufenstern leicht bekleidete Männer und Frauen die Kunden zu sich einluden, und Foliatumhöhlen, deren Rauch sich mit dem Nebel vermischte und diesen einzigartig blumigen Geruch in sich trug.
Es war Jahre her, seit ich zum letzten Mal durch diese Straßen gewandert war, und als wir eine Bar mit dem Namen Zum schmutzigen Entchen vorbeikamen, packte mich die Nostalgie. Am liebsten hätte ich Kae mit mir hineingezogen, um sie den Cider aus der Hausbrauerei probieren zu lassen, allerdings war mir das Risiko zu hoch. Es war eine Sache, mit einer Maske, die den Großteil meines Gesichts bedeckte, durch eine neblige Straße zu wandern, aber eine völlig andere, mich in eine Bar zu setzen. Ebenso gut könnte ich gleich eine riesige Zielscheibe auf meinen Rücken malen.
Am Ende der Gasse führte eine Brücke über einen der vielen Kanäle zur Etana, der Hauptstraße, wo fast noch mehr los war. Kein Vergleich zu unserer Ankunft vorgestern Morgen. Frauen, Männer, sogar Kinder spazierten durch den Schleier aus Sporen, ohne ihnen Beachtung zu schenken. Sie blieben stehen, um sich zu unterhalten, begutachteten die Auslagen in Schaufenstern und gingen ihrem Alltag nach, als gäbe es die Sporen überhaupt nicht. Nur die schweren Ledermasken deuteten darauf hin, dass etwas nicht stimmte.
Unwillkürlich rückte ich ein Stück näher an Kae heran, als wir die Straße betraten, und zog die Kapuze meines Mantels etwas tiefer. Um mich zu erkennen, müsste jemand mir zwar die Maske vom Gesicht reißen und mich aus unmittelbarer Nähe anschauen, doch die vielen Menschen schürten meine Nervosität. Ich beschloss, unseren Spaziergang möglichst kurz zu halten und nur bis zur nächsten Abzweigung auf der Etana zu bleiben, bevor wir uns auf den Rückweg machen würden. Da riss mich plötzlich ein Geräusch aus meinen Gedanken. Das hohe regelmäßige Läuten einer Glocke, begleitet vom Brummen eines Motors, das sich uns näherte.
Ein Raunen ging durch die Menge, Eltern ermahnten ihre Kinder und rasch wichen die Menschen von der Straße. Ohne zu wissen, was uns erwartete, taten Kae und ich es ihnen gleich. Wir sprangen auf den Bordstein und drängten uns in die Nische eines Gebäudes.
Das Läuten der Glocke wurde lauter und allmählich schälte sich ein Automobil aus dem Nebel. Es war ein schmales Militärfahrzeug mit nur einem Sitz und einer winzigen Ladefläche mit einem darauf montierten Gewehr. Die Fahrerin hatte eine Hand am Lenkrad und hielt die andere aus der offenen Seite, um die Glocke zu läuten und auf sich aufmerksam zu machen.