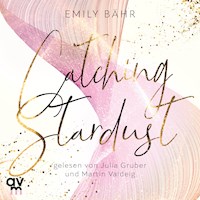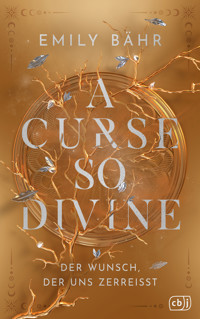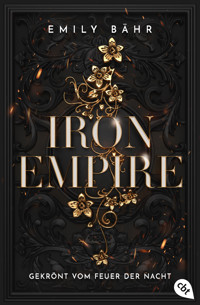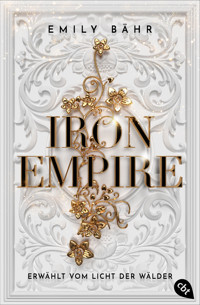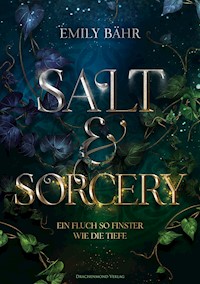
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Ich hätte das ganze Königreich zu Eis erstarren lassen, wenn sich dadurch nur eine winzige Chance ergeben hätte, dich zurückzuholen, aber …« »Es hätte nicht gereicht.« Bei dem Versuch, einem Menschen das Leben zu retten, verliert das Selkie-Mädchen Maebh ihren magischen Mantel und damit die einzige Möglichkeit, wieder nach Hause zu gelangen. So hat sie nur bis zum nächsten Vollmond Zeit, um sich in einer ihr völlig unbekannten Welt zurechtzufinden und ihren wertvollsten Besitz zurückzuholen. Ihre letzte Hoffnung ist Ciarán, der schweigsame Fremde, der sie überhaupt erst in diese Situation gebracht hat. Doch obwohl er alles daransetzt, sie loszuwerden, führt ihr Weg die beiden immer wieder zusammen, und Maebh erkennt, dass er hinter seiner undurchdringlichen Fassade noch viel mehr verbirgt als nur Geheimnisse. Und dass ihr Schicksal weitaus dichter mit der Menschenwelt verwoben ist, als sie glaubt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
SALT & SORCERY
EIN FLUCH SO FINSTER WIE DIE TIEFE
EMILY BÄHR
Copyright © 2022 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Nina Bellem
Korrektorat: Sarah Nierwitzki – Wortkosmos
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-574-8
Alle Rechte vorbehalten
INHALT
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Epilog
Drachenpost
Für Miriam
Solas ar d’anam
Aussprache der Namen
Maebh – Mäif
Ciarán – Kiehrenn
Siobhan – Schewonn
Fiadh – Fii-a
Éibhear – Eiwoor
Seamus – Schäi-mess
Oisin – Asheen
Sorcha – Sorkah
Daithi – Da-hie
Diarmaid Mac Cárthaigh Mór –
Dör-mott Mäk-Kar-thi Mor
Laoghaire – Lie-rie
Grainne – Grahn-je
Übersetzungen:
Tá an-bhrón orm, cailín – Tut mir leid, Mädchen
Go dté tú slán – Viel Glück und gute Reise
Slain go foil – Auf Wiedersehen
Slán agat – Lebewohl
»When angels fell,
some fell on the land, some on the sea.
The former are the faeries
and the latter were often said to be the seals.«
Unbekannt, Orkney-Inseln
PROLOG
Der Legende nach herrschten einst ein König und eine Königin über das Meer. Sie waren gesegnet mit vielen wunderschönen Kindern, die die Tage glückselig inmitten der magischen Korallengärten und grünen Weiden am Meeresgrund verbrachten. Ihr Leben war voll Heiterkeit, Gesang und Lachen.
Eines schicksalhaften Tages jedoch wurde die Königin furchtbar krank, und nur wenige Wochen später starb sie. Das brach das Herz des Königs mitten entzwei. Auch die Kinder vermissten ihre Mutter sehr, weshalb im ganzen Königreich kein Lachen oder Singen mehr zu hören war.
Trotz allen Leids wusste der König, dass es seine Pflicht war, erneut zu heiraten, um seinen Kindern eine Mutter zu geben. Die Seehexe, die von Jahren der Bitterkeit ganz hässlich geworden war, witterte die Gelegenheit, Königin zu werden, um jene zu beherrschen, die schon immer über sie gespottet hatten. Mit einer List verführte sie den König, und die beiden vermählten sich.
Ihre Bitterkeit legte sich allerdings auch dann nicht, denn sie war eifersüchtig auf die Kinder des Königs, die selbst im Kummer noch so viel schöner waren, als die Königin es je sein würde.
Da verfluchte die Hexe sie und verwandelte sie in Robben, auf dass sie nie wieder das Königreich betreten und nur im Licht des vollen Mondes ihre wahre Gestalt annehmen konnten.
In seinem Zorn verbannte der König die Hexe in die dunkelsten Tiefen des Ozeans, doch niemand vermochte es, den Fluch, den sie auf seine Kinder gelegt hatte, zu brechen.
Und so durchschwimmen die Robben die Weltmeere, ohne je in ihre Heimat zurückkehren zu können. Und wenn man genau hinhört, kann man in einer klaren Vollmondnacht an der Küste ihrem Gesang lauschen.
1
Die anderen hielten sich stets von der Küste fern. Stattdessen zog es sie in den magischen Vollmondnächten, die nur ihnen gehörten, auf die felsigen Stufen von Sceilg Mhichil, dorthin, wo die Menschen vor Jahrhunderten schon kleine, runde Häuschen und steile Treppen errichtet hatten. Inzwischen kamen sie nicht mehr auf diese Insel. Sie fürchteten den Ort, der wie ein Monolith aus dem Ozean ragte, und erzählten sich Schauermärchen von lieblichen Gesängen, die vom Wind bis ans Festland getragen wurden. Von gespenstisch hellem Lachen, das selbst die tiefste Nacht durchschnitt. Von blassen Gestalten, die sich dort auf den Steinen tummelten.
All dies traf auf ihre Geschwister zu, doch als angsteinflößend hätte Maebh sie nicht bezeichnet. Denn sie nutzten die wenigen Stunden der Nacht, die ihnen in ihrer wahren Gestalt blieben, nur dazu, sie selbst zu sein. Für Maebh gab es nicht Schöneres, als ihre Beine auszustrecken und im silbernen Licht des vollen Mondes zu baden, mit ihren Geschwistern zu scherzen und zu singen, bevor die dunkle Magie sie in die kalten Arme von Mutter Ozean zurückzwang.
Die Geschichte vom Fluch der Meerhexe war so alt, dass sie inzwischen als Legende galt. Eine der vielen, die die Selkies sich unter den Sternen erzählten. Und doch würde niemand von ihnen es wagen, die Regeln zu brechen:
Eine Nacht im Monat gehört dir.
Verwandelst du dich nicht vor Anbruch des Morgens wieder in eine Robbe, bleibt dir Zeit bis zum nächsten Vollmond – dann musst du für immer zurück ins Meer. Tust du das nicht, stirbst du.
Egal, wo du bist, verstecke deinen Mantel gut.
Die erste Regel beschrieb ihr Leben. Die zweite war eine Warnung.
Die dritte betraf vor allem diejenigen, die sich nicht im Schutz der kleinen Insel der Verwandlung unterzogen. Diejenigen, die trotz jeglicher Risiken mehr sehen wollten als die ewig gleichen Felsen im Ozean. Die wissen wollten, was es mit diesen Menschen auf sich hatte.
Aber wer war schon so töricht, sich aus reiner Neugier in eine solche Gefahr zu begeben?
»Gehst du schon zurück?«, flötete Maebhs Schwester Siobhan, als sie bemerkte, wie diese sich zu ihrem Mantel am Fuß der steinernen Treppe schlich. Die anderen waren völlig vertieft in ihren Gesang, und weiter oben bei den kleinen Häusern spielten einige von ihnen Verstecken. Doch Siobhan musste ihre Schwester Maebh eine Weile dabei beobachtet haben, wie sie unruhig auf einen günstigen Moment gewartet hatte. Ihre Miene war keineswegs missbilligend, sondern eher fragend, als sie Maebh auf leisen Sohlen zu der kleinen Nische im Gestein folgte, wo sie beide ihre Mäntel abgelegt hatten.
»Nein.« Maebh schüttelte ertappt den Kopf, weil es vergebens gewesen wäre, ihr ins Gesicht zu lügen. »Ich will noch kurz zur Küste.«
»Um diese Zeit?«
Siobhans Blick wanderte hinauf zum Vollmond, der heute so hell strahlte, dass die Sterne in seinem Angesicht vor Neid verblassten. Doch Maebh verstand, was sie meinte. Sie saßen bereits lange auf der Insel und die Nacht war bald vorbei.
Vorsichtig strich Maebh sich eine Strähne aus dem Gesicht. Wie das ihrer Schwester war ihr Haar lang und von einer gräulich-braunen Farbe. Seidig und glatt wie das Fell in ihrer zweiten Gestalt. Dort hörten die Ähnlichkeiten zwischen den beiden allerdings auf, denn Siobhans Hautfarbe war dunkel, fast schwarz, und auch ihre Augen waren anders. Maebhs hellgrün, Siobhans dagegen braun und voller Besorgnis.
»Nicht lange«, versprach sie ihr. »Ich will nur …«
Was? Was sollte sie ihrer Schwester schon sagen?
Ich will nur schauen. Herausfinden, was die Menschen so tun. Sehen, was abseits des Meeres und dieser öden Felsen passiert.
Siobhan schien sie auch ohne Worte zu verstehen, denn sie nickte. Sie war eine der Ältesten, zählte schon bald über zwei Jahrhunderte, und hatte in ihrem Leben viele andere Ozeane erkundet. Sie kannte Geschichten von Selkies, die den Schutz des Meeres für die Menschen verlassen hatten, nicht nur, sie hatte sie sogar mitbekommen.
Wann immer sie davon erzählte, beschrieb sie es so: Es ist, als würden manche von uns einem Ruf folgen …
Ob das auch auf Maebh zutraf?
Sie kam nicht dazu, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, weil sie sich plötzlich in einer stürmischen Umarmung wiederfand. Siobhans nackte Haut schmiegte sich angenehm kühl an ihre, und in dem Moment, in dem Maebhs Hand auf ihrem Rücken verharrte, spürte sie ihr Herz schlagen.
»Pass auf dich auf«, flüsterte Siobhan ihr zu, bevor sie ihr einen Kuss auf die Stirn hauchte und sich wieder von ihr löste. Es war nicht das erste Mal, dass Maebh sich im Vollmond davonstahl, nicht das erste Mal, dass ihre Schwester es mitbekam, weshalb ihr dieser innige Abschied seltsam unangebracht vorkam. Schließlich ging sie nur kurz schauen.
Ihr blieb keine Gelegenheit mehr, Siobhan nach dem Grund für ihr Verhalten zu fragen, denn ehe sie ihre Gedanken sortiert hatte, war diese wieder auf dem Weg zu den anderen nach oben.
Maebhs Blick wanderte noch einmal zum Mond, dessen zarte Strahlen ein Prickeln auf ihrem Körper hinterließen, als würden sie ihn mit Magie küssen. Dann schnappte sie sich ihren Mantel und huschte zum Ufer.
Es war bereits mehr Morgen als Nacht, als Maebh am Kap vorbeischwamm. Obwohl es ihr Tempo verlangsamte, hielt sie den Kopf stets über Wasser. Immer wieder sah sie zurück, bis Sceilg Mhichil von den Klippen des Festlands verdeckt wurde. Erst, nachdem sie die steilen Felsen umrundet hatte, fühlte sie sich völlig vor den verurteilenden Blicken ihrer Geschwister geschützt, die ihr Fehlen inzwischen bemerkt haben mussten. Sie hätten Maebh nicht aufgehalten, aber im Vergleich zu Siobhan hatten andere wenig Verständnis dafür, wieso sie sich oft zu so später Stunde davonmachte, um ausgerechnet den Ort aufzusuchen, den sie so sehr fürchteten.
Maebh hielt kurz an, um zu lauschen, doch über das Tosen der Wellen hinweg waren ihre Stimmen nicht zu hören. Sie war allein. Kaum mehr als ein einziger dunkler Fleck im silbernen Band, das der Mond auf die Wasseroberfläche zeichnete. Und sie hatte ein Ziel.
Inzwischen war ihr die Strecke so geläufig, dass sie den Weg auch in tiefster Dunkelheit gefunden hätte. Von nichts geleitet als den Klängen des Ozeans und dem Rauschen der Flut, die gegen die Felsen des Kaps prallte und sie weiter die Küste entlang lockte. Maebh folgte ihrem Verlauf für einige Kilometer – ein Leichtes für ihren geschmeidigen Körper, der nur für das Schwimmen geschaffen war –, bis vor ihr eine Insel auftauchte. Zwischen dieser und dem Festland führte eine Meerenge zu ihrem Ziel. Ab hier musste Maebh auf der Hut sein.
Sie tauchte unter, bevor sie die schmale Passage durchquerte, wo sich auf dem Grund die Wracks Dutzender Schiffe und Barken fanden, deren Steuermänner die reißende Gewalt der Fluten zum Gezeitenwechsel unterschätzt hatten. Behutsam schlängelte sich Maebh zwischen ihnen hindurch, denn obwohl ihre Augen die Dunkelheit unter der Oberfläche durchdrangen, musste sie vorsichtig sein, falls die Strömung sich plötzlich veränderte.
Erst als das Wasser wieder ruhiger und gleichzeitig wärmer wurde, wusste sie, dass sie es geschafft hatte.
Die Menschen nannten die Bucht Baile an Sceilg, den Ort der schroffen Felsen, eine Anspielung auf die Inseln, die die Selkies zu ihrem Zuhause erklärt hatten. Eine seltsame Wahl, wie Maebh immer wieder feststellte, denn was sie hier vor allem sah, waren Strände. Sanfte, im Mondlicht fast kalkweiße Streifen, die sich wie Aale um die Küste schlängelten. Und genau deshalb war sie hier. Um weichen Sand unter ihren Sohlen zu spüren statt rauer Felsen. Um den Wellen zu lauschen, die hier im Schutz der Bucht sanfter waren. Und um vielleicht, ganz vielleicht sogar einen Blick auf einen Menschen zu erhaschen.
Maebhs Atem ging flach, während sie sich so geräuschlos wie möglich an der Küste entlangbewegte. Ein Jahr zuvor hatten die Menschen am Ende der schmalen Landzunge einen Wachturm errichtet, der fast die gesamte Bucht überblickte. Tag und Nacht patrouillierten Soldaten auf den hohen Mauern, was es schwieriger machte, sich aus dem Meer zu wagen – aber auch umso aufregender.
Maebh schwamm an den Fuß der aus dem Wasser ragenden Mauern heran, bevor sie das Gebäude in seinem Schatten umrundete. In manchen Nächten konnte sie den Gesprächen der Wachen zuhören, doch heute schwiegen sie. Maebh hielt inne und lauschte dem Ozean. Die Wellen brandeten sanft und leise gegen das steinerne Fundament, mehr plätschernd als tosend. Hier auf der Schattenseite waren die Sterne deutlicher zu sehen, ihr Funkeln in der Nacht, das heute irgendwie anders wirkte. Eine eigentümliche Stimmung lag in der Luft. Etwas, das Maebh nicht benennen, aber bis in ihre Eingeweide spüren konnte. Ein Prickeln, das ihr die Wirbelsäule hinab bis in die Schwanzspitze fuhr.
Ein Sirren lag in der Luft. Dann erklangen auf einmal Stimmen.
»Lasst mich sofort gehen oder ihr werdet es bereuen!«
»Mach dir da mal keinen Kopf, Junge. Wir sind schon dabei, dich gehen zu lassen!«
»Wo sind meine Sachen?«
»Maul halten.«
Über ihr ertönte ein Geräusch, als würde etwas Schweres zu Boden geworfen. Unbewusst hielt Maebh den Atem an und presste ihren Leib gegen das Mauerwerk. Für die Männer war sie zwar nur eine Robbe, doch sie wollte kein Risiko eingehen.
»Wenn du dem König deine Dienste verweigerst, hast du nichts in unserem Land verloren.«
Eine dritte Stimme ertönte. »Denkst du, es ist sicher? Ich meine, er ist einer von denen. Wenn wir ihn ins Meer werfen, spielen wir ihm vielleicht nur in die Hände und …«
»Papperlapapp. Wir haben seinen Stab. Ohne ist er so nutzlos wie ein Kind.«
»Aber …«
»Kein Aber. Los jetzt, hilf mir, ihn hochzuheben. Wenn er sich nicht das Genick an den Felsen bricht, ist er spätestens in ein paar Minuten ersoffen. Und dann bringt ihr das Ding sofort zum König. Ist das klar?«
»Ja. Ich meine nur, dass …«
Ein entnervtes Stöhnen war über ihr jetzt so deutlich hörbar, dass es ihr durch Mark und Bein fuhr.
»Nichts mehr davon. Wenn du sicher sein willst, dass er nicht wiederkommt und dich in deinen Träumen heimsucht, dann …«
Das Ende des Satzes hörte sie nicht, denn ein lautes Platschen im Wasser ließ Maebh fast reflexartig in eben dieses hinabtauchen. Kreisförmig breiteten sich die Wellen von der Stelle aus, an der soeben ein menschlicher Körper in den Fluten versunken war. Feine Bläschen tanzten auf der pechschwarzen Oberfläche, keine drei Schwimmzüge von ihr entfernt.
Was?
»Und erledigt«, kommentierte einer der Männer zufrieden. »War doch gar nicht so schlimm.«
An der Art des Schweigens erkannte Maebh, dass der andere Wachmann sich einen weiteren Protest verkniff. Stattdessen war ein leises Räuspern zu hören, ehe der erste erneut das Wort ergriff.
»So, und jetzt macht, dass ihr loskommt! Alle beide.«
Schritte entfernten sich eilig, doch erst als es so still wurde, dass Maebh sicher war, allein mit dem Ozean zu sein, wagte sie es wieder, zu atmen. Ein einziger langer Atemzug, mit dem sie so viel Luft einsog, wie sie nur konnte, bevor sie, ohne nachzudenken, in die Tiefe tauchte.
Selbst für ihre Sinne war die Schwärze in diesem Teil des Wassers ein Hindernis. Sie war gezwungen, sich auf ihre Schnauze zu verlassen. Auf das feine Tasten ihrer Schnurrhaare, während sie die Fluten nach einem Widerstand absuchte.
Da! Etwas streifte ihren Rücken, weich und bitterkalt. Maebh schlug einen Haken und konnte einen Körper ertasten. Einen menschlichen. Jetzt musste sie sich konzentrieren.
Es war nicht das erste Mal, dass sie jemanden rettete, aber heute stellten nicht nur die Wellen eine Gefahr dar. Die Furcht rauschte wie ein Gift durch ihre Venen. Was, wenn sie sie längst entdeckt hatten? Was, wenn sie bemerkten, was Maebh vorhatte?
Sie gab der Angst keine Zeit, sie zu lähmen, sondern tat genau das, was sie schon oft getan hatte. In einer einzigen geschmeidigen Bewegung schob sie ihren Körper unter den des Fremden. Von dort presste sie sich behutsam gegen ihn, bis sie sicher war, dass sie die Kontrolle über ihn hatte.
Normalerweise verließ sich Maebh auf ihre Balance und ihr Gefühl für die Launen des Ozeans, während sie den Ertrinkenden langsam zur Oberfläche und anschließend an Land brachte. Doch dieses Mal passiert etwas Seltsames.
Schwerelos wie Seegras schwebten die Glieder des Mannes neben ihm, nur getragen vom Hin und Her der Strömung. Dann, wie aus dem Nichts, schien sein Überlebensinstinkt zu erwachen, und als ihr Körper seinen berührte, schlang er die Arme um ihren Leib.
Maebh widerstand dem Impuls, schnell das Weite zu suchen, und ließ zu, dass er sich an ihr festhielt. Sein Griff war kraftlos, gerade ausreichend, um sich an sie zu klammern. Ihr war klar, dass er dringend Sauerstoff benötigte. Nur durfte sie es nicht wagen, in der Nähe der Burg aufzutauchen, solange die Männer dort waren. Sie musste darauf vertrauen, dass seine Kraft den Fremden am Leben hielt, bis sie von hier weg waren.
Sie gab alles, doch als sie endlich die Oberfläche durchstieß, war der Fremde kaum noch bei ihr. Das verzweifelte Nach-Luft-Schnappen blieb aus, und nur sein schweres Gewicht auf ihrem Rücken erinnerte Maebh daran, dass er überhaupt dort war. Jetzt warf sie alle Sorgen über Bord und schwamm auf direktem Weg zum Strand. Er sah leer aus, doch um sicherzugehen, fehlte ihr die Zeit. Sie waren kaum mehr als einige hundert Meter von der Burg entfernt, allerdings konnte sie an der Küste ein paar Felsen entdecken.
Eine Welle packte Maebhs Körper und schob sie voran, als wollte Mutter Ozean selbst, dass sie es schaffte. Maebh spürte feinen Sand unter ihrem Bauch. Über ihr schien noch immer der Vollmond, in dessen Licht sie ihre Verwandlung in rasender Geschwindigkeit vollzog, als hinge ihr eigenes Leben davon ab. Ihr dicker Körper wurde länger und definierter. Danach teilte sich ihre Schwanzflosse, wurde erst zu Beinen, zu Füßen, dann zu Zehen. Sie richtete sich auf und streifte eilig den Rest ihres Fells von den Schultern wie einen Mantel. Einen Mantel, den sie nun achtlos zur Seite warf, bevor sie sich umwandte und den Fremden mit sich an Land zog.
Das schwarze Haar klebte ihm wie Seetang im Gesicht. Hier an der Luft, aber vor allem in ihrer schmächtigen, menschlichen Gestalt war es umso schwerer, ihn zu bewegen. Nach ein paar Metern war Maebh völlig entkräftet, doch es hatte gereicht, um ihn so weit aus dem Wasser zu zerren, dass die Wellen nur seine Füße umspielten.
Anschließend beugte sie sich über ihn und legte ein Ohr an seine Brust. Sein Herz flatterte leise und schnell, aber es hatte noch Kraft. Sie musste nur …
Lautes Hufgetrappel riss sie aus ihren Überlegungen. Es kam aus Richtung des Weges, der direkt hinter dem Strand am Ufer entlangführte. Und es kam näher. Maebhs Blick wanderte zu dem Mann am Boden, der still und regungslos um sein Leben kämpfte, und dann wieder hinauf zur Böschung. Noch erkannte sie dort niemanden, meinte aber, das Stampfen der Pferde als Vibration im Boden zu spüren. Panik legte sich wie eine Schicht aus Eis um sie, machte sie kopflos. Nur wenige Meter entfernt bot eine Gruppe Felsen möglichen Schutz. Maebh dachte nicht länger nach, sondern hastete drauf zu und ließ ihren Körper zwischen die Spalten gleiten, obwohl sich der Stein in ihre dünne, blasse Haut bohrte.
Ein stechender Schmerz im Oberschenkel trieb ihr die Tränen in die Augen, doch sie schaffte es gerade so, einen Schrei zu unterdrücken. Da sah sie, wie die Pferde über die Dünen jagten und sich direkt auf den bewusstlosen Mann zubewegten.
Erleichterung durchflutete sie. Die Flucht zu ergreifen, war die richtige Entscheidung gewesen, doch ihr Mantel!
Panisch tastete Maebh sich danach ab, nur um das Bündel aus Fell und Leder ein paar Meter entfernt halb in den Dünen, halb in der Brandung zu entdecken. Dort, wo die Wellen ihre verräterischen Spuren im Sand verschwinden ließen. Ihr Herz sackte hinab. Nein!
Die beiden Reiter kamen neben dem Bewusstlosen zum Stehen. Ihre Worte wurden vom Wind zu ihr herübergetragen.
»S-siehst du, Fínghin? Ich hab doch gesagt, d-d-dass …« Trotz der klappernden Zähne konnte sie die Stimme des Mannes genau identifizieren. Er war einer der Wachen auf dem Turm. Er schien jünger zu sein als der andere, wobei seine Haare selbst in der Dunkelheit rötlich schimmerten. Sein Begleiter, der seine unordentlichen Locken zu einem Zopf gebunden hatte, rutschte vom Pferd und beugte sich nach unten. Vorsichtig legte er die Finger an die Kehle des Bewusstlosen, sodass Maebh befürchtete, er würde ihn würgen. Dann schüttelte er den Kopf.
»Der ist so gut wie tot«, gab er Entwarnung.
Wie zur Demonstration verpasste er dem am Boden Liegenden einen Tritt, doch nicht einmal ein Stöhnen verließ dessen Lippen.
»Siehst du? Komplett hinüber.«
Der Rothaarige, der noch immer auf seinem Pferd hockte, schüttelte nur den Kopf, während sein Kamerad im Begriff war, wieder aufzusteigen. Erleichterung durchflutete Maebh.
Geht weg, wollte sie ihnen entgegenschreien. Verschwindet!
Und fast war es so, als würden sie ihr stilles Flehen erhören. Scheinbar ein letztes Mal ließ der ältere Wachmann, Fínghin, seinen Blick über den Strand schweifen. Dabei verharrte er ausgerechnet auf dem kleinen Bündel Fell, das achtlos in der Brandung lag.
Maebhs Herz setzte aus, nur um nach wenigen Sekunden wieder weiter zu schlagen.
Bum.
Bum.
Bum.
Bum.
Genau im Takt seiner schweren Schritte. Hilflos sah sie dabei zu, wie Fínghin in die Knie ging und ihren Mantel aus dem Wasser zog. Einzelne Sandkörner rieselten zu Boden, während er ihn langsam entfaltete. Was für den Mann aussehen musste wie eine Decke aus Robbenfell, bedeutete Maebh mehr als ihr ganzes Leben.
»W-was ist das?«, fragte sein Kumpan vor Kälte zitternd.
Ein Lächeln verzog Fínghins Lippen so sehr, dass seine unnatürlich weißen Zähne im Mondlicht blitzten.
»Etwas, das dem König fast noch besser gefallen wird als der Schatz des Bastards dort drüben.«
2
Maebh wartete zu lange, nachdem die beiden Wachmänner verschwunden waren, obwohl sie wusste, dass die Zeit für den von ihr geretteten Mann ablief. Sekunde um Sekunde verstrich, während sie zwischen den Felsen kauerte, wo ihr jeder einzelne Muskel unsägliche Schmerzen bereitete. Tränen der Verzweiflung rannen über ihre Wangen und sie fühlte sich, als hätte man sie entzweigerissen.
Ihr magischer Mantel, ihr Robbenfell, ihre einzige Möglichkeit, wieder eins mit dem Ozean zu werden, war weg. Gestohlen von diesen grausamen Menschen, die einen Mann einfach so in den Tod geschickt hatten.
Maebhs Puls dröhnte laut in ihren Ohren und übertönte selbst das Tosen des Meeres, das wütender wurde, als wollte es sie für ihren Leichtsinn beschimpfen.
Was mache ich jetzt?
Sie hatte niemanden, den sie um Hilfe bitten konnte. Ihre Geschwister waren draußen bei den Felsen – zu weit weg, als dass ihr Rufen sie erreichen würde. Und selbst wenn, hätten sie Maebh ohnehin nur verhöhnt.
Regel Nummer drei: Egal, wo du bist, verstecke deinen Mantel gut.
Warum hatte sie nur so unbedacht sein müssen?
Irgendwann, es fühlte sich an wie Stunden, dabei konnten nur ein paar Minuten vergangen sein, beruhigte sie sich und wagte sich hinter den Felsen hervor. Der Strand war verlassen. Ein kühler Wind stellte die Härchen auf ihren Armen auf, während feuchter Sand sie zwischen den Zehen kitzelte. Die Welt war noch immer in silbernes Licht getaucht, doch zum ersten Mal kam ihr die Nacht nicht mehr magisch vor, sondern bedrohlich. Als könnte hinter jedem Schatten eine Gefahr lauern, der Maebh ohne die Magie ihres Mantels niemals gewachsen war.
Sie war im Begriff, erneut in Tränen auszubrechen, da fiel ihr wieder ein, wie sie überhaupt in diese missliche Lage geraten war. Eilig trugen ihre Beine sie zu dem Fremden, und als sie dieses Mal das Ohr an seine Brust legte, hörte sie nichts außer Meeresrauschen.
Nein!
Maebh lauschte noch einmal genauer.
»Nein. Nein. Nein!«
Panik ergriff von ihr Besitz, als sie mit der Hand über das Hemd des Mannes fuhr. Eisige Kälte hatte seinen gesamten Leib erfasst und seine Haut so blass werden lassen wie der Mond selbst.
»Nein!«, keuchte sie wieder, strich ihm die nassen, schwarzen Locken aus dem Gesicht. Seine Lippen besaßen fast dieselbe Farbe wie seine Haut, die Augen dagegen waren dunkel wie die Nacht und starrten glanzlos hinauf zu den Sternen.
Das durfte einfach nicht passieren. Nicht auch noch. Sie hatte nie einen geretteten Menschen ans Meer verloren. Und wenn ihr Opfer jetzt umsonst gewesen sein sollte … Energisch verbiss sie sich die Tränen.
Sie holte tief Luft, bevor sie verzweifelt ihre Lippen auf seine presste, so, wie sie es schon hundertmal bei den Menschen gesehen hatte. Immer wieder hatten sie es auf diese Weise geschafft, Totgeglaubte ins Leben zurückzuholen. Als hätte ihr Kuss allein unerklärliche Kräfte.
Sie zählte die Sekunden, während sie in dieser Position verharrte, ohne zu wissen, was genau sie zu tun hatte. Alles, was sie spürte, war Kälte, die sie um jeden Preis vertreiben wollte. Maebh stellte sich vor, wie sie den Fremden in ihren Mantel hüllte, um ihm einen Teil der Wärme zu spenden, die sie selbst in den tiefsten Gefilden des Ozeans am Leben hielt. Sie wollte, dass ihn diese Energie erfüllte, dass sie ihn zurückholte aus der Dunkelheit, in die er gestürzt war. Maebh wünschte es sich, wie sie sich nie etwas sehnlicher in ihrem Leben gewünscht hatte.
Mit einem Mal durchzuckte sie ein Funke, woraufhin sie mit einem leisen Aufschrei von ihm abließ. Wie ein Stich bohrte sich ein Taubheitsgefühl in Maebhs Lippen, ließ sie panisch von ihm wegstolpern.
Dann schnappte der Fremde nach Luft.
Es war ein einziger verzweifelter Atemzug, der seine Lunge augenblicklich mit Luft füllte. Ein Hustenanfall schüttelte seinen Körper, und schon war Maebh wieder neben ihm. Behutsam half sie ihm, sich auf die Seite zu rollen, bevor sich ein Schwall Salzwasser aus seinem Rachen ergoss, als hätte er beim Ertrinken den ganzen Ozean verschluckt.
Sacht klopfte sie ihm auf den Rücken. Er fühlte sich noch immer bitterkalt an, doch allmählich färbte sich seine Haut wieder mit Leben. Es dauerte einige Minuten, bis sein Körper aufhörte, das für ihn giftige Salzwasser auszustoßen. Danach sackte der Fremde entkräftet zurück und sah Maebh zum ersten Mal an.
»Bin ich tot?«
Seine Augen waren das Seltsamste, das sie je gesehen hatte. Vor Kurzem noch pechschwarz, erstrahlten sie nun in einem dunklen, silbernen Schillern, als hätte er das Meer selbst darin eingefangen. Der Anblick ließ sie für eine Sekunde überlegen, ob sie nicht beide gestorben waren.
»Nein. Du lebst.«
Ob alle Menschen so seltsame Augen hatten? Maebh hatte nie einen in Ruhe aus der Nähe betrachtet, hatte sie immer nur zum Strand gebracht, um danach hastig wieder zu verschwinden.
Ein freudloses Lächeln erschien auf den Lippen des Mannes. »Verfluchte Scheiße.«
Stirnrunzelnd fragte sie: »Wolltest du etwa sterben?«
Ein Kopfschütteln folgte als Antwort, dann Schweigen, während sich sein Atem weiter beruhigte. Seine Sachen – Lederstiefel, Mantel sowie Hemd und Hose aus Stoff – waren völlig durchnässt, doch entgegen jeder Logik schien er sich weder daran zu stören noch zu frieren. Stattdessen starrte er hinauf zu den Sternen, als würde er nicht nur seine Lage, sondern auch sein ganzes Leben infrage stellen.
Er war ein schöner Mann, soweit Maebh das beurteilen konnte, und sah mit seinem länglichen Gesicht und der markanten Nase so anders aus als ihre Brüder. Ihm wuchsen nicht nur Haare auf dem Kopf, sondern dichte Stoppeln am Kiefer und um den Mund herum. Feine Wassertropfen hafteten auf seinen Wangen und bildeten einen funkelnden Kontrast zu seiner leicht gebräunten Haut.
»Bist du eine Traumerscheinung?«, fragte er mit rauer Stimme.
»Nein.«
»Eine Meerjungfrau? Sirene?«
»Nein.«
Er nickte, dabei konnten ihm ihre wenig genauen Antworten unmöglich genügen. »Und wie ist dein Name?«
»Maebh.«
»Ich danke dir, Maebh.«
Ihr blieb nicht mehr die Gelegenheit, nach seinem Namen zu fragen, denn schon kurz darauf sackte sein Kopf kraftlos nach hinten.
In Ermangelung eines besseren Plans begann Maebh damit, sich um den Fremden zu kümmern. Zuerst zog sie ihn an eine Stelle bei den Felsen, wo er einigermaßen vor dem Wind und ungewollten Blicken geschützt war. Anschließend verwischte sie die Spuren im Sand, die die Wellen nicht erreichten, und holte Wasser aus einem Bach, der nur ein wenige Schritte entfernt im Meer mündete, um dem Mann etwas zu trinken einzuflößen. Die Hälfte verlor sie unterwegs aus den Händen, doch nach ein paar Runden war sie sicher, dass der Unbekannte nicht verdursten würde.
Ihr war bewusst, wie vorsichtig sie sein musste, weshalb sie sich sputete, sobald sie sich im Sichtfeld des Wachturms aufhielt. In die Nähe des Dorfes, das hinter der Böschung im Norden wartete, wagte sich Maebh gar nicht erst. Lange durfte sie jedoch nicht hier ausharren. Die Felsen boten kaum Schutz und das umliegende Land war so flach, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sie jemand entdeckte.
Nachdem Maebh alle Wassergänge erledigt und Seetang gesammelt hatte, auf dem sie missmutig herumkaute, fiel ihr nichts mehr ein. Am Horizont schob sich die Sonne langsam über die Kämme der Hügel auf der anderen Seite der Bucht, tauchte ihre kahlen Hänge und die von der Ebbe freigelegten Sandbänke in goldenes Licht.
Erneut liefen Tränen über Maebhs Wangen, die zum ersten Mal in ihrem Leben die Sonne aus menschlichen Augen betrachtete. Als Robbe war ihre Sicht dafür geschaffen, sich selbst im tiefsten Dunkel der See zurechtzufinden. Dabei sah die Welt allerdings aus, als hätte man sie ihrer Farbe beraubt. Normalerweise wäre Maebh um diese Zeit zurück bei ihren Geschwistern, weshalb der Anblick der aufgehenden Sonne, so atemberaubend er auch war, sie traurig stimmte, denn er kam zu einem Preis. Maebhs Herz schmerzte, als würde eine unsichtbare Kraft es ins Meer ziehen, doch ohne ihren Mantel blieb ihr die Rückkehr verwehrt.
Während sie vor wenigen Stunden noch mit ihren Geschwistern im Mondlicht herumgetollt war, fühlte sie sich jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben einsam. Sie kauerte sich zwischen den Felsen zusammen. Warm tropften die Tränen auf Maebhs nackte Beine, hinterließen Spuren auf ihrer sandverkrusteten Haut.
»Du bist noch hier?«
Augenblicklich wischte sie die verräterische Nässe fort, obwohl ihr klar war, dass es ohnehin wenig Sinn ergab. Der Fremde hatte sich, ohne dass sie es bemerkt hatte, aus eigener Kraft aufgerichtet und betrachtete sie mit gehobenen Brauen. Seine Iriden waren jetzt golden, wie die Oberfläche des Wassers. Beschämt wandte Maebh den Blick ab, weil sie nicht wollte, dass er sie so verzweifelt sah.
»Ich habe dir zu trinken gebracht und frischen Seetang, falls du hungrig bist.«
»Du bist eine Selkie, richtig?«, fragte er geradeheraus.
Ihr erschrockenes Zucken war vermutlich Antwort genug.
»Woher …?« Sie brachte keine ganze Frage über ihre zitternden Lippen. Er verzog den Mund und hielt einen Strang Seetang in die Höhe, den sie ihm als kleine Mahlzeit mitgebracht hatte.
»Die Menschen hier«, erklärte er ihr, als wäre er selbst keiner davon, »essen keinen Seetang. Zumindest nicht, ohne ihn vorher getrocknet zu haben.«
Wie zur Betonung nahm er das grünbraune Stück Tang und steckte es sich in den Mund, bevor er angewidert das Gesicht verzog. Was wollte er ihr damit vermitteln?
»Sag mir, Selkie-Mädchen, wieso bist du zu dieser Zeit noch an der Küste?«
Beschämt senkte Maebh den Blick, dabei hätte sie schwören können, dass er sich die Antwort bereits dachte. »Ich war gestern Nacht unvorsichtig. Ein paar Wachen haben meinen Mantel gefunden und mitgenommen. Es waren dieselben, die …«
Er nickte. »Soldaten des Königs.«
»Was wollten sie von dir? Ich meine, wieso wollten sie dich …?« Das Wort »umbringen« wollte nicht über ihre Lippen. Ihresgleichen würde es nie wagen, einem anderen Selkie Leid zuzufügen – selbst zu Streit kam es nur selten.
»Der König will etwas von mir«, erklärte der Fremde. »Etwas, das ich ihm nicht geben will.«
»Und dafür sollst du sterben?« Das letzte Wort verließ nur als Wispern ihre Kehle.
»Ja.« Seine Stimme wurde auf einmal ernst. Kälte legte sich in seinen Blick. »Hör mir zu, Selkie-Mädchen. Ich bin dir ausgesprochen dankbar, dass du mich gerettet hast, aber diese Männer haben etwas, das ich unbedingt wiederhaben muss.« Mit einem Mal richtete er sich auf. Sein ganzer Körper strahlte vor Energie, als hätten das bisschen Schlaf und Trinkwasser ein Wunder bewirkt. »Unsere Wege trennen sich hier.«
»Warte!«
Augenblicklich war Maebh ebenfalls auf den Beinen und stolperte ihm unbeholfen hinterher. Das Licht der Morgensonne wärmte ihre Haut, als sie ihre Hand um den Arm des Mannes schloss.
»Du musst mir helfen!«
Sofort entzog er sich ihrem Griff. »Ich kann dir nicht helfen.«
»Bitte!«, flehte sie. »Du musst mich mitnehmen. Die Männer, sie haben meinen Mantel und …«
»Es ist nicht mein Problem, dass du so achtlos mit deinen Habseligkeiten umgehst.«
Der Schlag saß so tief, dass ihr fast die Beine wegknickten. Nein, es war nicht sein Problem.
»Maebh.« Seine Stimme wurde ein wenig sanfter. »Ich bin nicht gerade das, was man sich unter einer idealen Reisebegleitung vorstellt. Jemand wie ich fällt auf und zieht Probleme magisch an. Mit dir an meiner Seite wäre das leichtsinnig.«
Ihr Mut verließ sie immer mehr, ihre Stimme brach beinahe bei ihren nächsten Worten. »Bitte … ich habe sonst niemanden.« Wehmütig wanderte Maebhs Blick zur See. Ihre Heimat, zum Greifen nah und dennoch so unendlich weit entfernt. Bei ihrem Anblick wurde das Herz in ihrer Brust schwer wie ein Klumpen aus Gold. »Bitte«, flüsterte sie eher in das Tosen der Wellen hinein als zu dem Mann, auf den sie sich einzig und allein verlassen konnte.
Ein Seufzen verließ seine Lippen, das Maebhs Aufmerksamkeit zurück auf ihn lenkte. Nervös huschten seine Pupillen umher und blieben dabei immer wieder an dem Wachturm haften, der nur wenige hundert Meter von ihnen entfernt in den Himmel ragte.
»Ich kann dich nicht mitnehmen«, betonte er nochmals. »Das Risiko wäre für uns beide zu groß.«
Maebh nickte und versuchte, sich mit dieser Absage abzufinden. Eigentlich glaubte sie ihm, wenn er sie vor der möglichen Gefahr warnte – die Soldaten in der Nacht waren schon Beweis genug –, aber …
»Dennoch schulde ich dir etwas. Du hast mir das Leben gerettet. Ich kann dich ein Stück weit mitnehmen, weg von der Küste, und dir helfen, dich zurechtzufinden. Bis zum nächsten Inn. Von dort musst du dich allein durchschlagen.«
Ihr Körper reagierte schneller, als es ihr Verstand zuließ. Überschwänglich fiel Maebh ihm um den Hals. Sie presste sich an ihn und spürte, wie er sich völlig unter der Umarmung versteifte.
»Was wird das?«, kam die pikierte Frage, doch sie achtete kaum darauf.
»Ich danke dir«, flüsterte sie in den feuchten Stoff seines schwarzen Mantels, der die Gerüche ihrer Heimat in sich trug. »Ich danke dir so sehr.«
Vorsichtig schob der Fremde sie von sich, obwohl sie ihn am liebsten gleich noch geküsst hätte. Ihr war klar, dass sein Versprechen nicht die Lösung all ihrer Probleme bedeutete, doch es war ein Anfang. Einer, der sie in die richtige Richtung leitete. Der Beginn eines Abenteuers.
Erst als ihr bewusst wurde, wie intensiv er sie musterte, gelang es Maebh, ihre überschwängliche Freude zu zügeln.
»Was war das eben?«
»Eine Umarmung.«
Er runzelte die Stirn. »Und wozu?«
»Na, weil du mir hilfst, und ich dir dankbar dafür bin. Macht man das bei den Menschen etwa nicht so?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube, wir müssen ein paar Regeln aufstellen, Selkie-Mädchen.«
Zur Antwort nickte sie eifrig, auch wenn ein bitterer Nachgeschmack sie daran erinnerte, wie tadellos das mit ihr und Regeln bisher funktioniert hatte.
»Erstens: Keine Umarmungen bei Menschen, die du nicht oder kaum kennst.«
Sie runzelte die Stirn. »Was ist mit Küssen?«
»Nein.« Er machte eine kurze Pause, dann sagte er: »Wir brauchen Kleidung für dich …«
Verwirrt sah sie an sich hinab. »Wieso das?«
Der Fremde wandte den Blick ab, bevor er den Kopf in der Handfläche vergrub. Ein tiefer Atemzug hob und senkte seine Brust deutlich. »Menschen mögen es nicht, ohne Kleidung herumzulaufen.«
»Aber warum denn?«
»Es ist ihnen unangenehm.«
»Dir etwa auch?«
Zur Antwort verdrehte er die Augen. Das deutete sie als Nein.
»Na gut.« Maebh zuckte mit den Schultern. Was sollte sie schon sagen? Bisher hatte sie die Zweibeiner nur aus der Ferne beobachtet, und obwohl ihr aufgefallen war, dass sie immer falsche Felle trugen, die sie Kleidung nannten, hatte sie den Sinn dahinter nie verstanden.
»Noch etwas?«, fragte Maebh stattdessen, weil der Mann den Eindruck erweckte, er würde am liebsten wieder in die Fluten zurückspringen. Es folgte ein weiterer tiefer Atemzug, bevor er sie aus seinen goldenen Augen so ernst ansah, dass sie sich augenblicklich auf seine nächsten Worte gefasst machte.
»Falls wir in die Verlegenheit kommen und irgendjemandem begegnen, sagst du kein Wort. Und wenn ich sage ›Lauf!‹, dann rennst du, so schnell und so weit du kannst, verstanden?«
Der Ernst seiner Ansage verpasste ihrer Hochstimmung einen jähen Dämpfer. Dennoch nickte sie. »In Ordnung.«
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen zwischen ihnen. Dann, als er das nächste Mal das Wort an sie richtete, hatte Maebh das Gefühl, seine tiefe, raue Stimme in jeder Zelle zu spüren.
»Was passiert, wenn du deinen Mantel nicht wiederbekommst?«
Ein Zittern durchfuhr ihren gesamten Körper, während ihr Blick wieder hinaus aufs Meer wanderte. Zum ersten Mal im Leben hatte sie das Gefühl, zu frieren.
»Wenn ich es nicht bis zum nächsten Vollmond schaffe«, flüsterte sie, »sterbe ich.«
3
Das Fell, das der Unbekannte ihr freundlicherweise geliehen hatte, kratzte und fühlte sich trotz der wohligen Wärme, in das es sie hüllte, wie ein Fremdkörper auf Maebhs Haut an. Alles an ihm, sein Geruch, seine Textur, seine Schwere, erinnerte sie nur umso schmerzlicher daran, in welcher Lage sie sich befand. Was passiert war. An ihren Leichtsinn. Lieber hätte sie die Leihgabe abgelehnt, doch wenn sie diesem Fremden und ihrem spärlichen Wissen über die Menschenwelt trauen durfte, gehörte es sich nicht, ohne Kleidung herumzulaufen. Auch wenn diese Kleidung wie in Maebhs Fall nur aus einem abgenutzten, schweren Fell bestand, das so lang war, dass sie sich dreimal darin hätte einwickeln können.
Mantel, erinnerte sie sich an die Erklärung des Fremden dazu. Die Menschen benutzten die Worte Mantel und Fell nicht synonym, wie sie es bisher getan hatte, weil das Kleidungsstück nicht untrennbar zu ihnen gehörte. Menschen waren so kompliziert.
Aber nein. Sie hatte sich nicht darüber zu beschweren, dass der des Fremden ihr viel zu groß war. Stattdessen sollte sie dankbar sein. Ihrer Zukunft mutig entgegenblicken. Das Beste aus ihrer Situation herausholen. Nur war das gar nicht so leicht. Sie befand sich in einem wahrgewordenen Albtraum, vor dem ihre Geschwister sie all die Jahre gewarnt hatten. Gleichzeitig war dieser aber, wie sie sich allmählich eingestand, die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches. Maebh hatte immer unter den Menschen sein gewollt, sie kennenlernen, obwohl sie sich die Umstände anders vorgestellt hatte.
Sie seufzte ergeben. Von diesem Auf und Ab der Gefühle wurde ihr schwindelig. Dabei waren keine zehn Minuten vergangen, seit sie sich in den Felsen unter dem Wachturm versteckt und dem Geschehen darin gelauscht hatten. Der Fremde hatte angeboten, Maebh ins nächstgelegene Dorf zu bringen, dabei allerdings kurzentschlossen einen Umweg eingeplant, der ausgerechnet zurück an den Ort führte, von dem er rein logisch betrachtet, so schnell wie möglich verschwinden sollte.
»Bist du wohl still«, zischte er ihr ungnädig zu, woraufhin sie erst realisierte, dass sie schon wieder geseufzt oder irgendein anderes Geräusch von sich gegeben hatte, das ihr klägliches Versteck auffliegen lassen könnte. Maebh nickte entschuldigend und musterte ihre nackten Füße, wo der schwarze Schlamm zwischen ihren Zehen langsam zu trocknen begann. Mittlerweile hatte sich Mutter Ozean vollständig zurückgezogen, woraufhin der Fremde und sie sich einen Weg an die dem Meer zugewandte Seite des Wachturms gebahnt hatten. In der Ferne sah sie die Wasseroberfläche blau schimmern, was ihr ihre Lage nur wieder bewusst machte.
Maebh zog den Mantel fester um sich. Noch so etwas, das sie jetzt, wo sie in ihrer menschlichen Gestalt feststeckte, erlebte: Kälte. Scheinbar war die Magie, die sie sonst selbst in den winterlichsten Vollmondnächten beschützte, im Begriff, sie zu verlassen.
»Maebh.« Sie blinzelte überrascht, als der Fremde sie ansprach.
»Ja?«
»Lass uns gehen.«
»Wo …« Sie kam nicht einmal dazu, den Satz zu beenden, da hatte er sich schon aus seiner kauernden Position aufgerichtet. Den Rücken an die Mauer gepresst, tastete er sich an dieser entlang in Richtung einer schmalen Tür, von der aus steinerne Stufen ins Meer hinabführten. Vermutlich ein geheimer Ausgang, den der Mann entschlossen ansteuerte.
»Was tust du da?«, fragte Maebh vollkommen verstört, während sie ihm hinterherkletterte. Sofort erntete sie sich einen vorwurfsvollen Blick, weil sie zu laut gesprochen hatte, dennoch antwortete er ihr.
»Die Wachen haben meine Wertsachen genommen.«
»Aber sind sie damit nicht verschwunden?«
»Ja. Und nein. Wahrscheinlich sind sie mit meinem Besitz schon längst über alle Berge, um ihn dem König zu präsentieren, doch der wird sich wohl kaum für ein paar Goldmünzen und Messer interessieren.«
»Wofür denn dann?«
Schweigen. In der kurzen Zeit, die Maebh ihn kannte, hatte sie gelernt, dass er ihr nur antwortete, wenn ihm danach war. Sobald sie etwas über diesen ominösen Schatz oder gar seinen Namen wissen wollte, stieß sie auf eine Mauer. So stur war nicht einmal Siobhan.
Autsch. Bei dem Gedanken an sie zog sich Maebhs Herz schmerzhaft zusammen, nur blieb ihr keine Zeit, sich mit ihrem Verlust auseinanderzusetzen, da der Fremde sich bereits an der Tür zu schaffen machte. Bei dem Lärm, den er dabei veranstaltete, fragte sie sich, ob seine mehrmaligen Ermahnungen überhaupt mit der Angst davor, erwischt zu werden, zu tun hatten und nicht vielmehr damit, dass er einfach seine Ruhe haben wollte. Doch immerhin schienen seine Anstrengungen belohnt zu werden. Das vom ständigen Meereswind rostig gewordene Schloss wehrte sich kaum, sobald er sich mit seinem vollen Gewicht dagegenstemmte, und die Tür gab ächzend nach.
Diskret schob sich der Fremde in die Öffnung, bevor er Maebh mit einem Winken bedeutete, ihm zu folgen. Kurz zögerte sie, dann kletterte sie ihm vorsichtig hinterher.
Hinter der Tür erwartete sie ein Raum, der wie die Häuser auf Sceilg Michail vollkommen aus Stein zu bestehen schien, jedoch nicht annähernd so alt und zerfallen war. Maebh erinnerte sich lebhaft daran, wie die Menschen vor Jahren hergekommen waren, um diesen Wachturm zu errichten, in dem selten mehr als ein paar Soldaten ein- und ausgingen. Ob der Lärm, den sie und der Fremde verursacht hatten, einen von denen aufgeschreckt hatte, konnte sie nicht einschätzen, denn bis auf das leise Echo ihrer Schritte und das Heulen des Windes, herrschte in dem Gemäuer absolute Stille.
Zielsicher schlich der Unbekannte zu einer schmalen Treppe in einer Ecke und begann sofort, die Stufen zu erklimmen. Maebh war sich uneins, ob sie ihm folgen oder nicht doch hier, wo es sicher zu sein schien, warten sollte. Dann wiederum war sie nie im Inneren eines Menschenhauses gewesen und ihre Neugier zu groß.
Die Treppe führte in einer engen Spirale nach oben in einen ungeahnt geräumigen, runden Raum. Hier war es deutlich wärmer. Ein Feuer knisterte in einer Ecke, vor dem ein Tisch mit zwei Bänken Platz fanden. Ein seltsamer Geruch lag in der Luft, der aus Richtung der Sitzecke zu kommen schien. Zu ihrer Rechten erkannte Maebh die große, hölzerne Eingangstür, die von dieser Seite verbarrikadiert war, zu ihrer Linken befanden sich drei Schlaflager aus trockenem Gras – allesamt verlassen. Obwohl es nicht so schien, als wäre irgendjemand hier, bedeutete ihr der Fremde mit einem vielsagenden Blick, weiterhin auf der Hut zu sein.
Maebh war klar, dass sich hier irgendwo ein Mann aufhalten könnte, denn von den dreien, die sie gehört hatte, hatte sie nur zwei am Strand entdeckt. Sie war versucht, ihren Begleiter darüber zu informieren, entschied sich jedoch dagegen. Er würde ebenso wissen, dass sie hier wahrscheinlich nicht allein waren.
Suchend blickte er sich im Raum um und ging zu den Nachtlagern, wo er auf gut Glück das Stroh durchwühlte. Währenddessen schlenderte Maebh in Richtung der Feuerstelle. Überrascht zuckte sie zurück, als ihr prickelnde Wärme entgegenschlug. Zwar wusste sie, was Feuer war und wie es funktionierte, hatte es allerdings nie aus nächster Nähe gesehen – oder gespürt. Wie hypnotisiert blinzelte sie in die tanzenden Flammen, hätte am liebsten ihre Hand danach ausgestreckt. Dabei war ihr klar, dass sie sich nur verbrennen würde.
Es war seltsam, all diese Eindrücke, von denen Maebh bisher nur geträumt oder Geschichten gehört hatte, plötzlich am eigenen Leib zu erfahren. Sonnenaufgänge in Menschengestalt, das Gefühl von Kleidung auf nackter Haut, Kälte, der Geruch von Asche und Rauch. Eine Welt voller Wunder, die sich ihr jetzt erst eröffnete.
»Na also …« Nur am Rande bekam Maebh das leise Gemurmel des Fremden mit, während sie sich auf das Ende der Bank sinken ließ und die Beine an ihren Körper zog. Augenblicklich sank ihr die Hitze in die Glieder, wurde förmlich von ihrer Haut absorbiert, sodass sie spürte, wie sich die feinen Härchen auf ihren Armen und Beinen aufrichteten.
Wie seltsam.
Ein wohliger Seufzer kam ihr über die Lippen, und Maebh erwartete, von ihrem Begleiter angefahren zu werden. Doch stattdessen war es eine andere Stimme, deren Klang sie erschrocken zusammenfahren ließ.
»Was tust du hier?!«
Ertappt wandte sie sich um. Am Fuß einer weiteren Treppe, die hinauf in den Turm führte, stand einer der Wachen und starrte Maebh mit vor Schock geweiteten Augen an. Ein Schrei blieb ihr in der Kehle stecken, während sie sich panisch im Raum umsah. Doch nirgends eine Spur ihres Begleiters. Sie war allein mit einem Unbekannten, den sie vor nur wenigen Stunden dabei beobachtet hatte, wie er einen anderen Menschen hatte töten wollen.
Panik erfüllte sie. War das etwa von Anfang an der Plan des Fremden gewesen? Er hatte sich nicht für die Idee begeistern können, Maebh mitzunehmen. Was, wenn das alles nur ein perfides Manöver war, um sie loszuwerden? Wenn er nicht einmal beabsichtigt hatte, sie überhaupt ins nächste Dorf zu bringen?
Langsam und mit schweren Schritten bewegte sich der Soldat auf sie zu. Maebh sprang hastig auf, wich zurück, bis ihr Rücken auf die Wand neben dem Karmin traf. Die Wache musterte sie mit suchendem Blick von Kopf bis Fuß und einem Lächeln, das sie nicht so recht beurteilen konnte. Ihre Erfahrung wollte ihr weismachen, dass ein Lächeln etwas Schönes war, ein Ausdruck der Freude. Aber da war keine Freude im Gesicht des Mannes.
»Wer bist du und was tust du hier?«, wiederholte er.
Maebh schüttelte den Kopf. Sämtliche Laute steckten in ihrer Kehle fest. Was sollte sie ihm sagen? Was sollte sie tun? Rennen? Oder sich ihm mutig entgegenstellen? Ihre zitternden Beine schlossen beide Optionen aus.
»Woher kommst du?« Seine Stimme war jetzt eine Spur freundlicher, woraufhin ihr ein Gedanke kam. Vielleicht konnte sie ihm vertrauen? Er war schließlich ein Wachmann. Und soweit Maebh sich erinnerte, bedeutete das, dass es seine Pflicht war, die Menschen zu beschützen. Auch wenn sie streng genommen keiner war. Aber das wusste er ja nicht, oder?
Nachdem er einen weiteren Schritt auf sie zugegangen war, blieb er nur eine Armeslänge von ihr entfernt stehen.
»Wer bist du?«, fragte er erneut, und dieses Mal nahm sie all ihren Mut zusammen und antwortete ihm.
»Mein Name ist Maebh.« Ihre Kehle fühlte sich staubtrocken an. Ihr Inneres war im Zwiespalt. Einerseits machte sich der Fluchtreflex bemerkbar, den sie sonst aus ihrer Robbengestalt kannte. Andererseits sah sie keinen Grund dafür, Angst zu haben. Der Mann trug zwar ein Schwert am Gürtel, wirkte jedoch nicht bereit, danach zu greifen.
»Wie bist du hier hereingekommen?«
Maebh schluckte, verkniff sich eine Antwort. Sie konnte ihm unmöglich sagen, dass sie mit einem Fremden durch eine Hintertür eingebrochen war. Ein Fremder, von dem nach wie vor jede Spur fehlte. Ob er sie tatsächlich hier hatte sitzen lassen?
»Wo ist dein Mann?«, fragte der Soldat weiter, nachdem Maebh ihm nicht geantwortet hatte.
Verwirrt legte sie den Kopf schief.
»Bist du ganz allein?«
Daraufhin nickte sie zögernd, denn was sollte sie schon erwidern? Allem Anschein nach war sie wirklich auf sich gestellt. Etwas veränderte sich in der Mimik des Mannes, kurz fuhr er mit der Zunge über seine Unterlippe, während er sich verstohlen im Raum umsah, als erwartete er, doch jemand anderen zu sehen. Danach wanderte sein Blick ein weiteres Mal an Maebh auf und ab. Was er wohl in ihr sah? Sicher nicht mehr als ein Menschenmädchen. Hoffte sie zumindest. Nervös strich sie sich eine leicht feuchte Haarsträhne hinters Ohr, woraufhin sich die Pupillen des Fremden kaum merklich weiteten.
»Dir ist sicher kalt«, stellte er fest, seine Stimme plötzlich rau. »Wir sollten dich aufwärmen.«
Ihr blieb keine Zeit zu reagieren, da hat er bereits den letzten Abstand überwunden und mit der Hand nach dem Mantel gegriffen. Die unvermittelte Nähe schnitt Maebh die Luft ab. Sie konnte ihn riechen, seinen beißenden Gestank nach fauligem Fisch, konnte seine Muskeln unter dem dünnen Leinenhemd erahnen, die Hitze auf seiner Haut. Sie wollte sich damit beruhigen, dass es ihr bei ihren Geschwistern sonst auch nichts ausmachte, ihnen so nahe zu sein, doch ihr pochendes Herz ließ sich nicht so leicht überzeugen. Entschlossen zog Maebh den Mantel enger um sich und bemühte sich, sich dem Griff des Mannes zu entziehen. Die Angst war zurück, stärker als zuvor, und auf ihren halbherzigen Versuch, seine Hand wegzuschieben, reagierte der Mann mit hämischem Gelächter, als wäre das alles nur ein Spiel für ihn.
Maebh wehrte sich umso entschlossener, wand sich aus seinem Griff. Sie zappelte, trat und biss, doch gegen seinen gewaltigen Körper war sie in ihrer menschlichen Gestalt machtlos. Schmerzlich wurde ihr bewusst, dass ihre Geschwister sie genau hiervor gewarnt hatten.
Sobald Maebh klar wurde, dass Widerstand zwecklos war, presste sie die Lider zusammen. Dann, keine zwei Sekunden später, ließ der Mann von ihr ab. Sein Gewicht verschwand von ihrem Körper, ein lautes Rumsen ertönte, und als sie endlich wieder hinsah, lag er reglos vor ihr auf dem Boden. An seiner statt stand auf einmal wieder der Mann vor Maebh, dem sie vorhin das Leben gerettet hatte. Zorn funkelte in seinen blauen Augen, die Nasenflügel hatte er weit aufgebläht, doch zu ihrer Überraschung war es kein Vorwurf, der über seine Lippen kam.
»Bist du in Ordnung?«
Maebh schüttelte den Kopf. Alles andere wäre gelogen.
»Ich habe versucht, ihn zu finden, aber ich muss ihn verpasst haben.«
Abwesend nickend musste sie sich zwingen, nicht wieder zu ihm hinunterzuschauen. »Ist er tot?«
»Nein. In ein paar Stunden wird er aufwachen, keine Sorge.« Dann, als hätte er sich schlagartig eines Besseren besonnen, verschwand jegliche Sanftheit aus der Stimme des Fremden. »Du musst vorsichtiger sein.«
»Ich dachte, weil er ein Wachmann ist …«
»Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Die Menschen sind gefährlich, vor allem für dich.«
»Wieso?«
»Weil du eine Selkie bist. Du sprühst vor Magie und auch, wenn die meisten es nicht genau verstehen, werden sie davon angezogen.«
Maebh runzelte die Stirn. »Und das ist schlecht?«
»Gefährlich. Vertrau ihnen nicht. Keinem von ihnen.«
Ertappt biss sie sich auf die Lippe und kam sich mit einem Mal furchtbar naiv vor. All die Jahre hatten ihre Geschwister sie vor den Menschen gewarnt, während Maebh sie nur belächelt hatte. Sie hatte gedacht, die anderen wären im Unrecht, die Geschichten, die sie sich erzählten, kaum mehr als Schauermärchen. Aber nach nicht einmal einem halben Tag unter den Zweibeinern, hatte sie den Beweis am eigenen Leib erfahren dürfen.
Maebh schluckte schwer.
Vertraue ihnen nicht. Keinem von ihnen. Die Worte des Fremden hallten in ihren Kopf wider, als er sich plötzlich räusperte. Den Blick abgewandt hielt er ihr ein Stoffbündel entgegen.
»Die hier müssen einem von ihnen gehören. Für den Anfang sollten sie genügen, bis wir dir im Dorf etwas Neues gekauft haben.« Dankbar nickend nahm Maebh die Kleidung an. »Unten kannst du dich umziehen. Nur beeil dich. Der hier war zwar der einzige, der hiergeblieben ist, aber wer weiß, wann sich jemand hierher verirrt. Ich passe auf.«
»In Ordnung.« Ihre Stimme war nur ein heiseres Flüstern, ehe sie sich mit zögerlichen Schritten in Richtung der Treppe bewegte, über die sie ursprünglich gekommen waren. Noch immer bebte das Herz in ihrer Brust, und Maebh klammerte sich an das Bündel Stoff, als wäre es ein rettender Fels mitten im Sturm. Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
Sobald sie die Stufen erreichte, wandte sie sich ein letztes Mal um, woraufhin ihr der Fremde erneut zunickte und sich mit dem Rücken an die Wand lehnte, um ihr zu verdeutlichen, dass er den Raum im Blick behalten würde. Mit der schwarzen Kleidung und dem gleichfarbigen Haar gab er eine äußerst düstere Erscheinung ab, die Maebh an eine Krähe erinnert.
»Ciarán«, sagte er dann wie aus dem Nichts, und als sie verwirrt blinzelte, fügte er hinzu: »Das ist mein Name.«
Wie von allein bildete sich ein Lächeln auf Maebhs Lippen. »Ciarán.«
Mit einem Schnauben wandte er sich ab. Fast schon, als wäre er belustigt über die Art, wie sie den Namen aussprach. Oder als könnte er selbst nicht glauben, dass er ihn ihr verraten hatte.
Bevor Maebh sich endgültig umdrehte, fiel ihr Blick auf den Mann am Boden.
Vertraue keinem von ihnen. Bereits jetzt spürte sie, wie sich der Rat unweigerlich in ihr Gedächtnis brannte. Gleichzeitig hallte allerdings noch ein weiterer Gedanke unausgesprochen durch ihren Kopf: Schloss diese Warnung Ciarán mit ein?
4
Obwohl sie ihr Weg direkt an der Küste entlangführte und Maebh das Meer stets im Blick hatte, kam sie nicht umhin, regelmäßig über ihre Schulter zu schauen. Fast erwartete sie dort ihr Zuhause, Sceilg Mhichil, zu entdecken, das in der Ferne immer kleiner wurde, doch der Felsen war schon nicht mehr in Sichtweite, seit sie heute Morgen als Robbe das Kap umrundet hatte. Außerdem konnte sie bei dem diesigen Wetter nicht einmal die Insel An Scairbh erkennen, die ein gutes Stück östlich ihrer Heimat lag und meistens von der Bucht aus zu sehen war.
Ihre Heimat, so nah und doch so fern. Was wohl ihre Geschwister dachten? Ob Siobhan ihnen erzählt hatte, dass Maebh losgezogen war? Ahnte sie, dass ihr etwas zugestoßen war? Bei dem Gedanken wurde Maebhs Herz schwer, und sie musste sich zwingen, nicht allzu sehnsuchtsvoll auf die Wellen zu starren, um nicht der Versuchung zu erliegen, sich als Mensch dort hineinzustürzen.
Stattdessen fokussierte sie sich auf ihre Umgebung. Das saftige grüne Gras zu ihren Füßen. Die Berge, die im Süden, jenseits der Bucht, in den Himmel ragten. Die tausend unbekannten Gerüche, der Wind in ihren Haaren und die sanften Nieseltropfen auf ihrer Haut. Das Wetter kam ihr so zerrissen vor, wie sie sich selbst fühlte. Feiner Regen, eine leichte Brise, dann plötzlich schaffte es ein einziger Sonnenstrahl durch die dünne Wolkendecke.
Nachdem sie einige Zeit einem Trampelpfad gefolgt waren, der direkt am Ufer entlangführte, richtete Maebh das Wort an ihren Begleiter: »Wohin gehen wir?«
Ciarán lief ihr immer ein Stück voraus, wobei er sich hin und wieder zu ihr umwandte, als wäre er sich nicht sicher, ob sie ihm überhaupt folgte. Wahrscheinlich, weil ihre Schritte so leise waren im Vergleich zu seinen. Oder weil er Gedanken lesen konnte und befürchtete, sie hatte wirklich vor, ins Wasser zu springen. Nein. Vermutlich würde er daraufhin nur weiter seines Weges ziehen. So gut konnte sie ihn inzwischen sogar einschätzen.
»Baile an Sceilg liegt zu nah am Wachturm«, antwortete er. »Das wäre für uns beide nicht sicher. Deshalb bringe ich dich nach An Coireán.«
»An Coireán?« Maebh legte verwirrt den Kopf schief. »Wer nennt einen Ort ›kleiner Kessel‹? Ihr Menschen habt seltsame Namen.«
Schulterzuckend wandte er sich ab und deutete in Richtung Westen, wo in einiger Entfernung ein winziges Boot vor der Küste ankerte. »Es ist der nächste Ort, der nicht über einen halben Tagesmarsch von hier entfernt ist. Dort gibt es ein Gasthaus, das …«
»Was ist ein Gasthaus?«, fiel sie ihm ins Wort.
Als er sich erneut zu ihr umdrehte, konnte sie nicht einschätzen, was ihr sein Blick sagen wollte. Amüsierte ihn ihre Ahnungslosigkeit oder war er nur überrascht?
»Ein Gasthaus ist ein Ort, an dem sich die Leute treffen, um zu trinken und zu essen. Manche von ihnen bieten auch Zimmer an, in denen Reisende übernachten können.«
Maebh nickte, obwohl es ihr schwerfiel, sich etwas unter der Beschreibung vorzustellen. Wenn sie hungrig war, aß sie normalerweise einfach. Doch selbst darunter mussten die Menschen sich wohl etwas anderes vorstellen – zumindest schien Ciarán der Seetang nicht geschmeckt zu haben. Aber was war mit Fisch?
»Ich gebe dir Geld, sodass du dort ein paar Tage unterkommen kannst. In der Zeit solltest du jemanden finden, der dich mit in die Hauptstadt nimmt.«
»Kannst du mich nicht mitnehmen?« Lediglich der Gedanke, ein paar kostbare Tage nur damit zu verschwenden, auf eine Reisebegleitung zu hoffen, verursachte ihr Übelkeit.
»Nein. Ich reise allein.«
»Wieso?«
Obwohl er den Blick wieder nach vorne gerichtet hatte, entging ihr sein leiser Seufzer nicht. »Weil ich es bevorzuge.«
»Kannst du keine Ausnahme machen? Du hast selbst gesagt, dass ich niemandem trauen darf.«