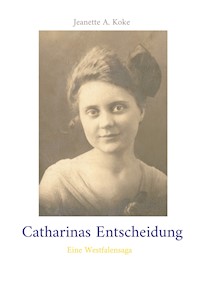
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dülmen und Münster - verbunden durch eine Familiengeschichte im 19. Jahrhundert. Eine einfache Weberfamilie, die vor dem wirtschaftlichen Elend ihrer Hunsrücker Heimat nach Westfalen geflohen ist, trifft auf eine Dülmener Fabrikantendynastie. Eine Rennbahn in Hiltrup, ein Weinlokal in Münster, ein Gasthaus am Marktplatz in Dülmen werden in den Zeiten revolutionärer Unruhen, Schauplatz dramatischer Ereignisse. Die industrielle Revolution, Pandemien, der Vorabend des ersten großen Krieges des 20. Jahrhunderts. Manch eine Parallele zur heutigen Zeit wird sichtbar. Vieles hat sich seither verändert. Gilt das auch für die Menschen? Wirtschaftsflüchtlinge, Pandemien, der Kampf um Frauenrechte, technischer Fortschritt und gesellschaftlicher Wandel - Kontroversen unserer Zeit? Ein Blick in das 19. Jahrhundert zeigt all das mitten im Münsterland, genauer gesagt im beschaulichen Städtchen Dülmen. Im Fokus der Geschichte steht Catharina, die Tochter eines Migranten aus dem Hunsrück, damals eine der ärmsten Regionen Europas. Inmitten gesellschaftlicher und politischer Umbrüche zeichnet die Autorin Jeanette Koke anhand ihrer eigenen Familiengeschichte ein lebendiges Bild des Lebens der sogenannten "kleinen Leute", die die Basis einer jeden Gesellschaft bilden. Catharina geht ihren Weg mit Mut und Stärke und ist beispielhaft für Generationen von Frauen vor uns. Obwohl sich der Alltag ihrer Familie, Mitstreiter*innen und Nachbar*innen in vielem von dem unsrigen unterscheidet, sind doch die jeweiligen Lebensumstände, mit denen wir alle uns auseinandersetzen müssen, sehr viel ähnlicher als vielleicht gedacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irgendwann werden wir alle zu Geschichten -Margret Atwood
Inhaltsverzeichnis
Buch 1
Joseph Stein, April 1849, Seibersbach, Hunsrück
Buch 2
Bernhard Pläster, 26. November 1848, Münster/Dülmen
Zuchthaus zu Münster, 28. November 1848
„Westfälischer Merkur“, 29. November 1848
Dülmen, Dezember 1848
Buch 3
Ende und Anfang eines Traums, Westfalen 1849−1854
Die Hugenotten kommen
Buch 4
Anton Bernhard Pläster, Dülmen, Spätsommer 1873
Die Fabrik, 1873
Catharina, Anfang September 1873
Catharina und Esther, November 1873
Anton, November 1873
Paris, November-Dezember 1873
Weihnachten, Dülmen 1873
Buch 5
Anton und Catharina, Dülmen 1874
Die Hochzeit, 1874
Buch 6
Zeit der Veränderung, Dülmen 1874 – 1875
Die Fabrik
Eine neue Generation, Oktober 1874
Dülmen, das Jahr 1875
Buch 7
Fruchtbare Zeiten, Dülmen, 1876 − 1882
Ein neues Haus
Buch 8
Catharina und Esther, Dülmen, Dezember 1883 – 1892
Buch 9
Leonard, Dülmen, 1892−1893
Buch 10
Catharina, Dülmen 1894
Buch 11
Catharinas Traum und das ausgehende Jahrhundert
Westfälischer Merkur
Epilog
Quellen
Buch 1
Joseph Stein, April 1849, Seibersbach, Hunsrück
Die Nacht war besonders dunkel. Tiefe Wolken verhängten den Himmel und weder Mond noch Sterne waren zu sehen. Es war außergewöhnlich still auf dem Weg von der Fabrik durchs Dorf, so als sei alles Leben im Tiefschlaf versunken. Kein Hund bellte, keine Katze huschte vor ihm über den steinigen Weg. Joseph hielt den Krug mit Milch vor der Brust und gab acht, dass er auf den letzten Metern nach Hause bloß nichts verschüttete.
Als vor ihm die Silhouetten einiger windschiefer Häuschen am Dorfrand auftauchten, ging er langsam auf das mittlere zu, strich sich sein dünn gewordenes, grau-blondes Haar mit einer kurzen Bewegung aus der hohen Stirn und öffnete die Tür. Obwohl er nur von mittlerem Wuchs war, musste er sich beim Eintreten etwas bücken, worauf er sofort ein schmerzhaftes Ziehen im unteren Rücken spürte. Drinnen richtete er seinen hageren Körper, der von den 14 Stunden Knochenarbeit als Sandformer auf der Eisenhütte ausgelaugt war, langsam wieder auf und blickte in die Dunkelheit des niedrigen Raumes. Müdigkeit durchzog seine Knochen.
Die anderen Männer von der Hütte und er brachten bei der Arbeit kaum noch etwas zuwege, so ausgehungert und geschwächt sie waren. Sie alle hatten sich noch lange nicht von der schlimmen Zeit erholt. Wer in den vergangenen Jahren nicht verhungert war, kämpfte immer wieder mit dem Fieber oder einer der anderen Heimsuchungen, die Tag für Tag ihre Opfer forderten. Sie waren am Rande ihrer Kräfte, oft jenseits davon. Aber heute hatte er seine drei Silbergroschen Wochenlohn erhalten und auf dem Rückweg durch den Ort beim Gastwirt Bündchen noch schnell einen Krug Milch für Jakob und Anna Maria gekauft. Er hatte im letzten Monat einiges beim Bündchen anschreiben lassen müssen und jetzt, nachdem er ihm die Schuld beglichen hatte, war kaum noch etwas übrig. Joseph seufzte, versuchte zu lächeln und wischte sich mit einer Hand durch das von tiefen Falten zerfurchte, schmutzige Gesicht.
Als sich seine Augen an die Dunkelheit im Raum gewöhnt hatten, sah er in die übergroßen Augen seiner Frau Marie Cath, die da stand wie ein Gespenst, mager, blass mit zerzausten Haaren, die kleine Anna Maria am Rockzipfel.
„Guten Abend, Frau, ich habe etwas Milch für die Kinder ergattert. Mach sie warm und gib zuerst Jakob einen guten Schluck. Der braucht es bei seinem Fieber.“ Keine Antwort, nur das leise Weinen Anna Marias war zu hören.
„Warum brennt kein Feuer, Frau? Was ist hier los?“ Er schob sich an Marie Cath und am alten Webstuhl vorbei weiter in den Raum hinein, dorthin, wo das Bett stand, in dem seit ein paar Tagen der einjährige Jakob im Fieber lag. Das Bett war leer. Irritiert sah sich Joseph zu seiner Frau um und zog fragend die Augenbrauen hoch.
„Wo ist er?“
„Sie haben ihn heute Mittag abgeholt“, sagte sie mit tonloser Stimme.
„Was heißt abgeholt?“ Joseph wollte nicht wahrhaben, was er in diesem Augenblick doch schon wusste. „Was heißt abgeholt?“, schrie er und packte Marie Cath bei den Schultern. Seine Beine zitterten so sehr, dass sie ihn kaum noch trugen. Da sackte seine Frau lautlos in sich zusammen wie eine leere Hülle.
„Er ist gestorben, Joseph, er ist einfach gestorben“, flüsterte sie mit kaum wahrnehmbarer Stimme. Joseph wollte sie hochziehen, doch sie war so schwer. Wieso ist sie so schwer, dachte er verstört, wo sie doch kaum noch etwas wiegt. Dann sank Joseph neben ihr zu Boden, drückte mit einem Arm das weinende Kind an seine Brust, mit dem anderen Arm hielt er seine Frau.
„Lass uns fortgehen, Joseph, bitte, ich halte es hier nicht mehr aus“, hörte er wie aus weiter Ferne ihre kraftlose Stimme.
„Fortgehen? Wie der Bruder? Einfach alles verlassen? Die Familie? Die Kinder? Die Heimat? Wie stellst du dir das denn vor?“
„Die Kinder sind tot, Joseph, so hör doch! Tot, tot, tot und jetzt auch noch der Kleine. Uns ist nur Anna Maria geblieben. Welchen Sinn hat es hierzubleiben? Ich halte es hier nicht mehr aus in dieser verdammten Gegend, die uns alles abverlangt, aber nichts dafür gibt außer Elend und Leid.“
„Ich weiß nicht, ob ich den Mut haben werde, Marie Cath. Wir werden vielleicht deine Eltern und die Familie niemals mehr wiedersehen.“ Josephs Stimme brach.
„Um Gottes Willen, Joseph, wir haben uns und Anna Maria. Sollen wir warten, bis auch sie uns noch genommen wird? Alle Kinder, die hier und in den umliegenden Dörfern sterben, sind arme Kinder, haben nichts auf den Rippen, um dem Fieber zu widerstehen. Du schuftest dich tot und verdienst nur ein paar Groschen. Ich schaffe es kaum noch zu weben. Meine Hände und der Rücken schmerzen zu sehr. Wir haben hier nichts!“, schrie sie mit erstaunlicher Kraft in sein Gesicht.
Ihr Körper spannte sich, sie befreite sich aus der Umarmung Josephs, erhob sich langsam und strich den Rock glatt.
Mit fester Stimme sagte sie: „Seit ein paar Tagen sind Werber unterwegs, Werber aus dem Norden. Ich glaube, es heißt Westfalen. Sie suchen Facharbeiter für eine neue Fabrik. Irgendein Fürst hat ein Eisenwerk erbaut und nicht genug gute Leute. Er verspricht einen rechten Lohn, eine erste Unterkunft und genügend zu essen. Du bist gut, Joseph. Und wenn du erst einmal wieder Fleisch auf den Knochen hast, bist du der Beste, warst es immer. Nicht Brasilien ist es, an das ich denke, nein, Westfalen. Westfalen hat Zukunft. Westfalen bietet Arbeit und Sicherheit. Dort können wir leben, Joseph, hörst du, leben! Und ich will, dass wir leben, Anna Maria, du und ich. Einfach nur leben, ganz normal leben.“
Jakob wurde am nächsten Tag beerdigt. Das kleine, traurige Häuflein, das noch von der Familie Stein übrig geblieben war, stand stumm und tränenlos da. Zu groß war der Schmerz und zu oft hatten sie hier gestanden, um einen kleinen Sarg hinabzulassen. Da waren nicht viele Tränen übrig geblieben für den kleinen Jakob.
Maria, die jüngere Schwester Marie Caths, mit ihrem dreijährigen Sohn Carl Christian an der Hand, ihr Mann Christian, der die einjährige Leoni auf dem Arm trug, Bruder Wilhelm mit seiner Frau Elsbeth und den vier kleinen Kindern standen hinter den Großeltern, schauten zu Boden und schwiegen. Großvater Lorenz hatte den Arm um seine Frau Greta gelegt. Sie weinte und hielt die kleine Hand der hilflos dreinblickenden Anna Maria fest in ihrer. So viel Unglück hatte es in dieser Familie gegeben, so viel Traurigkeit und Leid. Der Herrgott hatte ihnen viele Strafen auferlegt, aber sie konnte nicht sagen, warum. Ihr selbst waren vier Kinder gestorben, noch bevor sie das dritte Jahr erreicht hatten. Der Schmerz war nie ganz vergangen.
Alle standen mit gesenkten Köpfen und lauschten den Worten des Pfarrers, die niemanden von ihnen trösten konnten. Sie gingen schweigend zum Haus der Großeltern und versammelten sich in der Stube. Hier roch es nach Kartoffelklößen, die die Großmutter mit Brotkrumen gefüllt und mit etwas Lauch aus dem Garten zubereitet hatte. Ein großer Krug mit verdünntem Bier stand in der Mitte des Tisches und Lorenz schenkte jedem einen kleinen Humpen voll ein.
„Großvater, erzähl von früher“, rief es vom Ende des Tisches herüber, an dem die älteren Enkel saßen und genug von der traurigen Stimmung hatten. Der Großvater erzählte doch immer aus der alten Zeit, wenn sie zusammen saßen. Lorenz sah sich in der Runde um und blickte nicht nur in erwartungsvolle Kinderaugen.
„Also, das war so: Vor über 100 Jahre flohen die Doerrs, die Steins und viele andere aus Frankreich nach Simmern im Hunsrück, nachdem der französische König ihnen ans Leder wollte.“
„Warum wollte der König ihnen ans Leder?“, fragte mit dünnem Stimmchen Anna Maria.
„Sie waren französische Protestanten, sogenannte Hugenotten, die sich auf die Lehre des Meisters Calvin beriefen. Zuerst war man den Hugenotten auch wohlgesonnen, doch dann begannen die Verfolgungen und viele von uns flohen aus Frankreich.“
„Wieso denn welche von uns, Großvater?“, fragte der kleine Heinrich. „Wir sind doch katholisch.“
„Da hast du recht, Heinrich, aber unsere Familien waren einmal Hugenotten und haben sich entschieden, katholisch zu werden. Da lebte es sich leichter. Das war aber sehr viel später, als wir schon hier im Hunsrück waren“, entgegnete sein Großvater. „Manchmal ist es besser, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.“
Er blickte bedeutungsvoll in die Runde. „Und dann kam der große Napoleon. Er kam durch einen Umsturz an die Macht und hat für viel Wirbel gesorgt. Die ganze Welt und vor allem Russland wollte er beherrschen. Aber eins nach dem anderen. Ich bin nur vier Jahre vor der großen Revolution in Frankreich geboren, im Juni 1785. Mein Vatter Johannes war Tischler und Fuhrmann so wie sein Vatter Friedrich auch. Sie hatten einen Wagen und zwei große Pferde, mit denen sie alles transportierten, was es zu transportieren gab, sogar die napoleonischen Soldaten, die sich hier und in Simmern bis 1814 herumtrieben. Ihr müsst wissen, hier war alles Französisch und noch nicht Preußisch so wie heutzutage. Die meisten Leute haben Französisch und nicht unser Hunsrücker Platt geschwätzt!“
Die Kinder lachten. „Als mein Ob Friedrich starb, habe ich mit dem Vatter das Fuhrgeschäft weitergemacht und so mancherlei gesehen und erlebt. Das kann ich euch sagen. Die Soldaten ließen sich herumkutschieren wie große Herrschaften und dazu noch bedienen, als ob sie nicht nur Kanonenfutter wären. Sie hatten nur Fissemadenten im Kopp. Alle Hunsrücker hatten einen mächtigen Rochus auf sie. Aber dann war es vorbei mit lustig unsere Win getrunke und unsere Määdsche nachgestiege! Der Preuß und der Russ haben sich nämlich zusammengetan und den Napoleon mitsamt seine Fransose eins-zwei-drei hinausgeworfen aus unserem Hunsrück, weit zurück hinter den Rhein.“
Die Kinder kreischten und klatschten vor Vergnügen in die Hände. Auch auf den Gesichtern der Erwachsenen zeigte sich ein leises Lächeln.
„Es war im März 1814. Da schlichen sich der Preuss und der Russ leise heran, trieben die Fransose mit lautem Gebrüll über den Rhein und schlugen Napoleon in der Schlacht von Arcis-sur-Aube vernichtend.“
„Täterätätä, täterätätäääää!“, riefen die Buben laut vor Begeisterung.
„Genauso war es, ihr könnt es mir glauben. Mein Vatter Johannes, euer Urob, und ich waren dabei und haben es mit de eigene Aue gesiin. Es war eine wilde Zeit mit dem Napoleon und seine Soldate.“ Lorenz nahm einen kräftigen Schluck Bier, das Marie Cath ihrem Vater nachgeschenkt hatte. Er räusperte sich und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
„Und dann kamen die schlimmen Hungerjahre, in denen uns Gott ans Leder wollte.“ Lorenz blickte ernst in die Runde. Die Kinder verstummten und in den Gesichtern der Erwachsenen zeigten sich all die schmerzvollen Erinnerungen.
„Nur geregnet hat es, tagein, tagaus. Wochenlang, monatelang. Und kalt war es. Nichts wuchs mehr auf den Feldern und in den Gärten. Alles verrottete und verdarb. Zuerst starben die kleinen Kinder, dann die Alten und auch die anderen. Bald gab es keine Tiere mehr zum Schlachten. Sie waren alle aufgefressen. Und viele von uns packten ihre Bündel und fuhren in die Fremde nach Brasilien.“ Lorenz machte eine kleine Pause und nahm erneut einen Schluck Bier.
„Doch irgendwann hatte es sich der liebe Gott wieder anders überlegt und schickte die Sonne zurück. Die Felder wurden wieder grün und in den Gärten wuchsen Obst und Gemüse. Mit den Groschen, die ich als Tischler verdiente, kaufte ich zwei Hühner, die bald Eier legten.“
Die Augen der Kinder begannen wieder zu strahlen.
„Und dann hat der liebe Gott dafür gesorgt, dass es Küken gab und noch mehr Eier, und so war alles wieder gut.“ Anna Maria hatte mit ernstem Ausdruck gesprochen und die kleinen Hände vor der Brust gefaltet.
„Ja“, sagte Lorenz mit heiserer Stimme, „dann war alles wieder gut.“ Nur die Erwachsenen dachten an die zweite Zeit des Hungers nach 1841. Wie durch einen Fluch war das Land beinahe zugrunde gegangen, waren Mensch und Tier gestorben, weil es eine Missernte nach der anderen gab. Sie alle spürten es immer noch in ihren Knochen.
Am 21. Mai des Jahres 1849 begab sich die Familie Stein mit den wenigen Habseligkeiten, die sie besaß, und einem Arbeitsvertrag in Josephs Joppentasche auf den Dorfplatz, wo bereits eine große Menge Menschen wartete. Einige hatten Wagen dabei, auf denen sie ihr Gepäck und die Kinder verstaut hatten. Die meisten gingen jedoch zu Fuß und hatten nur ein Bündel über den Rücken geworfen.
Jetzt, wo die unruhige Zeit der Revolution weitgehend vorbei und es wieder friedlich in deutschen Landen war, folgten 41 Familien und an die 80 Junggesellen dem Ruf des Herzogs von Blois nach Dülmen in Westfalen, um dort auf der Eisenhütte Prinz Rudolph zu arbeiten und einen neuen, besseren Ort zum Leben zu finden.
Es war warm, die Sonne schien mit aller Kraft des Frühlings auf die Menschen. Der Gesang der Vögel war wie ein Abschiedskonzert, das einem stillen und andächtigen Publikum vorgetragen wurde. Joseph, Marie Cath und die kleine Anna Maria hatten ihre Sonntagskleider angezogen. Josephs Joppe war aus grauem gewebtem Tuch mit vier Hirschhornknöpfen, die er noch von seinem Vater hatte, eine braune Hose, die von einem geflochtenen Juteband um den Leib gehalten wurde, darunter ein einfaches blaues Baumwollhemd ohne Kragen. Seine braune Kappe hielt er in der Hand. Marie Cath trug einen weiten, schon etwas abgetragenen Rock aus hellgrauem Tuch, das sie selber gewebt hatte. Zwei Handbreit oberhalb des Saumes verzierte eine schmale Bordüre aus rotem Garn im Kreuzstich das Gewand. Über der langärmeligen grauen Bluse trug sie ein schwarzes Westchen, dass sie mit der gleichen Stickerei wie am Rock entlang der Säume versehen hatte. Um den Kopf hatte sie sich ein buntes Kopftuch gebunden, das ihr die Mutter zum Abschied geschenkt hatte. Die wenigen anderen Kleidungsstücke waren in einer einfachen Holztruhe verstaut, die das einzige Gepäckstück der Familie war.
Das gleiche buntbestickte Tuch wie Marie Cath, nur kleiner, trug Anna Maria, die die Großmutter gar nicht loslassen wollte, als der Treckführer zum Aufbruch drängte. Die alte Frau strich der Kleinen das blaue Kleidchen zurecht, zupfte an dem fadenscheinigen grauen Wolljäckchen, das sie darüber trug und sagte: „Geh mein Kind, es ist Zeit. Vergiss uns nicht.“ Sie küsste Anna Maria auf die Wange und verdeckte dann mit ihrem Schultertuch das Gesicht, damit die Kleine ihre Tränen nicht sah.
Der Augenblick des endgültigen Abschieds kam. Vater Lorenz kämpfte um Haltung. Um den Mund des alten Mannes zuckte es und seine zusammengekniffenen Augen versuchten vergeblich die Tränen zurückzuhalten. Die Großmutter hatte ihre Enkelin hochgehoben und mit geschlossenen Augen ganz fest an sich gedrückt. Der zarte Rücken des Kindes bebte.
Neben den Eltern standen Marie Caths Schwester Maria, ihr Bruder Wilhelm, seine Frau und die vier Kinder. Wilhelm wollte nicht fort von den Eltern, die ohne ihn ja niemanden mehr hätten. Josephs Eltern lebten schon lange nicht mehr und sein einziger Bruder Jakob hatte sich vor drei Jahren mit seinen beiden Kindern Karl Emil und Elisa auf den Weg nach Brasilien gemacht, nachdem seine Frau im Hungerjahr 1846 gestorben war.
So viele hatten die Heimat verlassen. Die Konraths waren mit der gesamten Familie losgezogen, die Kaspars zu elft, Joseph Pira, Witwer Merkel mit seinen vier Kindern, die Familien Michels und Rötsch, sie alle waren rüber nach Rio Grande do Sul oder in die Kolonie Petrópolis in der Provinz Rio de Janeiro. Für die meisten von ihnen hatte es hier im Hunsrück keine Arbeit mehr gegeben und der Hunger war täglicher Gast in jedem Haus. Die Verzweiflung hatte sie fortgetrieben.
Joseph umarmte die Schwägerinnen, den Schwager Christian und die weinende Schwiegermutter, die ihnen Gottes Segen mit auf den Weg gab und ihm die widerstrebende Anna Maria reichte, tätschelte die Köpfe der ratlos blickenden Nichten und Neffen. Wilhelm und Lorenz klopften ihm nickend auf die Schultern und schwiegen. Es war still auf dem Platz. Nur hier und da hörte man ein unterdrücktes Schluchzen.
Joseph half Marie Cath auf den Wagen der Brockmanns, den sie am großen Fluss würden zurücklassen müssen, hob das Kind zu ihr hinauf und nickte der zurückbleibenden Familie noch einmal mit ernstem Gesicht zu. In einem Beutel, den Marie Cath auf den Rücken geschnallt trug, verbarg sich eine Quetschkommode, auf der sie schon lange nicht mehr gespielt hatte. Eigentlich hatte sie das alte Instrument gar nicht mitnehmen wollen, doch Joseph bestand darauf. „Du wirst eines Tages froh sein, dass du sie noch hast“, hatte er gesagt und sie liebevoll angeschaut.
Marie Cath hatte ihre hellbraunen Haare im Nacken zu einem dünnen Knoten zusammengefasst und das buntes Tuch fest darüber gebunden. Keine Strähne lugte hervor. Ihre bernsteinfarbenen Augen, die jeden Glanz verloren hatten, blickten starr nach vorn. Sie saß hinter Brockmanns Frau, die leise weinte, vor ihr die Kinder, der sechsjährige Franz und die vierjährige Anna Lena, die sich ängstlich bei den Händen hielten.
Langsam setzte sich der Treck in Bewegung. Da löste sich in Maria die Starre, die sie seit dem frühen Morgen erfasst hatte. Sie lief hinter dem Wagen her, bis sie ihn erreichte, hielt sich neben der Schwester am Holz fest.
„Marie Cath“, schluchzte sie auf. Sie hielt ein Stoffbündel hoch, das Marie Cath mit zitternder Hand an sich nahm. Sie sah ihre kleine Schwester an und glaubte, ihr Herz müsse zerreißen. „Maria“, kam es leise, fast tonlos von ihren Lippen. Dann löste sie ihren Blick von diesen verzweifelten Augen, die sie niemals mehr würde vergessen können. Maria ließ den Wagen los und blieb zurück.
Brockmann lenkte das von zwei Kaltblütern gezogene Gefährt. Joseph ging zu Fuß. Er blickte zu Marie Cath hoch, die schweigend, aber nun mit einem zu allem entschlossenen Gesichtsausdruck ihre Tochter an sich drückte. Er war sich sicher, dass sie ebenso wie er in diesem Moment an ihre Kinder dachte, die sie auf dem Friedhof von Seibersbach zurücklassen mussten. Wolfgang, Philip und Joseph hatte der Tod noch vor ihrem dritten Jahr geholt, Catharina und Magdalena bereits wenige Tage nach der Geburt. Ja, und dann der kleine Jakob, ihr jüngstes und spätes Söhnchen, den das Fieber so grausam dahingerafft hatte. Joseph war bereits 39 und Marie Cath 37 Jahre alt gewesen, als ihnen Gott dieses Geschenk machte.
Jetzt war ihnen nur noch die dreijährige Anna Maria geblieben und ihr wollten sie etwas Besseres schenken als den Tod. Und zogen sie nicht wie in alter Tradition der Hugenotten aus der Heimat in die Ferne, wenn auch nicht auf andere Kontinente? War es nicht auch das Schicksal der Altvorderen gewesen, als sie aus ihrer französischen Heimat fliehen mussten? Was machte es für einen Unterschied, ob ein König, der Krieg oder eine Hungersnot sie vertrieb?
Die stumme Karawane zog nach Bingen am Rhein, wo ein Schiff auf sie wartete, dass sie nach Köln bringen sollte. Von dort aus würde sie ein Wagentransport der Eisenhütte in die neue Heimat bringen. Als sie Seibersbach und den Hunsrück hinter sich ließen, sah sich niemand um. Wieso sollte man sich auch nach Tod und Elend umsehen! All die toten Kinder flogen sicher als Engel mit ihnen mit. Allez, allez, dachte Joseph, vorwärts, nur vorwärts.
Buch 2
Bernhard Pläster, 26. November 1848, Münster/Dülmen
Bernhard war so schnell gerannt wie nie zuvor. Nur weg von diesem verdammten Platz, hatte er gedacht, nicht rechts, nicht links geschaut. Inmitten der panisch schreienden Menge hatte er sich den Weg zu den Ställen der Rennbahn gebahnt, wo die beiden Pferde warteten, mit denen er und Franz am Vormittag nach Münster geritten waren. Sein hochgewachsener, drahtiger Körper war bis zum letzten Muskel angespannt. Seine Nerven vibrierten. Er schwitzte aus alles Poren und seine braunen Locken klebten auf der Stirn und im Nacken. Er war von Kopf bis Fuß von einem rötlichen Staub bedeckt, den er sogar im Mund schmeckte.
Als die Soldaten auf die Leute losgingen, war er gestürzt, hatte wie ein Käfer auf dem Rücken gelegen und der verdammte Infanterist hatte seine Bajonettspitze gegen seine Brust gedrückt. Immer noch rauschte das Blut in seinem Kopf, auch wenn sein Herzschlag sich inzwischen etwas beruhigt hatte. Übergroß und deutlich stand die gelbe Schulterpatte mit der roten 15 vor seinem inneren Auge. Einen Moment lang hatte er geglaubt, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Er hörte immer noch das Schreien der Menschen, die von der Rennbahn weg in alle Richtungen rannten, einige Blut überströmt. Andere sah er fallen und reglos liegen bleiben.
Die Infanteristen des gerade erst in Münster eingesetzten 15. Regiments hatten den Flüchtenden gnadenlos nachgesetzt. Es hatte Schüsse gegeben und sein Freund Franz war mit einem blutigen Loch in der Brust neben ihm zu Boden gesunken, die weit aufgerissenen Augen blicklos in ungläubigem Staunen. Der Fluchtimpuls war stärker als alles andere gewesen. Bernhard hatte sich umgewandt und war losgelaufen. Und mit ihm all die anderen Genossen und Mitstreiter für eine gerechtere Welt.
Nach dem Sturz hatte seine Lähmung nur kurz angedauert, dann hatte er dem Soldaten sein mit Kraft hochgezogenes Bein in die Weichteile gerammt, als der einen Moment lang nachlässig das Bajonett anhob, um zu einem Kameraden zu sehen, der rechts neben ihm einen Mann umwarf. Dieser kurze Augenblick hatte ausgereicht, um sich zu befreien und loszurennen. Atemlos war er zu den Pferden gelangt und wie der Teufel losgeprescht.
Dank der beiden Pferde hatte der harte Ritt nur drei Stunden gedauert. Sein Leihpferd, ein rot-brauner Schleswiger mit üppig gewellter, blonder Mähne und einem herrlichen Schweif, war raumgreifend und energisch vorangestürmt, als erkenne er die drohende Gefahr im Rücken, und stellte seine Ausdauer und Nervenstärke einmalig unter Beweis. Nur einmal war Bernhard unterwegs auf Franz‘ Holsteiner umgestiegen, dessen eleganter, ausdrucksstarker Kopf und im rasenden Galopp gestreckter Körper immer neben dem seines Pferdes dahinflog, scheinbar mühelos. Die aufgeweckten Augen des schönen Tieres schienen ebenfalls sagen zu wollen ‚Keine Sorge, wir halten durch und schaffen es. Du kannst uns vertrauen.‘
So waren sie zu dritt durch die Nacht geflüchtet und hatten unbeschadet, aber schweißgebadet Dülmen erreicht. Das Hufgeklapper der Pferde hallte auf dem Kopfsteinpflaster der dunklen, stillen Gassen. Er war über den Westring an der Brauerei Holtkamp vorbeigeritten und war schließlich vor Göllmanns Stallungen angekommen.
Jetzt lag er zu Hause auf dem Bett und Gertrud verarztete seine Kopfwunde. Sie war zu Tode erschrocken, als er mitten in der Nacht völlig derangiert und blutend vor der Türe stand und wie wild klopfte. Er hatte kaum mehr die Pferde in Göllmanns Stallungen anbinden können, die nur einen Katzensprung von seinem Haus in der Tiberstrasse entfernt lagen. Bewusst hatte er die Tiere nicht in die große Stallung gebracht, weil dort mindestens zwei, wenn nicht gar drei Stallburschen Wache hielten und sicher viele Fragen gestellt hätten. Gegenüber lagen einige kleinere Ställe. Sein spätes Erscheinen erregte dort längst nicht so viel Aufmerksamkeit. Meist standen hier in den vier Boxen ein oder zwei Tiere, wohingegen sich im großen Stall rund 20 Pferde befanden.
Bernhard war den Fragen des verwirrt blinzelnden und schlaftrunkenen Stallknechts Bertram ausgewichen, hatte ihn auf später vertröstet, nichts zu Franzens Verbleib gesagt und war auch nicht zu dessen Frau gegangen. Zuerst ein wenig schlafen, hatte Bernhard gedacht, dann alles andere. Zuerst ein wenig schlafen.
Auf Gertrud gestützt war er zur Schlafkammer gewankt und hatte sich schwer atmend auf das Bett fallen lassen. Erst jetzt spürte er den rasenden Kopfschmerz und schmeckte das Blut auf den Lippen, das aus einer Stirnwunde über sein Gesicht lief.
Sofort war Gertrud zum Brunnen hinter dem Haus geeilt, hatte einen Eimer mit Wasser hochgezogen und sofort einen Topf mit der kühlen Flüssigkeit auf den Herd gestellt. Mit ruhiger Hand fachte sie die verbliebene Glut mit einigen dünnen Holzscheiten an. Ihr offenes helles Haar fiel in Wellen über den Rücken. Sie hatte keine Zeit gehabt, es zu flechten, als sie erschrocken aus dem Bett gesprungen und zur Tür gerannt war. Gertrud sprach kein Wort, wollte abwarten, bis das Notwendige getan war. Dann würde ihr Mann schon von allein erzählen.
Sie hatte ihn gewarnt, als er zusammen mit Gruwe, Keller und einigen Männern des Deutschen Vereins zur Volksversammlung nach Münster reiten wollte. Sie hatten doch alle vom Eingreifen des Militärs in anderen Städten gelesen. Die Zeitungen und Flugblätter sprachen eine eindeutige Sprache. Aber Gertrud machte Bernhard keine Vorwürfe. Sie wusste, wie sehr er für die Sache lebte. Und auch sie war voller Begeisterung ob der Ideen und Reformbewegungen. Es war an der Zeit, dass sich etwas änderte im preußischen Staat mit seinem hochherrschaftlichen König und seinen arroganten Beamten, die keinen Finger für die Arbeiter und Landlosen krumm machten. Und ja, der König hatte Versprechungen gemacht, hatte ihnen seit April Versammlungsund Pressefreiheit gewährt. Endlich konnte man sich auf der Straße und im Wirtshaus in Gruppen treffen, ohne dass sofort die Polizei antrabte, um die angeblich „konspirative Versammlung“ aufzulösen.
So viele neue Zeitungen waren seither erschienen, die ihnen frank und frei die Ereignisse in den deutschen Staaten und der Welt näherbrachten. Selbst im kleinen Dülmen gab es seit zwei Wochen als Beilage zum Westfälischen Merkur das Dülmener Tageblatt. Die Aufbruchstimmung der vergangenen Monate war wunderbar gewesen. Eine bessere Zukunft schien begonnen zu haben, vor allem für die armen Leute. Und natürlich für die Frauen!
Elisabeth Osthues, die Gattin des stellvertretenden Oberbürgermeisters, hatte im Ort einen Frauenverein gegründet, der Mathilde Anneke zum Vorbild hatte. Wie die Männer trafen sich die Frauen einmal in der Woche beim Stammtisch der Dülmener Stuben, die am Marktplatz 34 gegenüber dem Marktbrunnen lagen. Dort studierten sie gemeinsam die Zeitung und lasen den Frauen vor, die das selbst nicht konnten. Die drei Ausgaben der politische „Frauen Zeitschrift“ der Anneke, die im September in Köln herausgegeben und mittlerweile schon wieder verboten worden war, lagen auf dem großen runden Tisch.
Das war eine Frau nach ihrem Geschmack! Sie hatte ihren zur Gewalttätigkeit neigenden Mann 1837 mit nur 20 Jahren verlassen und die Scheidung eingereicht, lebte 1840 mit ihrer kleinen Tochter in Münster, schrieb dort im Kreis der Annette von Droste-Hülshoff Artikel und Gedichte. Unerhört, ja ungehört in Westfalen! Der Skandal breitete sich wie ein Lauffeuer aus und jeder wusste davon. Annekes politische Ansichten, die sie in den Zeitungen veröffentlichte, waren radikal. Sie hielt mit nichts hinterm Berg. Sie wollte die Freiheit der Frau, Selbstbestimmung und das Frauenwahlrecht. Ha, was das die Herren der Schöpfung aufregte! Doch nicht so ihren Bernhard. Der war davon überzeugt, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis allen Menschen diese Freiheiten gewährt werden mussten. Sein Eintritt in den neugegründeten demokratischen Deutschen Verein war nur konsequent.
„Zum Glück hattest du keine Waffe dabei“, sagte sie leise.
„Ja, aber Gruwe und Keller hatten ihre Gewehre mit. Wenn die Soldaten sie erwischt haben, wird man sie ins Zuchthaus sperren, wenn nicht gar Schlimmeres passiert“, antwortete Bernhard düster. „Franz hat es erwischt. Das Loch in seiner Brust von dem verdammten 15. war so groß wie meine Faust.“ Er schluckte und konnte nicht weiterreden.
„Um Himmels willen, Bernhard, warst du schon bei Marianne?“
„Nein, ich konnte nicht. Werde es später machen. Sie soll es von mir und nicht von den anderen erfahren.“
„Ich komme mit dir. Sie wird sicher Hilfe brauchen. Mein Gott, die Ärmste, was soll aus ihr und den Kindern werden ohne den Franz? Ihre Leute sind alle irgendwo im Ruhrgebiet. Und Franzens Eltern sind alt und klapprig.“
Die Mutter war die Stiege heruntergekommen und schaute besorgt in die Kammer der jungen Leute. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie den Jungen die untere Schlafkammer überlassen und war unters Dach gezogen.
„Was ist geschehen, Bernhard? Du bist ja verletzt!“, rief sie erschrocken aus und schob ihre verrutschte Nachthaube zurecht.
„Der Franz ist tot, Mutter, erschossen.“, sagte Gertrud leise, den Blick zur Mutter gewandt.
„Oh Gott, weiß es Marianne schon?“
„Nein, wir werden in ein paar Stunden zu ihr gehen. Geh wieder schlafen, Mutter. Die Nacht ist bald um und der Tag wird nicht einfach“, sagte Gertrud und legte der alten Frau sanft die Hand auf die Schulter.
Nachdem die Mutter gegangen war und Gertrud das leise Knarren des Bettgestells über sich hörte, trocknete sie sich die Tränen mit der Schürze, die sie nach Bernhards Rückkehr schnell über das Nachtgewand gebunden hatte. Sie band die Schürze los und legte sie sorgfältig auf den Stuhl, der neben dem Bett an der Wand stand, bevor sie zu Bernhard unter das Laken kroch. Sie wusste, dass ihr Mann nicht schlafen konnte, dass er noch lange grübeln würde. Sie schwieg, kuschelte sich an seinen Rücken, um ihn zu wärmen, und schlief kurz darauf ein.
So manches ging Bernhard tatsächlich durch den Kopf und er konnte trotz der großen Erschöpfung, die er fühlte, keinen Schlaf finden. Am 22. November hatten sich die Demokraten verschiedener Vereine zum ersten Mal in der neuen Weinstube Philip Schrodts auf der Neubrückenstraße in Münster getroffen. Der Wirt war ein guter Freund Anton Kellers und hatte ihn und seine Freunde vom Deutschen Verein zur Eröffnungsfeier eingeladen. Und was gab es Besseres als ein gutes Tröpfchen Wein, zumal umsonst! Da lohnte es sich allemal, den weiten Weg von Dülmen nach Münster auf sich zu nehmen. Es war ein sehr schöner, sangeslustiger, feuchtfröhlicher Abend gewesen. Sie hatten im Stall Schrodts hinter der Weinstube bei den Pferden übernachtet. Dort war es dank der Tiere recht warm und sie mussten nicht befürchten, alkoholselig an Unterkühlung zu sterben. Das Wetter war nasskalt und die ersten Nachtfröste zogen bereits übers Land. Bernhard musste ein wenig grinsen bei der Erinnerung an den Abend mit den Kameraden. Das war doch erst vier Tage her! Und so viel war seither geschehen …
Nach zwei Missernten 1845/46 war es im Sommer 1847 endlich wieder aufwärtsgegangen. Es gab eine gute Ernte und die Preise hatten sich erholt. Der Hunger schien vorerst gebannt. Doch Bernhards Schwiegervater Johann hatte die Strapazen der vergangenen Jahre nicht gut verkraftet. Er war am 22. Juli 1847 mit 61 Jahren am Schlag gestorben.
Die Ärmsten der Armen waren zu schwach, um auf den Barrikaden zu kämpfen. Es waren die Handwerker, Arbeiter und Kleinhändler, die sich bedroht fühlten, noch etwas zu verlieren hatten. Sie alle hatten die Nase voll von den Herrschaftsorganen. Die Menschen fühlten sich nicht nur in Westfalen von der Verwaltung ungerecht behandelt und schikaniert. Viele waren arbeitslos. Wer in Arbeit und Lohn stand, erhielt sehr oft zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Dieser neumodische Einsatz von Maschinen im Weberhandwerk stahl den Menschen ihre Einkommensgrundlage und machte ein würdevolles Leben schier unmöglich. Das betraf nicht nur Bernhard und seine ganze Familie, sondern fast alle Familien in Dülmen. Viele junge Männer begannen, ins Ruhrgebiet abzuwandern, wo sie Arbeit auf den Zechen und großen Eisenhütten fanden.
Bernhard war 1838 im Alter von 23 Jahren aus St. Mauritz bei Münster in die Weberstadt Dülmen gewandert, weil er sich dort bessere Chancen als Leineweber versprach. Daheim war für ihn die Situation in der großen Familie zu eng geworden. Sie lebten mit den Eltern, Großeltern und den sechs Geschwistern auf einer kleinen Hofstelle an der Straße Zum Guten Hirten.
Das Leben an sich war schon nicht einfach gewesen, aber Bernhard hatte zudem ein leicht hitziges und aufbrausendes Gemüt und einen kämpferischen Geist. Er ließ sich nur ungern etwas sagen und lag deshalb ständig mit seinem Vater Anton im Streit. Der war Ackersmann auf den Ländereien des Grundherrn Lauritz Pleister. Mutter Bernardina, eine stille und geduldige Frau, webte für einen Verleger in Münster, ebenso wie zwei seiner älteren Schwestern.
Vater Anton war strenger Katholik, was ihn jedoch nicht davon abhielt, zu viel zu trinken. Er war königstreu, wohingegen Bernhard die Macht des Adels und den großen Einfluss der Kirche ablehnte. Als die Meinungsverschiedenheiten und Streitereien der beiden unerträglich wurden, schnürte Bernhard sein Bündel und zog fort.
Von durchreisenden Webern hatte er gehört, dass die Firma Sterner in Dülmen ein guter Auftraggeber wäre. Sterner schien ein weitaus besserer und vor allem besser bezahlender Verleger von Garnen und Stoffen zu sein als die übrigen in der Region. Sie gaben den Heimwebern Material für die Weiterverarbeitung, nahmen ihnen die Webstoffe nur zu sehr niedrigem Preis ab und verkauften die Produkte an Handelskontore weiter. Dort wurden sie wiederum von Händlern aufgekauft und unter die Leute gebracht. Nicht so Sterner. Er wusste gute Handarbeit zu würdigen und zahlte entsprechend anständig. Er hatte ein eigenes Handelskontor mit Laden und konnte so die Ware der Weber direkt weiterverkaufen.
Die neue Zeit machte es den Heimwebern alles andere als leicht. Schon als Kind und Jugendlicher musste Bernhard erfahren, dass sie allen Webern den Angstschweiß auf die Stirn trieb. Die Krise der 30er-Jahre hatte Spuren hinterlassen und zu einer zunehmenden Verarmung der Weber geführt. Mehr und mehr Menschen zogen in die Provinz, was Hungersnöte begünstigte und die Leute dazu brachte, die Kornmagazine zu stürmen. Die Behörden und besitzenden Schichten fürchteten um ihr Hab und Gut und riefen das Militär.
Durch die mechanischen Webstühle, die in ganz Europa, angeführt von England, Einzug hielten, stürzten die Heimweber mehr und mehr ins Nichts. Dann kam es Ende 1847 nach einer kurzen Erholungsphase erneut zu enormen Preissteigerungen, die nach wie vor anhielten. Früher war Westfalen berühmt für seine Textilherstellung gewesen. Jetzt bestand der Ruhm nur noch darin, als Elendsregion zu gelten.
Die Zeitungen klärten die Menschen auf und machten ihnen ihr Elend noch bewusster. Sie begannen, den Sinn von allem zu hinterfragen. Wieso konnten sie trotz harter, zermürbender Arbeit kein normales Leben führen? Die Reichen aber wurden immer dicker und machten sich immer breiter. Wer sagte denn, dass das so gewollt war? Und wenn, von wem? An eine höhere Ordnung glaubte Bernhard schon lange nicht mehr und schon gar nicht daran, dass die Einteilung in Arm und Reich gottgegeben war. Die Spannungen und das Aufbegehren angesichts der großen sozialen Ungerechtigkeit waren nur natürlich. Der Zorn wuchs in den Herzen und Gemütern der Menschen.
Bernhards Hoffnungen auf ein besseres Leben in Dülmen hatten sich in den ersten Jahren bewahrheitet. Er fand Unterkunft bei der Weberfamilie Johann und Elisabeth Berning, die 1835 ihren damals 20-jährigen Sohn an die Cholera verloren hatten. Eine schmale Holzbank direkt neben dem Herd in der Stube wurde in der Nacht zu seinem Lager. Trocken und warm.
Die Tochter des Hauses, Gertrud, war ein Jahr älter als Bernhard. Ihr dunkelblondes Haar trug sie zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr bis zur Taille reichte. Der Blick ihrer blauen Augen war offen und neugierig. Sie und die Eltern hatten sich aus Gott weiß welchen Gründen nicht mit der Cholera angesteckt und waren unbeschadet geblieben. Aber in Dülmen hatte diese furchtbare Krankheit für Angst und Schrecken gesorgt und so manchen dahingerafft.
Und doch gab es immer wieder Leute, die selbst jetzt noch behaupteten, es habe die Cholera gar nicht gegeben, sie sei Propaganda irgendwelcher Umstürzler oder des Königs gewesen. Ja, einige meinten sogar, der König habe die arme Bevölkerung dezimieren wollen, um mehr Platz für die Reichen zu schaffen. Bei aller Wut gegen den Adel und seine Handlanger stellten sich bei Bernhard jedes Mal die Haare auf, wenn er solch einen Unsinn hörte. Die Streitereien darum füllten sogar die Zeitungsseiten. Waren die vielen Toten nicht Beweis genug gewesen?





























