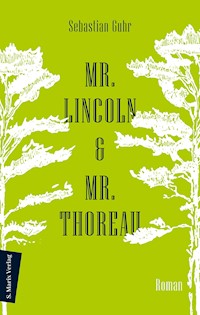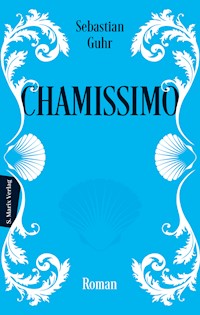
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem Adelbert mit seinen Eltern vor der Französischen Revolution fliehen muss, beginnt für ihn eine lebenslange Reise durch die Wirren aller gesellschaftlichen, geistigen und geografischen Welten seiner Zeit. Er wird Page am preußischen Hof, verdingt sich als Soldat, schließt Freundschaft mit dem Verleger Eduard Hitzig, verbringt auf der Flucht vor Napoleons Truppen einen Sommer als Liebhaber Madame de Staëls am Genfer See, erlangt unverhofft Berühmtheit durch seine Erzählung Peter Schlemihls wundersame Geschichte, bereist auf einem Expeditionsschiff den gesamten Erdball, verliert sich fast auf Hawaii und macht sich schließlich als Botaniker einen Namen an der Berliner Universität. Erzählt wird die faszinierende Lebensgeschichte des Schriftstellers, Wissenschaftlers und Weltreisenden Adelbert von Chamisso, einem wachen, unbestechlichen und empfindsamen Geist des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastian Guhr
CHAMISSIMO
Roman
Inhalt
Der Edelmann als Bürger
Venus und Amor
Böse Künste
Ich träumte, ich stach dir ins Herz
Gesellige Unterhaltungen im Freien
Preußisches Pastoral
Brasilianische Küstenlandschaft im Morgenlicht
Flora bekränzt einen Affen
König der stillen Inseln
Von Innen betrachtet ist nichts völlig leer.
Der Edelmann als Bürger
Es war der Sommer des Jahres 1791, als Adelbert aus der behüteten Welt des französischen Hochadels herauskatapultiert wurde und eine etwas andere Perspektive kennenlernte. Er verbrachte mit seinem Bruder Eugène den Vormittag auf einer Wiese hinter dem Schloss, als sich eine Wespe auf seiner Nasenspitze niederließ und ihn einfach nicht stechen wollte. Adelbert musste schielen, um ihren wippenden Hinterleib zu erkennen, denn er wollte unbedingt sehen, wie der kleine Stachel in seine Haut eindrang.
»Verjag sie!« rief Eugène, aber Adelbert tat das Gegenteil, er drückte mit seinem Zeigefinger auf die Wespe und ärgerte sie, bis er endlich den Stich spürte.
»Tut es sehr weh?« Eugènes untere Gesichtshälfte war mit Spucke verschmiert.
»Hat nur kurz gepiekt.« Auf seiner Nasenspitze wuchs ein roter Hügel und Adelbert schielte angestrengt, um jede Einzelheit des Kraters zu erkennen und später mit Kohle abzeichnen zu können. Sein Hauslehrer Monsieur Lusignan hatte davon gesprochen, dass die Materie aus winzigen Teilchen besteht, und auf Adelberts Nasenspitze sah es wirklich so aus, als hätte die Wespe ein Teil aus seiner Haut weggenommen.
»Es muss doch wehtun!« Eugène, der noch Mädchenkleider trug, raufte sich vor Sorge um seinen Bruder die Haare, während Adelbert ruhig an dem Krater herumdrückte, bis Blut kam. Er leckte das Blut von seinem Finger ab. Monsieur Lusignan meinte, das sei das Typische am Menschen: Ein Mensch sei Materie, die sich für Materie interessiere.
»Das Blut schmeckt nicht anders als sonst.« Diese Erkenntnis enttäuschte ihn, und am liebsten hätte er sich gleich noch mal stechen lassen, aber die Wespe war natürlich fort.
An diesem Vormittag hatten er und sein Bruder Staudämme gebaut, Reiche erobert und die Karawanen der Ameisen umgeleitet, bis eine vertrocknete Schlangenhaut die Möglichkeit eröffnete, dass Drachen vielleicht doch existierten. Letztlich verhalf ein Nachschlagen in der Enzyklopädie der Vernunft zum Sieg. Es gab keine Ungeheuer. Zumindest nicht in Frankreich.
Hier, im Norden des Landes, befand sich das Schloss der Familie Chamisso, ein quadratisches Gebäude, über dessen Eingangstor das Familienwappen hing: zwei tote Hände und fünf Kleeblätter auf silbernem Schild. Über den längst ausgetrockneten Wehrgraben führte eine Zugbrücke, die seit Generationen nicht mehr bewegt worden war. Vorn im Torhaus wohnten der Kutscher und der Hauslehrer, der die Nase eines Falken hatte und mit seinen Augen in unterschiedliche Richtungen blicken konnte, und vielleicht begriff sein Lehrer wegen dieser besonderen Fähigkeit so gut, wie das eine mit dem anderen zusammenhing.
Adelbert hörte seine Mutter rufen. Immer wenn er am tiefsten in seine Untersuchungen versunken war, rief sie ihn. Aber da seine Schläfen bereits schmerzten, war es vielleicht besser, das Schielen aufzugeben. Schmerz war ein Gefühl, das sich nicht zeichnen ließ, für das Adelbert aber später Worte in seinem Tagebuch finden wollte.
Als er aufsah, war Eugène schon zum Schloss gerannt. Adelbert hörte das Wiehern von Pferden, und wieder rief Maman, diesmal dringlicher. Am Himmel sahen die Wolken wie Pusteblumen aus, und am Horizont braute sich ein Gewitter zusammen. Er sah seine Mutter in einem reich gerüschten Kleid zur Treppe kommen, neben ihr stand die Kutsche. Wollten sie verreisen? Im Gehen holte er sein Heft und den Bleistift hervor, um seine Erfahrung mit der Wespe zu notieren. Warum tat der Wespenstich nicht weh? Verhinderte seine Konzentration auf den Stich den Schmerz? Er musste diese Dinge immer gleich aufschreiben, bevor er sie vergaß. Ob es eine besondere Wespenart war, die nur in dieser Gegend lebte? Wie sollte er die neue Art nennen? Adelbert erfand gern Wörter für Dinge, die er entdeckte, und er fragte sich, ob ihn das mehr zum Dichter oder mehr zum Forscher machte. Sobald er den Namen Vespinae Chamissae ins Heft gekritzelt hatte, meldete sich der Schmerz auf seiner Nasenspitze wie ein notwendiger Tribut für das Wissen und die Erfahrung.
Als er bei der Kutsche eintraf, trugen schwarzgekleidete Männer gerade eine Truhe aus dem Schloss, während Maman Anweisungen gab. Ihre Haare, sonst mit dutzenden Haarnadeln zu enormer Höhe aufgesteckt, fielen ihr ins Gesicht, dessen gepuderte Wangen von Tränenspuren gezeichnet waren. Was war hier los?
»Adelbert, wo hast du gesteckt? Was ist mit deiner Nase passiert?« Das klang scharf und gefährlich.
»Er hat sich absichtlich von einer Wespe stechen lassen und am ganzen Körper gezittert«, petzte Eugène.
»Hab’ ich nicht! Ist Monsieur Lusignan noch nicht da?«
»Der Unterricht fällt aus«, sagte Maman. »Packt eure Koffer und dann kommt zum Essen. Wir reisen noch heute ab.« Ihre Stimme bebte und kurz sah es aus, als wollte sie noch etwas sagen. Aber dann drehte sie sich um und tadelte den Mann, der mit einem Gemälde am Türrahmen aneckte. Adelbert kannte das Bild, es hatte im Schlafzimmer seiner Eltern gehangen. Es war damals seinem Vater, dem Comte Louis-Marie de Chamisso, geschickt worden, damit er sich in Maman verliebte. »Auf den Haufen damit! Alles verbrennen!« Seine Mutter zeigte auf einen Berg voller Möbel, die Adelbert seit seiner Geburt kannte, die zu ihm gehörten wie Körperteile und die nun dort lagen wie herausgerissene Zähne.
Adelbert konnte seinen Arm furchtlos in einen Fuchsbau stecken oder die Nacht allein im Wald verbringen, wenn er dabei etwas lernte. Aber seine Mutter so derangiert zu sehen, das machte ihm Angst. Auch Eugène kämpfte gegen seine Tränen an und folgte der Mutter ins Schloss, während Adelbert dem Kutscher dabei zusah, wie er das Familienwappen auf der Kutschentür schwarz übermalte. Von ihm erfuhr er, dass die Aufständischen den König gefangengenommen hatten.
Adelbert holte ein Köfferchen aus seinem Eckzimmer und überlegte nun, was er mitnehmen sollte, wobei die wichtigste Frage war, wie viele Bücher in den Koffer passten, ohne dass die Henkel rissen. Er ging in die Bibliothek seines Vaters, wo Weltkarten an den Wänden neben einem Regal mit der illustrierten Ausgabe des Robinson Crusoe hingen. Einem ersten Impuls folgend griff er dieses Buch, aber dann fiel ihm ein, dass er auf einer längeren Reise Bücher bräuchte, die er noch nicht gelesen hatte. Er setzte sich im Schneidersitz auf den Bibliotheksboden und seufzte. Am liebsten hätte er sich hier versteckt und so die Abreise verzögert, aber bestimmt waren die Aufständischen schon auf dem Weg hierher.
Er sah zu den Regalen hinauf, sah die persischen Märchen aus Tausendundeiner Nacht, den Musenalmanach der französischen Poesie 1777-1787, James Cooks Reiseberichte in siebzehn Teilen und die hundertneunundfünfzig Bände von Diderots Enzyklopädie. Den hundertsechzigsten Band hatte er an einen Freund im Dorf verschenkt. Dinge, die er gerade nicht benötigte, verschenkte Adelbert oft leichtfertig. Brauchte er sie dann doch, lieh er sie sich zurück, weshalb er manchen als Narr galt. Er spielte gern mit den Söhnen der Handwerker und Bauern, und wahrscheinlich fand sein Vater ihn deshalb für eine Offizierslaufbahn ungeeignet, im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern Hippolyte und Charles, die in Versailles dem König dienten. Gedient hatten, musste man nun wohl sagen. Adelbert fragte sich, wo seine Brüder sich gerade befanden. Im Kerker beim König? Oder auf der Flucht?
Er könnte hierbleiben, hier leben wie Robinson auf seiner Insel. Und wenn er Hunger hätte, könnte er sich Äpfel aus dem Schlossgarten holen. Viele kostbare Stunden hatte er hier auf dem Bibliotheksboden schon verbracht, während sein Vater in den Ländereien unterwegs war, hatte bäuchlings mit einem Buch auf dem Parkett dagelegen und alles Geschriebene Wirklichkeit werden lassen, einfach indem er es las. War das nicht Magie? Sein Körper war ein Reservat für all das Glück und den Schmerz, die er durch die Bücher aufnahm; sein Körper war dazu da, das Gelesene zu ermöglichen.
Er entschied sich für drei Bände von Cooks Reiseberichten und legte die Bücher, gerade als Maman ihn rief, mit schlechtem Gewissen ins Köfferchen. Meistens, wenn er aus dem Bibliothekszimmer kam, sah er die Welt mit anderen Augen: Die Flecken an den Tapeten fielen ihm plötzlich auf oder ein viertes Stuhlbein, das nicht zu den anderen dreien passte. Als er nun den Salon betrat und Eugène in einem der grau-weiß gestreiften Sessel am Marmorkamin sitzen sah, glaubte Adelbert ebenfalls zunächst, es stimme etwas mit seiner Wahrnehmung nicht. Sein Bruder lümmelte wie ein müder Harlekin auf einem Thron, indes der König außer Haus war, und schmollte, weil er zum ersten Mal Jungenkleider tragen musste.
»Du siehst drollig aus«, sagte Adelbert.
Eugène wollte nicht darüber reden. Sie gingen in den angrenzenden Speisesaal, wo seine Schwester Louise am Tisch saß und, als sie Eugènes Kleindung sah, schockiert den Kopf schüttelte.
»Was?« fragte Eugène und wurde feuerrot.
»Nichts«, sagte Louise. Sie trug ihr Kinn immer etwas zu hoch, was nicht nur daran lag, dass sie kleiner als Adelbert war. Mit ihr verband ihn wenig, eigentlich nur das gemeinsame Schimpfen über ihre Brüder. Sie starrte auf seine Nasenspitze, als er sich an den Esstisch setzte. »Bist du gestochen worden?«
»Nein.«
»Er hat sich absichtlich stechen lassen«, sagte Eugène, woraufhin seine Schwester ein Messer vom Tisch nahm und Adelbert reichte. »Hier, zum Kühlen.«
Maman öffnete die Flügeltür und betrat den Salon. Sie hatte sich um ihre Frisur gekümmert und wirkte gefasster als vorhin, obwohl sie sich mit beiden Händen auf die Stuhllehne stützte, während sie sprach: »Meine Lieben, die Nationalversammlung hat endgültig die Abschaffung der Feudalrechte beschlossen, zurzeit fliehen tausende Aristokraten über die Grenze nach Belgien und Deutschland, und wir werden uns ihnen anschließen. Die gute Nachricht ist, dass es eurem Bruder Hippolyte gut geht. Er und euer Vater reiten nach Koblenz, um sich einer Exilarmee anzuschließen. Nun ja«, – hier seufzte Maman vielsagend – »euer Vater hat den alten Säbel aus dem Keller geholt. Möge er ihm Glück bringen.«
»Was ist mit Charles?« fragte Adelbert.
»Was soll das Messer in deinem Gesicht? Willst du dich ebenfalls der Exilarmee anschließen?«
»Nein.« Er ließ das Messer sinken.
»Wir haben noch keine Nachricht von Charles. Es heißt, dass die preußisch-österreichische Armee unserem König zu Hilfe eilt, aber solange können wir nicht warten. Wir werden die Dörfer umfahren müssen, die Menschen dort haben keine Sprache für das, was gerade in diesem Land vor sich geht und greifen lieber zur Mistgabel, um sich auszudrücken.« Hier lachte Maman bitter. Als eine geborene Cherivy hatte sie ihre Jugend in Versailles verbracht, bevor sie auf den Stammsitz der Chamissos in die Champagne zog. Für die Provinz hatte sie sich nie erwärmen können. »Gott weiß, ob die Bauern weiterhin die Felder bestellen werden, wenn die Herrengüter in Gemeindeland umgewandelt werden. Ihrer Natur nach sind sie zu zügellos, um für sich selbst zu sorgen.«
Adelbert war oft genug im Dorf gewesen, um zu wissen, dass das nicht stimmte. Und sein Lehrer Lusignan hatte ihn darüber aufgeklärt, dass die Staatschulden mehr als 300 Millionen Livre betrugen. »Zügellosigkeit ist wohl eher in Versailles zu suchen als bei den Bauern.«
Mamans Finger krallten sich in die Stuhllehne, sie hob den ganzen Stuhl kurz an und ließ ihn aufs Parkett knallen. »Geh auf dein Zimmer, Adelbert! Und denke darüber nach, wie du dich gegenüber deiner Mutter verhalten hast!«
Er fand ihr Verhalten überspannt, aber er spürte, dass jetzt nicht die Zeit für Widerworte war. Er rutschte vom Stuhl hinunter und zog sich in sein Zimmer zurück. Maman hatte zuweilen diese plötzlichen Wutanfälle, vor allem, wenn Papa nicht da war. In seinem Zimmer sah sich Adelbert um und nahm Abschied von seinem Spielzeug, dem er sowieso entwachsen war. Er öffnete das kleine Fenster und blickte zu den Weinbergen, auf deren Südseiten die Pinoir-Traube angebaut wurde. Das Gewitter war inzwischen nähergekommen und nahm schon den halben Himmel ein. Hinter den Weinbergen, dort wo der Himmel am dunkelsten war, lebten die Deutschen. Laut seinem Hauslehrer fehlte ihnen jede psychologische Feinheit. »Ein seltsamer Menschenschlag. Auf eine plumpe Art zynisch!« hatte er gesagt. Ihm war es wichtig gewesen, Adelbert Dinge zu erklären, die dieser von seinen Eltern niemals erfahren hätte, etwa dass die Gemeindevorsteher der umliegenden Dörfer gelacht hatten, als Papa ihnen anbot, auf die Leibeigenschaft, nicht aber auf den zehnten Teil zu verzichten. Ob sein Hauslehrer sich den Aufständischen angeschlossen hatte? Mit einem Gewehr in der Hand konnte Adelbert sich ihn nicht vorstellen. Immerhin, mit seinen beweglichen Augen wäre Monsieur Lusignan in der Lage, in zwei Richtungen gleichzeitig zu schießen. Adelbert wünscht ihm leise Glück und spürte, wie eine Träne über seine Wange kullerte.
Unten stiegen Eugène und Louise in die Kutsche, die wegen der vielen Koffer auf dem Dach wie zweistöckig wirkte. Auch Mutter trat vor das Schloss, drehte sich um und blickte zu seinem Fenster hinauf. Sie winkte nicht und rief ihn auch nicht, sondern wartete nur, so als ob sie ihm tatsächlich eine Wahl ließ, zu bleiben oder mitzukommen. Sie hatte diese Macht, für die es keine Worte brauchte. Und er, er hatte keine Wahl. Deshalb schnappte er sein Köfferchen und rannte hinunter.
Während der ersten Stunde der Fahrt interessierte er sich noch für die Umgebung. Er sah Krähen, die in ordentlichen Reihen über die Felder staksten wie schwarzbefrackte Inspektoren, und er musste an die Aufständischen denken, die er sich ähnlich uniform und gewissenhaft in ihrer Verfolgung vorstellte.
Sie fuhren unter dem Gewitter hindurch, harter Regen fiel auf das Kutschendach, und bald ermüdete ihn das gleichmäßige Prasseln. Er schlief ein und träumte von einer Welt, in der sich Erwachsene wie Kinder verhielten, und die Kinder wie Erwachsene. Eine Welt, in der die Erwachsenen kreischend über die Straßen rannten und sich prügelten, Angst hatten und sich Märchen erzählten. Und die Kinder mussten sie beruhigen.
Als er erwachte, hatten sie eine Herberge erreicht, die erste von vielen folgenden, die alle überfüllt waren und muffig nach feuchtem Schimmel und Kohlsuppe stanken. Bei Reims bekam er Fieber und sah seine Verfolger hinter jeder Hausecke, als wären sie sein eigener Schatten, den er nicht loswurde. Wer mit den Schatten kämpft, wirkt auf andere oft zerzaust. Seine Mutter strich ihm durch die Haare, legte ihm kalte Tücher auf die Stirn und gab ihm Baldrian. Er wollte die Kutsche nicht mehr verlassen, sie war seine Höhle, nur hier fühlte er sich sicher. Er hätte schwören können, dass ihn einmal, bei einer kurzen Pause in der Nähe von Verdun, ein Schatten in eine Seitengasse ziehen wollte.
In manchen Herbergen lag ein Brief von Papa für sie bereit. Noch immer gab es keine Neuigkeiten von Charles, der vielleicht ebenfalls geflohen war oder irgendwo im Gefängnis saß. Bei Longwy fuhren sie über eine Ebene voller Militärzelte, zehntausende französische Revolutionäre warteten darauf, gegen die Exilarmee aus Royalisten, also gegen Papa und Hippolyte, zu kämpfen. Adelbert schaute aus dem Kutschenfenster, sah die Kanonen und Haufen von Kanonenkugeln, während Maman schon seit Minuten die Luft anhielt. Bis zur Grenze waren es noch zehn Meilen, erst dort wären sie in Sicherheit. Er erblickte manche Soldaten, die nicht einmal eine Uniform trugen, es waren überzeugte Gegner des Königs, die sich freiwillig gemeldet hatten, und auf Adelbert wirkten sie wie aus Bilderbüchern entsprungene Freibeuter und Abenteurer. Sie ließen die Kutsche gewähren, machten sogar einen freundlichen Eindruck, und als einer von ihnen »Freiheit und Gleichheit!« rief, sagte Adelbert zu seiner Mutter, dass man vor diesen Menschen keine Angst haben müsse. Ein tadelndes Schnalzen drang durch den zerknitterten Reiseschleier seiner Mutter, die den Vorhang vors Kutschenfenster zog. Erst als sie die luxemburgische Grenze erreichten, zog sie den Vorhang wieder zurück.
Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land irrend, ohne Bindungen und fast ohne Hoffnung, gewöhnte Adelbert sich allmählich an das provisorische Leben. In Luxemburg blieben sie zwei Wochen, dann ging es weiter nach Charleroi und nach Lüttich, wo er endlich seinen Vater wiedersah. Die Exilarmee war geschlagen worden, was weder Adelbert noch Maman überraschte. Papa war zum Kämpfen nicht geeignet, er war ein Salonlöwe, der den alten, von seinem Großvater geerbten Säbel nur vorsichtig anfasste, um das kostbare Erbstück bloß nicht zu beschädigen. Die Kämpfer der Revolution dagegen, die Adelbert gesehen hatte, kamen ihm wie junge Burschen vor, die kein Erbstück und auch sonst nichts zu verlieren hatten. Das Wiedersehen wurde unter Umarmungen und Tränen gefeiert, und alle waren erleichtert, dass Papa unverletzt geblieben war. Hippolyte war in Frankreich untergetaucht, um nach Charles zu suchen.
Adelbert hatte mit seinem Vater bis jetzt nur wenig Zeit verbracht, die Etikette verhinderte größere Vertrautheiten, und selbstverständlich siezten sie sich. Wenn sie in den vergangenen Jahren einmal miteinander gesprochen hatten, war es nur um wichtige Entscheidungen der Lebensplanung gegangen. Nun aber, auf der gemeinsamen Flucht, fühlte sich Adelbert ihm so nah wie nie zuvor. In der Kutsche saßen sie beengt und mussten sich fast notgedrungen miteinander beschäftigen, spielten Karten oder unterhielten sich über Politik. Nur wenn sein Vater schlief, las Adelbert heimlich in den Büchern, die er aus der Bibliothek gestohlen hatte. Er wusste nicht, was sein Vater davon halten würde.
Da die französische Revolutionsarmee immer mehr Gebiete gewann, und weil man die Familie Chamisso nun ganz offiziell suchte, mussten sie weiter fliehen. In Düsseldorf erfuhren sie von der Enthauptung König Louis XVI. auf der Guillotine, wo auch Marie Antoinette ihr Ende gefunden hatte.
»Mit einer Österreicherin auf dem Thron musste es so kommen«, seufzte Maman, die die Leichtsinnigkeit der Königin immer missbilligt hatte. »Man hätte sie früher loswerden müssen.«
»Das geht zu weit!« rief Papa und klammerte sich an seinen Säbel. Maman hatte ihn mehr als einmal zu überreden versucht, das alte Ding zu verkaufen, aber er mochte sich nicht davon trennen. Papa rief die Familie zu einem Trauergebet für den König und die Königin zusammen, bevor er ihnen mitteilte, dass die französischen Truppen vor Düsseldorf standen und sie daher noch heute abreisen müssten.
Also ging es wieder los. Aber für Adelbert hatte das provisorische Leben auch seine Vorteile, denn die flüchtige äußere Welt lenkte ihn auf seine innere Welt zurück. In der Kutsche, auf der ruckelnden Polsterbank, konnte er hemmungslos und stundenlang träumen, konnte sich alles Wünschenswerte – einen süßen Pudding oder einen Waldspaziergang mit Monsieur Lusignan – einfach vorstellen. Er wurde geradezu süchtig nach diesen phantastischen Erfüllungen, sie ersetzten ihm die Wirklichkeit fast vollständig. Manchmal konnte er es kaum erwarten, wieder in die Kutsche zu steigen und seine Augen zu schließen. Danach stellte sich immer das Gefühl ein, die Wirklichkeit hintergangen zu haben, auch fand er es eigentlich dumm. Und wie zur Strafe, als ob er sein Inneres überbeansprucht hätte, hörte er eines Nachts in einer Herberge ein Pfeifen im linken Ohr, das nicht fortging. Er wälzte sich im Bett und konnte nicht wieder einschlafen. Auch in den folgenden Nächten kehrte das Pfeifen zurück, Adelbert entkam ihm nicht und haderte mit seinem Pech: Gerade der Empfindliche fängt sich oft das Unwahrscheinlichste ein.
Sie fuhren wochenlang das Rheintal aufwärts. Deutsche lernte Adelbert dabei nur flüchtig, auf der Durchfahrt, kennen. Sie kamen ihm mürrisch vor, und ihre Sprache klang trocken wie Peitschenschläge. In einer Poststation schenkte man den Kindern braunes Packpapier, darauf zeichnete Adelbert die Felsen und das Flussufer. Maman unterrichtete ihn in Architektur, indes Papa ihm und seinen Geschwistern die Grundlagen der Ballistik beibrachte. Sie gaben sich Mühe, aber es war nicht dasselbe wie mit Monsieur Lusignan. Der Blick seiner Eltern auf die Welt war eben aristokratisch, und dem Adel ging es nicht um Erkenntnis und Wandel, sondern um Repräsentation und Dauer. So erklärte Papa einmal das Rheintal nicht als Ergebnis erdgeschichtlicher Korrosionen, sondern als ewigwährende, natürliche Grenze des französischen Hoheitsgebiets.
Eines Tages akzeptierten die deutschen Bäcker ihr französisches Geld nicht mehr, weil es eine Währungsreform gegeben hatte. Während Maman mit einem Bäcker verhandelte, wartete Adelbert draußen vor dem Haus. Er nahm eines der James-Cook-Bücher aus dem Koffer und setzte sich ans Wagenrad, gerade als sein Vater sich aus dem Fond beugte.
»Ist das mein Buch?«
Adelbert nickte verlegen. »Ich wollte es nicht zurücklassen.«
»Das hast du gut gemacht.«
Von da an lasen sie gemeinsam in den Reiseberichten und sprachen darüber, und das weckte sogar bei seinem Vater Neugier auf eine sich wandelnde Welt.
Als Preußen im April 1795 Frieden mit Frankreich schloss, war die Familie endlich in Sicherheit, und ihre Reise nahm in Bayreuth ein vorläufiges Ende. Im Frieden von Basel trat Preußen das linke Rheinufer an die französische Republik ab. Aber das waren Dinge, die Adelbert wenig interessierten. Er zeichnete und schrieb das eine oder andere Gedicht auf Packpapier, er redete mit Papa über ferne Länder, er träumte tagsüber und bezahlte das Träumen mit nächtlichem Ohrenpfeifen, von dem er seinen Eltern nichts verriet, weil es ihm wie eine Strafe vorkam. Da war etwas in ihm, das sich gegen ihn selbst wandte, etwas Fremdes, eine Nacht in der Nacht.
Die Packpapierblätter mit den Zeichnungen verlor er später, so wie er Jahre später auch seine französische Staatsangehörigkeit verlor. Er wurde ein Ruheloser, sein Schicksal war seltsam, und manche suchen den Grund dafür in dieser ersten Flucht.
Venus und Amor
Wie – zut alors – mimte man einen Franzosen? Das fragte sich Adelbert an einem Frühlingstag des Jahres 1796, als er neben dem Lieblingspferd der preußischen Königin darauf wartete, seinen Platz in einem Lebenden Bild einzunehmen. Er war Königin Friederike Louises Leibpage geworden, und deren zweitliebster Zeitvertreib bestand nun einmal darin, durch ein ›Bilderbuch der Welt‹ zu wandeln, wie sie es auszudrücken pflegte. Adelbert hatte bisher schon einen Amor, einen Tisch, ein Kätzchen zu Füßen Kleopatras und eine Cumuluswolke dargestellt, aber noch nie einen Franzosen.
Das Pferd neben ihm spürte seine Unsicherheit und wurde nun gleichfalls unsicher, schnaufte und trat auf der Stelle, indes Adelbert immer wieder zur offenen Stalltür blickte. Draußen, an einem der Bäume am Spreeufer, lehnte eine Leiter, die sich nun bewegte und auf ihn zuwackelte.
Nach ihrer Flucht hatte die Familie Chamisso ein Jahr in Bayreuth verbracht, wo Maman, Eugène und Louise in einer Papierblumenmanufaktur arbeiteten. Papa dagegen saß oft in Wirtshäusern herum, angeblich, um mit anderen Emigranten Pläne zur Rückeroberung Frankreichs zu schmieden. Adelbert war zu einem Tischler in die Lehre gegeben worden, lernte dadurch als erster der Familie Deutsch, und vielleicht wäre sogar ein guter Tischler aus ihm geworden, hätte sein Vater diesen Beruf nicht eines Chamissos’ unwürdig empfunden. Sie zogen nach Berlin, wo es von Franzosen nur so wimmelte. Mehr als Fünftausend, die meisten adlig, lebten in der Stadt. Seine Schwester Louise wurde zweite Vorleserin im Schloss Bellevue, wo auch sein Bruder Eugène unterkam. Adelbert landete im Schloss Monbijou, auf der anderen Spreeseite.
Im hellen Rechteck der Stalltür erschien ein Kopf mit blonden Zöpfen und rosigen Wangen, er gehörte Wilhelmine von Klenke, einer jungen Zofe der Königin. Der Rest ihres schlanken Körpers steckte in einem grauen Leiterkostüm.
»Bist du bereit?« fragte sie. »Sie kommt gleich.«
»Ich hab’ wirklich keine Ahnung, wie ich einen Franzosen darstellen soll!« Adelbert drückte seinen Brustkorb vor und winkte mit seiner Hand. »So?«
»Was soll das sein? Ein Truthahn auf der Balz?«
Er hüpfte wie ein französischer Pierrot auf einem Bein, bis das Pferd neben ihm schnaufte und Adelbert ihm beruhigende Worte in Ohr flüstern musste. Noch schlimmer, als die Königin bei einem Lebenden Bild zu enttäuschen, war, ihr Lieblingspferd scheu zu machen.
»Das ist auch kein Franzose«, sagte Wilhelmine.
»Wie benimmt sich denn ein Franzose?«
Wilhelmine fuhr mit ihrem Zeigefinger quer über ihren Hals. »Ihr köpft eure Könige.«
»Unmöglich.«
»Es heißt, Frankreich ist jetzt so frei, man kann dort köpfen lassen wen man will.«
»Das hilft mir nicht weiter.«
»Sei einfach du selbst. Sei froh, dass du keine Leiter spielen und die ganze Zeit so unschicklich breitbeinig dastehen musst. Wenigstens hab’ ich was zu lesen dabei.« Sie holte ein Buch hervor und blätterte darin. »Ich wollte dich etwas fragen. Was bedeutet der Satz ›Alles ist ein Gleichnis‹?«
»Er bedeutet, dass es das Echte nicht gibt.«
Wilhelmine klappte das Buch empört zu. »Das ist so eine französische Antwort! Wer nicht ans Echte glaubt, glaubt nicht an natürliche Grazie und auch nicht an die Monarchie!« Sie warf ihm das Buch vor die Füße, wodurch das Pferd erschreckte, nach hinten austrat und mit dem Huf die Holzwand traf. Adelbert hängte sich mit seinem ganzen Gewicht an den Zügel, aber leider wog er nicht viel. Das Pferd bäumte sich auf, Wilhelmine erschrak und rannte fort. Kurz darauf kam sie mit dem Pagenhofmeister Gabler zurück, der das Pferd mit einer einzigen Geste beruhigte und Adelbert ausschimpfte. Plötzlich knallte Gabler seine Stiefelabsätze gegeneinander. »Eure Exzellenz!«
Wilhelmine lehnte sich leiterartig gegen die Stallwand, als die Königin, begleitet von ihren Zofen, eintrat ein. Sie war rundlich, wirkte wie eine große, zitronengelbe Blüte auf zwei Beinen und war immer unglücklich, weil der König sie in Monbijou versauern ließ, während er sich im Stadtschloss mit seinen Mätressen amüsierte.
Adelbert erstarrte. Da er sich selbst nicht vertraute, schwieg er. Wie Wilhelmine es ihm geraten hatte, war er nun – notgedrungen – einfach er selbst.
»Wie viel Philosophie er besitzt! Ein richtiger kleiner Voltaire!« sagte die Königin und applaudierte in ihrer porzellanenen Vornehmheit mild, ohne dass sich ihre Hände berührten, und ihre Zofen taten es ihr gleich. Adelbert war erleichtert. Aber statt sich mit seiner gelungenen Darstellung zufrieden zu geben, und weil die Launen des Gemüts noch seltsamer sind als die Launen der Macht, wurde er übermütig und rief: »Wir in Frankreich sind jetzt so fortschrittlich, sogar die Guillotine hat einen Blitzableiter!«
Pagenhofmeister Gabler und auch die Zofen schnappten nach Luft. Wilhelmine, mit rotem Kopf an der Stallwand lehnend, rollte mit den Augen. Niemand erkühnte sich, zur Königin zu blicken, und kurz bot die kleine Gesellschaft in ihrer Erstarrung wahrhaftig ein lebendes Gemälde.
»Ja«, seufzte die Königin, »in Frankreich betreibt man nun Experimentalpolitik. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.« Dann wandte sie sich ab, nicht ohne Adelbert ein Zeichen zu geben, ihr zu folgen.
Die Wahrheit war, dass die Königin ihn mochte, fast egal, was er tat. Er folgte ihr ins Schloss, durch prunkvolle Säle, in denen die Königin wie immer die Tapisserien beklagte, die nicht der neuesten Mode entsprachen, und über die Stoffe ihrer Kleider jammerte, die nur zweite Wahl seien, weil der König sie vernachlässige. Adelbert stellte sich vor, wie sie mit dem Schneider um einen Sonderpreis feilschen würde. Wie würde sich ein armer Schneider in diesen Gemächern fühlen?
Und wie fühlte sich Adelbert? Auch er war eigentlich arm dran. Er lebte mit seiner Familie in einer kleinen Mietwohnung und sein Ohrensausen verdross ihn nicht mehr nur nachts, sondern hatte sich zur dauerhaften Beschallung ausgeweitet. Besonders laut wurde es, wenn Adelbert sich in falschen Situationen befand, was am Hof andauernd der Fall war. Seine Eltern blieben den ganzen Tag zu Hause, sie lebten von Zuwendungen befreundeter Exilanten und gaben sich keine Mühe, in Berlin heimisch zu werden. Sie klagten über deutsches Wetter und deutsches Essen; eigentlich aßen sie nur noch, um den Wein nicht auf leeren Magen zu trinken. Wenn Adelbert abends nach Hause kam und seine Pagenuniform ablegte, schlüpfte er manchmal in die zu kleinen Kleider aus Kindertagen, bloß um seinen Eltern eine Freude zu bereiten. Oder er fragte sie Dinge über die Heimat, die er eigentlich schon wusste, um sie ein wenig in besseren Zeiten schwelgen zu lassen. An seinen freien Sonntagen ging er durch die endlosen Straßen Berlins, melancholisch, einsam, aber unfähig, seine Lage zu ändern oder mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
»Komm her, du dummer keiner Franzmann!« Die Königin hatte sich vor einen goldgerahmten Spiegel gesetzt und die Schuhe von ihren Füßen gestreift. Adelbert hockte sich neben sie und ließ sich sein schulterlanges Haar kraulen.
»Gefällt dir Wilhelmine?«
»Ich weiß nicht.«
»Sie ist schön, und du bist ein schöner junger Mann.«
»Ach nein.«
Er wusste wirklich nicht, ob Wilhelmine ihm gefiel. Er fand sie ein bisschen harmlos, und er hatte das Gefühl, dass er sich in ihrer Gegenwart ebenfalls verharmloste, dass sein Reden harmlos wurde, nur damit sie ihn verstand.
Und was gab es Harmloseres, als das Schoßhündchen einer Königin zu sein? Ekel überkam ihn, und er wand sich unter der Hand seiner Gönnerin. »Gefällt dir das? Soll Wilhelmine kommen?«
Adelbert ahnte, worauf das hinauslief, auf ein ganz spezielles Lebendes Bild, eine Aufführung mit allein der Königin als Zuschauerin und mit ihm und Wilhelmine als Daphnis und Chloé.
»Eigentlich kann ich sie nicht leiden«, sagte er. »Sie wirft Bücher fort, nur weil ihr Sätze darin nicht gefallen.«
Die Königin lachte, drehte sich zum Spiegel und betrachtete ihr Profil. »Versprich mir nur, dass du sie nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, sobald sie die Form einer Kartoffel hat.«
»Sehr wohl, Eure Exzellenz.«
»Und jetzt wechsle deine Sachen, du riechst nach Pferdestall.«
Nachdem die Königin ihn auf Wilhelmine aufmerksam gemacht hatte, schaute er sie sich genauer an, und dafür eignete sich der gemeinsame Musikunterricht bei Pagenhofmeister Gabler besonders gut. Um die Königin angemessen zu unterhalten, mussten die Zofen und Pagen ein Instrument spielen können, wofür Adelbert leider jegliches Talent fehlte. Gabler hatte ihm mit spöttischem Grinsen die Bratsche zugeteilt, deren Name verdächtig nach Watsche klang. Adelbert mochte dieses Instrument nicht und spielte wahrscheinlich deshalb so schlecht darauf.
Der Musikunterricht fand in einem Seitenflügel des Schlosses möglichst weit weg von den empfindlichen Ohren der Königin statt, wo Gabler, mit einem Taktstock dirigierend, die Anweisung »Bratsche! Jetzt!« so derb in Adelberts Richtung schleuderte, dass es sich jedes Mal wie ein Schlag in Adelberts Gesicht anfühlte. Oft verstand er Gablers Deutsch auch einfach nicht. Oder wollte er es nicht verstehen? Aus Angst, mit dem Verständnis zu tief in Gablers Kopf einzudringen? Gablers Welt war nämlich klein, der Pagenhofmeister hatte kein Gefühl für die Schönheit eines Gedichts und keinen Sinn für Ironie; eine Gavotte oder Passacaille schritt er ab wie eine geometrische Aufgabe.
Neben Adelbert saß Wilhelmine. Sie hielt ein Cello zwischen den Knien und wiegte es hin und her, fast als liebkoste sie ihr Instrument. Adelbert sah ihr aus dem Augenwinkel zu, ein wenig eifersüchtig. Wie alle Zofen trug sie ein Kleid im englischen Stil, vorn mit Haken und Ösen verschlossen. Ihre aufgetürmte Frisur war mit Perlen und Federn dekoriert, und sogar ein kleines Schiffsmodell schaute halb aus den Haarwellen heraus. Er bemerkte erst jetzt, dass Wilhelmine zarte Sommersprossen auf der Nase hatte, nur leider verzog sie vor lauter Konzentration das Gesicht zu einer Grimasse. Das wollte Adelbert nicht sehen, er schloss seine Augen, hörte so die Sonate viel intensiver und stellte sich dabei Wilhelmine vor. Er strich den Bogen leidenschaftlich über die Seiten und merkte erst spät, dass die anderen ihr Spiel unterbrochen hatten. Als er seine Augen öffnete, erschrak er, denn über Wilhelmines Gesicht kullerten Tränen.
»Du spielst so gefühlvoll heute«, sagte sie.
»Papperlapapp«, bellte Gabler, »als Franzose wird er es nie zu wahrer Meisterschaft bringen. Die Bratsche ist gerade recht für ihn, sie bleibt im Hintergrund, fast als schämte sie sich für ihre Hässlichkeit.«
»Ein Jammer«, murmelte er.
»Die Musik als Kunstform ist den tiefsinnigen Deutschen vorbehalten, Franzosen sind dafür viel zu skrupellos. Ein Franzose würde mein Haus verbrennen, nur um sich zwei Eier zu kochen.«
»Das würde ich nicht!«
»Dann sind Sie ein falscher Franzose, was noch schlimmer ist als ein echter!«
Wilhelmine war dem Schlagabtausch mit so heftigen Wendungen ihres Kopfes gefolgt, dass das Modellschiffchen aus der Frisur kippte. Sie hob es auf, steckte es sich geschickt wieder in die Haarwellen und kam Adelbert zu Hilfe. »Und Sie, Herr Gabler, sind ein fürchterlicher Menschenfeind!«
»Bin ich nicht, ich habe nur einen guten Geschmack.«
Als sie das Musikstück erneut probten, versuchte Adelbert besonders tiefsinnig und besonders deutsch zu klingen. Seine Fingerkuppen schmerzten, so fest drückte er auf die Saiten, fast als könnte er den Tiefsinn aus seinen Fingern herauspressen. Allerdings fühlte er sich von Gabler und Wilhelmine beobachtet, und wie immer, wenn jemand besondere Erwartungen in ihn setzte, wurde er melancholisch und verlor jede Lust. Er bracht ab und hieb, um dem Abbruch einen Sinn zu verleihen, mit dem Bogen nach einer nicht vorhandenen Fliege.
»Sehen Sie«, rief Gabler, »schon ist es wieder nur so ein französisches Einerlei! Diesem Volk fehlt das Talent zur Konzentration!«
»Du hast wirklich wie ein Bauer gespielt«, sagte Wilhelmine.