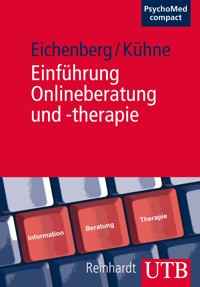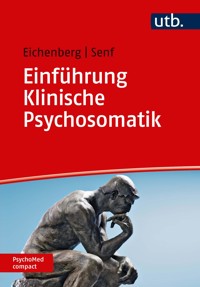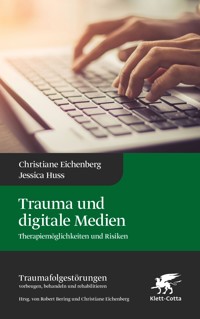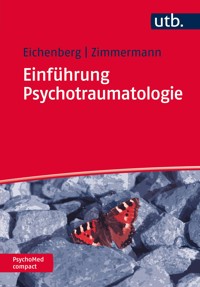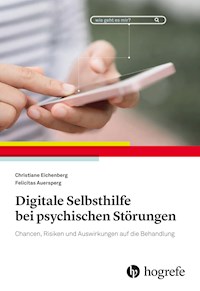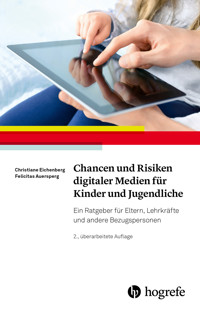
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Digitale Medien haben in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen eine hohe Bedeutung. Dabei gehen mit der Nutzung moderner Medien sowohl Chancen als auch Risiken einher. Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen stehen vor der Herausforderung, die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen konstruktiv zu fördern. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn Erwachsene wissen, was Heranwachsende heute im Internet bzw. mit ihrem Smartphone tun. Die Neubearbeitung des Ratgebers gibt zunächst einen Überblick über die Nutzungspraxis verschiedener Medien: Welche Medien werden heute von Kindern und Jugendlichen zu welchem Zweck und vor allem mit welchen Effekten genutzt? Anschließend werden aus entwicklungspsychologischer Perspektive die Potenziale moderner Mediennutzung für die Bereiche Identitätsentwicklung, Aufbau und Pflege sozialer Beziehungen, Lernen, Spielen, Informationsaustausch und Meinungsbildung sowie zur Unterstützung bei typischen Problemen im Jugendalter dargestellt. Den Chancen, die mit der Nutzung digitaler Medien verbunden sind, werden mögliche Risiken durch exzessive, dysfunktionale, selbstschädigende und deviante Nutzungsweisen gegenübergestellt (z.B. Internetsucht, Informationsüberflutung, Cybermobbing, sexuelle Gewalt). Auf der Basis wissenschaftlicher Befunde werden konkrete Hilfestellungen in Form von Checklisten, Fallbeispielen und Verhaltenstipps zum Umgang mit modernen Medien gegeben. Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen erhalten in diesem Ratgeber altersspezifische Hinweise für eine sinnvolle Vermittlung von Medienkompetenz in Familie und Schule.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christiane Eichenberg
Felicitas Auersperg
Chancen und Risiken digitaler Medien für Kinder und Jugendliche
Ein Ratgeber für Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen
2., überarbeitete Auflage
Prof. Dr. Christiane Eichenberg, geb. 1973. Studium der Psychologie in Köln. 2006 Promotion. 2010 Habilitation. 2013 – 2016 Professorin für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Medien an der Psychologischen Fakultät der Sigmund Freud PrivatUniversität, Wien. Seit 2016 Leiterin des Instituts für Psychosomatik an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud PrivatUniversität, Wien. Forschungsschwerpunkte: Schnittstellen von Psychologie und Internet; E-Mental-Health, Psychotraumatologie, Psychosomatik.
Dr. Felicitas Auersperg, geb. 1989. 2008 – 2013 Studium der Psychologie in Wien. 2013 – 2014 Universitätsassistentin am Lehrstuhl für Innovationsmanagement an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Seit 2014 Universitätsassistentin an der Psychologischen Fakultät der Sigmund Freud PrivatUniversität, Wien. Forschungsschwerpunkte: Sozialkognition, Schnittstelle von Psychologie und Soziologie.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / pressureUA
Satz: Michael Kleine, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2024
© 2018, 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3209-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3209-1)
ISBN 978-3-8017-3209-7
https://doi.org/10.1026/03209-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Bedeutung digitaler Medien in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
1.1 Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
1.1.1 Zur Verfügung stehende Medien
1.1.2 Nutzungsgewohnheiten
1.2 Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
2 Chancen digitaler Medien für Kinder und Jugendliche
2.1 Identitätsentwicklung
2.1.1 Selfies
2.1.2 Selbstdarstellung als Ausdruck der Persönlichkeit
2.1.3 Gefahren digitaler Selbstdarstellung
2.1.4 Positive Effekte der Selbstdarstellung im Internet
2.2 Soziale Kompetenzen und Beziehungen
2.3 Lernen
2.3.1 Wissensbezogene Inhalte
2.3.2 Filtersoftware
2.3.3 Kindergarten
2.3.4 Grundschule
2.3.5 Weiterführende Schulen
2.3.6 Gesundheitsbezogene Inhalte
2.4 Spielen
2.4.1 Warum Kinder spielen
2.4.2 Serious Gaming
2.4.3 Gewalt am Bildschirm
2.4.4 Kreativität und digitale Medien
2.5 Informationsaustausch und Meinungsbildung
2.5.1 Filterbubbles
2.5.2 Das Internet und der Abbau von Vorurteilen
2.6 Psychosoziale Hilfestellung bei typischen Problemen im Jugendalter
2.6.1 Selbsthilfeforen
2.6.2 Sexualität und Aufklärung im Internet
3 Risiken digitaler Medien für Kinder und Jugendliche
3.1 Fünf Risikobereiche
3.1.1 Exzessive Nutzungsweisen: Internetsüchte
3.1.2 Dysfunktionale Nutzungsweisen: Informationsüberflutung, Cyberchondrie & Co
3.1.3 Selbstschädigende Nutzungsweisen: Suizid-Foren, Ritzer-Seiten und Pro-Ana-Bewegung
3.1.4 Deviante Nutzungsweisen: Cybermobbing, Cyberstalking und sexuelle Gewalt
3.1.5 Jugendgefährdende Inhalte – Beispiel Politischer Extremismus
3.2 Interventionsmöglichkeiten bei Online-Sucht und Cybermobbing
3.2.1 Therapeutische Aspekte im Umgang mit Online-Sucht
3.2.2 Interventionsmöglichkeiten bei Cybermobbing
3.2.3 Präventive Maßnahmen
4 Medienkompetenz sinnvoll vermitteln
4.1 Medienkompetenz in der Familie
4.1.1 Strategien zur Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern
4.1.2 Strategien zur Vermittlung von Medienkompetenz bei Jugendlichen
4.1.3 Mediennutzung und intergenerationale Konflikte in der Familie
4.2 Medienkompetenz in der Schule
4.2.1 Konzepte zur Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern
4.2.2 Konzepte zur Vermittlung von Medienkompetenz bei Jugendlichen
4.3 Fazit
Literatur
Anhang
|7|1 Bedeutung digitaler Medien in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
Das Leben von Kindern und Jugendlichen ist heute untrennbar mit der Nutzung von und der Einflussnahme durch digitale Medien verbunden. Für alltägliche Aktivitäten, Freizeit, Schule oder Beruf steht ihnen ein gewaltiges Informationsnetz zur Verfügung, das mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Die Kompetenz, mit der überwältigenden Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten umgehen zu können, ist unverzichtbar – sowohl für das Schul- und Berufsleben als auch für das Privatleben. Somit fällt Eltern und anderen an der Erziehung beteiligten Personen die entscheidende Aufgabe zu, Kinder und Jugendliche früh damit vertraut zu machen und Fähigkeiten zur sicheren und effizienten Nutzung zu vermitteln. Gelingt diese Vermittlung im Rahmen der Entwicklung von Medienkompetenz, ist sie als „Skill“ für nahezu alle Bereiche des Lebens von unschätzbarem Wert. Neben der häufig zitierten Vereinfachung bzw. Vervielfältigung der Kommunikation leisten digitale Medien große Beiträge zur Wissenschaft und Forschung, zu Kunst und Kultur sowie zur Wirtschaft. Auch die Bereiche Bildung und Unterhaltung, d. h. Lernen und Spielen, wurden und werden durch den Einsatz und die Entwicklung digitaler Medien verändert. Kinder wachsen mit dieser Bandbreite an Möglichkeiten wie selbstverständlich auf und denken dabei nur selten darüber nach, welche Gefahren neben all diesen Chancen in der Nutzung digitaler Medien liegen. Das auf diese Art ausgesparte Thema wird umso intensiver von besorgten Eltern und Bezugspersonen aufgegriffen, da diese meistens nicht in einer digitalisierten Welt aufgewachsen sind und sich die sogenannte „Kindheit 2.0“ daher kaum vorstellen können.
In diesem Ratgeber soll auf häufige Fragen und Sorgen von Eltern, Lehrkräften und anderen Bezugspersonen eingegangen werden, ohne die spielerische und selbstverständliche Herangehensweise der Kinder und Jugendlichen dabei zu vernachlässigen oder zu unterschätzen. Bereits sehr früh entwickeln Kinder heute Strategien und Verhaltensmuster im Umgang mit digitalen Medien. Die sogenannten „digital natives“ sind im Gegensatz zu ihren Eltern mit den Möglichkeiten des Internets aufgewachsen und sind Erwachsenen in der Nutzung oftmals weit überlegen. Die Pflicht der Erwachsenen ist es nun, mindestens ebenso kompetent |8|mit digitalen Medien umgehen zu können, einerseits um nachvollziehen zu können, was ihre Kinder beispielsweise im Internet und mit ihren Smartphones heute so tun, andererseits um ihren Kindern in problematischen Situationen zur Seite stehen zu können. Diese Kompetenz zu erlangen ist allerdings eine Herausforderung, weil es inzwischen eine Vielzahl digitaler Medien gibt, die unseren Alltag mit unterschiedlichen Anwendungen begleiten (vgl. Kapitel 1.1).
1.1 Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
Die unterschiedlichen Formen digitaler Medien prägen somit unser Leben und sind fester Bestandteil unseres Alltags. Wir lassen uns vom individuell gewählten Ton unseres Handyweckers aus dem mittels App überwachten Schlaf reißen, lesen noch im warmen Bett die ersten E-Mails am Tablet und lachen beim morgendlichen Kaffee über eine witzige Facebook-Nachricht der Kollegin. Kommunikation, Information, Unterhaltung – Lebensbereiche, die bei den meisten Personen von digitalen Medien beherrscht werden. Die tatsächlichen Nutzungsmuster sind hierbei allerdings sehr unterschiedlich. Selbst, wenn zwei Personen, wie gerade geschildert, mit den gleichen Geräten ihren Tag beginnen, kann dieser Tagesbeginn sehr unterschiedlich aussehen. Ihr individuelles Nutzungsverhalten hängt von ihren persönlichen Vorlieben, ihren Nutzungsmotiven, Besonderheiten des spezifischen Milieus sowie der Peergroup ab, der sie angehören, und nicht zuletzt von ihrem Alter. Das Fernsehen wurde in der Vergangenheit bereits unter den verschiedensten Blickwinkeln von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen untersucht. Die ständige Entwicklung technischer Innovationen eröffnet ein Forschungsfeld, das nie stillsteht und das immer neue Fragen aufwirft. Hierbei ist insbesondere die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit gerückt. Allerdings konzentriert sich die Darstellung der Medienwelt von Kindern und Jugendlichen meist auf potenzielle Gefahren und vernachlässigt dabei die damit verbundenen Möglichkeiten. Den Risiken aber auch den Chancen digitaler Medien widmen sich Kapitel 2 und 3 dieses Buches. Zunächst sollen aber die Besonderheiten des Medienalltags von Kindern und Jugendlichen aufgedeckt werden. Nur wenn wir die tatsächlichen Gewohnheiten der |9|mit digitalen Medien aufwachsenden Generation kennen, sind wir in der Lage, Problemfelder und Irrtümer zu identifizieren aber auch die Potenziale digitaler Medien für den Nachwuchs auszuschöpfen.
1.1.1 Zur Verfügung stehende Medien
So wie die Welt ihrer Eltern ist auch die Welt von Kindern und Jugendlichen von Medien durchdrungen. In Deutschland wird das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen besonders detailliert in zwei großen Langzeitprojekten erforscht: Die KIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, die sich bereits seit 1999 mit dem Stellenwert neuer Medien im Leben der 6- bis 13-Jährigen beschäftigt (Feierabend et al., 2022b), und die ebenfalls vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest initiierte JIM-Studie (Feierabend et al., 2022a), eine im jährlichen Turnus durchgeführte Basisstudie zum Medienumgang von 12- bis 19-Jährigen. Der KIM-Studie zufolge wachsen 6- bis 13-Jährige in Deutschland mit zahlreichen stets verfügbaren Medien auf: Beinahe alle befragten Haushalte verfügen über Geräte, die Kindern den Zugang zu Medien ermöglichen: Fernsehgeräte (100 % der befragten Haushalte), Smartphones (97 %), Computer/Laptops (63 % und 82 %) und einen Internetzugang (99 %). Gut 80 % der befragten Haushalte besitzen Radiogeräte und Drucker. Smart-TVs und Streamingdienste sind in etwa drei von fünf Haushalten verfügbar. Auch Geräte wie Spielkonsolen und Digitalkameras stehen etwa in der Hälfte der befragten Haushalte zur Verfügung. Die Kinder nutzen diese Geräte mit, sind aber nur selten ihre Besitzer. Von den genannten Geräten befindet sich am ehesten das Smartphone im persönlichen Besitz des Kindes: Laut Angaben der befragten Eltern verfügen bereits 58 % der Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren über ein eigenes Smartphone. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Prozentsatz (eigener Besitz) zwar nicht nur in Bezug auf Smartphones, sondern auch in Bezug auf Fernsehgeräte, Laptops, Spielkonsolen, Tablets und den Zugang zu Streamingdiensten. Dabei zeigt sich ein deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied: Jungen verfügen häufiger über Spielkonsolen: 25 % der Jungen (aber nur 13 % der Mädchen) besitzen feste (nicht tragbare) Spielkonsolen und 32 % der Jungen (hingegen 24 % der Mädchen) besitzen tragbare Spielkonsolen. Noch 2014 ließen sich deutlichere geschlechtsspezifische Medienausstattungen beobachten (|10|Feierabend et al., 2014). Damals waren Jungen meist umfangreicher ausgestattet als Mädchen. Dies lag vermutlich an Stereotypen zur Medienkompetenz von Männern und Frauen, die sich auf das Kaufverhalten der Eltern und damit auf das zur Verfügung stehende Medienrepertoire der Kinder ausgewirkt haben. Möglicherweise lässt sich anhand der sich angleichenden Nutzungs- und Besitzprofile ein Aufweichen dieser Stereotype beobachten.
In den letzten Jahren verzeichnet die KIM-Studie einen deutlichen Zuwachs von Fernsehgeräten mit Internetzugang, Streamingdiensten, Pay-TV-Abonnements und Tablets. Fast alle (99 %) der befragten Haushalte verfügen über einen Internetanschluss und die meisten 6- bis 13-Jährigen wachsen mit einer Vielzahl internetfähiger Geräte wie Computern, Tablets oder Smartphones auf. Gut ein Fünftel der erfassten Kinder kann im eigenen Zimmer das Internet nutzen.
Auch Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren wachsen mit einer breiten Ausstattung an Medien auf. In beinahe allen Haushalten, in denen Personen dieser Altersgruppe leben, sind Handys oder Smartphones (99 %), Computer oder Laptops (97 %) und Fernsehgeräte (96 %) vorhanden. Dabei steigt vor allem die Zahl der Haushalte mit Smart-TV an (2021: 69 %; 2022: 81 %). Von den erfassten Haushalten verfügen 80 % über ein Radiogerät, 77 % über ein Tablet und eine Spielkonsole. Wearables, wie beispielsweise Smartwatches, sind in jedem zweiten Haushalt vertreten, 41 % der Familien setzen Smart Speaker wie Alexa oder Google Home ein und 37 % der befragten Haushalte sind im Besitz eines E-Book-Readers. Medienabonnements spielen im Leben Jugendlicher ebenfalls eine wichtige Rolle: 84 % der befragten Jugendlichen können zu Hause auf einen Dienst wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ zugreifen. Musik-Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder YouTube Music sind für 76 % der befragten Jugendlichen verfügbar. Geht es um den persönlichen Besitz, so steht das Smartphone bei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren an erster Stelle: 96 % der Befragten verfügen über ein eigenes Smartphone, 58 % der Jugendlichen besitzen einen Laptop und 35 % einen Stand-PC. Von den befragten Jugendlichen haben 58 % ein Fernsehgerät als Teil ihrer Zimmereinrichtung, 51 % besitzen ein Tablet, 61 % eine Spielkonsole, 35 % ein eigenes Radio und 28 % eigene Wearables wie beispielsweise Smartwatches (Feierabend et al., 2022a).
|11|1.1.2 Nutzungsgewohnheiten
Digitale Medien gehören für die meisten Kinder zum Alltag und prägen ihre Freizeit stark mit. Im Tagesverlauf zeigt sich, dass Fernsehen und Hausaufgaben etwa gleich viel Zeit der Woche in Anspruch nehmen, jeweils 67 % der Befragten geben an, diesen Aktivitäten jeden Tag nachzugehen. Beinahe jedes zweite Kind gibt an, täglich mit dem Handy zu spielen. Mit zunehmendem Alter nutzen immer mehr Kinder digitale Medien, wobei der deutlichste Anstieg im Altersverlauf beim Einsatz von Mobiltelefonen (6 bis 7 Jahre: 28 %; 12 bis 13 Jahre: 96 %) sowie bei der Internetnutzung (6 bis 7 Jahre: 21 %; 12 bis 13 Jahre: 92 %) zu bemerken ist. Das Aufzeichnen eigener Videos und Fotos nimmt ebenfalls deutlich zu (mehr dazu in Kapitel „Instragram, TikTok und Co – soziale Netzwerke im Detail“ auf Seite 27). In der KIM-Studie ist zu lesen, dass sich der kontinuierliche Anstieg bei den Internetnutzungen – außer in der jüngsten befragten Altersgruppe – nicht fortsetzt, und dass die Frage, ob nun eine Sättigungsgrenze erreicht ist, erst durch nachfolgende Studien beantwortet werden kann.
Die Nutzungsfrequenz des Inte5,rnets hat sich zwischen 2020 und 2022 erhöht, insbesondere bei 10- bis 13-jährigen Kindern: 72 % der befragten 12- und 13-Jährigen nutzen das Internet täglich (Feierabend et al., 2022b). Die durch WLAN und Smartphone ermöglichte immer privatere Nutzung des Internets wirft bei vielen besorgten Eltern und Lehrkräften die Frage auf, womit sich Kinder und Jugendliche im Internet eigentlich beschäftigen. Zwar stellen populäre Medien den Abruf jugendschutzrelevanter Inhalte (vgl. Kapitel 3.1.5) sowie sexualbezogene Nutzungsformen, wie z. B. Sexting (vgl. Kapitel 3.1.4), und die damit verbundenen Gefahren oft in den Vordergrund, das Hauptinteresse jugendlicher Internetnutzerinnen und -nutzer besteht jedoch laut JIM-Studie in der Kommunikation (Feierabend et al., 2022b). Der Austausch mit Gleichaltrigen ist ein wichtiges Element der Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung. Welche Plattform dafür genutzt wird, ist unerheblich und ändert sich im Laufe der Zeit. Digitale Medien bieten eine Vielfalt facettenreicher Möglichkeiten, die uns heute zur Kommunikation mit anderen zur Verfügung stehen. Die sich im Moment sehr schnell verändernde Medienlandschaft wird von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich flexibel angenommen. Kinder und Jugendliche adaptieren die Veränderungen von Medien besonders schnell, da diese zu ihrem Lebensalltag gehören und als selbstverständlich empfunden werden. Insbesondere |12|Jungen und männliche Jugendliche neigen dazu, innovative Medien schnell aufzugreifen (Feierabend et al., 2022b).
Mit der Aneignung neuer Medienentwicklung verändert sich die Häufigkeit, mit der digitale Medien genutzt werden (Klingler, 2008). Für alle befragten Altersgruppen der KIM-Studie 2022 ist die Kommunikation über WhatsApp besonders relevant, wenn es um die alltägliche Nutzung des Internets geht. Gut die Hälfte (55 %) der Kinder, die auf das Internet zugreifen, nutzt den Kommunikationsdienst täglich. Filme, Videos und Serien werden ebenfalls täglich konsumiert, dicht gefolgt von Suchmaschinen und TikTok (Feierabend et al., 2022b). Über ein Drittel (38 %) der befragten Kinder gibt an, mindestens wöchentlich online Musik zu hören, 36 % nutzen speziell für Kinder entwickelte Websites. Ein Viertel der Befragten nutzt Wikipedia und Instagram, etwa jedes fünfte Kind nutzt Snapchat, Facebook oder versendet E-Mails. Über das Internet hören 13 % der befragten Kinder Radio, 11 % nutzen Skype, Zoom oder Teams. Das Live-Streaming-Videoportal Twitch wird von 6 % der Befragten verwendet. Mit zunehmendem Alter der Befragten steigen auch die Nutzungszahlen in allen genannten Bereichen. Ein besonders rasanter Anstieg ist bei der Plattform TikTok zu beobachten: Unter den Sechs- bis Siebenjährigen nutzen 11 % TikTok, unter den Acht- bis Neunjährigen sind es bereits 24 %, unter den Zehn- bis Elfjährigen sind es 39 % und unter den Zwölf- bis Dreizehnjährigen 53 %.
Eltern schätzen, dass ihre Kinder an einem Wochentag durchschnittlich 43 Minuten online sind. Die Nutzungszeit von Jungen wird dabei als geringfügig länger angenommen (46 Min.) als die der Mädchen (41 Min.). Mit zunehmendem Alter steigt auch die vermutete Nutzungsdauer wesentlich an (6 bis 7 Jahre: 17 Min.; 8 bis 9 Jahre: 30 Min.; 10 bis 11 Jahre: 49 Min.; 12 bis 13 Jahre: 74 Min.). Verglichen mit der Befragung von 2020 sind dabei in der Befragung von 2022 keine großen Unterschiede zu bemerken.
Bemerkenswert ist, dass die KIM-Studie nach Motiven zur Mediennutzung von Kindern in spezifischen Situationen fragt. So geben 39 % der Befragten an, bei Langweile Filme, Videos und Serien anzusehen. Nur jedes zehnte Kind greift in diesem Fall zu Büchern, Zeitschriften oder Comics. Bei Einsamkeit werden bevorzugt Bewegtbilder und Messengerdienste genutzt. Auch um Spaß zu haben oder etwas Spannendes zu erleben, nutzen Kinder Bewegtbilder und digitale Spiele. Rund 25 % der befragten Kinder geben an, Serien, Filme und Videos zu konsumieren, |13|wenn sie traurig sind, 14 % hören dann Musik oder Radio und etwa jedes zehnte Kind setzt digitale Spiele, Messengerdienste oder Bücher, Zeitschriften und Comics ein, um seine Laune zu verbessern. Auf die Frage nach den liebsten Apps nannten 48 % der Kinder, die das Internet nutzen, WhatsApp, 30 % nannten YouTube und 28 % TikTok; 13 % gaben Instagram als eine ihrer drei liebsten Apps an, 8 % Snapchat und jeweils 6 % Google und Facebook (Feierabend et al., 2022b).
Die JIM-Studie 2022 gibt Auskunft zum Stellenwert unterschiedlicher Medien im Alltag von Jugendlichen (Feierabend et al., 2022a): Demnach nutzen 94 % der Befragten im Alter von 12 bis 19 Jahren das Internet regelmäßig in ihrer Freizeit und das von ihnen am meisten eingesetzte Gerät ist das Smartphone (96 %). Zudem hören 89 % regelmäßig Musik, 78 % sehen mehrmals wöchentlich fern, 76 % konsumieren Online-Videos und digitale Spiele. Gut zwei Drittel (67 %) der Befragten nutzen regelmäßig Videostreamingdienste und 57 % hören Radio. Ein Drittel der Jugendlichen liest in der Freizeit Bücher, 19 % hören Podcasts, und 17 % Hörspiele und -bücher, 14 % der Jugendlichen lesen Print-Zeitungen (online: 13 %).
Das Internet ist fester und alltäglicher Bestandteil des Lebens der allermeisten Jugendlichen. Über vier Fünftel (84 %) der 12- bis 19-Jährigen nutzen täglich in ihrer Freizeit das Internet (2020: 89 %, 2021: 88 %), 10 % der Befragten nutzen es mehrmals pro Woche und 6 % der befragten Jugendlichen nutzen das Internet seltener. Mit steigendem Alter der Jugendlichen steigt auch die Nutzungshäufigkeit des Internets: 76 % der 12- bis 13-Jährigen und 98 % der 18- bis 19-Jährigen sind täglich online. Die Nutzungsdauer von Onlinediensten ist während der Covid-19-Pandemie angestiegen und scheint sich nun rückläufig zu entwickeln: 2019 waren es laut JIM-Studie 205 Minuten, 2020 258 Minuten, im Jahr 2021 241 Minuten und im Jahr 2022 204 Minuten, die 12- bis 19-Jährige in ihrer Freizeit täglich online verbracht haben. Auch die Nutzungsdauer steigt mit dem Alter (Feierabend et al., 2022a).
Wie die KIM-Studie erfasst auch die JIM-Studie die liebsten Apps der Befragten. Dabei steht der Dienst WhatsApp an der Spitze: 79 % der Befragten gaben diese App als eine ihrer drei Lieblingsapps an. Die Plattform Instagram folgt mit deutlichem Abstand (31 %). TikTok und YouTube wurden von 23 % der Befragten angegeben, Snapchat von 19 %. Facebook wird von 10 % der Befragten als Lieblingsapp genannt. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig es ist, Medienkompetenz unabhängig von spezi|14|fischen Nutzungsdiensten zu erwerben, da diese ausgesprochen dynamisch sind und sich von Jahr zu Jahr verändern (Feierabend et al., 2022a).
1.1.2.1 Wie nutzen Kinder und Jugendliche Computer?
Jugendliche, die große Teile ihrer Freizeit mit Computerspielen oder Spielkonsolen verbringen, werden häufig als sozial vereinsamt wahrgenommen (Großegger & Zentner, 2008). Dieses Bild wird auch immer wieder in den Medien aufgegriffen und das Stereotyp wird auf diese Weise weiter verfestigt. Zu diesem Thema gibt eine Studie des Instituts für Jugendkulturforschung wichtige und vielleicht überraschende Einblicke (Schaefberger, 2010): Die sozialen Beziehungen von Jugendlichen, die sich in der Computerszene bewegen, unterscheiden sich kaum von den Freundschaften, die Jugendliche mit anderen Interessensschwerpunkten aufbauen. Bindungsfaktoren wie Sympathie, ähnliche Musikpräferenzen oder räumliche Nähe spielen eine ebenso große Rolle beim Aufbau von über die Computerszene entstandenen Beziehungen wie die gemeinsame Begeisterung für Computerspiele. Diese – bei manchen mehr, bei anderen weniger – stark ausgeprägte Leidenschaft wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass die Spieler sich an der Handlung aktiv beteiligen können (Bopp, 2005). Peer-Kontakte werden von passionierten Computerspielern nicht nur im realen Leben, sondern auch virtuell gepflegt, z. B. über die gemeinsame Teilnahme an Spielen. Wichtig ist hierbei der Aspekt der Ergänzung in dem Sinne, dass reale soziale Kontakte also nicht durch virtuelle Kontakte ersetzt werden, sondern vor allem um die Möglichkeit, auch virtuell Zeit zusammen verbringen zu können, erweitert werden. Beide Welten können z. B. in Form von LAN-Partys oder dem gemeinsamen Spielen am Nachmittag aufeinandertreffen. Im Internet geschlossene Freundschaften können ebenso auf die reale Welt ausgeweitet werden, sodass eine „Vermischung“ von „Offline“- und „Online“-Freundschaften heute die Regel darstellt (zum Potenzial von Computerspielen vgl. Kapitel 2.4; zu eventuellen Gefahren von virtuell angebahnten Kontakten vgl. Kapitel 3.1.4). Die Themengebiete, die von passionierten jungen Internetnutzerinnen und -nutzern thematisiert werden, unterscheiden sich nicht von jenen anderer Jugendkulturen: Frust in der Schule, aktuelle Trends oder eben die gemeinsame Computeraffinität werden im realen wie im virtuellen Leben miteinander besprochen. Die Computerszene ist im Gegensatz zur landläufigen Meinung nicht vereinsamt (Großegger & Zentner, 2008).
|15|Mädchen und Computerspiele
Dass der stereotype Computerspieler männlich ist, spiegelt sich nicht nur in populären Darstellungen im Fernsehen (z. B. in der beliebten Serie „Big Bang Theory“), sondern auch in der Gestaltung vieler Computerspiele wider. In den meisten Fällen sind die Hauptfiguren von digitalen Rollenspielen männlich und Frauen nehmen nur Nebenrollen mit zumeist sehr seichter Bedeutung ein (Downs & Smith, 2010). Sie werden als Objekt der männlichen Begierde in unterschiedlichen Rollen dargestellt: Entweder ist es die Aufgabe des Helden, eine Prinzessin zu retten oder eine Frau aus einer misslichen Lage zu befreien, oder übersexualisierte Frauen werden wie Dekorationsobjekte im Spiel als Beiwerk dargestellt. In dieser Funktion werden sogar gewalttätige Handlungen, zumeist mit sexuellem Inhalt, möglich, wie die Sichtung aktuell beliebter Spiele zeigt (z. B. im Spiel GTA 5). Selbst wenn eine weibliche Hauptfigur verschiedene Abenteuer bestehen muss, ist sie in vielen Fällen gemäß männlichen Fantasien gestaltet (z. B. Lara Croft). Diese Gestaltung könnte sich nicht nur negativ auf die Identitätsentwicklung und das Selbstbild von Mädchen auswirken, sondern auch die Wahrnehmung von Frauen durch junge männliche Spieler wird durch so gestaltete Geschlechterstereotype möglicherweise verzerrt. So ist beispielsweise bei Döring (2013) nachzulesen, wie sehr reale, aber auch fiktive Medienpersonen das Selbstkonzept beeinflussen können: Soziale Vergleiche können motivierend wirken, sofern sich die Medienpersonen zur Orientierung eignen, handelt es sich aber um völlig unrealistische Figuren, wird das Selbstwertgefühl beeinflusst und gefährdet. Yao et al. (2010) untersuchten, inwieweit Computerspiele, in denen Frauen als Objekte dargestellt werden, sich auf Spieler auswirken können. Ihre Ergebnisse weisen unter anderem darauf hin, dass die Spieler eher zu unangebrachtem Verhalten gegenüber Frauen neigen. Unter Berücksichtigung dieses Blickwinkels verwundert es nicht mehr, dass zum einen Mädchen andere Spielgenres präferieren als Jungen und zum anderen Frauen auch in der Entwicklung solcher Spiele zurzeit noch unterrepräsentiert sind. Die Spieleindustrie reagiert aber nach und nach auf die unterschiedlichen Bedürfnisse männlicher und weiblicher Nutzer, und es entstehen immer mehr auf weibliche Spielvorlieben zugeschnittene Spiele. Im Rückblick auf die letzten Jahre lässt sich eine Zunahme an weiblichen Gamern erkennen (Statista, 2018; vgl. Abbildung 1). Eine 2016 erschienene Studie weist darauf hin, dass sexistische Inhalte in Computerspielen über die letzten Jahre merklich zurückgingen. Weib|16|liche Protagonisten werden heute facettenreicher und weniger sexualisiert dargestellt als noch vor einigen Jahren. Spielen Frauen aber nur als begleitende Figuren eine Rolle, werden sie nach wie vor zu Objekten gemacht, die eher Dekorations- als einen für die Handlung relevanten Charakter haben (Lynch et al., 2016). Kelly et al. (2023) konnten zeigen, dass als weiblich kategorisierte Gamer als weniger kompetent wahrgenommen werden als als männlich kategorisierte Spieler. Diese stereotype Erwartungshaltung könnte von Mädchen internalisiert werden und Sexismus niederschwellig unterstützen. Yao et al. (2022) thematisieren, wie konterstereotype Elemente der Darstellung von weiblichen Gamern ihre Diskriminierung verringern könnten, wobei dies nicht die grundsätzliche Lösung sexistischer Diskriminierung im Kontext von Online-Spielen sein kann (ausführlich siehe Eichenberg & Huss, 2023; Schneider et al., 2023, Dezember).
Abbildung 1: Verteilung der Computer- und Videospielerinnen und -spieler in Deutschland nach Geschlecht von 2013 bis 2015 (Statista, 2018)
Dieser Trend wurde bereits genutzt und Spiele konzipiert, die starre Geschlechterstereotype aufweichen und genderspezifische Spielvorlieben aufgreifen. Um Computerspiele für Mädchen attraktiver zu gestalten, ist es somit wichtig, auf geschlechterspezifische Präferenzen Rücksicht zu nehmen. Eichenberg et al. (2016) haben die wichtigsten Kennzeichen von für Mädchen interessanten Computerspielen zusammengefasst:
|17|Empfehlungen für die Entwicklung von Computerspielen, die für Mädchen attraktiv sind (Eichenberg et al., 2016)
Soziale Beziehungen stehen im Vordergrund.
Fortlaufende Handlung mit Entwicklungsmöglichkeiten des Charakters.
Vermeidung eines polarisierten Konfliktes guter und böser Mächte.
Das Prinzip „Wettkampf“ sollte nicht im Zentrum des Spielkonzeptes stehen.
Das Spiel sollte actionreich, aber möglichst gewaltfrei sein.
Das Einbeziehen anderer Personen sollte möglich sein (z. B. mit anderen zusammen spielbar).
Spielwelten sollten möglichst real sein.
Spielfiguren sollten vornehmlich weiblichen Charakters sein; fiktive Figuren sind möglich; Figuren, die männliche Stereotype abbilden, sollten jedoch eher vermieden werden.
Im Gegensatz dazu werden für Spiele, die für Jungen konzipiert werden, folgende Empfehlungen gemacht:
Empfehlungen für die Entwicklung von Computerspielen, die für Jungen attraktiv sind (Eichenberg et al., 2016)
Spielsteuerung sollte Geschick erfordern; Entwicklungsmöglichkeiten in der Beherrschung der Spielsteuerung sollten gegeben sein.
Wettbewerbsartige Modi sollten implementiert sein (z. B. Highscores).
Actionbetonte Auseinandersetzungen, die nicht zwangsläufig brutal oder gewalttätig sein müssen, erhöhen das Spielinteresse.
Eine Spielaneignung über Versuch und Irrtum sollte gewährleistet sein.
Spielfiguren sollten, wenn diese fiktiv sind, eine mögliche Funktion mit einem Äquivalent aus der realen Welt abbilden (z. B. einen Beruf oder eine spezifische Aufgabe haben).
Das Geschlecht der Spielfigur sollte deutlich nicht weiblichen Geschlechts sein und zumindest theoretisch auch dem männlichen Geschlecht einer „Spezies“ zugeordnet werden können.
Kommunikative Aspekte brauchen nicht im Vordergrund des Spielgeschehens zu stehen.
|18|Das regelmäßige Spielen von Computerspielen birgt neben den zu berücksichtigenden Risiken (vgl. insbesondere Kapitel 3.1.1) auch viele Chancen (vgl. Kapitel 2.4).
1.1.2.2 Wie sieht die Handynutzung bei Kindern und Jugendlichen aus?
Nicht nur der Fernseher, auch das Smartphone löst bei vielen Erwachsenen große Irritation aus, wenn sie ihre Kinder dabei beobachten, wie sie scheinbar mit Klebstoff an das Gerät gebunden durch den Tag gehen – würde man sie gewähren lassen. Beim Handy werden von früh bis spät unterschiedlichste Funktionen in Anspruch genommen, und es gibt kaum eine Situation, in der das Handy nicht als Begleiter fungiert. Am Morgen als Wecker, auf dem Schulweg als willkommene Ablenkung während der Busfahrt, in der Schule als schnelle Möglichkeit, Wikipedia abzurufen, und beim Sport nach dem Unterricht als nützlicher Pulsmesser hat das Smartphone bereits um die Mittagszeit den Großteil des Tages begleitet, ohne ein einziges Mal seine ursprüngliche Aufgabe, nämlich das Telefonieren, zu erfüllen. Wenn es um exzessive Nutzungsweisen geht, muss klar darauf hingewiesen werden, dass Kinder am Modell – also am Vorbild ihrer Eltern – lernen und auch Erwachsene nicht davor gefeit sind, überdurchschnittlich viel Zeit am Smartphone zu verbringen. Kinder nehmen sich ein Beispiel an den Nutzungsgewohnheiten ihrer Eltern, weshalb der eigene Umgang mit digitalen Medien eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung kindlicher Medienkompetenz spielt.
Die in Abbildung 2 dargestellten Ergebnisse einer Umfrage zum Anteil der Smartphone-Nutzer bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Jahr 2014 (Statista, 2014) belegen, was Eltern auch ohne wissenschaftliche Expertise beobachten können: Handy und Smartphone spielen im Alltag von Jugendlichen und Kindern eine wesentliche Rolle. Neben technischen Gadgets, die die Nutzung verschiedener digitaler Medien integriert in nur einem Gerät ermöglichen (so ist jedes Smartphone mit Internetzugang, mit einer Kamera und einem MP3-Player ausgestattet), werden hierfür auch soziale Gründe vermutet. Walsh et al. (2008) beschreiben größeres Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Peergroup, erhöhtes Sicherheitsgefühl und höhere soziale Identifikation innerhalb einer Gruppe als positive Aspekte der Handynutzung. Die Kommunikation über Handys ermöglicht es Jugendlichen, den Kontakt zu |19|ihrer Peergroup auch über räumliche Distanz zu halten. Besonders beliebt als Kommunikationsmittel sind Kurzmitteilungen, die über unterschiedliche Anbieter an einen oder mehrere Ansprechpartner versendet werden können (Waller & Süss, 2012). Ganze Unterhaltungen werden per SMS bzw. WhatsApp-Nachrichten (häufig auch mittels Sprachnachrichten) geführt, was bei vielen Erwachsenen Kopfschütteln und Unverständnis auslöst, auch weil es als eine umständliche Form der Kommunikation erscheint.
Abbildung 2: Handynutzung von Kindern und Jugendlichen (Nutzeranteil je Altersgruppe; Statista, 2014)