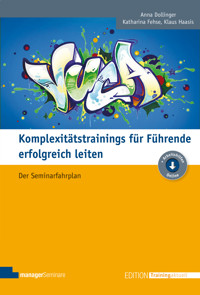Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Bildung
- Serie: Edition Training aktuell
- Sprache: Deutsch
Eine völlig neu aufgesetzte Fassung des Trainings-Klassikers: Wer Trainings zum Thema Veränderungsmanagement vorbereitet, erhält mit diesem Buch eine vielfach geprüfte Beschreibung zur Durchführung von bis zu sechs Trainingstagen. Das Werk stellt Konzepte, Methoden und Werkzeuge für die Praxis zur Verfügung, die sich in der Anwendung im Arbeitsalltag bewährt und zu erfolgreichen Veränderungsprojekten beigetragen haben. Sie kommen aus systemischen, gestaltpsychologischen sowie organisationsentwicklungsspezifischen Werkzeugkisten. Das Trainings-Curriculum bzw. Bausteine daraus können zum Ausbau der Veränderungskompetenz von Führungskräften, Change-Agents, internen Fachberatern, Projektleitern und auch Betriebsräten beitragen. Die Beschreibungen eignen sich sowohl für den Präsenzeinsatz als auch - weitgehend - für virtuelle Formate.
Online-Service: Auch dieses Werk beinhaltet weitere Arbeitshilfen, Schaubilder und Falldarstellungen zum Download-Abruf. Das Wissen steht Käuferinnen und Käufern des Buchs exklusiv zum digitalen Abruf bereit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Dollinger, Katharina Fehse
Change-Trainings erfolgreich leiten – Reloaded
Seminarfahrplan für sechs Trainingstage in Präsenz oder online
© 2022 managerSeminare Verlags GmbH
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-977910, Fax: 0228-9779199
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
ISBN 978-3-98856-297-5
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat: Ralf Muskatewitz
Cover: Designstudio Eminent: Emin Hasirci
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Ihre Download-Ressourcen
Begleitend zum Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen für die private Verwendung zum Download im Internet zur Verfügung. Sie können die Vorlagen jederzeit in hoher Qualität abrufen und einsetzen.
www.managerseminare.de/tmdl/k,142616
Inhalt
Impressum
Alle miteinander wissen mehr
Zu den Inhalten
Der Seminarfahrplan:Change-Trainings erfolgreich leiten – Reloaded
Die Module im Überblick
Modul I – Ankommen und Einchecken
Tag 1
I.1 Die Eröffnung der Veranstaltung
I.2 Kennenlernen, Veränderungs-erfahrungen teilen, Themen sammeln und priorisieren
I.3 Debriefing: Mind-Map zum Check-in
Modul II – Orientierung ausbauen
II.1 Zielsetzungen, Spielregeln, Agenda festlegen
II.2 Meine Changeability und meine Lernziele
Modul III – Erfolgsfaktoren für das Gelingen des Wandels
III.1 Intro und Gruppenarbeit: Unsere Erfahrungen zu Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen
III.2 Die Faktoren zur Implementierung eines erfolgreichen Wandels (Alternative A)
III.3 Die Evaluation unseres Veränderungsprozesses (Alternative B)
III.4 Debriefing und Transfer-Journal
Energizer: Autogrammjagd
Modul IV – Den Change Frame definieren:Die Veränderungsformel nutzen
IV.1 Die Veränderungsformel und ihre Bedeutung
IV.2 Ein Storybook (Change Frame) oder eine Sprungbrett-Rede skizzieren und die Entwürfe vorstellen
Modul V – Green Screen Loops:Den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen erkennen
V.1 Intro: Über den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen
V.2 Als Basis für den Green Screen Loop: Die Analyse der Unternehmens- (Bereichs-, Team-) Historie
V.3 Tagesausklang: Erste Ernte
Tag 2Retrospektive: Die Starfish-Methode
V.4 Gruppenarbeiten zur Analyse der Unternehmens-(Bereichs-/ Team-) Historie
Modul VI – Analysemodelle für Ausgangssituationen
VI.1 Als Basis für den Green Screen Loop: Die Analyse der Wirkmuster anhand des Impuls-Reaktions-Zeitstrahls
Energizer: Seile-Kreis-Ressourcenspiel
VI.2 Als Basis für den Green Screen Loop: Das Change-Portfolio
VI.3 Vorbereitende Interviews
VI.4 Einen Green Screen Loop entwerfen
Tag 3Retrospektive: Die 4-L-Methode
Modul VII – Planspiel: Solarflight AG
VII.1 Durchführung und Auswertung des Planspiels
VII.2 Vertiefen des Themas „Fehler- bzw. Lernkultur im Transformationsprozess“
Energizer: Ball Point Game
VII.3 Ergänzende Perspektiven zum Thema Fehler- bzw. Lernkultur
Modul VIII – Die Klimakurve und die Phasen des Wandels
VIII.1 Aufstellungsarbeit mit der Klimakurve „Radical Change“
VIII.2 Die Saatgut-Methode & Lernschleifen einbauen
VIII.3 Die Klimakurve „Pivoting“
Übung: Sag jetzt nichts Tag 4
Modul IX – Kommunikation im Veränderungsprozess
IX.1 Die Kommunikations-Kollision umgehen
IX.2 Prinzipien der Kommunikation in Veränderungsprozessen
Energizer: Die Change-Playlist
IX.3 Kommunikation im Veränderungsprozess: Definitionen, Konzepte und Unterscheidungen
IX.4 Die Erstellung eines Kommunikationskonzepts
1. Eine Stakeholder Map entwickeln
2. Der Business Case „Kundenservice“: Ein Kommunikationskonzept (Ablaufplan) entwerfen
3. Die Präsentation der Kommunikationskonzepte
4. Die Erstellung der Kommunikations-Skyline
IX.5 Tagesausklang: Was mein Transfer-Journal über den Tag mit dem Schwerpunkt Kommunikation erzählt
Tag 5Übung: Bild ohne Worte
Modul X – Eine Veränderungsarchitektur entwerfen
X.1 Definition des Begriffs Veränderungsarchitektur
X.2 Beispiele für Veränderungsarchitekturen
X.3 Eine Veränderungsarchitektur entwerfen anhand des Business Case „Transformation in der Medienwelt“
1. Entwerfen der Veränderungsarchitektur
2. Die Präsentation der Veränderungsarchitekturen
3. SMARTIE
Modul XI – Rund um das Thema Visionsentwicklung
XI.1 Intro & Definitionen: Vision, Leitbild, Strategie
XI.2 Eine attraktive und emotionale Vision entwickeln
Schritt 1: Impulse austauschen
Schritt 2: Die Wunschvorstellung erarbeiten
Schritte 3 + 4: Wunschvorstellungen austauschen & visualisieren sowie: Unsere Wunschvorstellungen kreativ-spielerisch inszenieren
Schritt 5: Präsentation der Inszenierungen „Reiseziel Change-Vision“
Schritt 6: Die wahrgenommenen Gemeinsamkeiten visualisieren
Tag 6Rückblick am Morgen
Schritt 7: Visionstexte „Change“ formulieren
Schritt 8: Präsentieren der Change-Visionen
Modul XII – Das Neue festigen – Bausteine & Methoden
XII.1 Die Bedeutung von Ritualen
XII.2 Wrap-up: Meine Changeability stärken
XII.3 Entwurf eines Ankerrituals: Fast Design Thinking – Perform magic
XII.4 Alternative Übungen: Das Neue festigen
XII.5 Wrap-up: Lose Enden zusammenführen
XII.6 Abschlussrunde & Zukunftstypen
Weitere Methoden-Bausteine zum Thema
I – Den Wandel starten
Analysemethoden für individuelle Belange
Heldenreise im Angebot
Was ich finde, dass du brauchst
Riemann-Thomann-Modell – Reloaded
Analysemethoden auf taktischer (Gruppen-)Ebene
Familiengeschichten
Team-Vernissagen
Analysemethode auf strategischer Managementebene
Die Analyse des Wirkungsumfelds mithilfe der Netzwerkdarstellung
II – Den Wandel vorantreiben
Motivationsmethoden für individuelle Belange
Das Neue festigen – Rituale
Future mobiles – eine persönliche Zukunftsvision entwickeln
Horror-Ich und Wunsch-Ichs: Worauf ich einzahlen will
Das Ressourcen-Triple
Wider Versandung und Beharrung
Der Sanddünen-Effekt
Methoden ausprobieren
de Bono meets Change
artTeaming
Die Betroffenen im Veränderungsprozess:Von Missionaren und Langsam-Adaptern
Wandel garantiert Widerstand
Übung/Experiment: Tanz der Kommunikation
III – Einstreu-Geschichten
Das funktioniert doch nicht 1: Das Wasserglas
Das funktioniert doch nicht 2: Der Apfel
Das funktioniert doch nicht 3: Die Einschnitte
Dakota tribal wisdom says
Noch mal Feedback: Body Talk
Download-Ressourcen
Seite 36: Vorlage Kompetenzprofil Changeability
Seite 53: Evaluierungsmatrix unseres Veränderungsprozesses
Seite 68: Leitfaden zur Erstellung eines Storybook of Transformation
Seite 116: Textvorschläge für Guten-Morgen-Kärtchen
Seite 133: Anleitung zur Produktion von Solarflugzeugen
Seite 133: Bastelvorlage Solarflugzeuge
Seite 165: Die Change-Playlist
Seite 170: Leitfaden zur Erstellung eines Kommunikationskonzepts
Seite 215: Die 8 Schritte der Visionserarbeitung
Seite 219: Instruktion zur Zukunftsreise „Reiseziel Change-Vision“
Seite 260: Mandala
Seite 290: Vorgehen After Action Revue
Seite 306: Der VAKOG-Leitfaden
Alle miteinander wissen mehr
Nicht nur Beraterinnen, Führende, Projektleiterinnen sehen sich zunehmend komplexeren Herausforderungen gegenüber: Ob wir nun von VUCA sprechen oder von BANI, ob wir auf die Wirtschaft schauen, auf unsere Gesellschaft oder die Politik. Wir alle befinden uns in einer gigantischen Transformation. Insofern kann es nur hilfreich sein, wenn wir unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Erkenntnisse ständig miteinander teilen: Im Transformationsprozess, im Training wie im täglichen Miteinander. Ehrlich eingestehend, dass wir immer von allen unseren Partnern der Zusammenarbeit lernen können und uns gleichzeitig mit Demut und Respekt an Veränderungsprozesse heranwagen. Frei nach dem Zitat von Kurt Lewin, dass wir ein System erst dann kennenlernen, wenn wir versuchen, es zu ändern.
Gleichzeitig können wir voll Zuversicht und Vertrauen bleiben, gerade weil in VUCA- und Veränderungskontexten nicht intendierbare Qualitäten notwendig sind, von denen es in unseren freiheitlich demokratischen Kulturen reichlich gibt: Kreativität, Inspiration und Kollaboration. Intellektuelle Hochleistungen lassen sich schwerlich mittels Sanktionsmacht anweisen. Wir sind der Überzeugung, dass sich im Gefolge von narzisstischen, machiavellistischen Diktatoren auf Dauer keine der anstehenden Herausforderungen lösen lassen werden. Dass Reaktionsformen einer alten autokratischen Hierarchie bzw. Macht in der digitalen Gegenwart nicht wirksam bleiben können.
Es gibt die „Kraft der vernetzten Vielen“. Eine tektonische Verschiebung von Macht durch Information und Kommunikation, die den Dialog auf Augenhöhe fordert und neue Formen der Zusammenarbeit möglich macht. Dass eine stark ausgeprägte hierarchische Führung negative Auswirkungen auf pyschologische Sicherheit hat, ist gut erforscht und dass psychologische Sicherheit zentral wichtig für Innovationsprozesse ist, auch (siehe auch Google: Aristoteles Studie).
Im Verbund mit diesen Perspektiven und Überzeugungen bieten wir mit diesem Buch einige Impulse an, wie wir Veränderungsprozesse zielorientiert begleiten können. Es bleiben Aussagen auf schwankendem Grund.
Dabei hat unser Buch nicht den Anspruch, wissenschaftstheoretischen Definitionen und Diskussionen zu genügen. Es stellt pragmatisch und auch eklektisch Konzepte, Methoden und Werkzeuge aus der Praxis für die Praxis zur Verfügung, die sich in der Anwendung im Arbeitsalltag der Transformationen bewährt und zu erfolgreichen Veränderungsprojekten beigetragen haben. Sie kommen aus systemischen, gestaltpsychologischen sowie organisationsentwicklungsspezifischen „Werkzeugkisten“.
Die vorliegende Veröffentlichung gäbe es nicht, ohne …
unsere Auftraggeber! Die Möglichkeit, an ihren konkreten Veränderungsprojekten mitzuarbeiten, ihr Vertrauen in uns, innovative Methoden mit uns auszuprobieren und ihr kritisches Fordern haben die vorliegende Veröffentlichung erst ermöglicht.
all die Autorinnen und Autoren, Kolleginnen und Kollegen, Teilnehmenden, auf deren „Wissens-Schultern“ wir stehen dürfen!
Sadia Oumohand und Ralf Muskatewitz vom Verlag managerSeminare, deren humorvolle, professionelle, geduldige Zusammenarbeit und Unterstützung uns stets sehr ermutigt.
Herzlichen Dank an Sie/an euch alle!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ihr loslegt, hier noch eine Binsenweisheit: Bitte fühlt euch völlig frei, aus all unseren Vorschlägen, Ideen und Methoden etwas ganz anderes zu machen. Etwas, das für euch und eure Vorhaben logisch und anschlussfähig ist und euch Spaß macht. Es gibt hier kein Falsch oder Richtig. Entsprechend darf eine Methode auch mal „schief gehen“. Unsere Haltung hierzu ist: „… und was können wir jetzt daraus lernen?“ Mit dieser Einstellung können alle Beteiligten immer etwas Neues entdecken, etwas, das für Veränderungen wichtig ist. Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Wenn zu Instruktionen oder Methoden Fragen auftauchen, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir schauen dann mal, was wir daraus lernen können. Und besonders freuen wir uns, wenn wir Rückmeldungen über eure Erfolge, Erkenntnisse und Weiterentwicklungen bekommen.
Anna Dollinger und Katharina Fehse
Zu den Inhalten
Präsenz oder Online?
Hier ein paar Gebrauchshinweise: Viele der hier beschriebenen Übungen und Methoden (nicht alle, z.B. „Solarflight AG“ nicht) können sehr wohl auch online durchgeführt werden. Wir legen in unseren Trainingsreihen sehr bewusst virtuelle Sessions ein, weil wir Vorteile darin sehen, auch online zu arbeiten. Digitale Formate vereinfachen und beschleunigen Prozesse der Ideenfindung, des Austausches und der Bewertung bisweilen enorm. Daten können in Echtzeit erhoben und ausgewertet werden (von Live-Polling bis zu Mood-Barometern), Gruppen können ortsunabhängig miteinander interagieren, durch asynchrone Verfahren werden wir auch zeitlich flexibler. Last but noch least ermöglichen die Anonymität des Austausches bzw. Sammelns von Daten wirklich hierarchieunabhängige Meinungsäußerungen und Ergebnisfindungen.
Wie immer sind Werkzeuge, auch digitale, nur ein Hilfsmittel, um Ziele zu erreichen und Erkenntnisse und Ergebnisse zu schaffen. Bevor wir also in die Konzeption eines Formats einsteigen, sind die wichtigsten Fragen:
Was wollen wir erreichen: Mit der gesamten Durchführung des Formats sowie bei jedem einzelnen Modul?
Was soll das Ergebnis des Formats bzw. jeweiligen Moduls sein und woran würden wir erkennen, dass wir bestmögliche Ergebnisse erreicht haben?
Was müssen entsprechend diesbezüglich die Arbeitsfragen für die einzelnen Module sein?
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für digitale Formate ist aus unserer Sicht, möglichst schon in der Vorbereitung über die wichtigsten Themen zu informieren, damit sich die Teilnehmenden gut vorbereiten können und so in der Veranstaltung Diskussion und Austausch im Vordergrund stehen. Daher sind wichtige Fragen:
Welche Informationen brauchen Teilnehmende, damit sie gut vorbereitet in Arbeitsaufgaben während der Veranstaltung einsteigen können?
Und wie können wir diese möglichst nutzerfreundlich und attraktiv aufbereiten (Video Scribings, Slightshows, Impulsreden, Tutorials)?
Können die Teilnehmenden den Umgang mit Tools vorab einüben?
Trainings-Skyline
Wir haben hier eine Trainings-Skyline dargestellt, die 6 Arbeitstage umfasst. So führen wir das Training nur für einen unserer Auftraggeber durch. Für andere ist es teilweise nur ein Tag („Die eigene Change-Kompetenz ausbauen“) oder es sind 2 x 2 Tage („Veränderungen steuern“ und „Kommunikation im Veränderungsprozess“). In unserer Transformationsausbildung von 17 Tagen findet sich dann ziemlich umfassend alles und mehr wieder, was hier im Buch hinterlegt ist. Durchaus häufig folgen wir, mit Erlaubnis der Auftraggeber, im Training einfach direkt den Wünschen und aktuellen Anliegen unserer Teilnehmenden und lassen die Agenda links liegen.
Wie durch die Anzahl der möglichen Variationen der Anzahl von Trainingstagen vermutlich schon klar wurde, bieten wir unsere Change-Trainings für die unterschiedlichsten Zielgruppen an. Von den Sachbearbeiterinnen in der Verwaltung bis hin zu Key Usern in der IT. Entsprechend nutzen wir in unseren Ausführungen den Begriff „Führende“. Wir wollen damit ausdrücken, dass wir uns eben nicht nur an Projektleiter, Führungskräfte oder Change-Agents wenden, sondern an alle, die in Zeiten des Wandels (und auch der Krisen) andere Menschen ermutigen, mitnehmen, inspirieren möchten. Also auch (agile) Coachs, Moderatorinnen, Mentorinnen, Mediatorinnen …
Zum Duzen und Gendern: Wir duzen üblicherweise unsere Kolleg:innen, bleiben hier aber bei der direkten Ansprache unserer Leserschaft beim respektvollen „Sie“. Bei den Durchführungsempfehlungen sprechen wir von „der Tainerin“ aus unserer weiblichen Perspektive als Autorinnen. Selbstverständlich sind alle Geschlechter angesprochen. Davon abgesehen wird in diesem Werk möglichst geschlechtsneutral formuliert.
Abschließend noch ein Hinweis auf die Download-Ressourcen zum Buch: Über die Buchinhalte hinaus stehen zusätzliche Materialien, vorbereitete Arbeitsmaterialien oder Vertiefungen für den sofortigen Einsatz als Download-Ressourcen zur Verfügung. Diese Ressourcen können über den Link in der inneren Umschlagklappe abgerufen werden und sind mit nebenstehendem Symbol im Buch gekennzeichnet.
Download-Ressourcen
Der Seminarfahrplan Change-Trainings erfolgreich leiten – Reloaded
Die Module im Überblick
Inhalte
Module I - V
• I Ankommen und Einchecken
• II Orientierung ausbauen
• III Erfolgsfaktoren für das Gelingen des Wandels
• IV Den Change Frame definieren: Die Veränderungsformel nutzen
• V Den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen erkennen (1)
Module V - VI
• V Den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen erkennen (2)
• VI Analysemodelle für Ausgangssituationen
Module VII - VIII
• VII Planspiel: Solarflight AG
• VIII Die Klimakurve und die Phasen des Wandels
Modul IX
• IX Kommunikation im Veränderungsprozess
Module X - XI
• X Eine Veränderungsarchitektur entwerfen
• XI Rund um das Thema Visionsentwicklung (1)
Module XI - XIII
• XI Rund um das Thema Visionsentwicklung (2)
• XII Das Neue festigen – Bausteine & Methoden
• XIII Abschlussrunde & Zukunftstypen
Der erste Tag im Überblick
I Ankommen und Einchecken
Die Eröffnung der Veranstaltung
Kennenlernen, Veränderungserfahrungen teilen, Themen sammeln und priorisieren
Debriefing
II Orientierung ausbauen
Zielsetzungen, Spielregeln, Agenda festlegen
Meine Changeability und meine Lernziele
III Erfolgsfaktoren für das Gelingen des Wandels
Unsere Erfahrungen zu Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen
Die Faktoren zur Implementierung eines erfolgreichen Wandels (A)
Alternativ: Die Evaluation unseres Veränderungsprozesses (B)
Debriefing und Transfer-Journal füllen
Energizer: Autogrammjagd
IV Den Change Frame definieren: Die Veränderungsformel nutzen
Die Veränderungsformel und ihre Bedeutung
Ein Storybook (Change Frame) oder eine Sprungbrett-Rede skizzieren und die Entwürfe vorstellen
Debriefing: SMARTIE & Transfer-Journal
V Den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen erkennen (Teil 1)
Intro: Über den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen
Erläuterung der Green Screen Loops
Als Basis für den Green Screen Loop: Die Analyse der Unternehmens- (Bereichs-, Team-) Historie
Debriefing
Tagesausklang: Erste Ernte
Der zweite Tag im Überblick
Retrospektive: Die Starfish-Methode
V Den systemischen Eigen-Sinn von Organisationen kennen (Teil 2)
Gruppenarbeiten zur Analyse der Unternehmens-(Bereichs-, Team-) Historie
Debriefing: SMARTIE
VI Analysemodelle für Ausgangssituationen
Die Analyse der Wirkmuster anhand des Impuls-Reaktions-Zeitstrahls
Energizer: Seile-Kreis-Ressourcenspiel
Als Basis für den Green Screen Loop: Das Change-Portfolio
Vorbereitende Interviews
Einen Green Screen Loop entwerfen
Debriefing: SMARTIE
Der dritte Tag im Überblick
Retrospektive: Die 4-L-Methode
VII Planspiel Solarflight AG
Durchführung und Auswertung des Planspiels
Vertiefen des Themas Fehler- bzw. Lernkultur im Transformationsprozess
Energizer: Ball Point Game
Ergänzende Perspektiven zum Thema Fehler- bzw. Lernkultur
Das Transfer-Journal füllen
VIII Die Klimakurve und die Phasen des Wandels
Aufstellungsarbeit mit der Klimakurve: Radical Change
Die Saatgut-Methode & Lernschleifen einbauen
Die Klimakurve „Pivoting“
Defbriefing: SMARTIE
Der vierte Tag im Überblick
Übung: Sagen Sie jetzt nichts
IX Komunikation im Veränderungsprozess
Die Kommunikationskollision umgehen
Prinzipien der Kommunikation im Veränderungsprozess
Energizer: Die Change-Playlist
Kommunikation im Veränderungsprozess: Definitionen, Konzepte und Unterscheidungen
Ein Kommunikationskonzept erstellen
– Eine Stakeholder Map entwickeln
– Der Business Case „Kundenservice“: Ein Kommunikationskonzept (Ablaufplan) entwerfen
– Die Präsentationen der Kommunikationskonzepte
– Die Erstellung der Kommunikations-Skyline
Zum Tagesausklang: Was mein Transfer-Journal über den Tag mit dem Schwerpunkt Kommunikation erzählt …
Der fünfte Tag im Überblick
Übung: Bild ohne Worte
X Eine Veränderungsarchitektur entwerfen
Definition des Begriffs Veränderungsarchitektur
Beispiele für Veränderungsarchitekturen
– Ein Strategieprozess
– Ein Kulturentwicklungsprozess
Eine Veränderungsarchitektur entwerfen anhand des Business Case „Transformation in der Medienwelt“
– Vorbereitung und Gruppenarbeit
– Die Präsentationen
– SMARTIE
XI Rund um das Thema Visionsentwicklung (Teil 1)
Intro & Definitionen: Vision, Leitbild, Strategie
Eine attraktive und emotionale Vision entwickeln
– Schritt 1: Impulse austauschen
– Schritt 2: Die Wunschvorstellung erarbeiten
– Schritte 3 + 4: Wunschvorstellungen austauschen & visualisieren sowie: Unsere Wunschvorstellungen kreativspielerisch inszenieren
– Schritt 5: Präsentation der Inszenierungen „Reiseziel Change-Vision“
– Schritt 6: Die wahrgenommenen Gemeinsamkeiten visualisieren
Der sechste Tag im Überblick
Rückblick am Morgen
Morning News: Die Trainingszeitung
XI Rund um das Thema Visionsentwicklung (Teil 2)
Eine attraktive und emotionale Vision entwickeln
– Schritt 7: Visionstexte Change formulieren
– Schritt 8: Präsentieren der Change-Visionen SMARTIE
Schritt 8: Präsentieren der Change-Visionen SMARTIE
XII Das Neue festigen – Bausteine & Methoden
Die Bedeutung von Ritualen
Wrap-up: Meine Changeability stärken
Entwurf eines Ankerrituals „Fast Design Thinking: Perform magic“
Alternative Übungen: Das Neue festigen
– Future Mobiles
– Priming
Wrap-up: Lose Enden zusammenführen
XIII Abschlussrunde & Zukunftstypen
Modul I – Ankommen und Einchecken
Die Eröffnung der Veranstaltung hat den Zweck, die Teilnehmenden darauf einzustimmen, was jetzt auf sie zukommt, ihnen Orientierung zu geben. Aus unserer Sicht sollte die Einführung nicht zu lange sein, sonst verlieren wir das Interesse der Teilnehmenden (maximal 10 Minuten durch die Trainerin), anstatt ihre Neugierde zu wecken. Das kann aus unserer Sicht vor allem durch zwei Aspekte angestrebt werden. Einmal, indem man bereits jetzt (hoffentlich) neue Informationen bietet (hier die Dimensionen der Changeability) und diese mit der Person des Teilnehmenden in Verbindung bringt. Also bestmöglich Fragen beziehungsweise Antworten auslöst wie: „So ist das bei mir“, „Was hat das mit mir zu tun?“, „Was kann mir das bringen/nutzen?“ und „Wie sehe ich das?“
Wenn die Eröffnung durch den Auftraggeber ergänzt wird, wäre dies aus unserer Sicht sehr günstig, weil interne Partner oft Notwendigkeit und Nutzen des Trainings aus Sicht des Unternehmens sehr überzeugend und glaubhaft darstellen können. Gleichwohl ist es wichtig, sich im Vorfeld diesbezüglich mit den internen Partnern abzustimmen, damit die Botschaften sich möglichst ergänzen und verstärken und nicht widersprechen.
I.1 Die Eröffnung der Veranstaltung
Tag 1
Orientierung
Ziele
Teilnehmende einstimmen und diese willkommen heißen
Darstellen: Wie kam es zu diesem Thema/dieser Veranstaltung?
Veranstaltungsziele bekanntmachen
Seminarleitung vorstellen
Kriterien der Changeability vorstellen
Zeit
10-30 Minuten durch den Auftraggeber – je nach Zielgruppe, Anlass und Ausgangssituation
Weitere 10 Minuten durch die Trainerin
Material
Modell der Changeability auf Flipchart oder PPT
Auftraggeber
Die Eröffnung der Veranstaltung durch den Auftraggeber
Die Eröffnung der Veranstaltung wird im Idealfall von einer verantwortlichen Person der auftraggebenden Organisation vorgenommen. Diese sollte vor allem betonen, was Anlass und Ausgangssituation der Veranstaltung sind, woran sie die konkrete Erreichung der Veranstaltungsziele festmacht und welche Ergebnisse sie sich von der Veranstaltung wünscht. Dies sollte selbstverständlich mit einer positiven, vertrauensvollen Konnotation geschehen.
Wenn es konkrete Transformationsprojekte sowie entsprechendes Zahlenmaterial und eine zugehörige Vision gibt, so sollten diese zu Beginn des Change-Trainings durchaus (wieder) vorgestellt werden (max. Redezeit: 30 Minuten).
Anschließend stellt die verantwortliche Person Sie als Trainerin vor, erklärt gegebenenfalls, wieso sie sich für Sie entschieden hat und was sie sich von Ihnen erwartet.
Trainerin
Die Eröffnung durch die Trainerin
Als Trainerin haben Sie nunmehr das Ziel, die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden auf sich zu ziehen und ihnen zu signalisieren, dass es für sie sinnvoll und nützlich sein kann, sich hier zu engagieren. Das funktioniert online wie analog. Hilfreich ist es, sich zu diesem Zweck auf ganz konkrete Erfahrungen zu beziehen, die man als Prozessbegleiterin in (vielleicht sogar dem betreffenden) Unternehmen zu dem aktuellen Thema gemacht hat, um zu verdeutlichen, was diese Erfahrungen für die Teilnehmenden bringen können. Auch sollte hervorgehoben werden, was die Teilnehmenden von diesem Seminar erwarten können.
Intro
Hier ein Intro-Vorschlag:
„Veränderungsprozesse voranzubringen, ist zu einer Kernkompetenz für Führende geworden, denn Veränderungen in Unternehmen sind an der Tagesordnung. Dabei geht es derzeit vor allem um Digitalisierung und entsprechende Prozess-beziehungsweise Tätigkeitsveränderungen, um Innovationen in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen oder ganze Geschäftsbereiche oder auch um Einstellungs- bzw. Kulturveränderungen, die sich beispielsweise auf die Themen Agilität oder New-Work-Ansätze beziehen. Doch etwa zwei Drittel aller Veränderungsprozesse erreichen nicht die gewünschten Ziele, wie internationale und deutsche Untersuchungen seit Jahren zeigen (u.a. Dersch, Freibichler, Pannes & Zacherl, 2020).
Erklärungsmodelle hierfür gibt es reichlich. Unter anderem die Erkenntnis, dass viele Veränderungsprojekte viel zu technisch-funktional angepackt werden nach dem Motto: ‚Jetzt haben wir doch diese neuen logisch-stimmigen Prozesse genauestens beschrieben und allen gesagt, wie es läuft, warum läuft es denn nicht?‘ Doch Veränderungen oder – genauer gesagt – ‚Eingriffe‘ in soziale Systeme sind in ihren Auswirkungen nicht planbar, nicht vorhersehbar, nicht kontrollierbar. Weil sie eben nicht linear-kausalen Regeln gehorchen, nach dem Prinzip ‚Wenn-dann‘, sondern ihrem ‚Eigen-Sinn‘, ihrer eigenen Entwicklungsdynamik folgen. Einer Dynamik, die sich aus den im System bestehenden Überzeugungen speist und aus dem Gedächtnis der Organisation, das Handlungen bevorzugt, die sich aus bestimmten Perspektiven heraus als nützlich erwiesen haben.
Sie verändern sich in gewisser Weise permanent. Und zugleich sind bestimmte Interventionen und Vorgehensweisen an bestimmte Systeme mehr oder weniger anschlussfähig. So hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass ambidextre Projekte in einer bestehenden Unternehmensstruktur beziehungsweise -kultur schwerlich reussieren können (Organisationsentwicklung, 2020): Es zeigt sich, dass innovative Startup-Bereicheinnerhalb eines Unternehmens leicht von der bestehenden Kultur ‚assimiliert‘ und somit ihrer Innovationskraft beraubt werden.
Es scheint so, als ob die Fähigkeit, Menschen gekonnt durch einen Change-Prozess zu führen, fast eine Kunst ist. Eine Kunst, die einer bestimmten Haltung bedarf: nämlich Menschen wirklich mitnehmen und einbinden zu wollen beziehungsweise auch, sich als interner oder externer Change-Berater bzw. als Initiator mitnehmen zu lassen. Das heißt, offen, gemeinsam und zieldienlich zu diskutieren und zu integrieren, was von den verschiedenen Interessengruppen an Überlegungen und Impulsen kommt.
Es ist auch eine Kunst, die das konsequente Feedback aller Betroffenen braucht, um Lernen und Evaluieren zu können.
Weiterhin ist es eine Kunst, die die Fähigkeit benötigt, genau zu beobachten, welche Muster und Annahmen im System auftauchen und welche Interventionen wiederum welche Antwortmuster erzeugen – und sich dabei immer wieder in der eigenen begrenzten Beobachtungsfähigkeit zu hinterfragen.
Weiterhin benötigt es die Fähigkeit, die stets vorhandenen Emotionen willkommen zu heißen und sie als Treibstoff für den Veränderungsprozess zu nutzen.
Und schließlich ist es eine Kunst, ein geeignetes Methodenrepertoire immer wieder situativ und kreativ für die aktuellen Gegebenheiten und Ziele zu nutzen. Kompetenzen, die aus unserer Sicht zu den zentral wichtigen Metakompetenzen gehören, über die, unabhängig von Hierarchie-Ebene und fachlicher Funktion, alle Veränderungsinitiatoren und -begleiter verfügen sollten.
All diese Themen werden wir in diesem Seminar vertiefen. Zum Start in unsere Zusammenarbeit orientieren wir uns an dem Modell der Changeability (v. Kyaw, 2010), welches sich aus drei Kriterien zusammensetzt …“
Changeability
Veränderungsmöglichkeiten – „Dürfen, Ermöglichen“
Diese besagt, dass man geeignete Rahmenbedingungen haben muss, um etwas ändern zu können. Das bedeutet unter anderem, dass entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen und es auch der Unterstützung und Rückendeckung durch das Topmanagement bedarf. Unterstützung, etwas verändern zu dürfen oder zu sollen. Ein sehr eindrückliches, geradezu triviales Beispiel, wie dies nicht funktioniert hat, stammt aus der Produktion eines Unternehmens: Teilautonome Arbeitsgruppen sollten sich mehr eigenverantwortlich selbst steuern. Entsprechend sollten Gruppengespräche geführt werden. Allerdings gab es weder Gruppenräume, in denen Gespräche hätten geführt werden können – es war auf der Produktionsfläche selbst einfach viel zu laut – noch wurden von den leitenden Führungskräften entsprechende Zeiträume freigegeben. Ein ermutigendes Beispiel sei dem gegenübergestellt: In dem großen Change-Projekt „Multimedialer SWR“ forderte der Intendant mehrfach seine Mitarbeitenden auf, mit Mut zu experimentieren und etwas auszuprobieren. Dabei unterstrich er ausdrücklich, dass dazu auch Scheitern gehört: „Wichtig ist, daraus schnell zu lernen, um das Beste für unsere Kunden zu produzieren.“
Veränderungskompetenz – „Können“
Sie ist das Können, das insbesondere die Verfügbarkeit eines umfangreichen Methodenrepertoires voraussetzt. Gerade auch dieses wird in diesem Training hier ausgebaut. Die Teilnehmenden werden sich in unterschiedliche Methoden einarbeiten und diese ausprobieren – von der Erstellung eines zieldienlichen fortlaufenden Kommunikationskonzepts bis hin zum erfolgversprechenden Umgang mit Widerstand in Veränderungsprojekten. An dieser Stelle bitten Sie die Teilnehmenden schon jetzt, ihr Wissen und ihre Erfahrungen aktiv einzubringen. Denn das wäre sehr zum Nutzen und zum Vorteil aller Anwesenden. Schließlich gibt es auf dieser Welt nicht viele Dinge, die mehr werden, wenn man sie teilt. Aber für die Themen Wissen und Erfahrung gilt dies mit Sicherheit (neben der Liebe) …
Veränderungsbereitschaft – „Wollen“
Wollen bedeutet, eine Haltung einzunehmen, die nach kleinen Zeichen der Veränderung im unternehmensinternen sowie umgebenden systemrelevanten Kontext sucht, diese aufgreift und entsprechende Handlungen initiiert, um Chancen-Potenziale zu heben. Hierbei sind die bereits angesprochenen Metakompetenzen von besonderer Wichtigkeit:
Sich einfühlen, aufmerksam wahrnehmen und Musterveränderungen frühzeitig erkennen
Feedback und Lernen als fortlaufenden, lebenslang notwendigen Prozess betrachten
Mit Komplexität, Ungewissheit und Ambiguität umgehen und diese aushalten
Kollaboration und Rollenflexibilität als Mehrwert erkennen
Mut zu Innovation, Experimentieren und Lernen zeigen
Diese Fähigkeiten sollen ebenfalls in dieser Veranstaltung für den Ausbau der Changeability vertieft werden.
„Je früher man Entwicklungen und Veränderungen aufgreift, desto mehr kann man sie gestalten. Gunther Schmidt sagt hierzu ‚Wer immer der Gleiche bleiben will, muss sich stets ändern!’ – Weil die Kontexte, in denen wir agieren, sich fortlaufend ändern. Denken Sie nur an Ihre privaten Kontexte, an Ihr privates Umfeld und wie sich dieses im Laufe der Zeit verändert: von den Spielkameraden hin zu den Studienkolleginnen, hin zum Elternkreis und so fort. Wenn Sie sich gegenüber anderen Eltern auf einem Elternabend wie Spielkameraden verhalten würden, würden Sie vermutlich wenig bewirken.
Um das größtmögliche Zeitfenster des Gestaltens zu erkennen, das sich zu Beginn einer Veränderung öffnet, wäre ein ‚persönliches Frühwarnsystem‘ sehr hilfreich. Denn wer lieber gestalten will als gestaltet zu werden, sollte dieses frühe Zeitfenster nutzen. Sonst geht es uns wie den Fröschen in dem berühmt-berüchtigten Experiment – sofern es das in dieser experimentellen Form tatsächlich gegeben hat und die ganze Geschichte nicht ‚nur‘ eine Parabel ist: Versucht man einen Frosch in etwa 40 Grad heißes Wasser zu setzen, wird er sofort wieder herausspringen. Ganz anders ist dessen Verhalten, wenn man ihn in einen Topf mit kaltem Wasser setzt und diesen langsam auf 40 Grad erhitzt. Dann bleibt der Frosch weiterhin sitzen. Er merkt nicht, wann es für ihn zu spät wird, zu springen, weil er dann schon ‚weichgekocht‘ ist und seine Reflexe lahmgelegt sind: Somit kann uns das Boiling Frog Syndrom als Geschichte daran erinnern, sich frühzeitig mit aufkommenden Entwicklungen zu befassen und auf diese einzustellen.“
Ein Hinweis
Dieses Training und viele der hier dargestellten Übungen (nicht alle, z.B. Solarflight AG“, Seite 118 ff., nicht) können Sie sehr wohl auch online durchführen. Wir arbeiten derzeit mit dem virtuellen Whiteboard Mural, auf dem wir entsprechende Felder für die Gruppenarbeiten und Visualisierungen vorbereitet haben (einschließlich der jeweiligen Instruktionsfragen). Andere virtuelle Kollaborations-Plattformen sind beispielsweise Miro, Conceptboard, Klaxoon. Sie alle sind geeignet, virtuelle Trainings professionell durchzuführen. Für Gruppenarbeiten bieten sich im virtuellen Format die Breakout Sessions hervorragend an. Die Gruppen können dabei automatisch oder manuell zusammengestellt werden.
Quellen
Dersch, Freibichler, Pannes & Zacherl: Management Kompass 2020. Starke Führung ist der wichtigste Erfolgsfaktor für erfolgreiche Transformation (Porsche Consulting). In: Organisationsentwicklung Heft 4 2020.
Zeitschrift Organisationsentwicklung, Nr. 4/20: Unter Spannung – Ambidextrie als Zukunftsgarant.
von Kyaw, F. (2010): Change-Management-Studie 2010. Capgemini Consulting.
I.2 Kennenlernen, Veränderungserfahrungen teilen, Themen sammeln und priorisieren
Orientierung
Ziele
Die Teilnehmenden lernen einander kennen, erste Veränderungserfahrungen werden geteilt
Die Teilnehmenden können Themenwünsche/Fragen ergänzen
Themenpunkte werden gegebenenfalls priorisiert
Zeit
60 Minuten
Material
Pinnwand mit Mind-Map zur Visualisierung der Veränderungserfahrungen der Teilnehmenden
Pinnwand mit den vorab zugesandten Themenwünschen
Post-its für ergänzende Themenwünsche
Intro
„Soweit dies zur Orientierung. Mich selbst etwas ausführlicher vorstellen würde ich gerne in unserer gemeinsamen Check-in-Runde … und danach dann Organisatorisches und die Agenda präsentieren, einverstanden? Denn jetzt bin ich vor allem auch neugierig auf Sie, auf unsere kollegiale Runde für die nächsten sechs Tage, auf Ihre Veränderungserfahrungen und natürlich auch auf Ihre Themenwünsche. Diese haben Sie mir ja teilweise schon im Vorfeld zukommen lassen und entsprechend habe ich sie hier geclustert.“ – Sofern das abgefragt wurde, verweisen Sie auf die vorbereitete Wand.
„Wenn noch Wünsche dazugekommen sind, wenn Sie bestimmte Themen unterstreichen möchten, weil sie Ihnen besonders wichtig sind, dann bitte dies jetzt gleich beim Check-in nochmals erwähnen. Natürlich haben wir auch später noch Raum für Themenwünsche, aber es hilft mir für meine Planung sehr, wenn ich eine Übersicht bekommen und so Ihre Themenwünsche bestmöglich in die Agenda einflechten kann. Hier also zum weiteren Ankommen die Übersicht Ihrer Themenwünsche: …“ – Diese sollten Sie nun vorstellen.
Teilnehmende, die im Vorfeld keine Zeit gefunden haben, ihre Themenwünsche zu senden, können sie jetzt selbstverständlich an dieser Stelle noch einbringen.
Weiteres Einstimmen auf die Check-in-Runde
Die kommende Übung, wie nahezu alle der nachfolgend aufgeführten Methoden, kann aus der Erfahrung und Sicht der Autorinnen sowohl analog als auch digital durchgeführt werden. Wenn dazu bei Ihnen Fragen auftauchen, setzen Sie sich doch bitte einfach mit den Autorinnen in Verbindung.
Veränderungserfahrungen teilen
„Spätestens an den Themenwünschen hier sieht man: Wir sind alle, was Veränderungen betrifft, keine unbeschriebenen Blätter mehr. Letztlich hat jeder Jugendliche spätestens ab seinem 16. Lebensjahr erste Veränderungserfahrungen hinter sich: Das kann ein Schulwechsel sein, ein Umzug der Eltern mit Ortswechsel, der Hormonwechsel, der Wechsel des Freundeskreises oder schlimmstenfalls auch der Verlust eines geliebten Menschen. Im jungen Erwachsenenalter kommen dann weitere Veränderungserfahrungen wie der Abschluss des Studiums, Eintritt in die Berufswelt mit Veränderungsphänomenen wie ‚Praxisschock’ oder die Familiengründung hinzu …
Gemäß den bereits beschriebenen Voraussetzungen für gelingende Veränderungsprozesse ergibt es Sinn, wenn man bei anderen etwas verändern möchte, zuallererst auf sich selbst zu schauen: auf die eben angesprochenen eigenen Veränderungserfahrungen, auf die eigenen Einstellungen und die eigenen Glaubenssätze zum Thema. Dies werden wir im Verlauf dieses Trainings immer wieder tun. Und daher bitte ich Sie nun, über sich selbst zu sprechen – und über Ihre Veränderungserfahrungen. Zum Check-in, zum Ankommen und Einsteigen in unsere Themen sollten wir uns Zeit dafür lassen.“
Wir machen hier keine konkreten Zeitangaben, damit sich niemand unter Druck gesetzt fühlt – das wäre für das Thema und die eigene Ehrlichkeit nicht hilfreich. Falls wir als Trainerinnen beginnen, können wir den Zeitrahmen mit etwa 3-5 Minuten vorleben.
„Denn ich bin sicher, dass wir uns bereits in dieser ersten Runde viele Erkenntnisse rund um unser Thema vergegenwärtigen können. Daher werde ich auch einige Ihrer Erfahrungen mitvisualisieren … Also, dann packen wir es an.“
Als Trainerin können Sie nun die Check-in-Fragen vorlesen – verbunden mit dem Hinweis: „Erkenntnisse können zum Beispiel die Veränderung einer Einstellung sein, die eines persönlichen Glaubenssatzes oder eben auch generelle Erkenntnisse nach dem Motto: ‚Besonders schwer fand ich, ist …‘“
Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Teilnehmenden noch ein wenig Zeit zum Ankommen brauchen, beginnen Sie selbst mit der Beantwortung der Fragen. Wenn hingegen ein Teilnehmender schon „so schaut“, als könne er loslegen, dann sollte er auch die Gelegenheit bekommen. Sie erwähnen lediglich, dass Sie sich als Trainerin ebenfalls einreihen werden.
Falls noch ergänzende Themenwünsche genannt werden, schreiben Sie diese auf Moderationskärtchen mit. Die Erfahrungen der Teilnehmenden visualisieren Sie parallel via Mind-Map.
I.3 Debriefing: Mind-Map zum Check-in
Orientierung
Ziele
Die Teilnehmenden lernen einander kennen, erste Veränderungserfahrungen werden geteilt
Die Teilnehmenden können Themenwünsche/Fragen ergänzen
Themenpunkte werden gegebenenfalls priorisiert
Zeit
60 Minuten
Material
Pinnwand mit Mind-Map zur Visualisierung der Veränderungserfahrungen der Teilnehmenden
Pinnwand mit den vorab zugesandten Themenwünschen
Post-its für ergänzende Themenwünsche
Beim Aufbau der Mind-Map zum Check-in orientieren Sie sich an vier Dimensionen:
1.Zum einen gilt es zu zeigen, dass es selbstinitiierte Veränderungsprozesse gibt (Hochzeit, Elternschaft, Jobwechsel …), mit deren Folgen umzugehen einem meist deutlich leichter fällt als mit …
2.von anderen initiierten Veränderungsprozessen (Trennung, Kündigung, Umstrukturierung, aber auch Tod eines nahestehenden Menschen): Mit dieser Art von Veränderungsprozessen, durch die wir verändert werden und die folglich auch Krisen auslösen können, fällt es uns ungleich schwerer, zurechtzukommen.
3.Verdeutlichen Sie, dass man den größten Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten hat, wenn man Veränderungen im Kontext genau beobachtet.
4.Eine wichtige Erkenntnis wird zudem sein, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Veränderungen reagieren – auschlaggebend sind dabei oft bisherige Veränderungserfahrungen (Ist man in seinem Berufsleben bereits viermal umgezogen, wird der nächste Umzug schon fast zur Routine).
Dementsprechend zeichnen Sie bei der Mind-Map zwei dicke Äste (einen für „selbstinitiierte Veränderungen“ und einen für „geändert werden“), denen Sie abstrahiert entsprechende Beispiele zuordnen. Die Äste beschriften Sie zu Beginn erst einmal nicht; dies könnte irritieren nach dem Motto: „Muss mein Beispiel da jetzt reinpassen?“ oder Druck bei den Teilnehmenden auslösen. Der dritte dicke Ast darunter ist für „Erkenntnisse“ da. Diesen kann man bereits vorher beschriften. Gegebenenfalls umkreisen Sie Erkenntnisse im Debriefing dann noch, um diese hervorzuheben.
Zum Abschluss lässt sich das Chart „Wer immer der/die Gleiche sein will, muss sich ändern“ noch für das Debriefing und die Zusammenfassung nutzen. Das Debriefing ist selbstverständlich von den Aussagen der Teilnehmenden abhängig. Betonen Sie dabei insbesondere die Erkenntnisse und bedanken Sie sich für die Offenheit und die Bereitschaft, Erfahrungen zu teilen:
„Denn gerade dieses Training gewinnt ganz enorm durch Ihre Bereitschaft, eigene Erfahrungen und damit auch eigenes Wissen und eigene Erkenntnisse zu teilen. Dass Sie bereit sind, dies zu tun, haben Sie soeben schon gezeigt … Damit wir das auch gemeinschaftlich klären, möchte ich Ihnen nun nach der Pause einige Regeln der Zusammenarbeit für dieses Seminar vorschlagen bzw. mit Ihnen gemeinsam ausarbeiten.”
Quelle
Schmidt, G.: Persönliche Mitteilung im Workshop
Modul II – Orientierung ausbauen
Für die erfolgversprechende gemeinsame Arbeit im Training ist ein gemeinsam abgestimmter Rahmen extrem wichtig. Selbstverständlich sollte diese Rahmung Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Stil entsprechen: Wieviel Flexibilität und wieviel Sicherheit Sie selbst brauchen, spielt hier die entscheidende Rolle.
Spielregeln können auch gemeinsam erarbeitet werden, Zielsetzungen sehr abstrakt sein. Gleichwohl setzen wir die drei folgenden Ansätze zur Zusammenarbeit (8 Spielregeln) immer, weil sie aus unserer Sicht die Basis für die gemeinsam geteilte Verantwortung für das Gelingen des Trainings darstellen.
II.1 Zielsetzungen, Spielregeln, Agenda festlegen
Orientierung
Ziele
Die Teilnehmenden kennen die Zielsetzungen der Veranstaltung
Die Teilnehmenden kennen die Spielregeln, ergänzen diese gegebenenfalls und committen diese Regeln
Die Teilnehmenden werden ermutigt, Erfahrungen und Wissen zu teilen und auch Trainerinput kritisch zu hinterfragen
Die Teilnehmenden kennen die Agenda
Organisatorisches klären
Zeit
15 Minuten
Material
Flipchart mit Spielregeln
Pinnwand mit Agenda
Zielsetzungen vorstellen und anpassen
Die Zielsetzungen variieren natürlich je nach Anlass, Arbeitsauftrag und Zeitdauer des Seminars. Entsprechend müssen diese jeweils von der Trainerin selbst (re-)formuliert werden. Der Vorschlag zu den Zielsetzungen ist deshalb recht knapp und allgemein gehalten. Stellen Sie die Zielsetzungen kurz vor und fragen Sie nach, inwieweit die Teilnehmenden sich mit ihren Zielen generell hier wiederfinden.
Sich auf Spielregeln verständigen
Stellen Sie die auf Flipchart vorbereiteten Regeln vor.
„Für dieses Training ist Ihre Bereitschaft, eigene Erfahrungen und damit auch eigenes Wissen und eigene Erkenntnisse zu teilen, sehr von Nutzen. Dass Sie bereit sind, dies zu tun, haben Sie soeben schon gezeigt … Damit Sie dies auch weiterhin tun, möchte ich mit Ihnen gemeinsam nun auf die Spielregeln – oder den Arbeitsansatz – für diese Veranstaltung schauen. Die Regeln, die ich hier bereits aufgeführt habe, sind auch für mich wichtig. Ich brauche sie, um gut arbeiten beziehungsweise unsere Zusammenarbeit auf eine gute Basis stellen zu können. Ich werde Sie daher um Ihre Zustimmung zu diesen Regeln bitten, aber gleichzeitig bitte ich Sie auch, die Regeln entsprechend Ihrer Bedürfnisse zu ergänzen. Vorneweg habe ich gleich noch eine Bitte: Um unsere Erfahrungen und unsere Erkenntnisse zu teilen, braucht es eine vertrauensvolle Atmosphäre. Eine Basis, die dabei auch hilfreich sein kann, ist, dass wir uns in einer informelleren Weise begegnen. Diesbezüglich bitte ich darum, dass wir uns hier duzen. Ist das für Sie, für euch in Ordnung?“
Holen Sie sich dann das Einverständnis hierzu ab, sofern es nicht sowieso von Anfang an die Form der Zusammenarbeit war. Klar, das kann man sich als Trainerin auch schon früher abholen oder einfach von vorneherein tun.
„Mein erster Punkt lautet: ‚Jeder ist sein eigener Chairman‘. Damit bitte ich euch sozusagen, für euch selbst und eure Bedürfnisse der Vorstand zu sein und zu sagen, wenn euch etwas nicht passt, wenn etwas zu lang, zu kurz oder nicht nachvollziehbar ist. Ich vermute, dass ihr euch gewissermaßen die Zeit für diese Veranstaltung aus den Rippen schneidet – das ist übrigens aus unserer Erfahrung in mindestens 95 Prozent aller Fälle so. Dass vermutlich niemand sonst eure Arbeit erledigt, während ihr hier seid. Also muss dieser Workshop für euch möglichst viel Nutzen stiften. Damit das geschieht, werde ich darauf achten, dass eure Themenwünsche und Fragestellungenbearbeitet werden, aber ich brauche auch euer Feedback, inwieweit das für euch in angemessener Form geschieht – seid ihr also mit dieser Regel einverstanden?“– Holen Sie sich wieder ein Nicken von allen ab. „Damit übernehmt ihr also ebenso die Verantwortung für das Gelingen dieser Veranstaltung wie ich … und natürlich nehme ich auch gerne Feedback entgegen.
Meine zweite mitgebrachte Spielregel lautet: ‚Es gilt das Prinzip der Seminarglocke.‘ Will heißen: Persönliches, Privates und Vertrauliches bleibt hier in diesem Raum wie unter einer Käseglocke und wird nicht nach außen getragen. Das ist aus meiner Sicht vor allem wichtig, wenn es um persönliche Erfahrungen geht, aber auch um Mitarbeitende, Vorgesetzte … Eben um genau jene Erfahrungen, die wir hier teilen, um daraus lernen zu können. Und diese Regel gilt selbstverständlich auch für mich. Seid ihr mit dieser Regel einverstanden?“ – Holen Sie sich erneut das Einverständnis von allen ab.
„Falls hier einmal entgegen allen Erwartungen andere Erfahrungen gemacht werden sollten, dann bitte ich euch, das sofort anzusprechen. Wobei dies im Rahmen meiner Erfahrungen bisher immer sehr gut geklappt hat – und davon profitiert schließlich jeder von uns.
Die dritte hier von mir vorgeschlagene Regel lautet: ‚Jeder Blickwinkel und insbesondere auch gegensätzliche Meinungen sind wichtig!‘ Es geht mir darum, dass wir Erfahrungen und Meinungen wirklich nutzen! Wenn einer von uns die Erfahrung gemacht hat, dass etwas so funktionieren kann und ein anderer die Meinung vertritt, das funktioniere nicht, dann ist nicht einer von beiden Experten ‚blöd‘ oder ‚hat es halt noch nicht begriffen‘, sondern dann wird es erst richtig spannend. Wenn einer von uns ‚Praktizierenden‘ sagt, das geht, dann ist es für uns wichtig herauszufinden, unter welchen Umständen oder in welchen Kontexten es gehen kann! Und wo der Mehrwert unserer unterschiedlichen Erfahrungen liegen kann.“
Holen Sie sich auch hierfür das Commitment bzw. Nicken von allen ab; falls hier noch weitere Regeln gebraucht werden, nehmen Sie diese auf; falls irgendwo Dissens entsteht, würden wir den primär visualisieren und bei passender Gelegenheit darauf zurückkommen oder auch mit dem Dissens leben, wenn wir Themen nicht gemeinsam umsetzen müssen.
„Schön, vielen Dank. Welche ergänzenden Regeln braucht ihr nun noch, um gut arbeiten zu können?”
Zudem ist noch der folgende Hinweis ratsam: „Es wird ein digitales Fotoprotokoll von allen Charts geben: den gemeinsam erarbeiteten sowie derer, die von mir als Trainerin erarbeitet wurden. Wenn jemand nicht möchte, dass ein bestimmter visualisierter Sachverhalt ins Fotoprotokoll kommt, dannsprecht es bitte direkt an. Das entsprechende Chart wird dann aus dem Protokoll herausgenommen.“
Bei all den Regeln ist es wichtig,
zügig voranzukommen (deswegen müssen nicht alle bewährten Regeln gemeinsam neu erfunden werden),
für uns als Trainerinnen einen guten Kontext zum Arbeiten zu schaffen und
das auch für die Teilnehmenden sicherzustellen.
Häufig reichen diese drei Regeln. Sollten sich während des Seminars weitere Punkte ergeben, lassen sich diese jederzeit nachtragen.
Agenda
Die Agenda zur Veranstaltung vorstellen
Anschließend (oder auch schon davor, das ist Geschmackssache) stellen Sie als Trainerin die Agenda für die kommenden Tage vor, einschließlich Pausenzeiten, Organisatorisches (wo findet Mittagessen etc. statt?): „Das ist der Plan, der wird aber durch uns immer wieder gemeinsam weiterentwickelt und modifiziert. Hier fügen wir eure Themenwünsche ein, verweilen kürzer oder länger auf den einzelnen ‚Themeninseln‘, je nachdem, wie ihr euch das wünscht und priorisiert.“ – Selbstverständlich tun Sie das dann auch.
II.2 Meine Changeability und meine Lernziele
Orientierung
Ziele
Die Teilnehmenden vergegenwärtigen sich die eigenen Stärken, Bedürfnisse und Entwicklungswünsche in Bezug auf das Thema Changeability.
Die Teilnehmenden formulieren ihre konkreten Lernziele.
Zeit
Einzelarbeit: 5 Minuten
Partnerarbeit: 30 Minuten (15 Minuten pro Person)
Debriefing: 10 Minuten
Material
Kopien „Kompetenzprofil Changeability“, analog TN-Zahl
Hinweis
Wenn Sie diesen Baustein online durchführen wollen, beachten Sie bitte, dass das „Kompetenzprofil Changeability“ entweder entsprechend auf dem digitalen Whiteboard für jeden Teilnehmenden angelegt ist oder Sie laden das Dokument für alle in den Chat.
Je nach Schwerpunktsetzung des Seminars können Sie das Thema „Meine Changeability“ zur weiteren Erfassung und Bearbeitung der Lernziele der Teilnehmenden aufgreifen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Menschen im Rahmen eines Change-Prozesses steuernde Funktion übernehmen oder direkt betroffen sind. Dann ist die Selbstreflexion in Bezug auf eigene und die Bedürfnisse anderer besonders wichtig.
Das könnte so aussehen:
„Neben den ganz konkreten Themenwünschen, die ihr mitgebracht habt, schauen wir jetzt ergänzend noch auf eure ganz persönlichen Lernziele für unsere gemeinsamen Tage. Und zwar anhand unserer Metakompetenzen-Changeability. Ziel dieser Übung ist, sich die eigenen Stärken, Bedürfnisse und Entwicklungswünsche in Bezug auf das Thema Changeability klar zu vergegenwärtigen.“
Durchführung
„Bitte reflektiert zuerst für euch selbst anhand dieses Schemas und der Skala für ‚Wollen‘:
Wie kompetent schätzt ihr euch ein in Bezug auf …
Sich einfühlen, aufmerksam wahrnehmen, Musterveränderungen frühzeitig erkennen und auch Unangenehmes aussprechen?
Feedback nehmen und Lernen als fortlaufenden lebenslang notwendigen Prozess betrachten?
Erkennen, dass im Umgang mit Komplexität, Ungewissheit & Ambiguität Entscheidungen stets vorläufig bleiben?
Kollaboration und Rollenflexibilität als Mehrwert leben?
Mut zu Innovation, Fehlern und kalkulierbaren Risiken?
Stellt anschließend eurem ‚Seminar-Buddy‘ (dieser kann einfach als Partner spontan von jedem gewählt oder auch gelost werden) eure Einschätzungen zum Thema gegenseitig vor und beschreibt dann jeweils, woran ihr eure Einschätzungen festmacht. Haltet anschließend ggf. ein bis zwei persönliche Lernziele für euch fest.“
Zu jedem dieser Punkte können Sie Beispiele bringen, um diese zu veranschaulichen, etwa unter dem Stichwort …
Musterveränderungen, z.B. das Thema „Remote Arbeiten“ während des Corona-Lockdowns: Wieweit haben Kolleg:innen über die Zeit Musterwechsel im Verhalten anderer Kollegen wahrgenommen und angesprochen?
Feedback nehmen und Lernen: Wieweit haben Teilnehmende angesprochen, wenn sie etwas Neues lernen mussten – ein neues System – und dies nicht verstanden haben?
Entscheidungen vorläufig treffen: Corona-Themen oder auch Prozess-Innovationen bieten jede Menge von Beispielen.
Rollenflexibilität: Wie erging es Führungskräften in „nicht-machtvollen Rollen“, etwa als Projektteammitglied zuzuarbeiten und nicht über die finale Entscheidungsmacht zu verfügen?
Mut zu Fehlern: Wieweit wurde etwas Neues ausprobiert und man musste sich schließlich eingestehen, dass die Idee nicht sinnvoll war und nicht fortgesetzt wurde (siehe auch „Entscheidungen“)?
Bitten Sie anschließend die Teilnehmenden, noch die Aspekte „Können“ und „Dürfen“ zu diskutieren: „Für welche Situationen im Veränderungsprozess könntet ihr noch Ideen, Modelle oder Tools gebrauchen?“
Bitten Sie ggf. darum, auch hier noch ein bis zwei persönliche Lernziele festzuhalten und, falls die Teilnehmenden es möchten, diese weiteren persönlichen Lernziele auch noch bei den Themenwünschen zu ergänzen.
Für diese Partnerarbeit kann man 15 Minuten pro Person definieren.
Debriefing
Ein Debriefing kann anhand folgender Fragen eingeleitet werden:
Welche weiteren Aspekte habt ihr bei diesem Thema entdeckt, die ihr teilen wollt?
Welche Themenwünsche wollt ihr ggf. ergänzen?
Vorlage Kompetenzprofil Changeability
Download-Ressource
Modul III – Erfolgsfaktoren für das Gelingen des Wandels
Erfolgsfaktoren für das Gelingen des Wandels: Das klingt vielversprechend. Und gleichzeitig möchten wir vorneweg offen unsere Überzeugung mit Ihnen teilen: Wir finden es wichtig, sich diese Faktoren zu vergegenwärtigen und sich nach allen Regeln der Kunst und des Veränderungshandwerks zu engagieren.
Und gleichwohl demütig zu bleiben. Was wirksam werden kann, wissen wir nicht im Vornehinein. Wir haben in der Praxis oft erlebt, dass sich die Faktoren, die wir im Folgenden bearbeiten, als hochrelevant für das Gelingen des Veränderungsprozess gezeigt haben. Und wir empfinden diese als eine Art hilfreiches Geländer, an dem man sich orientieren kann.
III.1 Intro und Gruppenarbeit: Unsere Erfahrungen zu Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen
Orientierung
Ziele
Bewusstsein schärfen für persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse der Teilnehmenden zu den Erfolgsfaktoren für das Gelingen von Veränderungsprozessen
Zeit
Intro: 5 Minuten
Gruppenarbeiten: 20 Minuten Partnerarbeit
Präsentation und Diskussion: 30 Minuten
Material
Ein Fußball
Post-its, Stifte
Je eine Pinnwand pro Gruppe
Hinweis
Wenn Sie diesen Baustein online durchführen wollen, beachten Sie bitte, dass jede Gruppe auf dem digitalen Whiteboard einen eigenen Arbeitsbereich hat, um die zehn wichtigsten Gemeinsamkeiten festzuhalten.
Hinweis
Bei Zeitschätzungen für Übungen, die im Rahmen des Trainings durchgeführt werden, sollten Sie davon ausgehen, dass unterschiedliche Teilnehmende aus unterschiedlichen Unternehmen anwesend sind und dass Sie die Methoden hier gemeinsam eher ausprobieren, als mit ihnen finale Ergebnisse auszuarbeiten. Wenn finale Ergebnisse ausgearbeitet werden, auf denen Unternehmen (Bereiche/Teams) ihre Veränderungsprozesse aufbauen bzw. diese entsprechend integrieren, dann dauert der Methodeneinsatz oft deutlich länger (siehe das Beispiel „Analyse der Unternehmens-Historie“, Seite 85).
Sorgen Sie vorab dafür, dass Alle schon ihr Namensschild beschriftet und sich ein wenig „häuslich“ niedergelassen haben. Dann beginnen Sie:
Intro
„Bevor wir jetzt fortfahren, bitte ich euch eben noch um Folgendes: A (nna), bitte setze dich doch hier vorne hin, B (ernd) bitte an den Platz von C. Und D, dich hätte ich gerne hier am Platz von Z. Und Z …”
Je nach Reaktion der Teilnehmenden (Fragezeichen in den Augen …) stoppen Sie den „Ansatz“ direkt wieder, um folgendermaßen fortzufahren:
„Womöglich wundert ihr euch jetzt, wieso ich um diese Platzveränderungen gebeten habe. Nun, das hatte keinen tieferen Sinn. Er war lediglich eine kleine Kostprobe dessen, was in Veränderungsprozessen allzu oft vorkommt: Die Mitarbeitenden werden gebeten, etwas anders zu tun, sich zu verändern. Aber es wird ihnen nicht erklärt, wo der Sinn des Ganzen liegt oder gefragt, ob sie das als sinnvoll empfinden. Möglicherweise wird ihnen erklärt, was passieren wird, wenn sie ‚es‘ nicht tun – mehr in Form einer Drohung als einer Sinnstiftung. Frei nach Karl Valentin kann man dann zwar sagen ‚Früher war auch die Zukunft viel besser‘, doch das motiviert natürlich auch nicht, die Veränderung zu vollziehen. Ebenso wenig, wie ihr gerade motiviert ward, die von mir angesprochenen Veränderungen eurer Sitzplätze vorzunehmen. Wenn Menschen etwas verändern sollen – was auch immer –, dann brauchen sie dafür zuallererst einen Sinn. Sinnstiftung stellt auf einer generellen Meta-Ebene dar, was Nutzenstiftung auf einer individuellen Ebene bedeutet. ‚Menschen arbeiten für Geld, sie sterben für einen Sinn!‘, besagt der Volksmund. Eine wahrlich drastische Aussage und ich weiß nicht recht, ob das ein gutes Beispiel ist. Ein eindrückliches ist es auf alle Fälle.
Was das Thema ‚Drohen‘ auslöst, möchte ich an einem anderen Beispiel verdeutlichen, mit Blick auf diesen Fußball hier.“ – Präsentieren Sie nun einen Fußball.