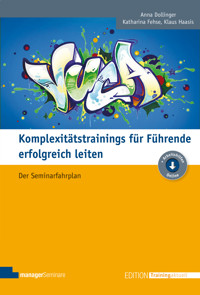
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Edition Training aktuell
- Sprache: Deutsch
Die enorme Komplexität des Umfelds, in dem wir agieren’ wird von den meisten Führungskräften oder Beratern als die größte Herausforderung unserer Zeit gesehen. Digitalisierung, New Work, Internet of Things, Big Data, Disruption - die Welt ändert sich dramatisch und wir müssen uns neu erfinden: als Organisation, als Team und als Führende. Wie wir dies tun können, wie wir als Impulsgeber und Führende in VUCA-Welten erfolgreich und kraftvoll agieren können, dafür setzt dieser Seminarfahrplan nun Wegweiser. Über drei Seminartage hinweg arbeiten Sie mit Mindsets und Metaphern, spielen mit Methoden, die unter die Haut gehen und bieten Ihren Teilnehmenden Strategien an, die auch in komplexen Welten Erfolg versprechen.
Das dreitägige Führungstraining stellt Ihnen einen erprobten roten Faden zur Verfügung und ist einsatzfertig: Die Durchführung des Trainings wird praktisch beschrieben und dazugehörige Handouts stehen Ihnen als Download-Ressource zum Buch zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung. In dem Training wird den Teilnehmenden das grundlegende Wissen über Komplexität vermittelt, d.h. Wissen über die Anforderungen und den Umgang mit einer digitalisierten 'VUCA'-Welt. Der Kern den Trainings ist das Vermitteln der wesentlichen Kompetenzen, die für diesen Umgang mit Komplexität gebraucht werden.
Dadurch, dass das Training modular aufgebaut ist, kann es einfach angepasst werden, Module lassen sich problemlos entnehmen oder neu einfügen. Dazu werden Ihnen im zweiten Teil des Buches weitere 22 Trainingsmodule zur Verfügung gestellt, mit denen Sie Ihr Training zusätzlich ergänzen können. Diese Module vertiefen einzelne Komplexitätskompetenzen. So können Sie Ihre Komplexitätstrainings jederzeit an spezifische Wünsche Ihrer Auftraggeber anpassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Dollinger, Katharina Fehse, Klaus Haasis
Komplexitätstrainings für Führende erfolgreich leiten
Der Seminarfahrplan
© 2019 managerSeminare Verlags GmbH
2. Auflage 2022
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-977910
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN: 978-3-98856-223-4
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat: Ralf Muskatewitz, Vera Sleeking
Gezeichnete Grafiken: Klaus Haasis
Cover: Designstudio Eminent: Emin Hasirci
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Ihre Download-Ressourcen
Begleitend zum Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen für die persönliche Verwendung zum Download im Internet zur Verfügung. Sie können die Vorlagen jederzeit in hoher Qualität abrufen und einsetzen.
www.managerseminare.de/tmdl/b,268485
Inhalt
Cover
Impressum
Ein Blick auf die Landkarte: Was es hier gibt
Orientierung: Wo finden Sie was?
Teil 1: Komplexität „in a Nutshell“
Vor dem Seminarbeginn: Die Methode Flipped Learning Offer
Der erste Seminartag
Intro & Die Teilnehmer abholen
2+1 Wertschätzungs-Dialog
Landkarte „Komplexitätsmanagement“ erstellen
Branding und Selbstreflexion mit der Selbstpyramide
Working Out Loud – Die 5 Prinzipien
Weitere „Wer ich als FührendeR und NetzwerkerIn bin“-Reden
Working Out Loud – Wir tun es
Die Vernetzungslandkarte – Im Netzwerk wirksam sein
In Resonanz sein: (Check-in/)Check-out
Zur Vorbereitung des nächsten Seminartags
Der zweite Seminartag
Glaubenssätze in der Wissenschaft und der wissenschaftliche Anstrich von Glaubenssätzen
Riemann-Thomann-Modell – Reloaded II
Weitere „Wer ich als FührendeR und NetzwerkerIn bin“-Reden
„Erste Ernte“: Austausch mit dem Seminar-Buddy
Alles Leben ist Problemlösen
Komplexität: Mehrere Definitionen und (k)eine Wahrheit
Impulse für Führende
Selbstorganisation und Komplexität
Muster wahrnehmen, ausmustern, verstärken
Wrap-up mit Poll Everywhere
Der dritte Seminartag
Alles Musterbrecher, … oder was?
Gewinnen Sie so viel wie möglich
Unterschiede kapitalisieren: Kooperation & Kollaboration als Erfolgsfaktor
Ambiguität & Ambivalenz nutzen: Das Tetralemma als Entscheidungshilfe
Das Agilitätsprofil: Definieren, evaluieren und entwickeln
Unsere „Landkarte Komplexitätsmanagement“ weiter ergänzen
Unterschiedlichkeit nutzen: Feedback 4.0
Teil 2: Baukasten für Komplexitätstrainings
Kultur zum Umgang mit Komplexität umbauen
Ansatzpunkte zur Kulturveränderung
Das Agile Manifest: Eine Standortbestimmung
Entscheidungen vergemeinschaften
Entscheidungen: System 1 und System 2 nutzen
Co-Kreation von Entscheidungen
Entscheidungen als Produktentwicklungsprozess
Die Pugh-Matrix und die Co-Kreation der Entscheidungskriterien
Slackline
Scrum-Poker
Spielen mit Organisation und Agilität
Das Ball Point Game
Arbeiten mit dem Cynefin-Modell
Flaschentornado: Eine Übung zum Thema „Selbstorganisation“
Unsicherheit und Ambiguität nutzen
Start-up als Lösungsprinzip
Ambiguität und das kontinuierliche Zwickmühlen-Management
„Ja, und“ – Improvisationsübung
Das Ungewissheitsprofil
Wirken im komplexen Umfeld
Das Minimal Viable Team
Was das Team-Canvas und ein Kühlschrank gemeinsam haben
Methoden der Zukunftsgestaltung: Das „Effectuation Grid“
Hackathon
Selbstreflexion: Boost your Buster
Von der Fehlerkultur zur Lernkultur
Delta-Talk – Über die Veränderungen sprechen
Feedback und Lernen – die Seestern-Methode
Stichwortverzeichnis
Orientierung: Wo finden Sie was?
Der erste Teil dieses Buches ist ein vollständig ausgearbeitetes, dreitägiges „offenes“ Komplexitätstraining. „Offen“, weil dieses Training sich dafür eignet, die Teilnehmenden grundlegend für das Thema und die Anliegen von „Komplexität“ fit zu machen – ohne dass ein ganz konkretes Unternehmensziel dahinter steht. Dieses Training bietet sich also auch dann an, wenn Sie beispielsweise Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen in einer Gruppe haben.
Wir empfehlen, die Teilnehmenden ein bis zwei Tage vor dem dreitägigen Präsenztraining darauf vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird zunächst eine „Flipped Learning Offer“ vorgestellt (FLO). Dabei handelt es sich um einen interaktiven Lernpfad, der von den Teilnehmenden komfortabel von zu Hause aus durchwandert werden kann und der sowohl Sie als Trainer vorstellt als auch in die wichtigen Kernbegriffe rund um das Thema „Komplexität“ einführt (S. 15).
Die nächsten Unterkapitel sind der erste Seminartag (S. 29), der zweite Seminartag (S. 81) und der dritte Seminartag (S. 151). Sie finden die jeweilige Tagesagenda zu Beginn jedes Seminartages. Dieses modulare Training vermittelt Führenden Komplexität „in a Nutshell“.
Sollten hinter Ihrem Training nun die konkreten Ziele und aktuellen Bedarfe eines Unternehmens stehen, dann passen Sie das Training nach dem Baukastenprinzip an. Mit den modularen Methoden und Tools aus dem zweiten Teil des Buches fügen Sie Ihr Training so zusammen, dass es den spezifischen Schwerpunkten Ihres Trainingsauftrags entspricht.
Zu diesem Zweck erhalten Sie dort Module, mit denen verschiedene Komplexitätskompetenzen trainiert werden. Wollen Sie beispielsweise in einem Unternehmen die Feedback-Kultur verbessern, so setzen Sie in Ihrem Komplexitätstraining einen Schwerpunkt auf „Selbstreflexion“ und bauen verstärkt die Module zum Thema „Selbstreflexion“ aus dem zweiten Teil des Buches ein (s. S. 335 ff.). Soll im Unternehmen das Thema „Kultureller Change“ angegangen werden, so empfehlen wir, entsprechend Module aus dem Themenbereich „Kultur zum Umgang mit Komplexität ausbauen“ (s. S. 199 ff.) in Ihr Training einzubauen.
Sie werden feststellen, dass die im zweiten Teil des Buches vorgestellten Module mit dem Themenbereich Kultur/Haltung beginnen, weil wir diese für das Thema Komplexität in Unternehmen grundsätzlich als sehr wichtig erachten und Ihnen besonders ans Herz legen möchten.
Sind Sie auf der Suche nach bestimmten inhaltliche Schwerpunkten oder Begriffsdefinitionen, empfehlen wir Ihnen, auf das Stichwortverzeichnis am Ende dieses Buches zurückzugreifen (s. S. 359).
Für Ihr Komplexitätstraining stehen Ihnen außerdem zusätzliche Materialien wie Handouts zum Herunterladen zur Verfügung. Geben Sie dafür den Link, der vorne im Impressum dieses Buches steht, in Ihre Browserzeile ein – oder klicken Sie auf das Pfeilsymbol. Folgen Sie der Downloadroutine, nachdem Sie sich registriert haben. Alle Dokumente, die Ihnen online als Download-Ressource zur Verfügung stehen, sind in diesem Buch mit dem nebenstehenden Pfeilsymbol gekennzeichnet.
Teil 1Komplexität „in a Nutshell“
Der erste Teil dieses Buches bietet Ihnen ein vollständig ausgearbeitetes, dreitägiges „offenes“ Komplexitätstraining. „Offen“, weil dieses Training sich dafür eignet, die Teilnehmenden grundlegend für das Thema und die Anliegen von „Komplexität“ fit zu machen – ohne dass ein ganz konkretes Unternehmensziel dahinter steht. Dieses Training bietet sich also auch dann an, wenn Sie beispielsweise Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen in einer Gruppe haben.
Zu Beginn wird eine „Flipped Learning Offer“ vorgestellt, mit der Sie die Teilnehmenden ein bis zwei Tage vor dem dreitägigen Präsenztraining vorbereiten können. Die „Flipped Learning Offer“ führt in die wichtigen Kernbegriffe rund um das Thema „Komplexität“ ein. Darauf folgt ein dreitägiges Präsenztraining. Die jeweilige Tagesagenda finden Sie zu Beginn jedes Seminartages.
Vor dem Seminarbeginn: Die Methode Flipped Learning Offer
Orientierung
Ziele
Die Teilnehmer auf die Inhalte des kommenden Trainings vorbereitenDie Teilnehmer zu Fragen und Themenwünschen anregenLust auf das kommende Training machenDie (kommende) kostbare Präsenzzeit so effektiv und effizient wie möglich nutzenZeit zur Erstellung
Für eine 30-minütige FLO werden etwa ein bis vier Tage Erstellungszeit benötigt (je nach Übung)
Material
Zum Erstellen brauchen Sie: ein Storyboard; das Präsentationsprogramm Prezi; zum Aufnehmen von Videos: Smartphone/Kamera, Stativ, Mikrofon; Videoschnittsoftware (z.B. von Microsoft: Windows Movie Maker ©Microsoft Corporation); diverse Videos oder Tutorials (z.B. über Link zu den Videoportalen YouTube.com, Vimeo.com), Erklärvideos (z.B. von Angela Recino: Bewegte Kommunikation: www.bewegtkommunikation.de/erklaervideo)
Hinweise
Auf den ersten Blick erscheint die Vorbereitung etwas aufwendig. Das Feedback vonseiten der Teilnehmer ist jedoch sehr, sehr positiv. Kommentare waren zum Beispiel „In Papierform hätte ich das niemals durchgearbeitet“ oder „Das hat richtig Spaß gemacht, das anzuschauen, das war keine Arbeit“ oder „Sehr gut war, dass ich mir das Ganze auch im Nachhinein nochmals anschauen konnte. So habe ich das Modell richtig gut verstanden“. Im Netz finden Sie entsprechende Tipps, die Ihnen helfen, eine Prezi aufzubauen. Um eine logische und gut verständliche FLO zu erstellen, arbeiten wir mit einem Storyboard. Der nachfolgende Vorschlag stellt ein solches Storyboard vor.
Erläuterung
Die Flipped-Learning-Offerte (oder „Flipped Learning Offer, FLO) ist ein Blended-Learning-Format, bei dem Inhalte des kommenden Trainings in einem interaktiven Lernpfad zusammengeführt werden. Die FLO wurde als Tool von Anna Dollinger entwickelt.
Das Format stellt eine didaktisch höchst sinnvolle und wirksame Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und in weitestem Sinn von E-Learning dar. Es verbindet die Effektivität und Flexibilität von elektronischen Lernformen und „Lernen on demand“ mit den Aspekten der Face-to-Face-Kommunikation sowie dem praktischen Lernen.
Die Inhalte der Präsenzphasen und der FLO werden durch den Trainer unternehmensspezifisch kuratiert und funktional aufeinander abgestimmt. Dadurch wird die Menge der Informationen reduziert und sie werden so dargeboten, dass sie „leicht aufnehmbar“ sind. „Leicht aufnehmbar“ auch deswegen, weil die FLO zeitlich und räumlich flexibel, also „on demand“, durch die Teilnehmer des Trainings abgerufen werden kann. Optimalerweise ist sie ein wirklicher Appetitanreger und auch als digitales Vor- und Nachbereitungstool und Wiki für Trainings und Seminare bietet sie einen echten Mehrwert. In der vom Trainer erstellten Prezi können im Seminar zum Einsatz kommende Modelle und Techniken präsentiert werden. Auf diese Weise fördert eine FLO den Lerntransfer, macht die Präsenzphase wesentlich effizienter und kann die sogenannte „Transferlücke“ deutlich verringern.
In dem nachfolgend beschriebenen Beispielfall wurde eine etwa 30-minütige multimediale Präsentation erstellt, die die Teilnehmer bereits vor Trainingsbeginn erhalten. In ihr werden Nutzen und Inhalt des bevorstehenden Komplexitätstrainings vermittelt. Es werden die Trainer vorgestellt, kurzweilig ins Thema eingeführt und schon eine Vorbereitungsaufgabe formuliert, die im Präsenztraining später verbindlich aufgegriffen werden soll.
Der Einsatz der FLO wurde von den Teilnehmern sehr begrüßt. Besonders betont wurde das entspannte und anregende Lernen, die Möglichkeit, sich an den unterschiedlichsten Orten und Zeiten vorzubereiten, die gezielte Anregung, sowohl zu Fragen und Anliegenarbeit bzw. kollegialer Beratung („Das hat mich angeregt, folgende Frage/folgendes Anliegen mitzubringen“) als auch dazu, Themen nachzubereiten („Gestern Abend habe ich mir das noch mal angeschaut und dabei ist mir klar geworden, …“).
Zur besseren Nachvollziehbarkeit greifen wir dem Erstellungsprozess vor und stellen Ihnen direkt den Link zu unserem Entwurf der FLO für das Seminar „Komplexitätsmanagement für Führende“ zur Verfügung. Sie können diese FLO als beispielhaften Ideengeber für Ihre eigene FLO nutzen, indem Sie diese in einer eigenen Prezi „nachbauen“: https://prezi.com/view/CpZUz9HMVIoxHOKeBVWh/
Vorgehen
In den Download-Ressourcen zu diesem Buch finden Sie einen Vorschlag für eine E-Mail-Formulierung, mit der Sie Ihre Teilnehmenden zu Ihrer Flipped-Learning-Offer einladen. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie als Trainer ein Storyboard für eine FLO erstellen können, mit der Ihr Komplexitätstraining vorbereitet wird. Präsentiert werden soll die FLO dann mithilfe der Präsentationssoftware Prezi.
Über das Storyboard legt man Inhalte und Reihenfolge der Präsentation fest. Im Beispielfall gliedert sich das Storyboard in fünf Stationen:
Anleitung zur Nutzung der FLO (hier in Textform, die Anleitung kann beispielsweise mit Bild des Unternehmens und Firmenlogo ergänzt werden. Die Betrachtungsdauer ist max. eine Minute).
Begrüßung & Sinnstiftung: zum Beispiel durch den Trainer, durch die Leitung des Bereichs Führungskräfte-Entwicklung (dies kann z.B. als Video angelegt werden, Laufzeit: max. drei Minuten).
Die VUCA-Welt: Erklärung des Begriffs; Sprechertext plus Slideshow (hier: sieben Minuten Laufzeit)
Definition „Führende“ (zum Beispiel als Erklärvideo, ca. drei Minuten Laufzeit. Dazu gibt es etwa ein Erklärvideo von unserer Kooperationspartnerin Angela Recino „Bewegte Kommunikation“, www.bewegtkommunikation.de/erklaervideo)
Vorbereitungsaufgabe: „Eine Brand als FührendeR und NetzwerkerIN entwickeln“ (Tutorial einsprechen und außerdem als Dokument zur Verfügung stellen. Informationsaufnahme: fünf bis zehn Minuten).
Anleitung zur Nutzung der FLO
Hier der Vorschlag für einen Anleitungstext: Gerade hören Sie also in Ihre Flipped-Learning-Offerte rein. Und vielleicht fragen Sie sich: Was soll das bringen?
Nun, indem wir die Digitalisierung nutzen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich ohne Papierkram und lästige Ordner auf das kommende Seminar inhaltlich einzustimmen.Sie können dies zeit- und ortsunabhängig tun: Vielleicht sind Sie gerade im Zug oder auch zu Hause in einem gemütlichen Sessel …Wir können die kostbare Präsenzzeit besser im Training für den Austausch miteinander nutzen, indem wir uns im Vorfeld auf die Themen des Trainings einstimmen …und Sie damit hoffentlich zu konkreten Fragen und Überlegungen für den Austausch in unserer Gruppe inspirieren.Sie können sich anhand der Pfeile unten durch die ca. 30-minütige Präsentation klicken oder sich an den grünen Würfeln orientieren, die die Kernmodelle kennzeichnen. Durch Wischen und Zoomen können Sie jederzeit an gewünschten Stellen wieder in Ihre FLO einsteigen.Immer, wenn Sie auf der Prezi weitergehen möchten, klicken Sie einfach auf den Pfeil unten.Begrüßung & Sinnstiftung
Dieser Teil wird am besten von der PE und vom Trainer als Video erstellt. Die Leitung Führungskräfteentwicklung oder gar der Geschäftsführer begrüßt, informiert über Ziele und Hintergrund zum Training und stellt den/die Trainer vor. Dies kann beispielsweise per Video geschehen. Je nach Bedeutsamkeit der einführenden Person kann das hohen Einfluss auf den wahrgenommenen Stellenwert des Seminars haben. In einem weiteren Video kann/können sich der/die Trainer vorstellen. Die Trainervorstellung schafft Vertrauen und vermittelt Kompetenz.
VUCA – Wofür steht der Begriff?
Hier bietet sich eine Slideshow an. In unserem Beispiel ist der erste Fachinput eingesprochen und wird durch eine Slideshow-Bebilderung unterstützt. Das macht die Vermittlung von Fachinhalten kurzweiliger als eine reine Textdarstellung. Hier der Text:
„Vierte industrielle Revolution, Digitalisierung, New Work: Diese Begriffe signalisieren ‚Die Welt ändert sich – und wir müssen uns neu erfinden! Als Unternehmen, als Team und als Führungskraft. Denn Führung, die ihren Bezug zum Umfeld verliert, wird unwirksam. Ziel unseres Trainings ist es, sich mit den aktuellen und sich abzeichnenden Anforderungen dieses Umfelds auseinanderzusetzen: die eigene Rolle als Führungskraft zu reflektieren sowie das eigene Handlungsspektrum bewusst und gezielt zu nutzen.
Unternehmen als Organisationen, wie wir sie heute kennen, haben ihren Ursprung im Militär, im römischen Heer, das zum Rollenmodel für die katholische Kirche und später für Industrieunternehmen wurde. Begriffe wie Chief Executive Officer oder Finance Officer erinnern daran. Diese Organisationen waren gekennzeichnet durch klare Strukturen, hohe Stabilität und eine klare hierarchische Kommunikations- bzw. Entscheidungskultur. Das römische Militär konnte allerdings den Zerfall des Römischen Reiches auch nicht aufhalten und die katholische Kirche droht an ihren starren Regeln und ihrer Weltfremdheit zu zerbrechen. Führung, die ‚abgehängt wird‘, verliert ihre Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten.
Jede technologische Entwicklung bringt eine kulturelle Evolution mit sich. Die digitale Welt schafft neue Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit: Soziale Plattformen laden zum hierarchiefreien Austausch ein und fördern Netzwerkstrukturen. Das Organigramm wird durch ein Dynamogramm ersetzt, Hierarchie durch Heterarchie. Netzwerkstrukturen und partizipative Abstimmungs- bzw. Kooperationsprozesse sorgen für tragfähige und nachhaltige Lösungen, weil sie den multirationalen Anforderungen unserer Realität besser entsprechen. Die Rolle der Führungskraft wandelt sich vom ‚allwissenden Helden‘ zum Moderator, der vor allem den We-Q der Gruppe – die Intelligenz der Gruppe – voranbringt. Die Führungskraft wird zum Coach und Mitarbeiterentwickler, der die individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeitenden mit den Aufgaben und Anforderungen gekonnt zusammenführt. Sie wird zum Inspirator, der Orientierung und Sinn vermittelt und Anerkennung und Wertschätzung ausspricht. Von Führenden wird damit eine deutlich höhere Rollenflexibilität erwartet. Wir bewegen uns weg von ‚Command, Control, Execute‘ hin zu ‚Sense Making, Enabling, Motivating‘.
Was heißt das für unsere Haltungen, Überzeugungen und Glaubenssätze als Führende? Es zeichnet sich ab, dass einige unserer bisherigen Paradigmen und Erklärungsmodelle nicht mehr funktionieren werden. Paradigmen hatten und haben stets die Funktion, Komplexität zu reduzieren und uns Orientierung für unser Handeln zu bieten. Bis etwa in das 15. Jahrhundert hinein übernahm dies für unsere mitteleuropäische Region die katholische Kirche: Sie erklärte und bewertete die Welt. Das geschah in überwiegend binären Kategorien wie ‚gut und schlecht’, ‚falsch und richtig’, ‚zu tun und zu lassen’. Später, durch die Erfindung verschiedenster Technologien, wie zum Beispiel des Fernrohrs, entstanden neue, nun vor allem naturwissenschaftlich basierte Paradigmen. Die Naturwissenschaften erforschten und erklärten die Welt in Ursache-Wirkungs-Prinzipien. Der Glaube an die Objektivität der Zahlen, an Fakten und Machbarkeit entstand. Doch wenn wir unsere aktuelle Welt betrachten, stellen wir fest, dass wir mit unseren linearen Erklärungsmodellen nicht mehr zurechtkommen. Wir stellen fest, dass unsere heutige Welt besser abgebildet wird durch dynamische und vernetzte Systeme, dass sie gekennzeichnet ist von Wechselwirkungen und Disruption! Die Suche nach klaren Ursache-Wirkungs-Prinzipien bringt uns nicht mehr voran. Entsprechend funktionieren klassische Ansätze der Unternehmenssteuerung in unseren komplexen Umfeldern immer weniger, weil sie Linearität, Kausalität und Machbarkeit unterstellen.
Unsere Märkte und Finanzströme sind undurchschaubar und volatil. Zinsentwicklungen, Fintechs, politische Umwälzungen und Trend-Zyklen jagen einander den Rang ab. In unseren digitalisierten Technikwelten tauchen mehr und mehr Chatbots auf, die unsere Arbeit ununterbrochen, 24 Stunden und sieben Tage die Woche, ausführen können. Für diese sich immer schneller verändernde Welt taucht international ein Begriff auf, der dieses Umfeld beschreibt:
VUCA als Akronym setzt sich aus den vier Begriffen Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität zusammen.
Volatilität beschreibt die Schwankungsintensität von bestimmten Faktoren über einen zeitlichen Verlauf hinweg. Leicht erkennbar ist dies am Beispiel von Aktienkursen: Innerhalb eines kurzen Zeitraums schwanken Aktienkurse stark und zeigen „scharfe Zacken“ im Verlaufschart. Je höher die Volatilität, desto stärker und „zackiger“ die Ausschläge.
Das hängt auch mit dem Faktor Ungewissheit zusammen: Wir müssen uns eingestehen, dass wir in bestimmten vor allem auch marktwirtschaftlichen Zusammenhängen niemals alle einflussnehmenden Variablen kennen können. Mit Blick auf den Brexit beispielsweise werden diese „Unknown Unknowns“ mehr als deutlich. Und wir als Führende müssen in solchen Kontexten, die von hoher Ungewissheit geprägt sind, entscheiden.
Der Buchstabe C steht für den Begriff der Komplexität (engl. Complexity). Von einem komplexen System sprechen wir, wenn die Anzahl der Einflussfaktoren in einem System hoch und die Art der gegenseitigen Einflussnahme der Faktoren in Teilen unbekannt und nicht stabil ist. Die Zusammenhänge in solchen Systemen sind nicht linear. Das heißt, es gibt keine eindeutigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Alle menschlichen Systeme, ob wir von einem Wirtschaftssystem, von einem Unternehmen oder auch von einem einzelnen Menschen sprechen, sind komplexe Systeme. Sie entwickeln sich selbst weiter mit einem dem System eigenen Eigen-Sinn. Ein künftiger Zustand ist – und würde man auch noch so viele noch so detaillierte Analysen durchführen – nicht vorhersagbar, und schon gar nicht mit absoluter Sicherheit. Wir können Annahmen treffen (z.B. für bestimmtes Wahlverhalten und bestimmte Wahlergebnisse) und im Nachhinein bestimmte Ereignisse allenfalls erklären. Gleichwohl gibt es keine vorhersagbaren zwingend linear-kausalen Zusammenhänge. Auswirkungen von Entscheidungen bzw. von bestimmten Maßnahmen und Eingriffen lassen sich nicht vorhersagen. Somit sind solche Systeme auch nicht direkt steuerbar.
Das A steht für das Wort Ambiguität und für die Vieldeutigkeit und die Widersprüchlichkeit, mit der wir uns in unseren Wirtschaftssystemen zunehmend konfrontiert sehen. Ein Management des Sowohl-als-auch ist gefordert. Ein fortwährendes Handeln und Entscheiden in Dilemmata-Situationen und Welten der Gegensätze. Die Forderungen lauten „kürzere Entwicklungszeiten bei gleichzeitig hoher Qualität der Ergebnisse“ oder „Geschwindigkeit und gleichzeitig Zuverlässigkeit“ oder „Standardisierung bei gleichzeitig maximaler Individualisierung“ oder „Innovation bei gleichzeitiger Effizienz-Forderung“. Solche durchaus als in sich widersprüchlich zu bezeichnende Anforderungen hätte man vor 20 Jahren als schlicht nicht erfüllbar abgetan. Die Fähigkeit, diese Widersprüche zu integrieren, eine gewisse Ambiguitätstoleranz zu entwickeln und entsprechende Lösungen zu finden ist in einer VUCA-Welt klar gefordert. In dieser Welt bleiben Entscheidungsprozesse stets diskutierbar und ergebnisoffen. Auswirkungen von Handlungen bzw. Entscheidungen müssen fortwährend beobachtet und gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen begleitet werden.
In der VUCA-Welt brauchen wir als Führungskräfte eine „analoge Haltung“. Damit ist gemeint, dass wir die „Unschärfe“ des Kontextes akzeptieren und ein „Das ist nicht mit Sicherheit vorhersagbar“ als stimmige Antwort aushalten. Damit ist gemeint, dass wir nicht nach dem einen richtigen Weg suchen, sondern in kleinen Schritten vorangehen, Rückmeldeschleifen initiieren und Muster finden. Damit ist gemeint, dass wir den Faktor Zeit als zentralen Einflussfaktor wahrnehmen und Unterschiedlichkeit würdigen: in uns selbst wie in unseren Teams und Netzwerken. Denn alle miteinander wissen mehr!
In einer VUCA-Welt als Führender Impulse zu setzen, hat mehr mit Gartenarbeit als mit IT zu tun. Mit sehen, was das Wetter (das Umfeld) auslöst, und pflanzen, wässern, düngen, jäten. Und dabei fortwährend beobachten, also sich Feedback einholen. Mit Delete, Escape und Reset geht‘s leider nicht.
Mit diesen Gärtner-Strategien werden wir uns also in unserem Seminar auseinandersetzen. Um als Führender Impulse in einer VUCA-Welt zu setzen und eine gute Ernte einfahren zu können.
Definition „Führende“ – Was ist gemeint?
Wir nutzen zur Erklärung Video Scribing – hier umgesetzt von Angela Recino, Bewegte Kommunikation: www.youtube.com/watch?v=GD7boS4tdF4
„Warum haben wir den Begriff ‚Führende‘ für unseren Seminar-Titel gewählt? Weil wir einen umfassenden Führungsbegriff setzen wollen. Führen ist in unseren Organisationsformen häufig immer noch mit dem Aspekt der Positionsmacht assoziiert. Mit der Vorstellung, dass kraft Funktion Macht über Mittel, Prozesse und Menschen gegeben wird. Doch weil Organisationen lebendige komplexe Systeme sind, werden sie nicht primär mittels Positionsmacht gesteuert. Von Menschen gebildete Systeme sind immer komplex und haben einen starken Eigen-Sinn: Informelle Netze, ‚Hubs‘ und Kultur eines Unternehmens steuern oft kraftvoller als die offizielle Hierarchiestruktur (Pfläging 2015). Beispielsweise kann man dies schnell wahrnehmen und spüren, wenn neue Mitarbeiter in ein Unternehmen kommen: ‚Wer immer in einem neuen System aufgenommen wird, beeinflusst soziale Struktur wesentlich‘ (Pfläging 2015).
Ob man diese Erkenntnis nun mag oder ablehnt, an ihr vorbeikommen kann man nur mit einem äußerst hohen Verdrängungsaufwand oder mit einem prächtig ausgeprägten Narzissmus. Selbst ‚Klassiker‘ der Managementtheorie wie Peter Drucker haben dies formuliert (‚Culture eats strategy for breakfast‘). Durch die Digitalisierung und soziale Plattformen, die mächtige Demokratisierungsimpulse setzen, wurde dieser individuelle Einfluss bewusster und zusätzlich verstärkt. Jeder von uns setzt in jedem System, eben auch im Unternehmen, in jedem Moment Impulse. Impulse des Verharrens, des Rückschritts oder auch der Veränderung und Entwicklung. Durch das, was man tut oder auch durch das, was man lässt. Starke impulsgebende Hubs können einen Shitstorm auslösen ebenso wie sie eine Follower-Gemeinde anwachsen lassen.
Selbst wenn wir eine allgemeine Definition von ‚Führen‘ heranziehen, nämlich Führen ist zielbezogene Einflussnahme mittels Kommunikation (Neuberger 1976; v. Rosenstiel, Molt & Rüttinger 1995) kann jedes Organisationsmitglied als ‚führend‘ betrachtet werden: Als formelle Führungskraft, als Projektleiter und als Mitarbeitender. ‚We lead Bosch‘, lautet ein Prinzip für Führung und Zusammenarbeit bei der Robert Bosch GmbH und weist glasklar auf diesen Aspekt hin.
Unser Seminar ist also gedacht für alle, die sich bewusst mit der eigenen Wirksamkeit in einer komplexen Welt auseinandersetzen wollen. Für alle, die ihre eigene Haltung dazu erforschen und bewusst gestalten möchten und Lust darauf haben, auch in komplexem und unsicherem Terrain gezielt zu handeln und zu lernen.“
Die Vorbereitungsaufgabe: Eine Brand als FührendeR und NetzwerkerIn entwickeln
Die Aufgabe wird vom Trainer z.B. als Video vorgestellt und den Teilnehmern als Dokument zur Verfügung gestellt. Der Aufgabentext:
„Was ist mit ‚Branding‘ gemeint?„Märkte, Angebote, Foren, Plattformen … unsere Welt wird immer unübersichtlicher. Selbst in den Unternehmen steigt diese ‚Unüberschaubarkeit‘. Externe und unternehmensinterne Netzwerke und Plattformen stehen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Matrix-Organisationen und Projektstrukturen lösen klare Hierarchien auf und Sichtbarkeit spielt eine zunehmend wichtige Rolle für den persönlichen Erfolg. So, wie es für Unternehmen entscheidend ist, klare und einzigartige Marken aufzubauen, um sich zu profilieren, so wichtig ist dies zunehmend auch für Menschen. Insbesondere für solche, die in einem Unternehmen Einfluss nehmen und steuernde Impulse setzen wollen. Ihre ‚Brand‘ als FührendeR und NetzwerkerIn umfasst all Ihre persönlichen und beruflichen Stärken, Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen, Ihre Werte und Ihre Glaubensätze.“
Was bringt es, ein starkes persönliches „Branding“ zu entwickeln?„Führungskräfte können sich nicht mehr auf die Macht ihrer Position verlassen und sich auf Hierarchie beziehen. In einer Welt ‚Leadership 4.0‘ ist die bewusste Entwicklung einer (Marken-)Persönlichkeit ein Schlüssel für Anerkennung und Respekt. Jeder Mensch, jeder Führende hat eine Persönlichkeit, hat immer auch ein ‚Image‘ oder anders gesagt, ein ‚Markenbild‘. Gleichwohl kann es sehr hilfreich für die eigene Wirksamkeit als FührendeR und NetzwerkerIn sein, sich bewusst mit diesem Image, dieser ‚Brand‘ auseinanderzusetzen. Erstens, um zu sehen, wieweit die persönliche Vorstellung von der eigenen Wirkung auch der Wirkung auf andere entspricht. Zweitens, um diese weiterzuentwickeln und drittens, um die eigene Wirksamkeit in einer komplexen unübersichtlichen Welt zu stärken und den persönlichen Erfolg zu sichern.
Entsprechend gilt es, ein eigenes Profil zu entwickeln, das zeigt, wofür man steht, was andere von einem erwarten können und was man selbst gerne von anderen hätte. Ein Profil, das anderen Orientierung gibt und mit dem man für bestimmte Themen ‚Follower‘ gewinnen kann.
Die Vorbereitungsaufgabe für unser Training ‚Komplexitätstraining für Führende‘ lautet: Ihre ‚Brand‘ als FührendeR und NetzwerkerIn definieren und dazu eine Rede entwickeln.
Für unser kommendes Training bitte wir Sie, eine ‚Wer ich als FührendeR und NetzwerkerIn bin‘-Rede zu entwickeln. Diese Rede bitten wir Sie in unserem Training zu halten. Sie sollte etwa drei Minuten dauern und die Kernbotschaften Ihrer ‚Brand‘ umfassen. Während des Trainings werden Sie zu dieser Rede und zu Ihrer ‚Markenpersönlichkeit‘ Feedback bekommen, sodass Sie Ihre ‚Brand‘ bewusst und gezielt weiterentwickeln können.
Die nachfolgenden Fragen können Ihnen bei der Definition und der Entwicklung Ihrer Rede helfen. Dabei müssen Sie keineswegs alle Fragen beantworten. Wählen Sie einfach solche aus, zu denen Ihnen Antworten und Beispiele einfallen. Und dann bauen Sie daraus eine Geschichte zu Ihrer ‚Wer ich als FührendeR und NetzwerkerIn bin‘-Rede.“
Bitte reflektieren Sie: Wofür?„Wofür wollen Sie in Ihrem System (mehr) Einfluss nehmen? Wofür und wobei? Warum glauben Sie, dass Sie einen Unterschied erzeugen und Dinge voranbringen können? Was ist oder was könnte eine Ihrer Kernrolle in Ihrem System/Unternehmen/Ihrer Organisation sein? Was ist dann besser für wen? Was ist Ihre Leidenschaft? Was treibt Sie? Bitte notieren Sie entsprechend Beispiele und Geschichten, anhand derer man Ihr Selbstverständnis und Ihre ‚Mission‘ erkennen kann.“
Was sind Ihre Werte und Glaubenssätze?„Welche Werte leiten Sie in Ihrem (täglichen beruflichen) Leben? Vielen Menschen fällt es nicht ganz leicht, die eigenen Werte zu definieren. Um diese zu entdecken, könnte es hilfreich sein, darüber nachzudenken, welche Situationen bei Ihnen (stärkere) Emotionen auslösen. Was Sie zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit anderen begeistert oder auch nervt bzw. frustriert. Diese Emotionen sagen viel darüber aus, was Ihnen wirklich wichtig ist. Denn wenn unsere Werte und Bedürfnisse positiv angesprochen werden, reagieren wir mit Freude, Zufriedenheit oder Begeisterung. Wenn unsere Werte und Bedürfnisse verletzt werden, reagieren wir mit Trauer, Frust oder zum Beispiel auch mit Wut. Wenn Sie über solche emotionalen Situationen nachdenken, können Sie Rückschlüsse auf Ihre Werte ziehen. Auch die Frage, wofür Sie Vorbild sind, kann dabei helfen.
Ebenso handlungsleitend wie prägend für eine Persönlichkeit sind sogenannte Glaubenssätze bzw. Überzeugungen (Grundannahmen) eines Menschen. Diese werden über Sozialisation erworben und sind wenig bewusst. Überzeugungen, wie die Welt ist oder auch funktioniert, beziehen sich zum Beispiel auf zwischenmenschliche Beziehungen und zwischenmenschliches Handeln (Kerpen 2007). Beispiele zu solchen Glaubenssätzen sind Formulierungen wie ‚Alle zusammen wissen mehr‘, ‚Wenn man Mitarbeiter motivieren will, muss man ihnen interessante fordernde Aufgaben geben (oder mehr Geld)‘ oder ‚Man kann nicht motivieren, man kann nur demotivieren‘. Wenn wir genau hinhören, werden wir bemerken, dass Menschen ständig solche Glaubenssätze verbalisieren (auch wir hier in unserem Seminar. Und manchmal versuchen wir, sie durch die Angaben von mehr oder weniger wissenschaftlichen Quellen zu validieren).
Um Ihren Werten und Glaubenssätzen schneller und leichter auf die Spur zu kommen, können Sie Ihre Kollegen, Mitarbeitenden oder Vorgesetzte befragen. Manchmal wissen andere viel besser als man selbst, was einem wirklich wichtig ist. Bitte notieren Sie Ihre Erkenntnisse zu Ihren Werten und Glaubenssätzen und ergänzen Sie diese mit Beispielen und Geschichten.“
Erfassen Sie Ihre Stärken„Welches sind Ihre Stärken als FührendeR und NetzwerkerIn? Fragen Sie sich: ‚Für welches Wissen und welche Erfahrungen wird mein Rat eingeholt?‘ Und auch: ‚Für welche Stärken möchte ich bekannt sein?‘
Um diese Frage zu beantworten, können Sie eine Liste Ihrer Stärken erstellen. Sie können dazu auch Testergebnisse heranziehen und auch einfach um Feedback Ihrer Kollegen, Freunde, Familie oder auch Ihrer Mitarbeitenden bitten. Bitte notieren Sie Ihre Erkenntnisse zu Ihren Stärken und ergänzen Sie diese mit Beispielen und Geschichten.“
Erkennen Sie Ihre Entwicklungsfelder und Ihre potenziellen Fallstricke„Fallstricke können Schwächen sein, aber auch Stärken, die zu extrem ausgeprägt sind (z.B. der Perfektionist, der ungern delegiert). Fallstricke können beim Ausbau einer attraktiven Brand im Wege stehen. Daher ist es diesbezüglich ebenfalls hilfreich, andere um Feedback zu bitten: Sie können zum Beispiel wieder Ihre Vorgesetzten, Ihre Kollegen und Mitarbeitende fragen …
Dieses Nachforschen und die ernsthafte Selbstbeobachtung helfen, um eigene Entwicklungsfelder zu erkennen und zu verstehen. Entscheiden Sie, welche dieser ‚Entdeckungen‘ für Sie nützlich sein könnten und wie Sie sich weiterentwickeln können. Bitte notieren Sie Ihre Erkenntnisse und ergänzen Sie diese mit Beispielen und Geschichten.“
Der erste Entwurf: In einigen Sätzen ein Fazit ziehen und Ihre Brand formulieren„Welche ‚Best of …‘-Brand können Sie erkennen? Welche ‚Best of …‘-Brand möchten Sie verstärken? Was inspiriert andere dazu, Ihnen zu folgen? Was ist ‚attraktiv‘ daran, mit Ihnen zu arbeiten und Ihr ‚Follower‘ zu sein?
Entwerfen Sie jetzt Ihre dreiminütige ‚Wer ich als FührendeR und NetzwerkerIn bin‘-Rede.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Zeit. Nun bin ich sehr gespannt darauf, Sie kennenzulernen und natürlich auch ganz besonders auf Ihre Reden! Viel Spaß bei der Einstimmung und Vorbereitung, bis zum XX.XX.20XX.“
Quellen
Neuberger, O. (1976): Führungsverhalten und Führungserfolg. Verlage Duncker & Humblot.Christian Rieckhof (Hrsg.) (2006): Strategien der Personalentwicklung, Gabler.Rosenstiel, L. v., Molt, W. & Rüttinger, B. (1995): Organisationspsychologie. Stuttgart: Kohlhammer.Wilkening, O. (2002): Bildungs-Controlling, Erfolgssteuerungssystem der Personalentwickler und Wissensmanager, in: Hans-Christian Riekhof (Hrsg): Strategien der Pesonalentwicklung. Gabler Verlag.Prezi – die erforderliche Software: https://prezi.com.Beispiel für eine FLO für das Komplexitätstraining: https://prezi.com/view/CpZUz9HMVIoxHOKeBVWh/Der erste Seminartag
Thema/Übung
Dauer
Uhrzeit
Intro & Die Teilnehmer abholen
30 Minuten
9.00 bis 9.30 Uhr
2+1 Wertschätzungs-Dialog
45 Minuten
9.30 bis 10.15 Uhr
Pause
15 Minuten
10.15 bis 10.30 Uhr
Landkarte „Komplexitätsmanagement“ erstellen
30 Minuten
10.30 bis 11.00 Uhr
Branding & Selbstreflexion mit der Selbstpyramide – Einführung
20 Minuten
11.00 bis 11.20 Uhr
Erste drei Reden „Wer ich als FüherendeR und NetzwerkerIn bin“
30 Minuten
11.20 bis 11.50 Uhr
Working Out Loud – Die 5 Prinzipien
85 Minuten
11.50 bis 13.10 Uhr
Mittagspause
60 Minuten
13.15 bis 14.15 Uhr
Zweite drei Reden „Wer ich als FüherendeR und NetzwerkerIn bin“
30 Minuten
14.15 bis 14.45 Uhr
Working Out Loud – Wir tun es
105 Minuten
14.45 bis 16.30 Uhr
Pause
15 Minuten
16.30 bis 16.45 Uhr
Die Vernetzungslandkarte – Im Netzwerk wirksam sein
60 Minuten
16.45 bis 17.45 Uhr
In Resonanz sein: (Check-in/) Check-out (Hinweis: Verteilen des Riemann-Thomann-Tests)
15 Minuten
17.45 bis 18.00 Uhr
Ende des Tages
Intro & die Teilnehmer abholen
Orientierung
Ziele
Überblick über das Seminar bzw. den ersten Tag bietenSich auf Spielregeln vereinbarenDu oder Sie?Ins Thema einführenZeit
Insgesamt 30 Minuten
Material
Flipchart mit der Agenda; Flipchart mit den Spielregeln
Intro-Vorschlag
Als Trainer begrüßen Sie Ihre Teilnehmer und steigen in das Seminar ein. Im Anschluss an die FLO (die Flipped-Learning-Offerte vor dem Training, s. S. 15 ff.) können Sie auch direkt in das Thema führen im Sinne von: „Mich kennt ihr ja schon aus der FLO! Also brauche ich mich als Person, als Mensch nicht noch einmal vorstellen! Ich steige direkt in unser Thema ein, nämlich in ‚Was mich umtreibt, was mich begeistert, interessiert und inspiriert, ist das Thema Umgang mit Komplexität. Das Thema Komplexitätsmanagement und Führen in komplexem Umfeld‘. Auf einiger dieser Themen sind wir ja in unserer FLO schon eingegangen. Gleichwohl setzen wir uns selbstverständlich mit allen diesen Themen noch im Detail auseinander: Mit den Themen
‚Führender sein‘ und‚wie als Führender wirksam werden in komplexen Systemen’ sowiemit den Definitionen und Facetten von Komplexität.“Vorgehen
Sie stellen nun als Erstes die Agenda vor und holen dazu Fragen und das Commitment ab. Dann werden Spielregeln zur Zusammenarbeit eingeführt, dabei können Sie etwa das Du vorschlagen sowie Vereinbarungen treffen.
Abb.: Die Spielregeln.
Wir empfehlen, dass Sie die Regeln mitbringen, diese einzeln vorstellen und um Commitment bitten. Dann fragen Sie am besten, welche Regeln noch gebraucht werden, damit man gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Diese werden dann ergänzt. „Als unser Motto für unsere drei Tage habe ich die drei Kant‘schen Kernfragen gewählt:
Was kann ich wissen?Was soll ich tun?Was darf ich hoffen?“Erklären Sie, warum beim Thema Komplexität die Kant‘schen Fragen einen guten Leitfaden darstellen:
„Für das Wissen orientieren wir uns an dem, was wir an Wissenschaftlichem zum Thema gefunden haben.Für das Tun biete ich euch Methoden an undhoffe, dass wir so miteinander und füreinander möglichst wirksam werden.“Sie können beispielsweise fortfahren mit: „Jede Epoche hat ihre Leitwissenschaften: Im Altertum war dies die Philosophie, das Mittelalter hatte die Theologie und die Moderne hatte die Naturwissenschaften. Heute widmen sich viele Disziplinen, nicht nur die Betriebswirtschaft und die Psychologie, der Erforschung lebendiger komplexer Systeme mit einem ganzheitlichen Ansatz. Denn die Naturwissenschaften mit der Zerlegung der Welt in Teildisziplinen sind an ihren Grenzen angekommen. Sie ermöglichen uns mit ihren Paradigmen nicht mehr, Systeme zu verstehen oder gar Steuerungsimpulse zu setzen. Es ist die Zeit der Erforschung komplexer lebendiger Systeme wie diese, die Marktwirtschaft oder Unternehmen verkörpern“ (Seliger 2014).
„Klassische Ansätze der Unternehmenssteuerung funktionieren in komplexen Umfeldern immer weniger, weil sie Linearität, Kausalität und Machbarkeit unterstellen. Wenn das Gelände vertraut, stabil und die Wege bekannt sind, dann kann es primär darum gehen, Prozesse zu verbessern und Qualität zu sichern, also linear zu denken. Wenn sich das Gelände jedoch ändert, dann ist es weniger hilfreich, mit mehr vom Selben zu reagieren.“
Mit dieser Begründung kommen Sie jetzt auf den Schwerpunkt des Trainings zu sprechen und leiten in die erste Übung über. „In unbekanntem Territorium hilft nur, sich behutsam zu bewegen, eine aufmerksame permanente Sondierung des Geländes und unterschiedlichste Wahrnehmungen und Erfahrungen zu nutzen. Kooperation und Kollaboration sind mithin die wichtigsten Dimensionen des Erfolgs im Umgang mit Komplexität (Sprenger 2012). Das werden in jedem Fall auch Schwerpunkte in unserem Training sein. Wir beginnen mit diesen Themen im ersten Schritt daher bewusst bei uns selbst mit einer ersten Übung, dem ‚2+1 Wertschätzungs-Dialog’.“
Der Hinweis auf die folgende Übung „2+1 Wertschätzungs-Dialog“ ist der Übergang zum folgenden Baustein.
Quellen
Seliger, R. (2014): Positive Leadership: Die Revolution in der Führung. Schäffer Poeschel Verlag.Sprenger, R. (2012): Radikal führen. Campus Verlag.2+1 Wertschätzungs-Dialog
Orientierung
Ziele
Sich mit anderen Teilnehmern wertschätzend verbindenIn kurzer Zeit spielerisch in einen tieferen Dialog kommenZuhören, um zu verstehen und wertschätzendes Feedback als Team-Tool erlebenZeit
Insgesamt 45 Minuten
Material
Aufgabenbeschreibung; Stoppuhr; eventuell einen Gong o. Ä., um auf die Zeit aufmerksam zu machen; Transferjournale/Logbücher
Hinweise
Legen Sie die Transferjournale/Logbücher mit dem Hinweis aus, dass jeder Teilnehmer sich hier die wichtigsten Feedbacks, die er bekommen hat sowie generell persönlich wichtige Themenpunkte und Erkenntnisse mitschreiben kann. In die Transferjournale/Logbücher können Sie die „Branding“-Instruktion schreiben, die Teilnehmer können darin die Reflexion ausfüllen. Bereiten Sie auch zwei Seiten mit leeren „Selbstpyramiden“ vor (s. S. 45).
Für den 2+1 Wertschätzungs-Dialog werden Dreiergruppen gebildet. 2+1 bedeutet, dass es zunächst einen Input von zwei Minuten und dann ein Feedback von einer Minute durch zwei Zuhörende auf das Gehörte gibt. Als Trainer stoppen Sie die Minutenintervalle und geben der Gruppe entsprechende Hinweise.
Erläuterung
Diese Übung ist ein hilfreicher Baustein, um die Teilnehmer für einen besonders wertschätzenden und verbindenden Umgang miteinander zu sensibilisieren. Wertschätzung und Anerkennung erzeugen psychologische Sicherheit, die gerade in komplexen Kontexten und bei Handeln unter Ungewissheit besonders wichtig ist.
Vor der eigentlichen Übung ist eine ausführliche und liebevolle Hinführung auf die Themen Wertschätzung und Empathie besonders wichtig für den Erfolg. Der Anbahnung von wertschätzendem und empathischen Umgang (siehe Intro), Dialog und Feedback sollte unbedingt ausreichend Zeit eingeräumt werden.
Intro-Vorschlag
Laden Sie die Teilnehmer ein, eine Übung miteinander durchzuführen. Es geht dabei um den Umgang mit Wertschätzung. Dazu erzählen Sie zunächst eine Einführungsgeschichte, um die dann folgende Aufgabe vorzubereiten und anzubahnen:
„Ich möchte euch gerne etwas darüber erzählen, wie Zusammenarbeit in der VUCA-Welt von Mehrdeutigkeit, Ungewissheit und Komplexität besonders gut gelingt. Dafür kann ein Blick in eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt hilfreich sein: Google. Google ist nicht nur als Unternehmen geschäftlich sehr erfolgreich. Google teilt auch öffentlich viele Informationen, Erkenntnisse und Erfolgsrezepte. Unter anderem Konzepte der Mitarbeiterentwicklung in einem Blog, der ‚re:Work‘ heißt.“
Kommen Sie darauf zu sprechen, dass in diesem Blog („The re:Work Blog“) im Jahr 2016 eine Analyse zu den Erfolgsfaktoren der erfolgreichsten Teams veröffentlicht wurde (s. Quellen, S. 38): „Dazu wurden zwei Jahre lang über 200 Interviews mit Google-Mitarbeitern geführt und mehr als 250 Attribute von über 180 aktiven Google-Teams betrachtet. Das Ziel war es, etwas über den perfekten Mix von Ausbildung, fachlicher Kompetenz und Erfahrung in besonders erfolgreichen Teams herauszufinden.
Die Forscher hatten erwartet, dass die ‚Rockstar-Teams‘ von Google besonders von den Eigenschaften und Fachkompetenzen der Teammitglieder abhängig sind.
Überraschenderweise zeigten die Untersuchungen, dass der Erfolg der Teams viel mehr durch die Art und Weise bestimmt wurde, wie die Teammitglieder miteinander umgehen. Grundlegend war dabei das Konzept der psychologischen Sicherheit, welches eng mit dem Grad des Vertrauens zwischen den einzelnen Teammitgliedern zusammenhängt. Die Teams waren dort besonders wirksam, wo die Teammitglieder das Gefühl hatten, sie können ein hohes Maß an Risiko eingehen, ohne sich unsicher oder beschämt zu fühlen.“
Damit leiten Sie zum Thema Schlüsselfähigkeiten über: „Was sind Schlüsselfähigkeiten, um ein Klima von psychologischer Sicherheit zu entwickeln? Es sind insbesondere die Fähigkeiten, Empathie und Wertschätzung zu zeigen und auszudrücken.“
Eine vertiefende Quelle hierzu ist ein Artikel des Management-Magazins Harvard Business Review (2016: „The most and least empathetic companies“). „Das Harvard Business Review beschreibt in einem Artikel über das Ranking der empathischsten Unternehmen, dass die emotionale Wirkung auf andere nicht nur persönliche Bedeutung für den Umgang der Mitarbeiter miteinander hat, sondern ganz klar mit Wachstum, Produktivität und Gewinn pro Mitarbeiter korreliert.
Wie können wir uns auf Empathie und Wertschätzung miteinander einschwingen? Das muss immer wieder neu eingeübt werden. Denn Menschen tendieren dazu, die Defizite immer stärker zu betonen als die Potenziale. Es scheint uns weniger Energie zu kosten, Kritik zu äußern, als Anerkennung auszudrücken. Deshalb möchte ich euch gerne zu einer kleinen dialogischen Übung einladen. Ich nenne es den ‚2+1 Wertschätzungs-Dialog‘.“
Vorgehen
Bitten Sie Ihre Teilnehmer, sich in Dreiergruppen zusammenzufinden, gerne mit Menschen, die sie noch nicht so gut oder überhaupt nicht kennen. Bitten Sie sie, eine bestimmte Frage zu beantworten, und zwar jeder Teilnehmer in der Gruppe in jeweils zwei Minuten. Nach jeder Antwort im Zeitraum von zwei Minuten gibt es von den beiden anderen zuhörenden Personen in der Gruppe direkt jeweils eine Minute wertschätzendes Feedback nach dem Motto: Was habe ich gehört? Was hat mich besonders beeindruckt? Was war unerwartet? Was hat mich berührt? Was war überraschend?
Es ist hilfreich, den Ablauf noch einmal genau in einer Folie oder einem Flipchart zu zeigen, da sonst leicht etwas Chaos entstehen kann.
Abb.: Der 2+1 Wertschätzungs-Dialog, Visualiserung des Ablaufs.
„Und jetzt die Frage, die jeder von euch in zwei Minuten beantworten sollte:
Welche Themen treiben mich immer wieder/gerade um und warum bin ich heute hier?Ihr könnt sowohl über berufliche als auch über private Kontexte sprechen. Der Grad der Offenheit, den jeder von euch zeigt, wird auch Auswirkung auf die Offenheit haben, die die anderen Teilnehmer in der Gruppe zeigen werden. Viel Spaß!“
Debriefing
Zunächst erfolgt die Auswertung der Übung nach der Durchführung und gemeinsames Lernen im Plenum. Die Gruppen verteilen sich dann im Raum, sitzend oder stehend. Als Trainer nehmen Sie die Zeit und sagen das jeweilige Ende einer Sequenz an, beispielsweise mit einem Gong oder einem anderen geeigneten Signal. Nach der Durchführung, also nach etwa zwölf Minuten, bitten Sie Ihre Teilnehmer wieder zurück ins Plenum. Und fragen:
„Wie war das für euch? Wie habt ihr die Übung erlebt?Wie war es, zwei Minuten über sich selbst zu sprechen?Wie war es, Feedback zu geben?Wie war es, Feedback zu bekommen?Wie sieht das bei euch im Unternehmen und in eurem System mit dem Thema Feedback aus?“Zum Abschluss der Übung können Sie noch weitere Hinweise auf ein grundlegendes Prinzip der Übung geben: das Zuhören. „Was macht diese Übung so besonders? Es ist unter anderem das Format, das zum Zuhören einlädt oder sogar zwingt.“
Erklären Sie, dass es zwei Arten von Zuhören gibt:
Zuhören, um zu antworten und
Zuhören, um zu verstehen.
Beziehen Sie sich darauf, wie das im Unternehmensalltag aussieht: „Man trifft sich ein einem Besprechungsraum. Nach einer kurzen Begrüßung wird in die Tagesordnung eingestiegen, oft mit einer PowerPoint-Präsentation. Das Zuhören konzentriert sich dann oft darauf, die Punkte herauszufinden, mit denen man nicht einverstanden ist, und schon während des Vortrags oder später am Ende der Präsentation werden schnell Antworten und Einwände vorgebracht, bei denen man anderer Meinung ist oder Bedenken hat.
Bei der ‚2+1-Übung‘ habt ihr zwei Minuten zugehört, um zu verstehen. Euer Mindset war: ‚Da bin ich jetzt einmal gespannt, was ich erfahren werde. Das ist ja interessant, was der andere mir erzählt hat. Das hätte ich nicht erwartet, das ist überraschend.‘ Und am Ende der zwei Minuten habt ihr zurückgemeldet, was ihr verstanden und gefühlt habt. Das ist die Haltung, die in der VUCA-Welt besonders wichtig ist. Die Zukunft ist ungewiss. Die Welt ist komplex. Keiner weiß, was richtig und falsch ist. Lasst uns voneinander lernen, lasst uns uns gegenseitig zuhören und daraus etwas Neues entstehen lassen.“
Quellen
Duhigg, Ch. (2016): What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. New York Times vom 25 Februar. www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html – abgerufen am 7.8.2018.Edmondson, A. (2014): Building a psychologically save workplace. TEDx HGSE. www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8 – abgerufen am 07.08.2018.Nasir, S. (2017): Be the Psychological Safety You Want to See in the World. medium.com/nulogy/be-the-psychological-safety-you-want-to-see-in-the-world-52753850cba2 – abgerufen am 07.08.2018.Parmar, B. (2016): The Most Empathetic Companies, 2016. hbr. org/2016/12/the-most-and-least-empathetic-companies-2016 – abgerufen am 30.8.2018.The re: Work Blog (2016): rework.withgoogle.com/blog/how-google-thinks-team-effectiveness/ – abgerufen am 07.08.2018.Landkarte „Komplexitätsmanagement“ erstellen
Orientierung
Ziele
Die generellen Erwartungen der Teilnehmer aufzeigenThemenwünsche und Fragen der Teilnehmer (also der „Forschungsaufträge“ für den Trainer und die Gruppe) visualisieren(Er-)kenntnisse & Erfahrungen der Teilnehmer zum Thema „Umgang mit Komplexität“ sichtbar machenZeit
Insgesamt 30 Minuten
Material
Spielkarten o. Ä., um Gruppen auszulosen; eine Pinnwand, bespannt und vorbereitet (in die Mitte das Stichwort „Umgang mit Komplexität“ schreiben); verschiedenfarbige große Post-its oder Moderationskarten, zum Beispiel:
Entsprechende Post-its mit Beschriftung vorbereiten; Post-its pro Teilnehmer vorbereiten; Bleistifte oder Kugelschreiber
Hinweise
Die Übung ist für maximal 12 Personen geeignet. Je größer die Gruppe, umso mehr sollte man die Anzahl der Post-its begrenzen, die pro Person geklebt werden dürfen. Unser Vorschlag: Jeder Teilnehmer bekommt drei orangefarbene, drei gelbe und drei hellgrüne Post-its.
Erläuterung
In diesem Schritt geht es darum, dass die Teilnehmer eine erste Landkarte zum Thema „Umgang mit Komplexität“ erstellen. Erfahrungsgemäß ist zu diesem Thema bereits viel Wissen und viel Erfahrung in der Gruppe. Mithilfe einer Pinnwand-Visualisierung werden Wissen und Erfahrungen sichtbar gemacht, vernetzt und alle können schnell darauf zurückgreifen. Die Landkarte soll auch zeigen, welche Erwartungen die Teilnehmer mitgebracht haben. Während der drei Trainingstage wird auf das, was an der „Landkarten-Pinnwand“ steht, Bezug genommen.
Intro-Vorschlag
Moderieren Sie die Aufgabe an: „Wir werden eine Landkarte zum Thema ‚Umgang mit Komplexität’ erstellen. So können wir unser vorhandenes Wissen und die Erfahrungen sichtbar machen, miteinander vernetzen und schnell darauf zugreifen. Es wird eine Art 3-D-Landkarte, auf die wir Schicht für Schicht unser Wissen, unsere Fragen und unsere Erwartungen auftragen.“ Bitten Sie Ihre Teilnehmer, dazu Post-its zu beschreiben:
Generelle Erwartungen sollen auf die orangefarbenen Post-its geschrieben werden. Das können Erwartungen sein, die sich etwa an den Trainer oder an die anderen Teilnehmer richten. Als Beispiele könnten Sie nennen, dass alle ihr Wissen teilen und alle genug Zeit für den Erfahrungsaustausch haben.Themenwünsche und Fragen an das Training sollen die Teilnehmer auf gelben Post-its notieren.Schließlich sollen die Teilnehmer auf den hellgrünen Post-its sichtbar machen, welches Wissen, welche Erfahrung und auch Kenntnisse über Modelle zum Thema „Umgang mit Komplexität“ schon im Raum sind.Hier können Sie auch ein Beispiel für ein Modell aus dem Themenbereich „Komplexität“ nennen, dass die Teilnehmer vielleicht schon kennen. „Wenn Ihnen zum Beispiel ein Modell wie die Stacey-Matrix bekannt ist, dann schreiben Sie bitte den Namen dieses Modells auf ein hellgrünes Kärtchen.“ Das Modell der Stacey-Matrix eignet sich gut als Beispiel, weil es eines der bekannteren ist, wenn es um das Stichwort „Umgang mit Komplexität“ geht. In diesem Buch werden wir die Stacey-Matrix nicht vertiefen, deswegen sei sie hier kurz beschrieben: Die Stacey-Matrix arbeitet mit zwei Achsen. Die eine Achse steht für „Was ist zu tun?“ und die andere für „Wie ist es zu tun?“. Die einzuschätzende Situation wird auf diesen Achsen jeweils danach bewertet, wie weit das „WIE“ oder das „WAS“ klar bzw. unklar ist. Fazit des Modells: Je stärker etwas auf beiden Achsen unklar ist, desto höher ist die Komplexität bzw. das Chaos.
Teilen Sie Gruppen ein, die dann die Post-its beschriften und aufhängen: „Wir losen mit den Spielkarten, die ihr jetzt zieht, die Gruppen zusammen. Das heißt, die Kollegen, die die ‚Asse‘ ziehen, beginnen mitder Arbeit. Ihr dürft euch austauschen und gemeinsam mit euren Postits die erste Schicht der Landkarte erstellen. Es sollen pro Teilnehmer maximal jeweils drei Post-its pro Farbe sein. Die Gruppe der Asse hat für die Erstellung der ersten Schicht maximal fünf Minuten Zeit. Die übrigen Kollegen hören zu und dürfen sich nicht einmischen. Sie sind dann danach an der Reihe.
Bitte notiert alle noch in kleinen Buchstaben mit Kugelschreiber oder Bleistift euren Namen auf eure Post-its, damit wir gegebenenfalls schnell auf euer Wissen zugreifen können.
Durch das Zuschauen und Zuhören werden wir sowohl mehr voneinander verstehen als auch wieder offenes Zuhören üben. Was wir ja gerade in unserem Einstiegsmodul schon getan haben und was zum Gewinnen von Mehrwert aus Unterschiedlichkeit eine zentrale Voraussetzung ist.“
Vorgehen
Die Gruppe wird nun in vier Untergruppen aufgeteilt, z.B. per Kartenlosen: Drei Asse bilden die erste Gruppe, drei Könige die zweite Gruppe, drei Zehner die dritte Gruppe und drei Neuner die vierte Gruppe. Die Regeln sind wie oben beschrieben, pro Person werden maximal drei Post-its pro Farbe beschrieben. Die Farben stehen für:
Erwartungen,Themenwünsche und Fragen sowievorhandenes Wissen.Nachdem die erste Gruppe fünf Minuten lang die erste Schicht erstellt hat, kommt die nächste Gruppe an die Reihe. Sie ergänzen ihre Kärtchen.





























