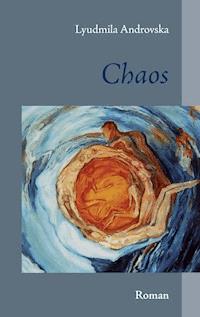
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Chaos in uns Sdravka Evstatieva hat Lyudmila Androvskas Buch "Chaos" aus dem Bulgarischen übersetzt - ein ganz wunderbares Kleinod über den Schmerz des Lebens, das unter die Haut geht. Eine Metapher für den ewigen Kreislauf der Dinge auf der Bühne eines kleinen Dorfes am Meer. Die Lebensbedingungen am Meer sind karg, die Hütten klein, die Welt ums Dorf herum ist längst aufgebrochen, nur hier steht die Zeit. Die Idylle und die Beschaulichkeit täuschen. Allen Traditionen zum Trotz nistet sich das Chaos der Welt ein und breitet sich aus. Die Menschen suchen, verzweifeln, schweigen und folgen dabei doch nur ihrer Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Allein das sorgt für Mord. Auch Wanda, die Dorf-Hebamme, führt ein kleines und schweres Leben, strickt an ihrer ewigen schwarzen Hebammen-Jacke, wie es die Tradition vorschreibt. Sie ist am dichtesten dran an Leben und Tod und begreift schließlich, wie das Chaos in den Seelen unausweichlich Schrecken produziert. Allein das Meer bleibt, was es immer war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Gewidmet meinem Ehemann Valeri – meine große Liebe
Aus dem Bulgarischen von Sdravka Evstatieva
CHAOS – Unordnung, Durcheinander, Wirrwarr, wirres Zeug, Missstand, Anarchie, ohne Anfang und Ende, Misswirtschaft, Zerrüttung, Desorganisation, babylonisches Sprachengewirr usw.
1.
Sie lag da und hoffte, in der tintenschwarzen Dunkelheit würde sie der Mann nicht finden. Von seinem männlichen Instinkt getrieben, steuerte er aber direkt auf sie zu, warf sich prustend über ihren Körper und presste sie auf den Boden. Seine Hand glitt blitzschnell unter den Rock, die Nägel kratzten die Haut und hinterließen blutige Spuren, winzige Hautfetzen blieben darunter kleben. Sie wusste, dass es sinnlos war, sich zu wehren, sank deshalb zusammen und bemühte sich, wenigstens den keuchenden Atem zu ignorieren. Sie hatte es längst gelernt, Verstand und Seele von dem abzutrennen, was mit ihrem Körper geschah. Sie versuchte sogar, einen kurzen Schlaf zu halten, während der Mann über ihr im eigenen stinkenden klebrigen Schweiß badete. Sie schloss die Augen und schlummerte ein.
Dann spürte sie auf einmal, wie etwas in ihr erschrak. Und da war schon wieder dieser intensive Geruch wie von einem Hengst, der zur Stute gerannt kommt. Er wehte von draußen zu ihr, etwas lauerte kurz und lauschte an den Wänden der Scheune. Sie spürte es, die Ausdünstung der Triebe war stark, der Mann über ihr roch es auch. Er stellte sich vor, wie der andere um die Scheune ging, verfolgte in Gedanken seine erwartungsvolle Ungeduld. Der Mann keuchte zum letzten Mal, goss die klebrige Flüssigkeit in sie hinein, lehnte sich zurück und erhob sich, nass und glatt wie eine Wegschnecke. Dann trat er schnell hinaus aus der Scheune und verschwand.
Sie sah es fast, so stark war ihre Vorstellungskraft, wie der andere draußen vor Ungeduld nahezu zitterte, den ersten Besucher kaum abwartend in die Scheune hineinstürmte. Er ging auf sie mit wilder Wollust los, noch mehr erregt von ihrem nackten, nassen Körper und von dem, was er draußen gehört hatte, und glitt in Sekundenschnelle in sie hinein. Diesmal durchdrang sie der schwere Atem übers andere Ohr, der Geruch überwältigte sie, schleimige Flüssigkeit ergoss sich über ihre Schenkel einmal, dann noch einmal ...
Blauer Nebel strömte durch die Wandbretter der Scheune in dünnen Streifen hindurch und die Angst, dass sie sein Gesicht sehen könnte, jagte den Mann davon. Er tauchte in die Ungewissheit der zurückschleichenden Finsternis ein, die seine Gesichtszüge wie auch seinen Namen und die befriedigte Wollust verschluckte.
Als die Sonne aufging, erschien genau dort, wo die ersten Sonnenstrahlen aufleuchteten, ein kleiner weißer Punkt und schwamm auf den Strand zu. Er näherte sich langsam, man konnte zuerst nur die hellen Haare sehen, glänzend wie Sonnenstrahlen, dann erkannte man die geschmeidigen Bewegungen der feinen weißen Arme. Die Küste fast erreicht, setzte die junge Frau die Füße auf den Meeresboden. Das Wasser bedeckte kaum ihren Hals, betupfte den Körper mit Perltropfen und ließ die langen goldenen Haare wie geschmolzen prächtig strahlen. Man konnte nicht sehen, wie sie die Füße unter dem Wasser bewegte, nur der weiße Schaum der kleinen Wellen enthüllte langsam die hohen, fein geformten Schultern, die straffen Brüste, so groß, dass sie in eine männliche Hand passten, den straffen Bauch. Als kochte und brodelte um sie herum das Wasser, als formte es jetzt, in diesem Augenblick, den schlanken Körper, die langen Beine, die schmalen Knie und die feinen Fesseln ...
Das Meer brachte in dieser Stunde eine Frau zur Welt, leicht und graziös, die ihre Sorgen und ihre Pein in sein tiefstes Wasser geworfen hatte, sowie auch den dunklen Schlamm, der von ihrer Seele Besitz ergreifen wollte. Eine Venus kam aus dem Wasser heraus, mit einem blassen und schönen Gesicht und in jenem unbestimmten Alter, das siebzehn, aber auch vierundzwanzig Jahre sein könnte. Die Haut war glatt und verriet nicht nur eine frische Jugend, sondern auch Unerfahrenheit, Leichtgläubigkeit, – und versprach Ärger mit dem Rest der Welt. Die Venus hieß Petra, alle nannten sie aber die Obdachlose.
Jeden Morgen, noch vor dem Sonnenaufgang, kam die Obdachlose zum Strand gelaufen, ließ ihre ohnehin spärliche Kleidung fallen und warf sich in die kalten Wellen. Sie schwamm immer weiter, bis sie den Strand aus den Augen verloren hatte, und atmete erst dann erleichtert auf, wenn sie glaubte, den anderen entlaufen zu sein. Die Müdigkeit und das kalte bodenlose Meer beruhigten allmählich das Chaos, das in ihrer Seele tobte. Petra drehte sich auf den Rücken und verharrte still, mit geschlossenen Augen, tief die Unendlichkeit und die Stille mit allen Sinnen in sich aufsaugend. Nur die Wellen plätscherten leise und schaukelten ihren Körper.
Dann aber wurde die Stille dicker, klirrte zuerst leise, dann immer lauter, bis es grollte und in ihren Ohren sauste. Die Angst vor dem Wasserabgrund übermannte sie, ihre Muskeln spannten sich, der Körper sank ins dunkle Wasser und es verschluckte sie langsam, Stück für Stück. Dann, mit einigen schwungvollen Bewegungen der Arme, kam Petra schnell an die Oberfläche, sah sich um und begriff erst jetzt, wie einsam sie in der Unendlichkeit war, so wie sie hier im Wasser hing, ohne jede Stütze unter sich. Alles flößte ihr Angst ein – das Meer, das gespannt auf die Sonne wartete, die hellen Flecken am Himmel und unter ihr, sogar die ersten Sonnenstrahlen, die die Finsternis durchbrachen.
Sie wendete und schwamm zurück zum Land. Sie schwamm langsam und genoss die Freiheit ihres Körpers, von dem das Wasser die fremden Berührungen gewaschen hatte, erlebte erneut jede Bewegung, das prickelnde Streicheln des Wassers über die wunden Schenkel, das die vergangene Nacht von ihr abspülte.
Petra, die Obdachlose, wohnte in verschiedenen Scheunen im Dorf. In jeder fanden sich für sie zwei oder drei dicke Matten, Essen und ab und zu ein Kleidungsstück. Sie wusste nie vorher, wo sie übernachten würde. Morgens fing sie nahe der Felsen Muscheln und Muschelhörner, nachmittags ging sie in den Wald und sammelte Kräuter für die Weiber im Dorf. Wenn sie müde wurde und dem Schrei nach Schlaf ihres Körpers nicht mehr widerstehen konnte, schlich sie in die nächste Scheune, aß schnell auf, was für sie da war, und schlüpfte unter die Decke in der entferntesten und dunkelsten Ecke. Petra schloss die Augen und bevor der Schlaf sie in seine Macht nahm, wünschte sie sich innig, dass sie diese Nacht niemand aufsuchen würde. Sie schlief nie den tiefen ruhigen Schlaf der normalen Menschen, sondern döste wie ein Hase, die Ohren stets gespitzt, und fuhr beim leisesten Geräusch zusammen.
Die Schritte hörte sie lange, bevor sie sich der Scheune näherten. Zuerst aber witterte sie den Geruch. Es war der Geruch der Männer, getrieben vom wilden Schrei des Fleisches. Schwer und erstickend schlich sich dieser Geruch heran, wenn Ungeduld und Wollust überhaupt unbemerkt bleiben können. In ihrer Ecke rollte sich Petra zusammen, presste sich gegen die Wand und wollte mit ihr eins werden.
Sie konnte sich nicht mehr erinnern, ob sie dreizehn oder vierzehn Jahre alt war, als zum ersten Mal in einer Nacht drei gleichzeitig kamen und sie einer nach dem anderen vergewaltigten. Sie wusste nicht, wer sie waren. Einer von ihnen könnte der Mann gewesen sein, der sie am jenen Tag getroffen hatte und der sie mit seinem männlichen Blick unverhohlen abgemessen hatte. Im kleinen Mädchen hatte er vielleicht auf einmal eine schöne, reife, junge Frau gesehen, die seine ungezügelten Fantasien weckte. Und wie die meisten Männer hatte er Angst gehabt, sie allein zur richtigen Frau zu machen.
Seit jener Nacht kannte Petra keinen ruhigen Schlaf mehr. Als sie viele Jahre später heiratete, schlief sie als Braut deshalb erst einmal aus, im Haus ihres Mannes in Sicherheit und versteckt. Die dicken hohen Mauern des Hauses hüteten sie in dieser Zeit, als Petra, die Obdachlose, den ganzen Monat schlief und nur dann aufwachte, wenn sie die warmen leckeren Suppen essen wollte. Dann sank sie wieder in tiefen Schlaf, zum Entsetzen ihres jungen Mannes. Hin und wieder presste er das Ohr an ihre Brust, um sicher zu sein, dass sie noch atmet.
Jede Nacht bekam Petra Besuch, egal, in welcher Scheune sie sich versteckte und wie tief sie unter das Stroh gekrochen war. Die Männer fanden sie überall. Sie warteten geduldig aufeinander, wussten, dass jeder zu ihr gehen würde. Die Geräusche, die aus der Scheune kamen, ließen ihre Wollust noch stärker werden und die Schranken ihrer Fantasie fallen.
Es kam manchmal vor, dass nur einer zu ihr kam, das war aber eher selten. Gewöhnlich waren es zwei oder drei, und wenn ein Fest im Dorf war und in der kleinen Dorfkneipe, vom Gevatter Natscho betrieben, reichlich Schnaps und Wein getrunken wurde, dann war nachts die Schlange vor ihrer Scheune sehr lang. Auch wenn die Besucher zahlreich waren, verschwanden sie alle bei der ersten Morgendämmerung. Dann machte sich Petra zurecht und lief zum Meer.
Das tat sie auch in jener ersten Nacht, als sie sich unendlich beschmutzt fühlte. Ihre Schenkel fühlten sich klebrig an, obwohl es Winter war. In ihrem Dorf hielt der Schnee selten lange, aber so kalt wie es damals war, war es lange nicht gewesen. Petra warf die Kleider auf den Strand und sich ins kalte Meer, mit Gedanken an den Tod im Kopf. Das eisige Wasser schnitt ihr den Atem ab, klärte den Kopf und alles kam ihr auf einmal so weit fort und irreal vor, als hätte sie es gar nicht erlebt. Sie schwamm lange, bis der Schmutz von ihrem Körper weggespült war, und als sie aus dem eisigen Meer herauskam, war sie wieder frisch und sauber, wie neugeboren.
Seitdem blieb ein Schmerz unten im Bauch, der an kalten Tagen immer wieder auf sich aufmerksam machte. Später, als sie wusste, wie Kinder auf die Welt kommen, wurde ihr klar, dass sie mit diesem Bad im winterlichen Meer für immer unfruchtbar geworden war. Umso besser, dachte sie und war zufrieden mit diesem Stand der Dinge. Gott half ihr, nicht ewig schwanger herumzulaufen und Kinder zur Welt zu bringen, denen sie nur sicher sagen könnte, dass sie in ihrem Körper gezeugt worden sind. Sie verspürte keine mütterlichen Gefühle. Vielleicht war es ihr angeboren, denn ihre Mutter hatte sie als neugeborenes Baby auch vor der Haustür ihres Vaters ausgesetzt. Oder genauer gesagt: Vor dem Haus des Mannes, den sie ihren Vater nannte. Eines Nachts hatte sie die Kleine in einem kleinen Korb dort abgestellt und sich einfach aus dem Staub gemacht. Der Korb war mit Laub bedeckt gewesen und das kleine Mädchen in eine Decke gewickelt. Seitdem waren bereits viele Jahre vergangen, und ihre Mutter hatte sich nie bei ihr gemeldet. Petra hatte auch nie nach ihr gefragt. Sie empfand auch keine Tochtergefühle gegenüber dem Mann, der sie großgezogen hatte und der sich keine Mühe gegeben hatte in all diesen Jahren, wenn nicht ihre Liebe, dann wenigstens ihren Respekt zu gewinnen. Außerdem war er aus ihrem Leben längst verschwunden, ohne ihr ein Dach über dem Kopf zu hinterlassen. So lebte Petra in den Dorfscheunen, sammelte Suppenkräuter im Wald, die ihr die alte Frau Krajan gezeigt hatte, und brachte sie den Frauen im Dorf. Früh morgens, vor dem Sonnenaufgang, lief sie zum Meer, dann stieg sie mit reiner Seele aus dem Wasser heraus, zog ihre Kleider an – eine seltsame Zusammenstellung aus Farben, Schnitten und Stoffen – und ging mit langsamen Schritten zurück ins Dorf.
2.
Das Dorf glich einer Insel, von der einen Seite rahmte das Meer es ein, von den anderen drei der Wald. Die Männer des Dorfes gingen nie bis zum anderen Ende des Waldes, sondern immer nur so weit, bis sie dickere Baumstämme fanden, fällten dann so viele, wie sie für ihre Boote und die kleinen Häuser brauchten, und kamen zurück. Niemals hatte sich einer getraut, nachzusehen, was es auf der anderen Seite des Waldes gibt, und es dann den anderen zu erzählen; das interessierte sie nicht. Ihre Neugier reichte bis zum Nachbarhaus, nicht weiter. Sie nahmen einfach an, dass drüben auch Meer ist, und das genügte ihnen.
Sie lebten das gleiche Leben, wie es ihre Vorfahren gelebt hatten. Das Neue ging einfach an ihnen vorbei, ohne sie zu berühren. Sie bemerkten noch nicht einmal, dass sich die Welt veränderte, standen nur da, erstarrt in Erwartung, taub und unempfindlich für alle Neuigkeiten. Die Zeit war hier stehengeblieben wie das Pendel einer kaputten Wanduhr. Es musste etwas geschehen, was die Uhr aufzieht und das Pendel wieder in Bewegung bringt, damit die Zeit wieder ihren gewöhnlichen Gang nimmt.
Die Leute im Dorf ernährten sich vom Meer, so wie es ihre Vorfahren getan hatten, fingen Fische und verkauften, was übrigblieb, den Urlaubern, die auf dem steinigen, staubigen Weg hierher kamen. Die Männer wogen den Fisch lange, als zögerten sie, sahen heimlich die Fremden an und versuchten sie aufzuhalten. Die Urlauber machten ein paar Schritte durchs Dorf und – wer weiß, warum – eilten dann schnell fort, als jagte sie etwas davon. Am Anfang dachten die Besucher, das Dorf sei kein Badeort geworden wegen der steilen Felsen, die es umringten, und weil es keinen Strand und keinen Sand ringsherum gab, bemerkten dann den seltsamen Geruch wie in einem Mäuseloch und fuhren weg, ohne gekauft zu haben, was sie ursprünglich beabsichtigten.
Die Fischer ärgerten sich nicht, denn das Meer gab immer weniger Fisch her, oft kamen die Boote ohne Fang zurück und um die Kinder ernähren zu können, rissen sie etwas von den gedörrten Makrelen ab, die unter dem Vordach hingen. Diese gedörrten, gesalzenen Kleinfische hingen dort schon seit Jahren als Vorrat für magere Zeiten. Davon bekamen die Kinder rissige Lippen, in ihren Hälsen klebte es vom Salz und sie hackten mit kleinen Fingern die runden schwarzen Insekten heraus, die in das dunkle Fischfleisch eingetrocknet waren. Die Dorfleute konnten sich nicht mehr vom Meer ernähren, verließen aber ihr Dorf, indem sie geboren waren, nicht. Die Ferne und die Ungewissheit, die außerhalb des Dorfes auf sie lauerten, ängstigten sie.
Die Frauen im Dorf brachten immer weniger Kinder zur Welt, heirateten aber, weil es so die Sitten verlangten. Sie warteten auf nichts, lebten jedoch in einer diffusen Erwartung, ohne zu wissen, was diese ihnen bringen sollte. Sie wussten nur, es sollte etwas sein, das die monotonen, grauen Tage verändert, die tote Stille in ihren Seelen erschüttert und die unbewegliche Luft im Dorf wieder mit Leben erfüllt. Sie hatten mal Geschichten erzählt bekommen von einem Leben von Liebe erfüllt und von einem Tod aus Liebe, glaubten aber nicht, dass diese Geschichten sich ausgerechnet in ihrem Dorf zugetragen hatten, denn die Liebe war etwas Ungreifbares und unendlich Unbekanntes. Es konnte sein, dass sie aber gerade darauf warteten, wer weiß. Alle warteten auf die Liebe – die Männer, die Frauen auch und auch die Greise. Sie würden es am ehesten verstehen, ihr Warten ging schon seinem Ende zu. Die Kinder hofften auch und lebten in einer stillen Geduld, ihr Warten war brav und beständig, denn ein ganzes Leben lag noch vor ihnen.
Das Ufer war hier überall felsig, aber die Dorfbuben mochten am meisten den steilen Fels, der direkt über das Meer ragte und von einem alten, verfallenen Haus gekrönt war, in dem niemand mehr wohnte. Das Haus war grau geworden, genau wie das Gestein, auf dem es hockte, aus der Ferne konnte man es nur schwer bemerken. Die Kinderschar versammelte sich jeden Tag bei der Hütte; zwanzig oder dreißig Meter unter ihnen toste und schäumte die Brandung. Die Lausejungen saßen stundenlang da, ihre Beine hingen über dem Abgrund herab und sie warteten. Warteten, hofften und träumten. Hier wurden alle Geschichten, die ihnen die Großväter an den langen Winterabenden am Feuer erzählt und denen sie mit großen Augen und aufgesperrten Mündern zugehört hatten, wieder lebendig. Dorthin, wo das Meer und der Himmel in einer blauen Linie ineinanderflossen, waren jetzt ihre verzückten Blicke gerichtet. Sie sahen Seeräuberschiffe, riesige Fische, Meeresstürme und Blitze auf sie zukommen, vor denen sich das Wasser in zwei Teile spaltete. Dann klärte sich ihr Blick, das Meer wurde wieder das alte und vertraute, das sich niemals veränderte, und sie warteten auf das Etwas. Das Etwas, das immer wieder ausblieb. Etwas, was sie schaudern lassen, den Hauch von Abenteuern in ihr Leben bringen und sie aus dem winzigen Dorf treiben und in die unendlichen Schluchten der Welt jagen würde.
Die Jungen seufzten, versuchten das sich in ihren Kinderseelen anbahnende Chaos zu unterdrücken und schauten wieder aufs Meer. Ihre Väter ruderten immer tiefer ins Unendliche hinein und kamen dann nach unzähligen Stunden zurück an Land, um am nächsten Tag wieder aufs Meer hinauszugehen und erneut zurückzukommen. Dieser Kreis hatte keinen Anfang und kein Ende, er riss sie einfach mit, sie konnten sich nicht befreien und fühlten sich vom ewigen Drehen wie berauscht.
Jedes Kind konnte schon aus der Ferne das Boot seines Vaters erkennen, wusste, welches Boot wem gehört; ihre Blicke wanderten über die Boote, sie zählten sie noch einmal ab und blickten endlich enttäuscht wieder zum Horizont. Und da ergriff sie wieder diese Gewissheit, dass etwas kommen würde.
Der Steg, der vom Felsen hinunter zum Kai führte, war steil und steinig und wand sich hoch über dem Dorf dahin. Ungefähr in seiner Mitte stand über dem Meer, als wolle es gerade hinunterspringen, Oma Wandas Haus, versteckt unter der breiten, schattenspendenden Krone eines großen Nussbaumes. Irgendwie seltsam sah dieser Baum aus. Oma Wanda hatte ihn vor vielen Jahren gepflanzt, als ihr Sohn Mavri gerade auf die Welt gekommen war. Sie wollte ihr erstes Kind hier im Dorf gebären. Wie alle Dorfbewohner hatte auch sie Angst vor der großen unbekannten Stadt, aber nach zwei qualvollen Tagen und zwei Nächten waren die Herztöne des Kindes kaum noch hörbar, Gesicht und Hände der Mutter wurden blau, da setzte man sie auf einen Karren, der Küster der Kirche kam mit und brachte sie in die Stadt. Wanda hatte keine Kräfte, sich zu wehren, aber bevor man sie auf den Wagen gesetzt hatte, konnte sie eine kleine Walnuss in die weiche bröckelige Erde vor dem Haus stecken. Irgendjemand hatte ihr gesagt, wer einen Nussbaum pflanze, würde solange leben, bis der Baumstamm so dick war wie sein Hals. Und das wären viele, viele Jahre. Sie würde vieles erleben können, ihr Kind großziehen, die Rückkehr seines Vaters sehen ... Aber nicht ihretwegen steckte sie die kleine Nuss in den Boden, sondern wegen ihrem Kind, das sie nicht mehr im Bauch strampeln spürte. „Du, lieber Gott, hüte es mir“, betete Wanda und legte die Hände auf den großen, hängenden Bauch. Die Hände zitterten, sie lauschte nach dem lautlosen Lebenszeichen in sich, das seit einigen Tagen wegblieb. „Hüte es, o lieber Gott“, betete sie, „und hilf mir, es großzuziehen, und wenn eines Tages sein Vater zurückkommt, soll er sehen, dass ich gut für seinen Sohn gesorgt habe.“ Und während der Karren weiterrumpelte, lag Wanda da, den Kopf nach hinten gedreht, auf die Stelle starrend, wo schon die kleine Nuss im Boden ruhte.





























