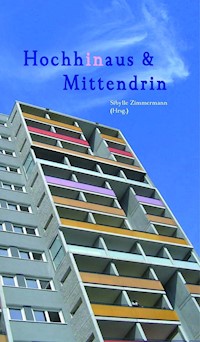2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
900 Jahre Freiburg – Grund genug für die Schreibw!lden, die Stadt in Kurzgeschichten, Anekdoten und Gedichten zu verewigen. Eine Kriminalkommissarin reist nach Freiburg und entdeckt im Zug einen mutmaßlichen Serienmörder, eine Frau lässt sich im Münster einschließen und erlebt ein nächtliches Abenteuer, ein Jungwinzer ist auf zweifelhafte Weise zu einem besonderen Stück Reben am Schönberg gekommen. Am Augustinerplatz sucht eine über achtzigjährige Französin nach ihrer Jugendliebe, eine unglückliche Bewohnerin des Stühlingers findet Trost am Tanzbrunnen, und auch das Gänsemännle auf dem Adelhauser Klosterplatz kommt zu Wort. Ob mitten in der Altstadt, im alternativ geprägten Vauban, dem urigen Stühlinger oder unterwegs in der Stadtbahn: Folgen Sie den Schreibw!lden auf ihrem Streifzug durch die 900 Jahre alte Universitätsstadt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
900 Jahre Freiburg – Grund genug für die Schreibw!lden, die Stadt in Kurzgeschichten, Anekdoten und Gedichten zu verewigen. Folgen Sie den Schreibw!lden auf ihrem Streifzug durch die 900 Jahre alte Universitätsstadt!
Wir danken der Stadt Freiburg für ihren Zuschuss im Rahmen des 900-jährigen Stadtjubiläums.
© 2021 Alex Devesper, Ellen Göppl, Claudia Hellstern, Sabine Lauffer, Uta Neumann, Ilse Reichinger
Layout & Umschlag: Die Schreibwilden
Fotos: © Die Schreibwilden
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-26238-6
Hardcover:
978-3-347-26239-3
e-Book:
978-3-347-26240-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung
Alex Devesper, Ellen Göppl, Claudia Hellstern, Sabine Lauffer, Uta Neumann, Ilse Reichinger
Chikiding!
52 x Freiburg
Heimatstadt
Oder Wahlheimat
Viele lieben sie
Manche nervt sie auch
Die Stadt lässt niemanden kalt
Freiburg!
Achtzig
Ilse Reichinger
Draußen sind alle Plätze belegt. Nach der neuen Verordnung dürfen nur ein oder zwei Menschen an den kleinen Tischen sitzen. Ich stehe etwas unsicher herum und warte. Sie schauen mich an, ich schaue sie an. Sie schauen auf ihre noch vollen Tassen. Volle Tassen als Alibi für eine längere Zeit der Stuhl-Besetzung. Ein Mann zeigt unverhohlen sein Wohlbehagen mittels gefährlichen Herumfläzens auf einem kleinen Stuhl. Er reckt seinen kahlen Schädel der Sonne entgegen, schließt die Augen. Ordinär, denke ich.
Der Vorgarten des Museums für Neue Kunst ist entschieden zu klein. Ich überlege, wo man einen Vorschlag einreichen könnte zur Erweiterung, Ausdehnung.
Mit dem Fuß auf der ersten Stufe zum Inneren des Museums rufen zwei ältere Damen im Chor „Maske, Maske“. Erschrocken zerre ich die baumelnde Maske vom Arm, setze sie hastig auf. Schuldgefühle sind in diesen Zeiten leicht einzufangen.
Im Café sitzen zwei Paare. Das ist angenehm. Ich hatte gehofft, der Stadtbummel würde mir den Stein von meiner Brust nehmen, mich aufheitern.
Achtzig Jahre alt, ein Paukenschlag ohne Pauke. Achtzig im April geworden und dann noch Corona. Ich hatte mir ein großes Fest gewünscht, eine ehrende Beachtung für 26 Jahre … naja, lassen wir das.
Ich habe es gut. Ich bin gesund. Ich kann mir eine Suppe leisten, einen Kaffee, eine Torte. Die Menschen im Café scheinen ihren Aufenthalt zu genießen. Auch ich entspanne mich. Das Bestellte wird mir freundlich serviert.
Eine junge Frau mit einem Kinderwagen kommt herein, setzt sich an den nächsten Tisch, nahe am Eingang. Sie lächelt mir fröhlich zu. Ich nicke dankbar. Das Kind strampelt und lacht. So könnte es bleiben. Ja, wohlfühlen! Dieses Gefühl ist mir seit März abhandengekommen.
Wie gerne würde ich das kleine Mädchen ein wenig herumtragen, an mich drücken, seine zarte Haut spüren, seinen Babygeruch einatmen, ihm putzige Worte ins Ohr flüstern.
Sentimentale Anwandlungen einer Achtzigjährigen? Nein, eine neue Klarheit. Vieles geht nicht mehr, wird nicht mehr sein. Zum Beispiel eine Reise nach Australien, die ich zu einem anderen Geburtstag geschenkt bekommen habe. Wertigkeiten, Wichtigkeiten haben sich verschoben.
Das frisch renovierte Café gefällt mir. Die Wände lavendelblau, das Gewölbe sandsteinfarbig. Angenehme Blumendekoration. Eine schöne blassrosa Rose in einem üppigen Blumenarrangement. Seltsam, sie bewegt sich, die Rose. Die Blüte neigt sich weit nach unten, dann wiegt sie sich wieder nach oben. Da hängt was dran. Ich nehme meine Brille ab, putze sie, setze sie auf, drücke beide Augen zu langen Sehschlitzen zusammen. Eine weiße Maus. Ich sehe eine weiße Maus. Ich will aufschreien, bleibe Gott sei Dank ruhig sitzen. Was wird man von mir denken, wenn ich sage, „da, eine weiße Maus“ und dann ist sie weg? Ich schaue mich um. Mein Blick fällt auf ein paar sehr große Füße in glänzenden schwarzen Schuhen. Daneben steht ein kleiner Karton. An den Schuhen und Socken klettern zwei weitere weiße Mäuse herum. Er sitzt hinter einer Säule. Deshalb habe ich ihn nicht wahrgenommen.
Ich setze mich mehr nach links. Ein Bär von einem Mann, ein bildschöner Mann, hätte meine Mutter gesagt. Er hat einen kreisrunden, großen schwarzen Hut auf dem Kopf. Das gibt ihm eine mexikanische Note. Der Hut ist etwas verrutscht. Er schläft. Wahrscheinlich ein Zimmermann auf Wanderschaft. Sein Anzug ist aus feinem schwarzen Cord. Die Hose mit Schlag. Perlmuttknöpfe. Zwirnenes, weißes neues Hemd. Roter Seidenschal. Nein, er ist bestimmt ein Zimmermannsmeister, kommt vielleicht von einer Freisprechung. Die weißen Mäuse sind als Geschenk getarnt aus dem Karton entwischt. Möglicherweise ein Scherz?
Was mache ich jetzt? Ich winke, „Ich möchte zahlen“, sage ich ziemlich leise. Er soll noch nicht aufwachen.
Mit 80 muss man sich nicht mehr um alles kümmern, denke ich belustigt.
Haste mal ne Mark?
Claudia Hellstern
Vier Wörter, fünfzehn Buchstaben – und eine ganze Geschichte.
Ich war neu in der Stadt, hatte nach meinem Studium Anfang 1980 eine Arbeit in der Kronenstraße gefunden und marschierte täglich vom Bertoldsbrunnen, wo ich aus der Straßenbahn ausstieg, durch das Martinstor ins Büro und am Abend den gleichen Weg zurück.
Im Grunde genommen war ich ein Landei, sicherheitsbewusst. Ich nahm immer den gleichen Weg, die gleiche Straßenbahn, um nichts falsch zu machen. Die falsche Linie zu benutzen oder gar falsch auszusteigen, war für mich eine Horrorvorstellung. Also die gleiche Bahn, den gleichen Weg.
Als ich mich nach einiger Zeit traute, mein Umfeld wahrzunehmen, mich umzuschauen, entdeckte ich direkt hinter dem Martinstor einen „Mantelberg“. Einen Mantelberg mit Haaren, der sprechen konnte. Verblüfft, nein erschreckt, sprang ich auf die andere Straßenseite, wäre dabei fast in eine Straßenbahn gerannt und stierte aus sicherer Entfernung hinüber.
Auf dem Boden bei dem Brunnen saß ein Mantelberg, der Arme hatte und eine Hand ausstreckte. Ich sah, wie ihm ein eiliger Passant etwas in die Hand legte.
Auf dem Nachhauseweg nahm ich mich zusammen und spazierte vorbei. Vorsichtig und langsam, möglichst unauffällig. Der Mantelberg saß an der gleichen Stelle wie am Morgen.
Ich war gespannt wie ein Flitzbogen und neugierig wie ein kleines Kind. Da hörte ich eine raue brüchige Stimme, leise und kratzig: „Haste mal ne Mark?“ Hä, dachte ich. Eine Mark? Für was?
Ich stellte mich in einiger Entfernung in Position. Vor dem Kolbencafé hatte ich einen guten Blick und beobachtete, wie ihm immer wieder Leute etwas in die austreckte Hand legten. Ich war zu weit weg, um Worte zu hören, meinte aber, leise Flüstertöne zu vernehmen. Ich blieb auf meinem Posten.
Auf dem Heimweg, den ich schließlich doch antrat, hatte ich diese vier Wörter wie ein Mantra im Kopf: „Hast mal ne Mark?“
Es ging mir nicht mehr aus dem Sinn.
„Haste mal ne Mark?“
„Haste mal ne Mark?“
Zu Hause angekommen, leerte ich meinen Geldbeutel und sortierte die Markstücke aus. Warum? Keine Ahnung.
Am nächsten Morgen steckte ich mir eine Mark in die Jackentasche. Griffbereit, falls er wieder da war und mich nach einer Mark fragte.
Mutig war ich nicht. Ich passierte das Martinstor und sah ihn an gleicher Stelle sitzen. Man konnte meinen, er habe sich nicht bewegt, die ganze Nacht nicht bewegt. Ein riesiger Mantel aus groben Stoff, eine haariger Kopf, Haare, nichts als Haare. Wie gesagt, mutig war ich nicht. Ich überquerte schnell die Straße, konnte es aber nicht lassen, ihn anzuschauen. Fast wäre ich mit meiner Glotzerei auf einen Laternenpfahl gerannt. Wie der Hans-Guck-in-die-Luft. Nach Feierabend wollte ich ihm die Mark geben. Ich wollte ganz nah an ihm vorbeigehen und ihm die mittlerweile von meiner Hand ganz heiße Mark reichen. Eine Mark? Was war das schon?
Es war mir peinlich – eine Mark – dafür bekommt man doch nichts! Dachte er womöglich, diese geizige Landfrau …? Genug. Er wollte eine Mark und nicht zwei.
So stolperte ich mutig auf ihn zu, ging ganz nah an ihm vorbei und hörte die rauen Worte: „Haste mal ne Mark?“
Schnell gab ich ihm meine heiße Mark und genauso schnell ging ich weiter. Ich hörte ein ganz schwaches „Danke“. Was machte er mit meiner Mark?
Ich blieb stehen, wieder am Kolbencafé, und beobachtete ihn. Meine Mark hatte er in die tiefen Höhlen seines Mantels verschwinden lassen. Er streckte seine Hand wieder aus und fragte die Passanten nach einer Mark. Wie viele Markstücke er zusammenbekam, ich hatte keine Vorstellung. Das interessierte mich wenig. Ich wollte sein Gesicht sehen. Ich wollte sehen, wie er sich aus seinem Mantel schälte und … naja, keine Ahnung.
Auf jeden Fall war der Anfang gemacht. Täglich ging ich vorbei, beobachtete ihn, die Markstücke klimperten in meiner Jackentasche und warteten darauf, an den Mann zu kommen. Manchmal saß ein zweiter Mantelberg neben ihm, genauso haarig, genauso eingehüllt, aber bei weitem nicht so faszinierend.
Ich erfuhr, dass er zu Freiburg gehörte wie das Münster. Dass die beiden die Freiburg-Clochards waren. Sie waren ungefährlich und pöbelten nicht. Manchmal diskutierten sie mit normalen Leuten und überließen sich ihrem Gottesglauben und ihrem Schicksal.
Überzeugt war ich, dass man nicht grundlos auf der Straße sitzen müsse und um eine Mark bitten. Irgendwas musste passiert sein. Meine grundeigene Landmädchen-Überzeugung ließ keine andere Option zu. Der arme Mann … er hatte keine andere Wahl. Ich gab ihm eine Mark.
Ich trieb mich geradezu besessen am Martinstor herum. Immer länger, immer öfter und bestaunte diese Gestalt, diese Ruhe, diese stoische Ruhe, diese Bewegungslosigkeit und auch das Schweigen.
Ich hatte mittlerweile sein Gesicht gesehen. Außer den Haaren auf dem Kopf und dem langen struppigen Bart, ich musste an das Bild von Rübezahl in meinem Märchenbuch aus Kindertagen denken, hatte er auch zwei Augen, eine spitzige Nase und einen Mund. Der Mantelberg war ein Mensch aus Fleisch und Blut, nur dass er die Hektik der Stadtbesucher nicht hatte. Er schien in sich zu ruhen. Er war die Ruhe selbst.
Mit den längeren und wärmeren Tagen verbrachte ich immer mehr Zeit dort am Martinstor. Ich wusste nicht, ob er es registrierte. Ich wusste nicht, ob er mich überhaupt bemerkte. Ich wusste nur, dass er meine Mark nahm, selbstverständlich nahm und sich keinerlei Gedanken darüber machte, von wem sie kam. Sie war ja auch nur eine Mark unter vielen.
Um mir die Zeit zu verkürzen, hatte ich ein Buch dabei und etwas zu trinken. Ich setzte mich auf die Bank in seiner Nähe und las oder tat zumindest so. Meist war ich abgelenkt und nicht in der Lage, mich auf das Buch zu konzentrieren, weil ich Angst hatte, irgendetwas Wichtiges zu verpassen. Sie waren jetzt meist zu zweit – wie Zwillinge – die ihrer Mama einen Streich spielen wollten. Obwohl es wärmer war, man im T-Shirt draußen sitzen konnte, steckten sie in ihren Mänteln.
Sie brüten, dachte ich.
Irgendwo wuschen sie sich, denn sie waren nicht schmutzig. Die Haare nicht fettig und der Bart nicht verklebt von Essen und Rotz. Ich stellte mir vor, wie sie in Herdern in einer großen Villa mit Pool im Garten wohnten und dies alles nur eine Farce war. Ein Test, eine neue Lebensart. Oder sie lebten eigentlich in Saint Tropez und hatten dort ein mondänes und anstrengendes Leben und brauchten einfach mal eine Auszeit. Meine Phantasie ließ alles zu, Väter von vielen Kindern, die ihnen auf die Nerven gegangen waren, betrogene Ehemänner oder umgekehrt Männer, die ihrer Frauen überdrüssig waren und einfach mal kurz ausstiegen. Alles war möglich, alles war unmöglich.
Unmöglich war auch ich. Ich hatte mich so sehr festgebissen und konnte nicht mehr anders, als meine Zeit dort in ihrer Nähe zu verbringen.
Ich sah keine Bierflaschen um sie herum, keine Kippen, keine Hunde.
„Haste mal ne Mark?“ war das einzige, was ich hörte. Ab und zu ein leises Danke oder ihr Gemurmel und Gebrummel, wenn die beiden irgendetwas diskutierten.
Doch dann eines Tages, als ich mit meinem Buch Platz genommen hatte, hörte ich plötzlich etwas anderes als „Haste mal ne Mark?“
Zuerst begriff ich nicht, was los war. Denn wie ein Zauberwind saß er plötzlich neben mir und schaute mich mit blauen, herrlich blauen Augen an. Spöttisch, neugierig.
„Sag mal, was willst du eigentlich? Warum treibst du dich hier rum? Du bist doch keine von uns?“
„Wwwie bitte?“
Ich stammelte, wusste nicht, wie mir geschah, was mir geschah. Was ich sagen sollte.
„Mensch Mädchen, meinst du ich bin blöd, weil ich einen langen Bart habe? Seit Wochen lungerst du hier herum und glotzt mich an. Was willst du?“
„Nichts!“, sagte ich kleinlaut. „Nichts, wirklich nichts!“
Er war schön. Er gefiel mir. Seine Augen, seine spitze Nase, seine Lippen und auch seine schönen Zähne. Er gefiel mir und ich weiß nicht, ob ich deswegen so stammelte, oder weil ich so überfordert war, oder keine Antwort wusste, oder weil es mir so peinlich war, ertappt worden zu sein.
„Nichts will ich!“
„Ist ja schon komisch, dass so ein fesches Mädchen wie du nicht nach Hause geht und lieber hier herumstreicht, wie eine Landstreicherin. Willst du wissen, wie’s geht? Das Betteln? Glaub mir, das ist nichts für dich.“
Ich sagte nichts. Ich klammerte mich an mein Buch und schluckte und hoffte, dass ich nicht zu weinen anfing. Aus Frust, aus Schrecken, aus allem, was in mir vorging.
Er schaute mich an, eindringlich, während der andere sich nicht um uns kümmerte und ein Schläfchen zu halten schien.
„Zeig mal, was du liest“, flüsterte er und er nahm mit zitternden Händen mein Buch und blätterte darin.
„Ich habe früher auch viel gelesen, gerne gelesen. Ist schon was Tolles. Lesen. Ist das Buch gut. Bist ja fast fertig.“
„Ja, es ist gut und spannend und gut geschrieben.“
„Mh, ist es unverschämt, wenn ich es mir ausleihe? Dafür brauchst du mir keine Markstücke mehr geben?“
Hatte ich mich verhört? Er will mein Buch? Will es lesen?
„Klar! Gerne. Du kannst es haben.“
Er schien sich zu freuen und ich versprach ihm, wenn ich es ausgelesen habe, ihm es am nächsten Tag zu geben.
So wurden wir zu Lesefreunden.
Haste mal ne Mark? Wurde mir gegenüber zu „Haste was zum Lesen?“
Vier Wörter und viel Spaß.
Der Sommer ging ins Land. Ich versorgte ihn mit Lesestoff und er schenkte mir sein Lächeln, seine Ruhe, seine raue leise Stimme.
Ich fuhr in den Ferien nach Hause zu meinen Eltern, aufs Land. Als ich danach mit neuem Lesestoff vorbeikam, war er nicht da. Er war nie mehr da. Der Mantelberg mit den schönen Augen war verschwunden.
Keiner wusste etwas, keiner sagte etwas. Vermutungen, nichts Sicheres.
Sein Mantelbergkollege wusste nichts zu berichten und kurze Zeit später war auch er wie vom Erdboden verschluckt.
Von Einhörnern und anderen bunten Gestalten
Ellen Göppl
Freunde von Bekannten hatten mir davon erzählt: Ein offener Meditationstag in einem dafür angemessenen Freiburger Stadtteil. Ich dachte mir, dass so eine kleine Auszeit bestimmt gut für mich wäre, bei meinem hektischen Alltag, dem Ärger mit den Nachbarn und überhaupt. Per E-Mail bekam ich vorab ein Infoblatt zu dem Meditationsangebot. Man solle doch bitte zu dem Mittagsbuffet einen Beitrag leisten, wenn möglich vegan, aus Rücksicht auf das Umfeld. Was genau mit Umfeld gemeint war, erschloss sich mir aus dem Schreiben nicht. Ich vermutete, es ging nicht nur um Mensch und Tier, sondern um etwas Größeres, Allumfassendes. Also mindestens um das ganze Universum. Ich recherchierte für meinen Nudelsalat zum Thema vegane Zutaten und fand heraus, dass Pasta ohne Ei, Pilze, getrocknete Tomaten und Olivenöl geeignet waren.
Als der Meditationstag schließlich kam, war ich ein bisschen aufgeregt. Ich kannte ja niemanden. Wir stellten uns kurz vor, allerdings sollte der Tag im weiteren Verlauf in Stille abgehalten werden, auch die Pause am Mittag. Nur der Kursleiter sprach zu uns.
Schon morgens stellten wir unsere Beiträge zu einem Buffet zusammen. Es sah alles sehr pflanzlich aus, aber ein paar Leuten war vegan wohl nicht geheuer: Jemand hatte ein kleines Glas Honig mitgebracht, ein Stück Käse, eine halbe Wildsalami, um stumm gegen das Konzept zu protestieren. Der Kursleiter lächelte nachsichtig.
Ich fand alles sehr bizarr. Da war diese Frau, die in seltsam bunten Klamotten, aber völlig ungeschminkt auf ihrem Meditationskissen saß und nervös den Kopf in alle Richtungen drehte. Die Farben ihrer Kleidung erinnerten mich an Einhörner, wie kleine Mädchen sie seit einiger Zeit überall mit sich herumschleppen. Womöglich glaubte sie an Einhörner und dann vielleicht auch an Chemtrails, die ja aller Wahrscheinlichkeit nach von Einhörnern erzeugt werden, damit der Bundesbürger an sich den Politikern hörig ist. Das hatte ich jedenfalls in einer Satirezeitschrift gelesen. Die Frau reckte ihren blassen Hals in die Höhe und drehte ihren Kopf mal nach links, mal nach rechts, als empfange sie ständig irgendwelche Signale von „ganz oben“.
Ein Mann namens Peter hatte zum Schutz vor genau diesen gleich einen Aluhut mitgebracht, der unübersehbar aus seiner Sporttasche ragte. Pardon, Yogatasche. Ich starrte den Hut skeptisch an, und Peter lächelte unsicher. Außer mir trugen fast alle handgestrickte, gestreifte Socken, auch die Männer.
Eigentlich war ich ganz froh, dass wir den Tag größtenteils nicht sprechen würden. Nur der Leiter des Meditationskurses sprach ab und zu, um die Meditationen anzuleiten – oder ganz profan den Weg zur Toilette zu erklären.
Schweigen war auf jeden Fall besser, als sich Verschwörungstheorien anzuhören, wie es mir in dafür bekannten Gegenden von Freiburg schon passiert war. Ich scheine solche Leute anzuziehen, keine Ahnung, warum. Wenn ich dann nicht glaubte, dass die Erde innen hohl und von Nazis bewohnt sei, oder die sogenannte Neue Weltordnung die Flüchtlinge geschickt hatte, hieß es gerne „Ich würde das mal googeln!“. Wie bitte??! Wenn ich persönlich Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich Google ganz sicher nicht nutzen.
Während ich so über dieses und andere Phänomene nachdachte, erinnerte der Dozent uns von Zeit zu Zeit daran, zu unserem Atem zurückzukehren. Ich atmete also, bis es Zeit für die Mittagspause und das vegane Buffet war. Während des Essens zu schweigen war doch ziemlich ungewohnt. Ich war wütend auf den Dozenten, weil er als einziger sprechen durfte und gewichtige Sätze von sich gab wie „Der Biomüll ist hier“ oder „Bitte spült nach dem Essen jeder selbst euer Geschirr ab.“ Ich schaute jedem auf den Teller und war beleidigt, wenn jemand nicht von meinem veganen Nudelsalat genommen hatte. Schließlich hatte ich mir große Mühe gegeben und bei jeder Zutat dreimal überlegt, ob sie wirklich unbedenklich war – zum Beispiel „Könnten Pinienkerne irgendwie mit Tieren zu tun haben?“
Allen anderen schien das Schweigen nichts auszumachen und nach und nach gingen alle hinaus, um in der Pause noch etwas frische Luft zu schnappen. Nur ich blieb auf dem Sofa sitzen wie festgesaugt und starrte die Wand an, wie von einer höheren Macht hypnotisiert. Schließlich schaffte ich es doch noch, für die letzte viertel Stunde der Pause das Gebäude zu verlassen. Ich staunte angesichts der vielen Geräusche in der „echten Welt“. Wortfetzen, Motorengeräusche und lautes Lachen. Eine Straßenbahn der Linie 3 klingelte schrill, als ein paar freilaufende Biohühner völlig unachtsam über die Gleise hasteten. Ich schaute den Hühnern nach, wie sie in einen grasbewachsenen Graben hinunter trippelten, und war fasziniert. Bei uns auf dem Dorf waren Hühner immer eingezäunt, damit der Fuchs sie nicht holte. Hierhin kam er wohl nicht. Oder er war hier schon vegetarisch unterwegs.
Der Nachmittag zog sich hin. Wir meditierten im Sitzen, im Liegen und im Gehen. Und zwar vorwärts und rückwärts. Ich atmete und zählte meine Atemzüge. Atmete. Zählte. Bekam Hunger und atmete. Musste aufstoßen und atmete. Starrte irritiert auf all die buntgestreiften Socken und atmete. Was auch passierte – ich atmete und manchmal gelang es mir tatsächlich, einige Momente lang nicht zu denken.
Am Ende des Meditationstages durften wir wieder sprechen und uns über unsere Eindrücke austauschen. Auch im Vorraum, in dem wir uns die Schuhe wieder anzogen, hörte das Geschnatter nicht auf, als habe man eine Schleuse geöffnet, aus der der Fluss der Worte nur so hervorschoss.
„Meine Frau wartet jetzt mit Grillwürstchen auf mich“, sagte ein Teilnehmer strahlend, der Bärlauch-Pesto fürs Buffet mitgebracht hatte.
Die blasse, ungeschminkte Frau in den Einhorn-Klamotten musste auch etwas loswerden. „Für mich ist es ja so ungewohnt, völlig ungeschminkt herumzulaufen“, brach es aus ihr hervor. Als ich irritiert guckte, fügte sie hinzu: „Ich bin Stewardess, ich gehe sonst nie ohne Makeup aus dem Haus“.
„Kommt jemand mit einen Burger essen?“, fragte Peter völlig überraschend. „Ich muss sowieso in die Innenstadt, einem Freund diesen schrecklichen Lampenschirm bringen.“
Er deutete auf das spitzhutförmige Ding aus Metall in seiner Tasche. Komisch, dass ich dieses Teil mit dem Kabel oben dran für einen Hut gehalten hatte.
Ich überlegte nicht lange.
„Da komme ich gerne mit“, rief ich voll neuem Elan, „aber nur, wenn es da auch Veggie-Burger gibt!“
Tage im Oktober 2019 in Freiburg
Uta Neumann
Mittwoch frühmorgens:
Während Yonna den warmen Tee trank, betrachtete sie die Fliege, die ihre letzten Tage in der Wohnung verbrachte. Zum ersten Mal seit Monaten machte Yonna die Wärme zu schaffen. Die Sonne brannte durch die großen Fenster, obwohl es schon Anfang Oktober war. Sie sann darüber nach, wie sie ihre Mutter heute Nachmittag am Bahnhof begrüßen könnte. Mutter hatte darauf bestanden jetzt zu kommen, um einen warmen Herbst in Freiburg und Umgebung erleben zu können. Sie hatte versucht, sie zu überreden erst im Frühling hierher zu fahren, aber es war nichts zu machen.
Ihre Mitbewohnerin Clara war gerade aufgestanden. Morgens um sieben über so etwas Schwieriges wie „Meine Mutter kommt zu Besuch“ zu sprechen, war aussichtslos. Clara kriegt morgens kaum die Augen auf, geschweige denn den Mund.
„Machst du mir einen Kaffee, Süße?“, hörte sie Clara säuseln.
Yonna mochte diese leeren Koseworte nicht besonders, aber bei Clara gehörten sie in jedem zweiten Satz dazu.
Sie antwortete nicht und stellte wortlos einen gerade gemachten Kaffee auf den Tisch.
Seit zwei Jahren studierte sie hier in Freiburg und hatte bis jetzt die Kontakte zu ihrer Familie kurzgehalten.
Für drei Tage über Weihnachten fuhr sie in ihr Elternhaus in einem Dorf in Schleswig-Holstein. Als Bauerntochter mit Gastwirtschaft hieß nach Hause kommen auch immer mithelfen und arbeiten.
Das Leben ihrer Mutter bestand aus Arbeit von 5 Uhr morgens (Kühe melken) bis 8 Uhr abends (Kühe melken). Auch wenn ihr Bruder und die Schwägerin den Hof und die Gastwirtschaft übernommen hatten, half Mutter weiterhin im alten Brauch mit.
Yonna war froh den Studienplatz im äußersten Süden Deutschlands bekommen zu haben. Sofort hatte sie zugesagt. Andere Studienplätze in Berlin und Kiel waren nicht weit genug weg.
Während sie in kleinen Schlucken ihren Tee austrank, hing sie ihren Gedanken an früher nach, ohne zu merken, dass Clara bereits geduscht und angezogen die Wohnung verlassen hatte.
Eine SMS von Clara 15 Minuten später: „Danke für den Kaffee, bin schon an der Uni.“ und „Wo bleibst du?“ bewirkten, dass Yonna schnell ihre Tasche packte und mit dem Fahrrad die kurze Fahrt zum Audimax am Platz der Synagoge radelte.
Mittwochnachmittag im ICE von Hamburg nach Basel.
Die kleine Frau schaut aus dem Fenster: Wie viel hat mir Yonna von Freiburg erzählt? Die Altstadt mit dem Münster will sie mir zeigen. Hoffentlich gehen wir nicht so viel über Kopfsteinpflaster. Danach tun mir bestimmt die Beine weh.
Gerade ist die Apfelernte rum und obwohl ich nur noch für die Erntehelfer das Essen bereitstelle, bin ich dieses Jahr müder als sonst. Hoffentlich übernimmt Selma nächstes Jahr einen Teil von dieser Arbeit. Peter macht das alles ganz gut, seit Heinz mit dem Rheuma nicht mehr so zupacken kann.
Ja, meine beiden Kinder sind gut geraten. Vielleicht können Yonna und ich mal von Frau zu Frau einiges besprechen, ohne dass Vater Heinz sich einmischt. Er ist auch so neugierig.
Mit ihren 25 Jahren hat sie es weit geschafft. Gutes Abitur und ihr Psychologiestudium scheint auch gut zu laufen. Nur einen Freund würde ich ihr wünschen.
Die Frau schaut auf die Uhr.
Noch 20 Minuten, dann bin ich da.
Aus dem einheitlichen Himmelgrau entwickelt sich ein blauer Himmel. Die Sonne kommt durch. Das Anfang Oktober.
Genauso wie Yonna sagte am Telefon: „Mama, in Freiburg geht der Himmel auf für mich.“
Vielleicht steckt ja ein Mann dahinter?
Der Zug hält.
Da ist sie, meine erwachsene Tochter. Sie trägt Jeans und einen Blazer. Sehr sportlich. Ich fühle mich wie ein altes Muttchen. Unsicher und neugierig.
Tochter: Da ist sie! Sie sieht müde aus und hat ihr schönes grünes Kleid angezogen, das sie sonst immer Heiligabend trägt. Ich mag es sehr an ihr.
In meinem Arm wirkt sie klein und zart.“
Die Rolltreppe Gleis 3 ist wieder kaputt. Der Fahrstuhl stinkt nach Urin.
„Wir gehen erst mal nach Hause Mutter, und ich zeig dir die Wohnung von Clara und mir.“
Der nächste Morgen.
Mutter: Der Blick auf den Park bei Tag ist schön. Diese Kirche mit dem grünen Dach soll ein Kraftplatz sein, sagt Yonna. Laut war esheute Nacht. Männer, die grölten, kreischende betrunkene Frauen zogen unterm Fenster vorbei. Grässlich!! Die Mitbewohnerin Clara ist nett. Dass die beiden sich in den Arm nehmen zur Begrüßung, scheint unter Studenten üblich zu sein, meint Yonna?!
Yonna: In dieser Altbauwohnung im Stühlinger zu wohnen ist toll. Meine Mutter muss sich erst mal an Stadt gewöhnen.
Heute schwänze ich die Vorlesung und Clara bringt mir die Aufzeichnungen mit. Ist ganz schön mit Muttern. Ich zeig ihr heute erst mal die Waldmenschen.
Sie fahren mit der Straßenbahn Richtung Günterstal und steigen an der Haltestelle ´Wonnhalde´ aus.
„Hier haben die Freiburger also ihre Wonne?“, ruft die Mutter ihrer Tochter zu, als sie die Straße überqueren.
„Sehr witzig“, ruft Yonna gereizt zurück. Diese blöden Anspielungen auf mein Liebesleben gehen mir auf die Nerven, denkt Sie
Yonna geht mit großen Schritten voraus und hört ihre Mutter sagen:
„Ich bin noch müde, nach der unruhigen Nacht.“
Ein Bach plätschert neben dem Weg und im Waldhaus hängen Schilder aus mit Ankündigungen zum Schnitzkurs und Schellen basteln. Für Fasnacht im Februar?
„Fasnacht ist so wie Fasching oder?“
Yonna: „Nee, ganz anders. Viel archaischer und sehr mystisch, mit gruseligen Masken. Die nennen sich Narren. Ich zeig dir Bilder nachher.“
Mutter denkt: Am liebsten würde ich gleich einen Kaffee trinken, aber es ist erst 11 Uhr und wir haben gerade gefrühstückt, mit Clara dabei. Die spricht manchmal so komisch. Kommt hier vom Dorf im Kaiserstuhl. Yonna musste manchmal übersetzen.
Die riesigen Gebilde aus Baumstämmen sind beeindruckend. Geschichten und Sagen sind damit verbunden.
Sie bleiben stehen bei einem riesigen Drachen und einige Minuten weiter liegt eine Frau aus Holz auf dem Weg. Der Tod ist dargestellt und ein Liebespaar im Tanz.
Heute ist der Himmel mal blau, mal grau, was diese großen Gestalten aus Bäumen gespenstisch macht. Sie sprechen wenig und wenn, nur Belangloses.
„Pass auf, eine Kuhle“ oder: „die Luft ist heute kühl“.
Das Gehen auf unebenem Boden fällt mir nicht leicht. Auf dem Boden liegen Kastanien mit vielen langen Stacheln. Sie sind kleiner. Meine schlaue Tochter erklärt mir, dass hier im Süden Deutschlands auch Esskastanien wachsen.
Ein schmaler Trampelpfad führt zu einem riesigen geschnitzten Pilz. Hier geht es um gute und böse Hexen und Zauberer. Pilze als Liebesdroge!!
Die Mutter wagt einen Vorstoß:
„Na, warst du schon mal mit jemandem hier und hast einen Liebespilz verabreicht?“
Yonna schweigt.
Yonna denkt:
Ich will irgendwie ins Gespräch kommen mit ihr. Es soll so normal wie möglich ankommen. Bei anderen kann ich wunderbar Lösungen in der Kommunikation anbieten, bei meiner Mutter scheitere ich schon, bevor ich anfange.
Wir kommen an einen Platz mit drei Hängematten aus Rundhölzern. Mama legt sich sofort auf eine.
„Ich mach mal kurz die Augen zu“, höre ich noch, dann nickt sie ein.
Ich lege mich auf die andere Hängematte.
Über mir die Bewegung der Blätter, das Rauschen vom Wind. Kinderstimmen aus dem Wald, und ich entspanne langsam und verspreche mir, alles gelassen anzugehen.
„Komm Mama, wir müssen weiter, es ist zu kühl.“
Mutter fühlt denkend: Zehn Minuten Nickerchen und ich fühle mich frisch und ausgeruht!
Das Schränkchen auf Stelzen birgt einige Bücher. Eine Waldbibliothek. Zu kalt zum Lesen. Es geht bergauf und ich halte Schritt.
Wann sie endlich mal was von sich erzählt. Ein großer Brunnen, kreisförmig, um ein großes Reh aus Metall. Eine Joggerin läuft vorbei. Ein Schild, der höchste Baum Deutschlands. Schön ist es hier.
Yonna: „Mama, ich möchte dir was sagen!“
Mutter denkt: Na endlich.
Yonna: „Ich liebe Clara.“
Mutter (bemüht ruhig): „Naja, du magst sie sehr, das habe ich gemerkt. Ihr streichelt euch ja viel.“
Yonna laut, leicht hysterisch: „Mama, wir werden vielleicht heiraten.“
Mutter schweigt guckt nach oben:
„Der Himmel wird immer grauer, wir sollten sehen, dass wir ein Dach über den Kopf haben, bevor es regnet.“
Keiner spricht mehr ein Wort. Yonna stampft voraus. Der Waldweg mündet in eine kleine Straße und macht den Blick frei auf die Stadt.
Mutter: „Du bist also lesbisch?“
Yonna: „Ja, bin ich.“
(Sie hat fast alles gesagt, was sie sagen wollte.)
“Guck mal, das ist Freiburg von oben.“
Mutter: „Und Kinder? Willst du keine Kinder?“
Yonna: Ihre zurechtgelegten Worte lässt sie bleiben und sagt nur: „Ja, doch, das geht auch.“
Mutter guckt sie direkt an. Sie lächelt sogar und sagt:
„Na, dann ist ja gut!“
Dabei hält sie die Hände wie zur Abwehr nach vorne.
„Aber ich will nicht wissen, wie ihr das macht. Verschone mich mit Einzelheiten.“
Yonna: „Und jetzt gehen wir ins Loretto-Schlösschen zum Kaffee trinken, bevor es regnet.“ Sie hakt ihre Mutter ein. Sie geht mit, ganz selbstverständlich und sagt:
„Weißt du, mit deinem Vater“..., sie hört auf zu sprechen, verschluckt die Worte und setzt dann fort:
„Naja, Männer sind schon ganz anders als Frauen. Das könnte schön werden mit euch!“
Endstation Bahnhof
Alex Devesper
Sie bemerken ihn nicht, den schlaksigen jungen Mann aus Rumänien, der immer den Blick auf den Boden gerichtet hat. Dessen vernarbtes Gesicht Heimweh und Sehnsucht zu verbergen versucht. Der jeden Tag den Müll entsorgt, die Abfalleimer leert, Unrat wegputzt, um Geld zu verdienen für seine Familie. Morgens bekommt er bei Starbucks einen Caffe Latte gratis, wenn das nette dunkelhaarige Mädchen mit dem Pferdeschwanz Frühdienst hat. Er kennt sie aus der Stadtbibliothek. Und manchmal gibt es eine Brezel vom Vortag beim Bäcker, wenn er früh genug dran ist. Er spricht überlegt und leise. Sein Deutsch ist mittlerweile fließend, mit einem kleinen Akzent und rollendem „R“. Wie bei dem bekannten Radio-Moderator mit der angenehmen Stimme. Seine Augen leuchten, wenn er liebevoll von seiner Frau und seinen Kindern erzählt und dabei zärtlich über das runzlige Foto streichelt, bevor er es wieder in seine linke Brusttasche steckt. Ganz nah am Herz. Einmal im Jahr besucht er sie. Dafür lebt er.
Und der bärtige Endvierziger mit dem lustigen Namen, der nachts seinen arthrose-geplagten Körper an das warme Abluftrohr in der Tiefgarage drückt. Der damals nur beim Segeln auf der Ostsee seine Gedanken laut herausschreien konnte. Er ist schon vor der deutschdeutschen Vereinigung in den Westen geflohen, als der Wind so günstig stand. Weil er nicht studieren durfte. Weil er im Gefängnis war. Weil er für Freiheit gekämpft hat. Eine schmerzhafte Freiheit. Gequält. Gefoltert. Gebrochen, nicht nur die Finger, die ihm eine Karriere als Pianist ermöglicht hätten. Er ist mit dem Techniker im Planetarium befreundet. Das sind seine schönsten Momente, wenn er sich in den Weltraum träumt, fasziniert von fernen Planeten und Galaxien. Das Universum ist seine Welt. Fuß gefasst hat er nicht wirklich. Mit Gelegenheitsjobs hielt er sich über Wasser. Bis vor kurzem. Jetzt wohnt er hier.
Der jungen Frau, die fast unbemerkt durch die Toilette huscht, sieht man nicht an, in welchem Gewerbe sie beschäftigt ist. Den Fahrplan kennt sie auswendig. Regelmäßig holt sie ihre Klienten, wie sie es nennt, am Bahnhof ab. Vorher zieht sie sich um. Die Tasche mit dem nötigen Outfit ist hier deponiert. Dauerhaft. Sie legt Make-up auf, steckt ihre langen blonden Locken aufgeräumt hoch. Sie trägt immer dasselbe mädchenhaft geblümte Mini-Kleid mit dem Bolero-Jäckchen und rote Stiefeletten. Ihr Erkennungszeichen. Hübsch sieht sie aus, wenn sie lachend die Rolltreppe hochkommt, den kleinen roten Rucksack lässig über der Schulter hängend. Die beiden Grübchen auf ihren Wangen und der geschminkte Mund lenken ab von den Schatten unter den Augen. Sie hat eine kleine Tochter. Nebenbei studiert sie Mathematik.
Verlorenes
Sabine Lauffer
Ich bin sehr froh darüber, dass ich in einer so genannten Fahrradstadt lebe. Nicht weil es dort ausgesprochen viele Privilegien für Fahrradfahrer gibt, sondern weil meine alltäglichen Ziele in Fahrradfahrdistanz entfernt liegen. Beim Fahrradfahren kann ich wunderbar meine Umgebung betrachten, ohne dass ich Angst haben muss, ein Verkehrshindernis zu werden. Ich fahre oft die gleichen Wege und lasse nur wenige Varianten zu. Dennoch werden sie mir nie langweilig. Sicherlich, die Jahreszeiten geben dem Weg und der umliegenden Natur ein unterschiedliches Erscheinungsbild, aber das sind langsame Veränderungen. Die Veränderungen, die ich schätze, das sind die Kleinigkeiten, die dem Weg täglich ein anderes Gesicht geben. Besonders spannend finde ich verloren gegangene Dinge. Sie regen meine Fantasie an.